
Anlässlich des Weltflüchtlingstags forderte die österreichische Menschenrechtsorganisation Südwind einen grundlegenden Kurswechsel in der Asyl- und Migrationspolitik – hin zu einer solidarischen Aufnahme, menschenwürdigen Unterbringung und aktiver gesellschaftlicher Teilhabe von Geflüchteten. „Flucht ist kein Verbrechen, sondern ein Menschenrecht. Die Bundesregierung muss auf sichere Fluchtwege, Integration und Mitbestimmung setzen, statt auf Symbolpolitik und leere Ankündigungen“, erklärt Stefan Grasgruber-Kerl, Kampagnenleiter bei Südwind. „Fluchtursachen zu bekämpfen heißt: Klimagerechtigkeit, internationale Solidaritätsarbeit und menschenrechtsbasierte Politik.“
Anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni (2001 zum 50. Geburtstag der Genfer Flüchtlingskonvention eingeführt) wurden die aktuellen Zahlen bekannt gegeben. Die für Flüchtlinge zuständige Organisation der Vereinten Nationen, UNHCR registriert mehr als 120 Millionen Menschen, die ihre unmittelbare Heimat verlassen mussten, wobei zwei Drittel Zuflucht im eigenen Land finden (müssen), 43 Millionen Menschen sind Geflüchtete in einem anderen Land. Die meisten von ihnen finden Schutz in Nachbarländern des Globalen Südens. Nur ein Bruchteil hat Zugang zu Asylverfahren in Staaten wie Österreich.

Stellvertretend für die fehlgeleitete EU-Migrationspolitik nennt Südwind das neue Flüchtlingslager Vastria auf der griechischen Insel Lesbos. Das Nachfolgelager des berüchtigten Camps Moria liegt inmitten eines Hochrisikogebiets für Waldbrände und ist nur äußerst schwer erreichbar für externe Beobachter:innen. Hohe Sicherheitsmaßnahmen, eine abgelegene Lage und mangelnde Infrastruktur verhindern, dass NGOs und Medien Einblicke in die Zustände vor Ort bekommen. „Isolation schützt nicht vor Missständen. Flüchtlingsaufnahme darf nicht an den Rand gedrängt werden. Wir fordern offene, gut erreichbare Unterkünfte, die soziale und rechtliche Betreuung ermöglichen und keine Lager im Nirgendwo, die sich einer unabhängigen Kontrolle entziehen. Gleichzeitig braucht es sichere und legale Fluchtwege in die EU, etwa über Programme für humanitäre Aufnahme“, so Grasgruber-Kerl beim Lokalaugenschein auf der Insel anlässlich eines europäischen Netzwerktreffens der Grenzgemeinden und –inseln (BTIN) in der Gemeinde West-Lesbos.
Im Rahmen des – noch bis einschließlich Sonntag laufenden Jugend- und Kunstfestivals „Demokratie, was geht?“ gemeinsam mit der ÖH, der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, wurde am Abend des Weltflüchtlingstages im Wiener Gartenbaukino der Film „Bürglkopf“ gezeigt, der seine Premiere bei der Diagonale im März in Graz hatte. Lisa Polster (Regie und Drehbuch – gemeinsam mit Maira Vazquez Leven) dokumentiert darin das Leben von geflüchteten Menschen in dem weit ab- bzw hochgelegenen „Rückkehrzentrum Bürglkopf“ (Tirol, 1300 Meter Seehöhe, stundenlanger Fußmarsch ins Tal. Isolation der einen, wenige Kilometer entfernt befördern Seilbahnen Tourist:innen auf Berggipfel. Insaßen arbeiten für 1,60 € pro Stunde…
Vor diesem Hintergrund betrachtet Südwind die innenpolitischen Angriffe auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) mit großer Sorge. „Der Schutz von Menschenrechten ist nicht verhandelbar. Wer die Europäische Menschenrechtskonvention angreift, sägt an einer tragenden Säule unserer Bundesverfassung “, sagt Stefan Grasgruber-Kerl. „Was derzeit an politischer Rhetorik kursiert, ist nicht nur unverantwortlich, sondern gefährlich und ebnet den Weg für autoritäre Tendenzen.“
Ähnlich problematisch sieht Südwind die Bemühungen der Bundesregierung gegen den Familiennachzug. „Die Familienzusammenführung ist ein Menschenrecht und kein Privileg. Gleichzeitig schafft familiärer Rückhalt Stabilität und erleichtert die Integration. Es ist schlimm genug, dass lange Verfahren und hohe Hürden die Familienzusammenführung erschweren. Eine Aussetzung wäre eine integrationspolitische Bankrotterklärung“, so der Südwind-Sprecher.
Ein Schlüssel zu gelungener Inklusion ist die gesellschaftliche und demokratische Teilhabe. Südwind fordert daher mehr politische Mitsprache für Geflüchtete und Migrant:innen. Mehrere Pilot-Projekte zeigen einen großen gesellschaftlichen Mehrwert von Beteiligungsmöglichkeiten für Migrant:innen, sei es über Migrant:innenbeiräte oder Online-Beteiligung. Das Südwind-Projekt EMV-LII (Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion) ermutigt Migrant:innen dazu, sich aktiv in die Politik einzubringen. Gleichzeitig werden Gemeinden beim Aufbau nachhaltiger Beteiligungsstrukturen unterstützt. In Österreich arbeitet Südwind mit der Stadt Graz und ihrem Migrant:innenbeirat sowie der Marktgemeinde Lustenau zusammen.
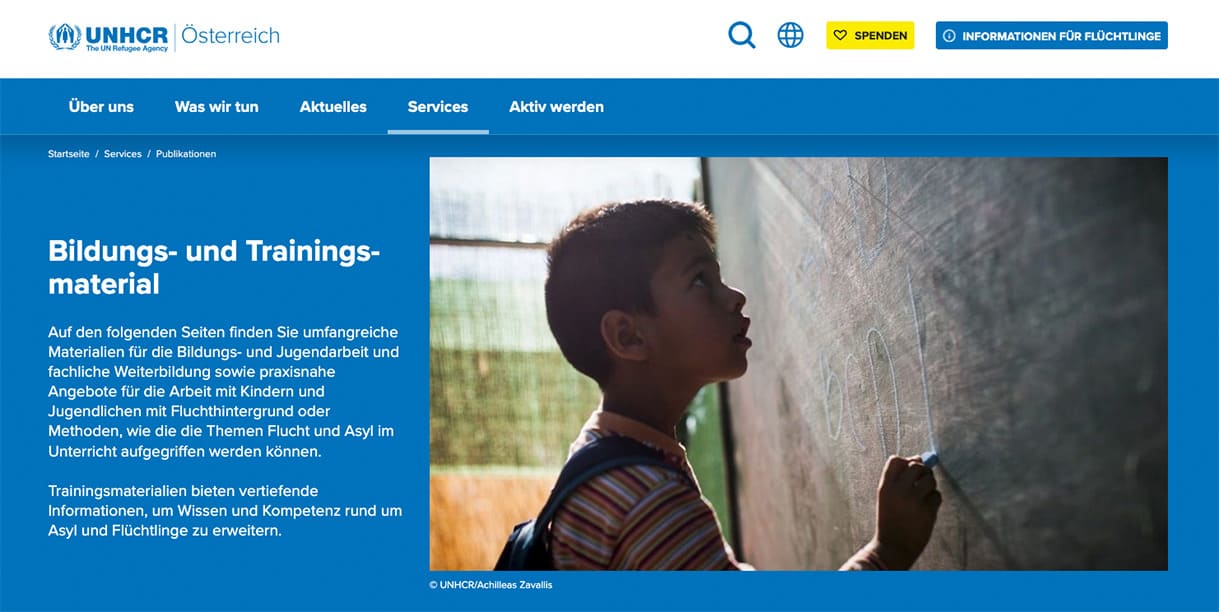
Eine Region, die besonders von Fluchtbewegungen innerhalb der eigenen Staatsgrenzen getroffen wurde, ist Tigray, im Norden Äthiopiens. Während des zweijährigen Bürgerkriegs zwischen der äthiopischen Regierung und der „Volksbefreiungsfront von Tigray“ (TPLF) verloren 700.000 Menschen ihr Leben. Eine Million flüchtete innerhalb der Region und lebt in notdürftigen Camps. „Oft wurden Schulen zu Notunterkünften umfunktioniert. Die Situation ist herzzerreißend. Auch zweieinhalb Jahre nach Kriegsende hausen Familien noch immer jeweils auf wenigen Quadratmetern, nur getrennt durch aufgehängte Planen oder Decken, die so gut wie keine Privatsphäre zulassen“, schildert Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt.
Diese österreichische Entwicklungsorganisation unterstützt, seit ihrer Gründung vor 28 Jahren, in Tigray Schul- und Berufsausbildungsprojekte. Mit Beginn des Bürgerkriegs im November 2020 leistete Jugend Eine Welt durchgehend wichtige Nothilfe für die hungerleidende und traumatisierte Bevölkerung, unter anderem dank der Unterstützung der Austrian Development Agency (ADA). „Der Krieg zerstörte nicht nur das Leben der Millionen Menschen in der Region, sondern traf auch das Bildungssystem, was für die jüngere Generation weitereichende Folgen hat“, so Heiserer. „Die Kinder hatten über mehrere Jahre keinen Unterricht. Schulen, die verwüstet wurden, müssen nun schnell wieder aufgebaut werden. Damit die Mädchen und Buben eine Perspektive haben.“

Während des Bürgerkriegs machten die bewaffneten Truppen in der Tigray-Region vor nichts Halt. Als sie beispielsweise durch die Stadt Adwa zogen, wo Jugend Eine Welt gemeinsam mit den Salesianern Don Boscos u.a. Jugendliche zu Solartechnikerinnen und -technikern ausbildete, rissen sie Türen der Schulen aus den Angeln, schleppten Tafeln und Bänke davon, verbrannten Hefte und Bücher. Mehr als 2.400 Mädchen und Buben verloren an nur einem Tag ihren sicheren Lern- und Schutzraum. „Einige Schulen, sofern sie nicht mehr als Notunterkünfte für Binnenvertriebene benötigt werden, sind mittlerweile wieder geöffnet. Doch viele Klassenzimmer haben keine Einrichtung mehr. Alles ist leer, außer dem staubigen Boden ist nichts mehr da“, skizziert Heiserer die aktuelle Lage. „Dank der Unterstützung der Austrian Development Agency (ADA) sind wir mittlerweile dabei die Schulen mit Tafeln, Tischen, Sesseln, Unterrichtsmaterialen sowie barrierefreien Toiletten auszustatten. Doch parallel müssen auch die Gebäude bis zum kommenden Schuljahr wieder hergerichtet werden. Dächer müssen gedeckt und Mauern verputzt werden. Darüber hinaus benötigen die Schulkinder sauberes Trinkwasser und eine warme Mahlzeit – damit sie nicht mit leerem Magen lernen müssen. Die Einrichtung eines Klassenzimmers kostet 4.000 Euro, eine Lehrkraft verdient rund 100 Euro pro Monat. Das sind kleine Summen, können aber Großes verändern!“
Bis alle Schulen wiederhergestellt sind, läuft der Unterricht weiterhin notdürftig unter freiem Himmel. Oft dient nur ein großer Mangobaum als Dach über dem Kopf. „Die Schulkinder rücken auf einfachen Holzscheiten zusammen und lauschen dem Lehrer, der seine Tafel an den Stamm lehnt“, schildert Wolfang Wedan, Nothilfe- Koordinator von Jugend Eine Welt, Eindrücke von seinen letzten Besuchen in der Tigray-Region. „Für die Kinder, die Gewalt und Flucht erlebt haben, bedeutet dieser provisorische Unterricht weit mehr als Lesen und Rechnen: Er schenkt Struktur, Sicherheit und eine Portion Normalität im Ausnahmezustand.“
suedwind -> weltfluechtlingstag 2025
unhcr.org/at -> bildungsmaterial zu Flucht

Auf der Bühne im Ankersaal in der Brotfabrik proben BeatBoxer:innen für ihren Auftritt beim Festival „DWG – Demokratie, was geht?“. Danach zeigen Breakdancer:innen ihre tänzerisch-akrobatischen Moves. Gleichzeitig kommt die Bitte, die Lautsprecher abzudrehen, weil auf der großen freien Fläche des Saals – üblicherweise für Publikum gedacht – eine Fashion-Performance erstmals geprobt werden will.
Ein bissl ist schon angespannte Hektik zu spüren. Immerhin sind es nur mehr wenige Tage bis zu den Live-Auftritten vor Publikum.
Das Festival bei dem insgesamt mehr als 100 Jugendliche ihre unterschiedlichsten künstlerischen Statements mit Gedanken, Wünschen, Forderungen zu (mehr) Demokratie, Teilhabe, Partizipation zeigen und zu Gehör bringen steigt vom 21. bis 23. September im Wiener MuseumsQuartier (Details in der Infobox am Ende des Beitrages).
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte am Wochenende vor dem Festival im Kulturareal Brotfabrik in Wien-Favoriten ein paar Stunden bei Proben zuschauen und -hören; vier der jugendlichen Künstler:innen gaben auch kurze Interviews. Die Fashion-Performance ist eine ziemlich komplizierte. Leopold hat ein weißes kleidartiges Gewand an, aus dem fast ein Dutzend urlange Stoffrollen laaaangsam abgewickelt werden sollen/müssen. Wer gerade Hände frei hat und nicht anderweitig im Einsatz ist, greift sich eine der Rollen. Langsam und würdevoll schreitet Leopold vom hinteren Ende des Saals in Richtung Bühne.
Auf dem Boden sind die Teile der Ovalhalle des MQ mit weißen Klebestreifen markiert. Die Rollen werden Drehung für Drehung abgewickelt, schwarze Schrift kommt zum Vorschein, verschiedene Alphabete – lateinisch, arabisch, kyrillisch – in vielen Sprachen. Auf Deutsch ist – sobald das Banner einigermaßen abgerollt ist u.a. zu lesen: „Mitreden, wenn ihr über uns redet“. Ähnliches bedeuten die Losungen und Forderungen auf Arabisch, Farsi, Ukrainisch, Türkisch… Viele dieser Jugendlichen dürfen, auch wenn sie schon 16 Jahre sind, nicht wie ihre Alterskolleg:innen wählen. Selbst solche nicht, die schon praktisch das ganze Leben hier verbringen, weil ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft fehlt/verwehrt wird.
In einer Ecke im Vorraum malt jemand ein weiteres Plakat, dahinter lehnt eines zum Trockenen auf dem steht: Jede Stimme braucht eine Bühne. Hinter einem Vorhang eines anderen Bereichs des Ankersaal-Vorraums ertönt afghanische Musik. Der Reporter darf Blicke dahinter werfen. Einige Jungs üben einen Tanz ein. Beim Festival werden sie selber einen Workshop anbieten, bei dem Besucher:innen, die Interesse haben, spielerisch die Grundschritte eines ihrer Volkstänze kennenlernen können. Solche Workshops wird es auch für serbische und jemenitische Tänze geben.
Die Jugendlichen, die ihre Kunst(werke) – von gemalten Bildern über Skulpturen bis zu Tänzen, Theaterstücken, Songs, und in anderen Performances (etwa Fashion) – vorstellen und vorführen, haben diese in den vergangenen Monaten in wöchentlichen – elf verschiedenen – Workshops entwickelt und erarbeitet. Kreativ-Mentor:innen und Jugendarbeiter:innen waren/sind die Coaches, die sie dabei unterstützten. Das Festival dient damit aber nicht nur der Präsentation dessen, was diese mehr als 100 Jugendlichen geschafft haben, sondern will auch jenen jungen Leuten, die zu Besuch kommen, sich die Kunst anschauen und -hören oder gar in Workshops mitmachen, in Talks mitdiskutieren, Mut machen, auch selber aktiv zu werden, sich auszudrücken, zu engagieren…
So manche der Jugendlichen sind erst hier in den Workshops draufgekommen, welche Talente in ihnen gesteckt haben. So schildert Kristina, mit 14 einer der Jüngsten, dass er zunächst über TikTok-Videos auf das Projekt aufmerksam geworden „bin und mir das dann bei einer Open Stage angeschaut und ich probiert habe, ein Lied zu covern. Da hab ich mich dabei wohlgefühlt, auf der Bühne gestrahlt.“ Als dann die Workshop-Leiter:innen sich von seinem Auftritt beeindruckt gezeigt haben, „bin ich beim Singen geblieben. Und als ich von meinem Traum erzählt habe, einmal eine Gitarre spielen zu lernen, wurde mir eine geborgt. Jetzt lern ich mit. YouTube- und tikTok-Videos Gitarre spielen!“
Ob er nicht bei seinem genannten allerersten Bühnenauftritt ein wenig Schiss hatte, will KiJuKU wissen: „Ein bisschen schon, aber ich hab’s gepackt und als mich dann alle gefeiert haben, war’s ein tolles Gefühl, das mich motiviert hat, weiterzumachen.“ Überhaupt fühle er sich in diesen Workshops hier sehr wohl, viel besser als in der Schule. „Hier kann man auch über alles reden, über Diskriminierungen oder dass eben alle gleichberechtigt sein sollen und können – egal welches Geschlecht, welche oder keine Religion und so weiter.“
Auch die 23-jährige Ida entdeckte erst in diesen Workshops ihre Talente. „Ich hab vorher nie Theater gespielt und nie gebreackdanced“. Jetzt legte sie nicht nur akrobatische Tanz-Bewegungen aufs Parkett, sondern spielt auch in einem Theaterstück, „da bin ich eine toughe Immobilienmaklerin und kann meine böse Seite ausleben“, verrät sie dem Journalisten. Auf DWG ist sie zufällig gestoßen, „durch ein Insta-Reel vom Theater der Unterdrückten bin ich auf die Schnupperworkshops gestoßen“ – und wie zu sehen dabeigeblieben!

Evray zückt fast gleichzeitig mit dem Beginn des Gesprächs sein Handy, scrollt durch einige Musik-Clips, verbindet das SmartPhone via Bluetooth mit einer kleinen Lautsprecher-Box und beginnt zu singen – in dem Fall Arabisch. Der 22-jährige ist im syrischen Afrin erst mit Kurdisch, dann noch mit Arabisch aufgewachsen. Diese Stadt im autonom unter kurdischer Führung verwalteten Rojava wurde vor mehr als einem halben Jahrzehnt von türkischem Militär überfallen.
„Schon mit acht, neun Jahren hab ich zu schreiben begonnen, wollte dann auch singen. Aber meine Stimme find ich nicht so gut, darum hab ich mit Hip*Hop begonnen. Ich schreib Texte über das, was ich erlebt habe und erlebe – oder zum Beispiel darüber, dass ich meine Familie schon seit fünf Jahren nicht gesehen habe und sehr vermisse.“
Er selbst war schon vor der Besetzung Afrins in die Türkei geflüchtet, wo er in Istanbul jahrelang als Jugendlicher gearbeitet hat, „als Schneider und Kellner“. Seit knapp einem Jahr lebt er in Österreich. Deutsch ist seine zweite Fremdsprache, die er neben Englisch lernt, „Kurdisch, Arabisch und Türkisch kann ich wie Muttersprachen. Ich lern jetzt intensiv im Deutschkurs, dann will ich eine Ausbildung machen und am liebsten später mein eigenes Tonstudio gründen“, erzählt Evray, der mit eigenen Hip*Hop-Nummern beim DWG-Festival auftreten wird.
Kurz kommt auch Leopold – genau der in dem Gewand schreiten wird, dessen Schriftrollen schon oben geschildert wurden – zum Interview-Tisch: „Ich fühl mich sehr wohl dabei, auch wenn ich langsam und vorsichtig gehen muss“, sagt er zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Und er freue sich schon auf den Auftritt im MuseumsQuartier.
„Wir sind immer wieder begeistert von der kreativen Energie junger Leute. Sie kann Berge versetzen und wir brauchen mehr davon, wenn wir uns ein harmonisches und vielfältiges Miteinander wünschen.“ Mit diesem Satz wird Mahir Yıldız, der Leiter und Erfinder des Projekts DWG – Demokratie, was geht?“ in der Presseaussendung zum Festival zitiert. Yıldız hat übrigens davor schon mit Jugendlichen vor allem partizipative Filmprojekte initiiert und geleitet wie „Echte Helden sind anders“ oder gemeinsam mit der Arbeiterkammer „Lockdown-Stories“ – die ihren Niederschlag in Berichterstattung auf KiJuKU.at gefunden haben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen