
Ein großer, leicht scheinender doch gewichtiger Tisch, eine Lichterkette mit subtilem Anklang an eine solche auf einem Segelboot. Zwei Leute betreten von hinten durch den Vorhang die Bühne im Theater am Saumarkt im Vorarlberger Feldkirch. Hier steht im Rahmen des aktuellen „Luaga & Losna“-Festivals die einzige Vorstellung auf dem Programm, die sich nicht an junge Kinder richtet. Ab 12 und nicht zuletzt für Erwachsene lassen hier Friederike Schreiber und Günther Henne von „TheaterGrueneSosse und Theaterhaus Ensemble (Frankfurt, Deutschland) einen Wesenszug der Hauptfigur in Sten Nadolnys Kult-Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ lebendig werden.
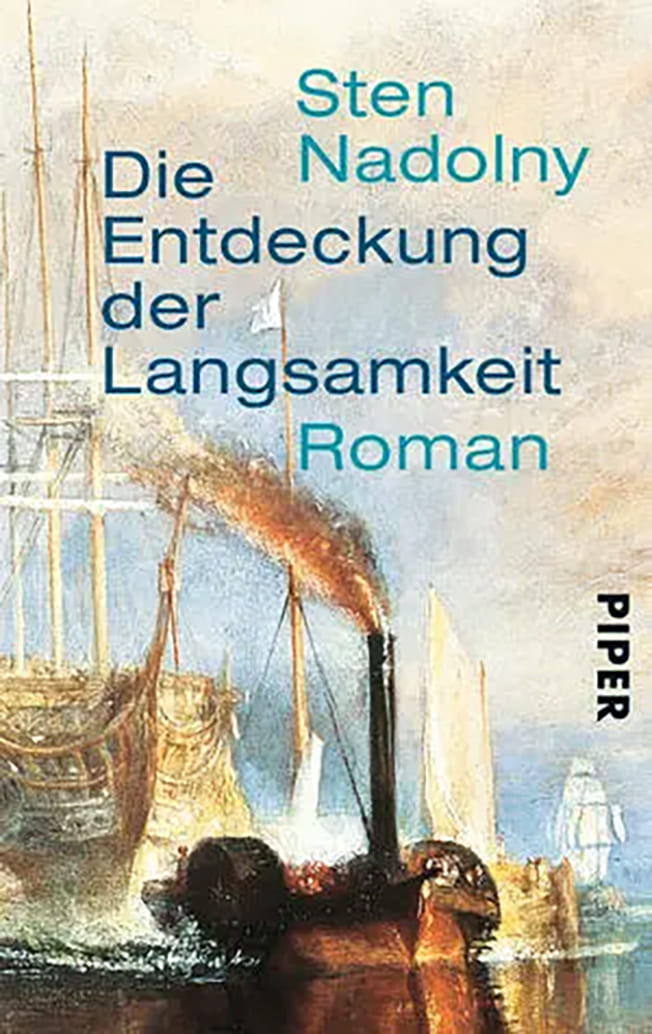
„John Franklin war schon 10 Jahre alt und noch immer so langsam, dass er keinen Ball fangen konnte. Er hielt für die anderen die Schnur. Vom tiefsten Ast des Baumes reichte sie herüber bis in seine empor gestreckte Hand. Er hielt sie so gut wie der Baum, er senkte den Arm nicht vor dem Ende des Spiels…“
Die echten ersten Sätze des Buches – so wie viele andere Passagen über diesen britischen Seefahrer und leidenschaftlichen Polarforscher – gepaart mit von Nadolny durchaus ausgedachten Szenen las das Duo – scheinbar, in Wahrheit hatten sie den Text – gemeinsam mit dem szenischen Spiel verinnerlicht.
Vor sich die Blätter in den ersten Minuten und immer wieder auch zwischendurch, machen sie aus dem Tisch ein Schiff (Bühnenbau: Detlef Köhler), ein Ventilator hilft bei der Darstellung von Stürmen, in die das Segelboot gerät.

Kernaspekt aus dem Roman, von dem sicher viiiiiel mehr Menschen den Titel und als Inhalt oder den Text kennen, ist die Langsamkeit, die vom lange Zeit den Titelhelden in seiner Kindheit und Jugend begleitendem Nachteil zu einem Vorzug aufgrund bedächtig gefällter Entscheidungen führt(e). Nadolny, der vieles, unter anderem Geschichte studierte und sogar unterrichtet, hatte viele Unterlagen über den historischen John Franklin (1786 – 1847) durchgeackert, zu weniger bekannten Phasen dachte er sich einiges aus. Den Charakterzug der Langsamkeit, „den der wirkliche Franklin nach Auskunft der Quellen möglicherweise hatte, aus dem er aber wohl nicht systematisch eine Tugend gemacht hätte“ (Stefan Munaretto, Die Entdeckung der Langsamkeit von Sten Nadolny. Textanalyse und Interpretation. Königs Erläuterungen und Materialien, Band 427 – siehe Info-Box am Ende) rückte der Autor ins Zentrum.
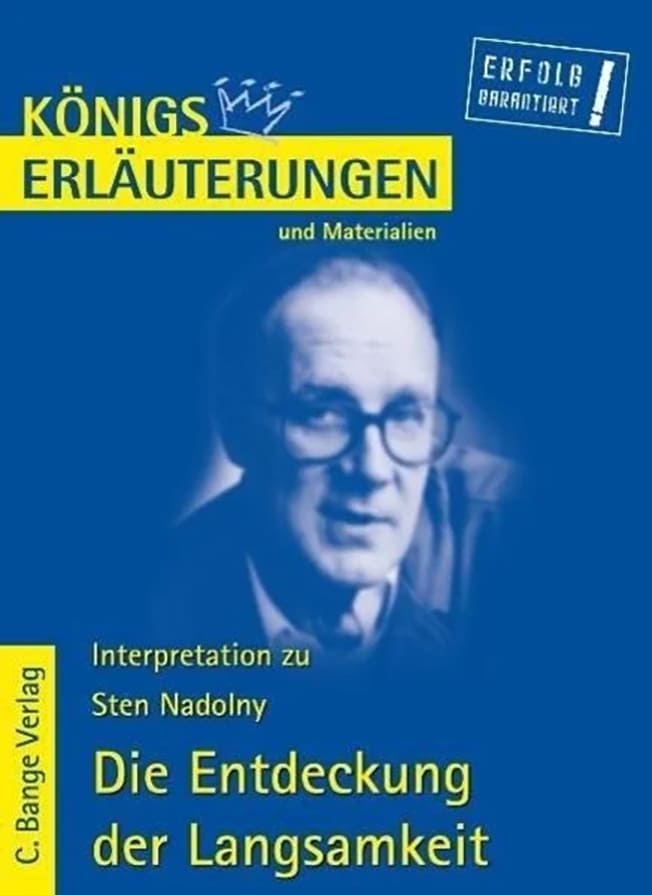
Und diese verkörpern die beiden Schauspieler:innen, ohne sie je übertrieben zu zelebrieren. Selbst wenn sie einigermaßen hektisch durch die Gegend – in dem Fall die Publikumsreihen wandern, über Sitze klettern, strahlen sie keine Hektik aus (Regie: Leandro Kees, der auch mit den beiden die Textfassung aus dem Roman destilliert hatte).
Hin und wieder schlüpfen sie doch in verteilte Rollen auch anderer Protagonist:innen in John Franklins Leben, vor allem stellen sie ihn und seine Haltung, seine Suche – unausgesprochen nach dem Horizont als Fixpunkt – dar. Und selbst in den heftigen Sequenzen einer Seeschlacht mit einem Schiff der französischen Marine oder in wildesten Stürmen, strahlen sie aus: Der Typ steht zu sich und seiner damit in die Außenseiterrolle gedrängten markanten Eigenschaft. Das Schauspiel von Schreiber und Henne lässt sowohl die anfängliche Ausgegrenztheit als such die spätere Stärke spüren.
Was – so erzählen die beiden im abendlichen Inszenierungsgespräch mit Teilnehmer:innen des Symposions „Theater & Bild & Ton“ (und anderen Interessierten) – nach den ersten Vorstellungen in Frankfurt durchaus auch gegenteilige Jugendliche ge- und bestärkt habe, etwa solche bei denen ADHS – also eher Hektik – diagnostiziert wurde.

Der vor knapp mehr als 40 Jahren erschienene Roman (mit einem Kapitel daraus hatte Nadolny drei Jahre zuvor den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen – und sein Preisgeld auf alle Teilnehmer:innen verteilt) wurde immer wieder auch als Art Statement gegen übertriebene und vor allem ungesunde Hektik, Missachtung der Lebenszyklen von Natur und Mensch interpretiert. Die Hauptfigur, die noch auf Segelschiffe setzt, während andere schon mit Raddampfer unterwegs sind. Hier bog auch Nadolny eine späte Expedition John Franklins ein wenig zurecht, dessen reale Schiffe schon maschinell ausgestattet waren.
Auch schon Michael Endes „Momo“ – zehn Jahre vor Nadolnys bekanntestem Roman erschienen – hielt ein Plädoyer für das reale Leben im hier und jetzt und gegen die grauen „Zeitdiebe“. Die Welt hat sich zwar „nur“ in der gleichen Geschwindigkeit weitergedreht, die Hektik der (allermeisten) Menschen, Zeitdruck, hat um ein Vielfaches zugenommen. Das was schon vor 50 und 40 Jahren beklagt worden war, dass damit nicht nur menschliche Beziehungen beeinträchtigt, sondern oft die Wahrnehmung der Wirklichkeit zunehmend verloren gehen könnte, hat sich potenziert. Hektische Bild- und Schnittfolge in Videos und Filmen – da setzt diese Version der Dramatisierung des Romans durch ihre Spielart viele Momente entgegen, sich auf das Loblied der Langsamkeit einzulassen.

„Wie dem – wie immer im „Spielraum“ umfangreichen, hintergründigen – Programmheft (wahrscheinlich den besten der Stadt) zu entnehmen ist, hatte das Schicksal der bei ihrer letzten Expedition im ewigen Eis verschollenen Forscher, namentlich John Franklins, Sten Nadolny schon als Schüler interessiert. Das schreibt er im Einleitungsabsatz eines Artikels für die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“ Anfang 2023 anlässlich des 40. „Geburtstages“ dieses Romans. Damals träumte er davon, selber eine Expedition zu leiten, um die verschollenen Schiffe bzw. eventuelle Überreste zu finden. Um viel später daraus einen Roman zu schreiben.“ (KiJuKU, November 2023)
Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.


Weil die Zeit immer hektischer, aufgeregter werde, darum wählte das kleine, feine, sehr engagierte Theater Spielraum – Motto: „Wir nehmen Texte beim Wort!“ – für seine jüngste Produktion einen Klassiker, der einen Gegenpol setzte: Sten Nadolny in seinem Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“, vor genau 40 Jahren erschienen (1983).
Folgerichtig beginnt recht langsam, Erwachen aus „eingefrorenem“ Zustand (freeze) in einer Art Zeitlupe. Um dann doch in den nicht ganz zwei Stunden (110 Minuten, ohne Pause) kurzweilig die Grundlinie des berühmt gewordenen Romans anschaulich miterleben zu lassen.
Hauptfigur des Romans – im Stück dreht sich fast alles um seine Geschichte, doch die vier Schauspieler:innen agieren annähernd gleichgewichtig – ist John Franklin (Adrian Stowasser). Er und Christian Kohlhofer, Julia Handle sowie Nicole Metzger, die gemeinsam mit Regisseur Peter Pausz aus dem Roman eine spielbare Bühnenfassung geschrieben hat, agieren in Matrosen-ähnlichen Gewändern (Kostüme wie immer dem Stück, der Zeit und dem Bühnengeschehen angepasst von Anna Pollack). Wer gerade das Sagen hat, drückt optisch eine dunkle Uniformjacke aus – an den Schulterpolstern glänzende „Auszeichnungen“ aus einer Vielzahl von (Zeiger-)Uhren.
Die fast zwei Stunden, die nie auch nur einen Moment der Langeweile ausstrahlen und dennoch nicht hektisch ablaufen, spielen sich in einem immer wieder mit wenigen Handgriffen wechselnden Bühnenbild (Raoul Rettberg) ab, die von vornherein – sowohl jedes einzelne hölzerne Teil, besonders aber in ihrer Gesamtheit das Bild von Schiffen in den Köpfen des Publikums erzeugen.
John Franklin hat wirklich gelebt (1786 bis 1847), war englischer Kapitän großer (Forschungs-)Schiffe und vor allem im hohen Norden auf Suche, wenngleich er wenige Jahre auch auf der anderen Seite der Erdkugel, in der südöstlich von Australien gelegenen Insel, die heute Tasmanien heißt, unterwegs war.
Das mit der Langsamkeit ist die literarische Freiheit des Autors, die er daraus erdachte, weil Franklin – so Überlieferungen – eher bedächtig überlegte, bevor er Entscheidungen traf. Daraus zimmerte Nadolny, der drei Jahre zuvor in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hatte und das Preisgeld unter allen Teilnehmer:innen aufteilte, um „den Wettbewerb zu entbittern“.
Seine Erzählung – auch die in der Inszenierung im Theater Spielraum – setzt beim zehnjährigen John ein, der von anderen zum Außenseiter wird, heute würde dafür das Wort gemobbt verwendet werden – wobei hier sicher sehr viel literarische Freiheit in den Roman floss. Vielleicht setzte Nadolny schon bei seiner Hauptfigur dieses Romans ein, weil die Geschichte auch schon bei ihm früh begonnen hatte.
Wie dem – wie immer im „Spieltraum“ umfangreichen, hintergründigen – Programmheft (wahrscheinlich den besten der Stadt) zu entnehmen ist, hatte das Schicksal der bei ihrer letzten Expedition im ewigen Eis verschollenen Forscher, namentlich John Franklins, Sten Nadolny schon als Schüler interessiert. Das schreib er im Einleitungsabsatz eines Artikels für die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“ Anfang dieses Jahres anlässlich des 40. „Geburtstages“ dieses Romans. Damals träumte er davon, selber eine Expedition zu leiten, um die verschollenen Schiffe bzw. eventuelle Überreste zu finden. Um viel später daraus einen Roman zu schreiben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen