
Honig und Essig? Klingt aufs erste, naja, nicht gerade verlockend. Doch es ist ein Jahrtausendealtes erprobtes, vor rund 2500 Jahren auch schriftlich verbürgtes Hausmittel, genannt Oxymel (meist im Verhältnis 3 bis 4 zu 1)– der zweite Wortteil ist für Honig bekannt und oxy – ebenfalls aus dem Altgriechischen – steht für sauer.
Gut, das wäre somit nichts Neues. Aber die „vitalOxy“-Jungunternehmer:innen aus der HBLA in Salzburg-Ursprung bauten nicht nur auf dem Wissen Theresa Mühlbachers auf, die von ihrem Vater, einem Imker, viel über Bienen und Honig einbrachte, sondern konnte es auch mit der von Iris Mackingers mütterlicher Kräuter-Expertise vermengen. Im wahrsten Sinn des Wortes.
Die beiden Genannten sowie Tristan Scheibenbauer, Maximilian Scheikl und Nico Kräutner vertraten als Quintett das gemeinsam mit vier weiteren Jugendlichen betriebene Unternehmen VitalOxy. Die Jungunternehmer:innen suchten Rezepturen mit gesundheitsfördernden Wirkungen für verschiedene Anlässe und gaben ihnen selbsterklärende Namen: Immun, Kraft, Darm, Kater und soll in besagten Fällen helfen. Der fünfte süß-saure dickliche Saft, den sie nach Wien mitgebracht haben namens „Küche“ könnte als Marinade oder beim Kochen Verwendung finden. 13 Sorten hatten sie im Laufe der Produktion gemixt.
Was aber ganz besonders an VitalOxy ist: „Wir verwenden den sogenannten Zementhonig, ja, der heißt wirklich so“, versichern die Jugendlichen dem zweifelnd dreinschauenden Journalisten. „Naja, der Fachbegriff ist Melezitose-Honig, der ist so fest, dass ihn Imker:innen kaum aus der Wabe kriegen, weshalb er meistens weggeschmissen wird. Man könnte die Wabe samt dem festen Honig kochen, aber dann verliert der Honig seine Nährstoffe. Wir haben uns gedacht, wir probieren’s einfach aus, diesen harten Honig mit Essig zu vermischen und schonend zu erhitzen. Das ist ein eigenes Verfahren, das wir entwickelt haben
Wem die sogenannten grünen Daumen fehlen und bei der oder dem Pflanzen in der Wohnung somit regelmäßig eingehen oder nicht richtig blühen und gedeihen, für den dachten sich Schüler:innen der HTL Anichstraße (Innsbruck, Tirol) etwas aus, und machten es zu ihrer Geschäftsidee. Nein, sie schicken keine Gärtner:innen in diverse Wohnungen oder WG-Zimmer, sondern konzipierten relativ kleine und doch beachtliche, noch dazu dekorative Glashäuser. Diese Mini-Gärten im geschlossenen Glas, womit das Wasser in diesem kleinen geschlossenen Ökosystem im Kreislauf bleibt, lassen sich auch via Handy-App pflegen – der spezifisch fachliche Part der HTL’er:innen Silvana Schennet, Christian Baumann, Andreas Achrainer, Benjamin André und Hannes Egger, die die Hardware entwarfen und das Gehäuse dazu 3D-druckten und die Software programmierten für die unterschiedlichen EcoSphere-Produkte ihres Unternehmens „Grow Green“.
Wähl deinen eigenen Spruch und mach (d)ein T-Shirt zu einem einzigartigen. Nicht schon vorgedruckte Kleidungsstücke aus dem Geschäft, sondern individuell designt – das ist die Geschäftsidee der Junior-Company „Print it“ aus der Handelsakademie und -schule im Vorarlberger Bludenz. Wem keine passende Idee kommt, für den halten Shaden Khalil, Enkhlen Buyansargal, Eva Fuchs, Maxima Lorenzin und Isabel Bruggmüller, die ihr und ihrer Kolleg:innen Schüler:innen-Unternehmen aus der 2. Klasse BHAK/BHASch beim Bundesfinale der Junior Companies in Wien vertraten, auch schon einiges bereit – Highlight: MEGA – Make Empathy Great Again.
Ihre Firma ist Teil des Unterrichtes im Pflichtfach Projektmanagement mit zwei Wochenstunden. Für ihr Leiberl-Bedruck-Business haben sie sich auch einen Werbespruch ausgedacht: „Your style – our mission“.

Die Wichtig- und Nützlichkeit von Bäumen und (Ur-)Wäldern – abseits der Verwertung von geschlägertem Holz und gerodeten Flächen – als grüne Lungen für das Weltklima, die Menschheit und beim Eintauchen in einen solchen für einzelne Menschen ist mittlerweile weithin bekannt. Dennoch behalten Wälder noch immer so etwas wie dunkles, fast Unheimliches, was nicht zuletzt aus jahrhundertealten Märchen kommt. Auch wenn das eine oder andere neu erzählt, umgeschrieben, gegen den Strich gebürstet inszeniert wird, kleben uralte Images an der Ansammlung von Bäumen.

Geheimnisvolles und Magisches soll dieser Wald in „Die sieben Wünsche“, das kürzlich vielumjubelte Premiere im großen Haus des Wiener Theaters der Jugend, dem Renaissancetheater hatte, durchaus haben. Das meinte der Autor und Regisseur (Henry Mason) dieses märchenhaften Stücks mit Elementen und Motiven aus gut einem Dutzend verschiedener der Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm im Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… – Link zu diesem Gespräch, in dem er auch erklärt, wie er auf die Story und die Zahl sieben für die Wünsche – es gibt ja etliche magische Zahlen – kam, am Ende des Beitrages.

Nun hier aber zunächst der Plot dieser knapp mehr als zweistündigen (eine Pause) kurzweiligen, spannenden, manchmal ein bisschen gruseligen, märchenhaften Inszenierung voll so mancher Überraschung: Familie Wunsch lebt in einem großzügigen Haus am Waldrand. Dort steht auch die Grundlage für den Wohlstand: Eine Papierfabrik.

Großmutter Adele Wunsch (Uwe Achilles nicht selten wirklich furchteinflößend in den meisten Auftritten), die eigentlich eine Prinzessin war, und darunter leidet, nicht genug weltweit Beachtung zu finden, hat neue Maschinen angeschafft, die statt grauen nun blütenweißen Papiers herstellen können – aus Holz. Also sollen / Müssen Bäume des Waldes dranglauben.
Enkelsohn Hans (Jonas Graber), ein empathischer Freund der Bäume und der in ihnen lebenden Tiere, möchte das gar nicht, seine Schwester Margarete (Anna Katharina Malli) hingegen sehr, sie glaubt an das, was als „Fortschritt“ verkauft wird und eilt mit Axt in den Wald.

Zwischen der tyrannischen Großmutter, dem ängstlichen Großvater Tilo (Frank Engelhardt), der seine Frau sehr liebt und den genannten Kindern gibt es deren Eltern: Walter (Stefan Rosenthal) den Sohn der Alten, der seine Kinder liebt, aber nix gegen seine Mutter sagen oder gar machen will und seine angeheiratete Frau Roswitha (Violetta Zupančič). Die war offenbar als Kind Rotkäppchen, weil sie immer wieder erzählt, dass sie einst von einem Wolf verschluckt worden war und samt der Großmutter, auf die sie im Wolfsbauch fiel, das Tier von innen aufgeschlitzt und sich so befreit hatte.

Als weitere Figur tritt eine im Wald lebende Frau, von allen als Hexe gefürchtet (Maria Fliri, die auch den Familienfotografen und eine Bedienstete im Hause Wunsch spielt) in Erscheinung. Sie versteht die Bäume, ist dabei ihre Sprache zu lernen. Wie und was sie mit der Familie Wunsch zu tun hat, sei hier nicht gespoilert – nicht nur, weil der Autor und Regisseur im Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… gebeten hatte, nicht zu viel zu verraten. Das wäre auch so schon hier nicht passiert. Auch nicht wie die ängstlich gewordene Mutter Roswitha ihren alten Mut (wieder) findet – dies ist übrigens eine wunderbare Szene dank der Kostümverwandlung.

Violetta Zupančič legt hier eine wahrhaft magische Verwandlung hin – nicht zuletzt auch dank einer kostümmäßigen Verwandlung. Kostümbildnerin Anna Katharina Jaritz und die Schneider:innen der Kostümwerkstatt haben hier ein meisterhaftes Kunstwerk aus Stoff geschaffen.
Eine Figur gibt’s darüber hinaus noch: Neben dem Wolf, in dem natürlich ein Schauspieler steckt – über den hier der Mantel des Schweigens gebreitet wird, um die letztlich verblüffende Enthüllung nicht kaputt zu machen, tritt mehrmals ein kleines grünes, wuscheliges Waldwesen, ein Moosmännlein, in Erscheinung – als Puppe, geführt, gespielt und gesprochen von Frank Engelhardt (ansonsten Großvater Tilo Wunsch).

Die Puppe gebaut und das ganze Bühnenbild entworfen hat Rebekah Wild. Die Bäume, die den Wald bilden und von denen die Tyrannin viele schlägern lässt, sind „nur“ stilisiert – als Träger einer Produktionshalle der Papierfabrik. Sie wirken voll als wären sie typische Fabriks-Stahlgerüst-Teile. Sie sind aber in echt aus Holz, vertraute Rebekah Wild dem Reporter an und zeigt sich fasziniert vom Werk der Mitarbeiter:innen der Werkstatt haben dies so perfekt hingekriegt, dass sie, als sie künstliche Blumen befestigen wollte, erst meinte: „Antackern kann ich sie nicht, die Träger sind ja aus Stahl, ach nein, sind ja Holz!“

Natürlich heißen Hans und Margarte nicht zufällig so, manchmal werden sie auch Hänsel und Gretel genannt – und so manche Anspielung ans gleichnamige Märchen kommt vor. Ein anderes – Rotkäppchen – wurde schon genannt. Die Großmutter will – nicht wegen ihres Aussehens, sondern einer besonderen Fähigkeit, die hier sicher nicht verraten wird, sich von einem Spiegel bestätigen lassen, dass sie darin die Beste sei. Zu ihrem Ehemann kam sie, weil dieser sieben Fliegen erschlagen hat und als Held galt. Margarete hilft dem eingeklemmten Moosmännlein nicht, ihr Bruder tut’s schon – ein Motiv, das mindestens an Frau Holle, aber noch etliche andere Märchen erinnert wo solch unterschiedlich empathische Geschwister vorkommen.

Bevor sich alle gegen die Tyrannin zusammenschließen und versuchen den Wald oder viel weniger das, was von ihm noch übrig ist, zu retten, geht die Show noch eine Reihe etlicher Verwicklungen, Windungen und Wendungen. Spannend, manchmal auch reißt’s dich und dann ist wieder etliches zu schmunzeln oder gar lachen dabei. Bei der Premiere gab’s mehrfach Szenen-Applaus im zweiten Teil nach der Pause.
Gedacht und angegeben für Kinder ab sechs Jahren, aber so hin- und mitreißend gespielt und spannend inszeniert, dass „Die sieben Wünsche“ Besucher:innen jedweden Alters darüber anspricht und mitnimmt.
Achja, wie schon einleitend angesprochen, natürlich spielt der Wald als Symbol für die Natur und ihre Schutzwürdigkeit eine zentrale hintergründige Rolle, ohne dies „oberlehrer:innhaft“ mit erhobenem Zeigefinger zu tun.

Zwei Schauspieler stehen zunächst seitlich vom Publikum, kommen auf die Bühne und schlüpfen vor aller Augen erst in ihre Rollen. Jugendliche. Pubertierende. Burschen. Goschert der eine, voll der Macker – zumindest will er sich so geben, sähe sich auch selbst gern so. Manchmal aufbrausend. Ohne Ansatz. Eher zurückhaltend, schüchtern, verträumt, ja poetisch der andere.
Aber sie sind nun einmal hier zusammen. Auf engem Raum. Zusammengeschweißt durch Schicksalsschläge, von denen der Name Ikarus noch nicht der allerschlimmste ist. Der ist querschnittgelähmt von TH 10 – von zwischen Brust- und Bauchmuskeln abwärts. Francis, der spätere Kumpel, hat Multiple Sklerose, geht mit Krücken.

Ihre Behinderungen haben sie hier in einer Rehabilitationsklinik zusammengebracht, sind klarerweise nicht zuletzt deswegen Gesprächsthema. Und mit dem gehen sie – wie es echt Betroffene oft wirklich tun, scheinbar respektlos, bitterböse, schwarzhumorig um. Weshalb der ursprüngliche Stücktitel „Mongos“ (das in gut einem halben Dutzend deutschsprachiger Theater lief/ läuft) ziemlich zutreffend ist – so wie sich in Wien vor mehr als einem Vierteljahrhundert eine Gruppe von Satirikern mit verschiedenen Behinderungen „Krüppelkabarett“ nannte. Weil der Begriff aber doch diskriminierend wirkt, haben sich Verlag und Theatergruppe entschlossen, es unter neuem Titel zu spielen: „Irreparabel“.
Geblieben ist die für manche mitunter verstörend radikale Ablehnung von Pseudo-Mitgefühl, das eher ins Mitleid abgleitet. So zeigen sie einander – und dem Publikum wie Respekt geht: Sich als Menschen zu behandeln, genauso wie wenn sie keine Behinderung hätten. Nicht in Watte packen, also auch benennen, vielmehr sogar beschimpfen, wenn sich einer als A…-loch aufführt…

Vor diesem Hintergrund spielt sich in diesen knapp eineinviertel Stunden des Stücks von Sergej Gößner vor allem die Annäherung zweier völlig unterschiedlicher Typen ab: Von der Ablehnung des Zwangsgenossen – es gibt anfangs fast keine echte gemeinsame Gesprächsbasis – bis hin zur Freundschaft. Derzeit ist eine Version des Stücks in einer Koproduktion der Grazer Gruppe „Follow the Rabbit“ mit dem Theaterhaus TiG7 Mannheim in Österreich zu sehen – derzeit im Wiener Werkstätten- und Kulturhaus (WuK), demnächst im Grazer Theater am Ortweinplatz (taO!).
Gefühle – auch da klafft’s lange auseinander. Ach wozu sollen die gut sein, lehnt Ikarus (sehr überzeugend Nuri Yıldız) die ab. Macho. Frauen sind in seinem Hirn und in seinen Sprüchen nichts als Sexualobjekte. Schüchtern im Gespräch, tiefgreifend gefühlvoll in seinen aufgenommenen Gedichten hingegen Francis (voll glaubhaft Jonas Werling). Und dann taucht Jasmin auf. In die verknallt sich Ikarus – und wird sanfter. Zunächst nur vorübergehend. Dauerhaft will – oder kann – er noch nicht von seinem schon eingeschliffenen Männlichkeitswahn lassen. Als er droht, allein in der Reha-Klinik zurückzubleiben, bereut er kurz, will alles gut machen, nochmals von vorn anfangen, um wieder und nochmals ins alte Fahrwasser zu kippen, bis … – schau und erlebe dieses Stück selbst mit!


Reich trifft Arm. Zwei Kinder, jeweils Angehörige zweier voneinander getrennter Welten treffen aufeinander. Beginnen ihre anfänglichen Vorurteile zu überwinden, werden am Ende sogar dickste Freund:innen oder mehr? Nach abenteuerlichen Missverständnissen Happy End. Das ist wohl kürzest zusammengefasst „Pünktchen und Anton“ von Erich Kästner.
Zum Glück eher von der jüngsten (auch schon mehr als 20 Jahre alten, der dritten) filmischen Adaption (1999, Regie: Caroline Linke) als vom Buch selbst – mit doch sehr überkommenen Frauen- und Männerrollen – ausgehend (Fassung von Nicole Claudia Weber und Sarah Caliciotti), erzählt ein äußerst spielfreudiges Ensemble derzeit im Wiener Renaissancetheater (dem größeren der beiden Häuser des Theaters der Jugend) in knapp zwei Stunden (eine Pause) diese Story. Da ist zum einen die fantasievolle Luise Pogge, genannt Pünktchen (mit Pippi-Langstrumpf-Anwandlungen: Katharina Stadtmann), und zum anderen der sozial kompetente, aufopfernde Anton Gast (überzeugend: Jonas Graber).

Er jobbt als Rieseneis verkleidet, um Rechnungen seiner schwerkranken Mutter (Claudia Waldherr), die deswegen nicht arbeiten kann, zu bezahlen, organisiert weggeworfene Lebensmittel aus dem Mistkübel, kümmert sich liebevoll um seine Mutter. Sie, aus urreichem Haushalt, leidet darunter, dass ihre fast ständig abwesenden Eltern – Mutter Anwältin und Charity-Organisatorin – „wenn Kameras dabei sind“ – (Ursula Anna Baumgartner), Vater renommierter, weltweit tourender Dirigent (Frank Engelhardt) – ihr nicht einmal dann zuhören, wenn sie selten zu Hause sind. Und jedes Versprechen, hin und wieder Zeit miteinander zu verbringen, prompt brechen.
Antons Initiative, selber eigenes Geld zu verdienen, animiert Pünktchen, die immer wieder neue Wörter erfindet, maskiert auf der Straße altes Spielzeug von ihr Flohmarkt-artig zu verkaufen. Sie bewundert Anton um sein Engagement und beneidet ihn um sein liebevolles Verhältnis zu seiner Mutter (was bei Kästner ja von deren Seite nicht so unbedingt der Fall ist).

Natürlich kann nicht alles glatt gehen. Da hat sich schon der Dichter ein paar abenteuerliche Wendungen einfallen lassen: Das Kindermädchen – dort noch Andacht, hier namens Ines (Shirina Granmayeh), fast so abwesend wie Pünktchens Eltern selber – verliebt sich in Robert (Haris Ademović), den Eiswagen-Betreiber bei dem Anton arbeitet. Robert pumpt Ines ständig um Geld an; er ist einem zwielichtigen, irgendwie mafiösem Geldgeber die Kohle für sein Gewerbe schuldig. Und kommt auf die Idee, sich im ur-reichen Haushalt zu bedienen…

Bevor noch die Polizei eintrifft, haben Anton und vor allem die boxende Köchin Bertha (Petra Strasser) den Einbrecher erledigt. Letztere mit der – aus vielen Filmen bekannten uralten Bratpfanne, die – ein Stilbruch -, so gar nicht in diesen noblen, hypermodernen Haushalt passt 😉 Die dreh- und wandelbare Bühne (Daniel Sommergruber; Kostüme: Nina Holzapfel) ist ansonsten sehr stilsicher: Riesengroßes Speisezimmer der Pogges, klein, gedrängt, aber doch irgendwie herzlicher die Küche = Aufenthaltsraum der Gasts.

Den bei Kästner noch eindeutig nur bösen Gottfried Klepperbein gibt der oft im Theater der Jugend auch Hauptrollen ausfüllende Stefan Rosenthal differenzierter. Böse sein wollen und doch auch irgendwie arm dran – und immer wieder für Situationskomik gut. Keinesfalls vergessen werden darf auf den wandelbaren Uwe Achilles, der sowohl den strengen Lehrer Bremser als auch den mafiösen Drago und den eher patscherten Polizisten spielt.

Ein wenig zu kurz fallen die Flohmarkt-Szenen Pünktchens aus – mit sehr skurrilen Passant:innen, in die – mit Ausnahme der beiden Darsteller:innen von Pünktchen und Anton – alle anderen Schauspieler:innen schlüpfen. Klar, ist nur eine kleine Episode, aber von diesen fast karikaturhaften Figuren würd’s ein paar Minuten mehr vertragen. Dafür vielleicht ein wenig weniger vom Kampf mit dem Einbrecher, der so heftig ausfüllt, dass bei der Premiere einige jüngere Kinder lauthals weinen mussten.

Auch wenn „Pünktchen und Anton“ eine noch dazu doch schwarz-weiß-gezeichnete Arm-Reich-Geschichte ist – emotional vernachlässigte Reiche, herzlich warme arme Familie – wird in vielen Szenen konkrete Auswirkung von Armut immer wieder angespielt. Nicht zuletzt die -Beschämung. Und das krasse Missverhältnis zwischen arm und reich. Im Programmheft ergänzt das Theater der Jugend auch die Fakten: Jedes fünfte Kind ist im reichen Österreich von Armut betroffen bzw. stark bedroht. Und Österreich gehört zu einem der ganz wenigen Länder, die noch immer nicht den eigenen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von Kinderarmut im Rahmen der Europäischen Kindergarantie erstellt haben.

Eine Kategorie der Exil-Literaturpreise „Schreiben zwischen den Kulturen“ ist Texten aus Schulprojekten gewidmet. In diesem Jahr ging er an sieben Schülerinnen der Wortwerkstatt im privaten Wiener Gymnasium St. Ursula (23. Bezirk, Liesing). Lehrerin Johanna Schmidt, die diese kreativen Schreib-Workshops leitet, gab als Thema vor „Ich bin…“
Sieben Schülerinnen (ca. 15 bis 18 Jahre) – in diesem Jahr gab es ausschließlich Mädchen und Frauen, die gewonnen haben – dachten sich ungefähr Gleichaltrige in verschiedensten Gegenden der Welt aus: Vancouver (West-Kanada), Regenwald in Brasilien, Grönland, Insel Elba (Italien), Teheran (Iran), Indien und Sydney (Australien).
Die Bandbreite der Texte reicht vom Leben einer Jugendlichen in einem indischen Slum über den Widerstand gegen das Fällen von Bäumen im Regenwald, die ständige Angst als Protestierende in der iranischen Hauptstadt Teheran bis zur Verbundenheit mit dem Element (Meer-)Wasser, der Sehnsucht aus der Abgeschiedenheit einer kleinen grönländischen Siedlung die große, weite Welt kennenzulernen bis zum überprivilegierten Leben als Kind superreicher Eltern in Sydney (als bewusste Ausnahme). In der Geschichte aus dem kanadischen Vancouver – in einer viel zu engen Wohngemeinschaft – findet sich ein Satz, der vielleicht für viele andere wo auch immer auf der Welt gilt: „mein größter Wunsch wäre, eine Person zu finden, die mir zuhört, mich ernst nimmt…“
Sechs der sieben Autorinnen kamen zur Preisverleihung ins Wiener Literaturhaus. Und stellten sich jeweils zwei Fragen von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Erstens, wie sie jeweils zum Schreiben – über das für die Schule erforderliche Ausmaß hinaus – gekommen waren; und zweitens: warum und wie sie sich für die jeweilige fiktive Person und Weltgegend entschieden haben. Die Reihenfolge entspricht nur derjenigen, in denen die Jugendlichen die Interviews gegeben haben.
Elisa Rodia (1. Klasse Oberstufe) – Delphina, 15-jährige im Amazonas-Regenwald in Brasilien
In der Schule mussten wir einmal einen Kreativtext schreiben, das war in der zweiten Klasse Unterstufe. Aber wir hatten eine Wortbegrenzung und ich wollte halt weiterschreiben. Dann hab ich diesen Text zu Hause ausgeschrieben, der hat jetzt 20 Seiten. Das hat mir Spaß gemacht und so habe ich immer mehr Texte geschrieben.
Für den Regenwald in Brasilien hab ich mich entschieden, weil ich gerne Fantasybücher lese. Regenwald hatte für mich so etwas Geheimnisvolles, Mystisches. So hab ich mir vorgestellt, als Autorin viel Freiraum zu haben.
Athina Klenk (7. Klasse) – Blake, Jugendliche in Sydney (Australien)
Zu schreiben begonnen habe ich so ungefähr mit zehn Jahren, in der ersten Klasse Gymnasium – zuerst Tagebuch und ich habe angefangen, sehr viel zu lesen. So bin ich dazu gekommen, mir eigene Geschichten mit den Figuren aus Büchern auszudenken.
Meine Lehrerin hat mich gefragt, ob ich etwas über Australien schreiben könnte. Es gab da schon sehr viele Texte, die ärmere Menschen dargestellt haben, so hab ich mir gedacht, ich schreibe etwas über sehr reiche Leute und kann dadurch ein bisschen die andere Seite beleuchten. So gesteht ihre Blake, die entspannt im Luxus lebt ihre große Ignoranz gegenüber Armut, die sie auf der Straße sieht und wie sie entsprechende Nachrichten überspringt. „In stillen Momenten kommt die Frage nach dem Wieso. Immer kehrt sie wieder, wieso haben manche so viel und manche so wenig?“
Lena Heindl (8. Klasse) – Ajala Amita Gandhi aus einem indischen Slum
Bei der Wortwerkstatt bin ich jetzt das vierte Jahr dabei. Selber hab ich mit acht Jahren angefangen mitvKurzgeschichten über Kinder und Jugendliche, wo sich Freunde und Freundinnen treffen und gemeinsam etwas unternehmen. Über die Zeit hinweg hat es sich dann entwickelt zu Liebesgeschichten. Aber ich hab auch über tiefere, ernstere Themen geschrieben.
Wettbewerbe haben mir Inspiration gegeben, aber ich hab auch immer wieder aus dem Privatleben Anregungen bekommen, mich dann hingesetzt und geschrieben.
Wir haben im Geografieunterricht schon vor Jahren über das Leben in Slums geredet. Das fand ich immer schockierend, dass das Leben in anderen Orten so komplett anders ist als ich es hier kenne. Als wir das Thema bekommen haben, sich in andere hineinzuversetzen, hab ich mich daran erinnert und wollte darüber schreiben. Um sich auch als eine reichere Person vorzustellen, wie schwierig das Leben für andere Menschen ist.
Rosa Klanatsky (6. Klasse) – Zahra Asadi (was übrigens Freiheit heißt), 15-Jährige in Teheran (Iran)
Begonnen mehr als für die Schule zu schreiben hab ich als ich 12 Jahre war. Angefangen hab ich mit Tagebüchern und bin dann zu Kurzgeschichten übergegangen.
Die Protestbewegung im Iran war oft in den Nachrichten, so bin ich draufgekommen, dass das ein interessantes Thema sein könnte. Ich wollte, dass auch mehr Menschen darüber erfahren.
Auf die Nachfrage, ob sie Menschen gesucht habe, die aus dem Iran gekommen sind, meinte die Mit-Preisträgerin: Ich hab mir ein paar Videos und Nachrichten angeschaut. Und dann versucht, mich hineinzuversetzen.
Elsa Mayr (1. Oberstufe) – Felicia auf der italienischen Insel Elba
Ich war so drei, vier Jahre alt, da hab ich angefangen, meiner Mutter Geschichten zu diktieren, weil mir sehr viel eingefallen ist und mir das extrem viel Spaß gemacht hat. Sie hat alles aufgeschrieben
„Gibt’s diese Texte noch?“, will KiJuKU wissen. „Ja, das hat sie in so ein Fotobuch eingeklebt und Zeichnungen dazu gemacht.
„Haben Sie sich das später einmal angeschaut und durchgelesen?“
„Schon, aber ich kann mich auch noch so an die Geschichten erinnern.“
Für Italien habe ich mich entschieden, weil ich Wurzeln in Italien habe und weil mich einfach das Meer extrem fasziniert. Deswegen wollte ich eine Figur erfinden, die das Meer als Seele hat.
Livia Pajor (7. Klasse) –Maya (16), Vancouver (Kanada)
Schon im Volksschulalter habe ich Gedichte geschrieben. Irgendwann hab ich begonnen, Gefühle in meine Texte einzubauen und mich so ausgedrückt. Zuerst nur für mich, hin und wieder habe ich Texte dann einem engeren Kreis um mich herum gezeigt, aber nie bewusst für Wettbewerbe oder so. Das hat erst mit der Wortwerkstatt begonnen.
Ich habe einen großen Teil meiner Familie in Kanada und fühl mich mit dem Land ziemlich verbunden und wollte mal darüber schreiben.
Weitere Beiträge zu den Exil-Literaturpreisen 2023 folgen
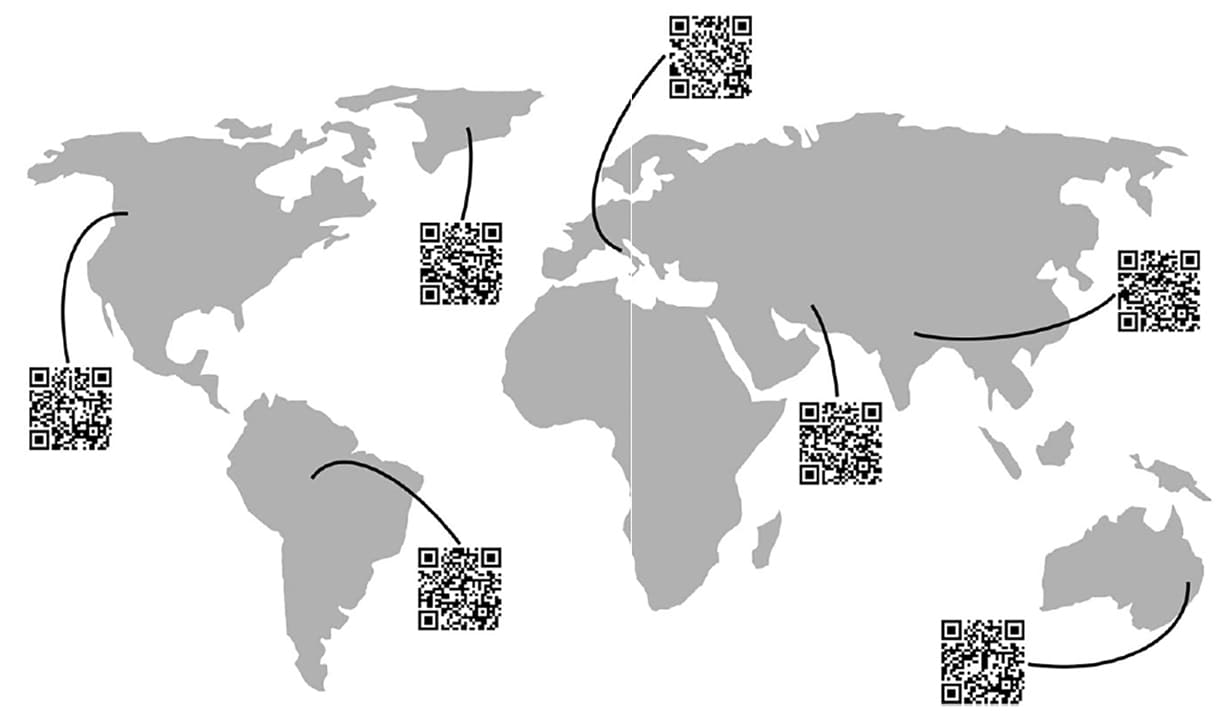
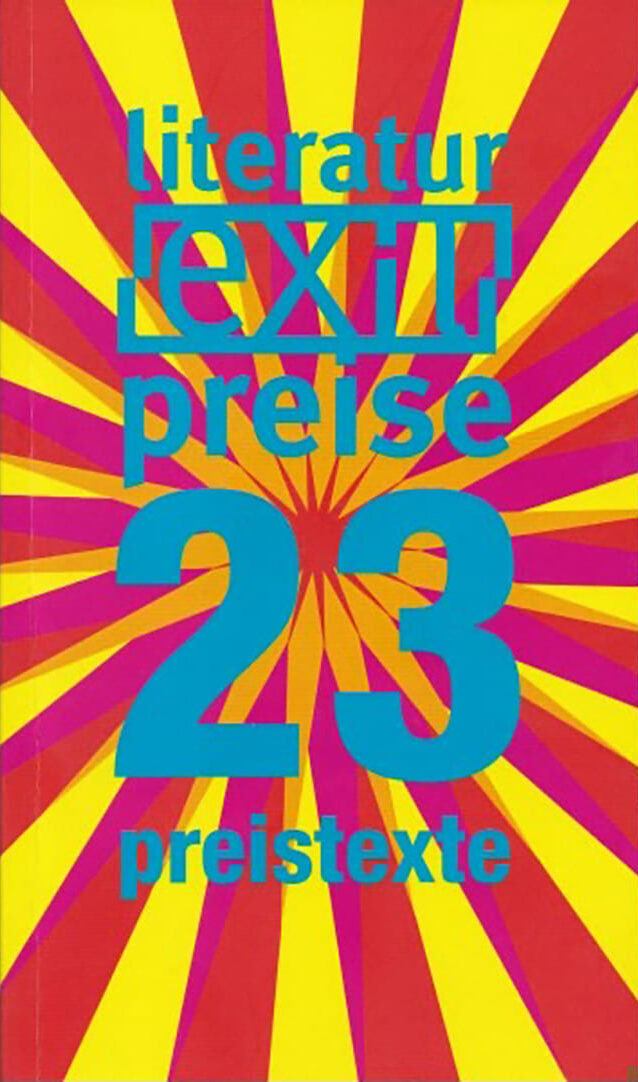
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen