
Ein Wald voller weißer, eleganter Kleider. Die meisten hängen in unterschiedlicher Höhe von der Decke, eines auf einem umgedrehten schwarzen Schirm, ein anderes scheint zu stehen. Auf dem Boden liegen viele Äpfel. In einem eingezäunten Geviert warten mehrere Dutzend kleinwunzige und große Kreisel darauf, von den Besucher:innen der interaktiven Ausstellung „Was ist, was war, was wäre“ in Schwung gesetzt zu werden. Mit den Drehungen ertönen auch unterschiedliche Klänge.
An anderen Stellen, meist neben oder unter einem der Kleider können die Gäst:innen zeichnen, Türme bauen, sich mit Pappteller-GesichtsMasken in unterschiedlichsten Stimmungen durchschauen und vieles mehr. Die Aktions-Stationen sind jeweils mit Fragen rund um Theater verknüpft: „Sollte Theater verführen? Oder soll es ärgern, provozieren, verwirren?“
Die interaktive Ausstellung war Teil des Theaterfestivals für junges Publikum in Linz (Schäxpir, Ausgabe 13) – im „Sonnenstein-Loft“ nahe dem Ars Electronica Center.
„Ist das Theater ein Haus, wo wir träumen dürfen? Können wir im Theater Ideen und Wünsche fliegen lassen? Kann das Theater ein Haus sein wo mehrere Realitäten in Zeit und Raum schweben können?“ Und dazu die Bitte: „Nimm ein farbiges Papier. Schenk uns einen Wunsch fürs Theater oder für die Welt.“
Mit dem Attribut „magisch“ fürs Theater liegen Papier und Pinsel bereit, dazu Schälchen „nur“ mit Wasser – malst du Bilder, verflüchtigen die sich rasch – wie mitunter Figuren und Szenen auf der Bühne. Die vielleicht dennoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Möglicherweise auch dein Wasser-ohne-Farben-Bild 😉
Nachdem das Leben nicht nur Sonnenseiten zu bieten hat, spielen sich auf Bühnen natürlich auch traurige Geschichten oder zumindest Szenen ab. Abschieden ist eine weitere Station gewidmet. Aus schwarz beschichteten Blättern kannst du Gedanken an Personen oder Situationen, von denen du dich verabschieden musstest, kratzen – und an Metallboxen mit elektrischen Kerzerln wie an Grabsteinen befestigen.
Auf alten Schreibmaschinen kannst du ein kurzes Theaterstück oder eine Szene verfassen, auf einer anderen einen Brief an eine Freundin oder einen Freund… oder was auch immer 😉
Schwarz sind übrigens auch die Seiten eines Tabu-Buches – denn auch für solche ist am Theater Platz. Und das sind noch nicht alle der 14 Stationen, die die langjährige Theaterautorin und -Regisseurin sowie -leiterin Hanneke Paauwe (aus den Niederlanden, die derzeit in Brüssel lebt) nach Linz mitgebracht hat. Noch einige mehr hatte sie für das Vorstadttheater Basel (Schweiz) anlässlich dessen Umzugs in eine neues Haus kreiiert.
Das Magische, Märchenhafte wollte sie mit Fragen an die Besucher:innen verknüpfen, sie zu deren eigenen Gedanken – im Kopf und mit Händen malend, schreibend, bauend, spielend – einladen. Auf die Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, weshalb „nur“ weiße, wenngleich verschieden geschnittene Kleider, die an Hochzeitsgarderobe erinnern und nicht wie im Theater bunte, vielfältige Kostüme, meinte die Theaterliebhaberin: „Mit Hochzeitskleidern taucht als erstes die Assoziation an Liebe auf, außerdem hatte ich das Bild eines Birkenwaldes im Kopf und sie strahlen – auch mit den Äpfeln – etwas Märchenhaftes aus. Und wo darfst oder sollst du sogar einmal auf einem weißen Kleid schreiben?“
Mit den vielen Fragen an und rund um das Theater, den Kleidern auf unterschiedlicher Höhe, den vielen verschiedenen Interaktionen ergeben sich allein schon durch Wechsel vom Gehen und Stehen ins Hockerln, Knien, Sitzen immer wieder Perspektivenwechsel.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Einst ein Supermarkt in einem großen Eckhaus, wenige Gehminuten vom Bahnhof Neulengbach Stadt (eine halbe Zugstunde von Hütteldorf in Richtung St. Pölten) entfernt. Danach lange leergestanden, heute „Herberge“ für Gemälde, Skulpturen, Installationen und in einer nur halb abgedeckten Ecke wenige Schritte vom Eingang entfernt für Theater, Konzerte und andere Kulturveranstaltungen. Der Name ist sozusagen gleich Programm: Pop Up Kunstfreiraum Stachel.
Das Eckhaus mit großen Glasfronten versprüht den Charme vieler abgefuckter Hütten, die immer wieder in allen Ecken und Enden der Welt durch Kultur neues Leben eingehaucht bekommen. Die Ausstellungen laufen unter dem Motto: Kunst ist DADA.
Dort verfolgte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… eine Aufführung von „Therese“, einer vom Ensemble 21 dramatisierten Fassung mit Live-Musik von Arthur Schnitzlers gleichnamigem Roman, am 11. Juni 2025 im südoststeirischen Straden in der Reihe ARTigKLASSISCH – Stückbesprechung und Termin-Details (auch weiterer Aufführungen) in einem eigenen Beitrag – Link am Ende dieses Artikels.
Bilder, die an die Epoche des phantastischen Realismus erinnern, finden sich großen im Ausstellungsraum ebenso wie Skulpturen mit augenscheinlich (gesellschafts-)politischem Inhalt, etwa einer Art Diktatoren-Ecke mit dem nordkoreanischen Atomraketen-Liebhaber Kim Jong-un, Waldimir Putin als „Energie-Junkie“ mit einer Hand am Abzug des Ölkanister-Hahns, dem US-Präsidenten Trump, der alle überragen will und nicht weit von den Genannten entfernt ein Kopf, dem Würmer daraus wachsen („Entwurmung eines Politikers“).
Bei Abgang zum Klo im Stiegenhaus ein riesiger Fisch – gebaut als Plastikmüll. Vor allem Getränkeflaschen wurden von Gerhard Malecik, der gemeinsam mit Erich Heyduck Ausstellung und den Kunstraum konzipiert, zu einer Reihe von Kunstobjekten upgecycelt.
Stachel hat sich auch ein Manifest geschrieben: „Wir stehen auf dem fruchtbaren Boden der Veränderungen – Die Freiheit der Kunst – der Kunst ihre Freiheit.
Unser Zusammenschluss erfolgt aus der Gleichheit menschlicher und künstlerischer Gesinnung. Wir betrachten es als unsere Pflicht, dem humanitären und kulturellen Aufbau eines freien und vielfältigen Europas, unsere besten Kräfte zu widmen.
Wir plädieren für die Freiheit der Künste in all ihren Ausdrucksformen und unterstützen diese mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln… (auf der in der Infobox verlinkten Website ist das Manifest in voller – nicht allzu langer – Version zu lesen.)

Die Wände hängen voller Bilder unterschiedlichster Art – von fast fotorealistischen bis zu künstlerisch gestalteten Selbstporträts bis zu Malereien in unterschiedlichsten Stilen. Mitten im erdig-urig wirkenden Projektraum des Wiener Kulturzentrums WuK (Werkstätten-und Kulturhaus) stehen auch noch Tische mit dreidimensionalen Kunstwerken. Darüber hinaus hängt eine Gitterwand voller kreativer Teil- und Ganzgesichtsmasken. Schöpferinnen und Schöpfer der vielen künstlerischen Arbeiten sind 361 Schüler:innen des Kunstschwerpunkts im Gymnasium Boerhaavegasse (Wien-Landstraße; 3. Bezirk).

Die Ausstellung lief leider nur an zwei Tagen – und musste gestaffelt eröffnet werden, da der Raum nicht mehr als 160 Menschen fasst. Da Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nicht für all die Vernissagen Zeit hatte – an diesen Tagen lief auch das Theaterclubfestival im Vestibül des Burgtheaters mit vier verschiedenen Performances – vereinbarte eine der federführenden und organisierenden Lehrer:innen – eine kleine Interviewrunde aus den ersten und zweiten Klassen vor deren feierlicher Ausstellungs-Eröffnung.
Zoe, Pola und Manes präsentierten ihre drei Masken samt den Gedanken für genau diese Arbeiten, Tamina, Ana und Pauline ihre Plastilin-Monster vor Mini-Staffeleien mit selbst gemalten Bildern.
Zoe bot an, ihre rosafarbene Halbmaske auch aufzusetzen. „Die habe ich aus Karton gemacht – die Maske war schon fertig, aber ich hab die Ohren und aus einer kleinen Schachtel die Nase dazu gebastelt und die Masche mit den vielen kleinen weißen Perlen“, berichtet sie dem Journalisten. „Die Maske soll ein Schwein darstellen. Ich mag Schweine, weil ich die einfach süüüß finde!“
Von einem anderen Tier – und auch das ebenfalls nicht in echt, sondern aus Filmen, Dokus und so weiter – ließ sich Pola zu ihrem Werk inspirieren, von einer Giraffe. Zur Form der Ganzgesichtsmaske bin ich gekommen, weil ich Zeitungspapier auf einen Ballon geklebt habe, der dann als diese verklebten Papierschichten getrocknet waren aufgestochen und rausgeschnitten worden ist.“ Für die zapfenartigen Hörner „habe ich den Karton aus dem Inneren von Toilettenpapier verwendet.“
Die Maske von Manes erinnert aufs erste auch an ein Tier, einen Elefanten. Das aber war nicht das Vorbild ihres Schöpfers. „Das ist ein Teufelsding“, erklärt der – wie seine zuvor erwähnten Kolleginnen, Schüler der ersten Klasse. „Ich war bevor wir diese Arbeit gemacht haben in den Ferien am Grundlsee, dort gibt es viel Teufelsmasken. So eine wollte ich auch machen.“ Was vielleicht auf den ersten Blick wie eine Art Rüssel wirkt, „sollte so eine Art Schnabelmaske wie bei den Pestärzten werden und die Ohren sind so groß, weil das teuflisch wirkt“.
Vom Teuflischen ist es vielleicht nicht so weit zu Monstern 😉 Und so kommen wir nun zur Präsentation der drei schon genannten jungen Künstlerinnen, die aus der Modelliermasse unterschiedliche Monster – das war die Vorgabe der Lehrperson – geformt haben. Diese sollten jeweils in Bezug gesetzt oder gestellt werden zu einer Malerei auf einer Mini-Staffelei (ungefähr Din A7).
Für ihre gelbe, runde Figur mit einer Art grüner Krone nahm Tamina Anleihe bei einer Ananas. „Ich wollte was mit Früchten und Gemüse machen und weil ich Ananas mag, schaut mein Monster so aus! Auf die Staffelei hab ich einen kleinen Apfel gesetzt und gemalt hab ich eine Katze, weil ich sie gern hab und selber welche zu Hause habe.“ Übrigens ist ihre „Monster“-Ananas auch die mögliche Malerin des Bildes 😉 Immerhin hat sie an ihren Fuß eine Mal-Palette und in einer Hand einen Pinsel.
Pauline schuf gleich zwei Monster – und damit auch zwei Staffeleien. Für beide standen die jeweiligen Farben Pate. So malte die Schülerin auf der einen kleinen Leinwand eine große Kerze, deren Flamme kräftig orangefarben leuchtet – entsprechend auch ihr fast kugelrundes Monster mit grauem Hut. Auf dem zweiten Bild schwimmen zwei Schwäne, am Rande des Teiches ist viel Grün zu sehen. Das dazugehörige Monster ist durchgängig grün – mit einer deutlich roten, filigranen Zunge im weit geöffneten Mund. „Da wollte ich auch einen Gegensatz oder Widerspruch darstellen. Schwäne sind ja eher leise, das Bild wirkt auch ruhig und das Monster sollte dagegen sehr laut sein!“
Die 12jährige, dreisprachige Ana – Rumänisch, Französisch, Deutsch – hält ein einäugiges Monster auf ihrer Hand in die Kamera und setzt es danach wieder an eine der Tischkanten. Danach holt sie ihre Staffelei, die sie nicht bemalt, sondern beklebt hat – mit einem grauen Klebeband ist hier nun eine aus Modelliermasse geformte Banane. Eine solche kam übrigens diese Woche auch im Bericht über das Theaterstück „Umami“ der Kompanie Freispiel im Dschungel vor. Und auch hier war natürlich die Inspiration das Kunstwerk von Maurizio Cattelan, der eine echte Banane mit festem Klebeband an einer Wand einer Ausstellung fixierte, die im November des Vorjahres dann um rund sechs Millionen Euro versteigert – und vom Käufer einfach aufgegessen wurde.
Apropos Essen: Schüler:innen der 7. Klassen hatten im Ausstellungsraum ein „Kunstbuffet“ organisiert, das am nächsten Tag von Lehrer:innen betreut wurde. Die Kostproben: Kunstwerke im Postkartenformat.

Sieben – die Zahl um die sich viele Mythen in verschiedensten Gegenden der Welt ranken, mal für Glück, andernorts für Unglück stehen, ist sehr oft auch mit der biblischen Geschichte um die Entstehung der Welt verknüpft. Linda Wolfsgruber, die vielfach ausgezeichneten Kinderbuch-Illustratorin und -Autorin, hatte vor zwölf – auch so eine mythische Zahl 😉 – Jahren schon die Idee zu einem derartigen Buch. In der Pandemie holte sie die Skizzen aus einer Lade und daraus wurde sieben mal sieben: Sieben Blätter für jeden der sieben Tage.
Die Originale dieser 49 Seiten, dazu die der Vorsatzseiten sowie des Buchcovers hängen seit einigen Tagen in einer Ausstellung im Kardinal-König-Haus (Wien-Hietzing).
Zur Eröffnung hatten die Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur (STUBE) sowie die Verlage Tyrolia, Jungbrunnen, Obelisk, NordSüd, Ueberreuter, edition lex liszt und Bibliothek der Provinz geladen. In all diesen hat neben Linda Wolfgsruber auch Heinz Janisch unzählige Bücher veröffentlicht. Er wurde im Vorjahr mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis ausgezeichnet, der informell als der „Nobelpreis“ der Kinderliteratur gilt.
Heidi Lexe, Leiterin der Stube und u.a. Lehrbeauftragte für Kinder- und Jugendliteratur am Germanistik-Institut der Uni Wien, sprach mit beiden über viele der Bücher und deren Entstehungsgeschichte bzw. über die Zusammenarbeit der beiden sowie die mit vielen anderen Kinder- und Jugendbuchmacher:innen.

Du näherst dich einem unscheinbar wirkenden an der Wand hängenden querformatigen Rechteck. Es scheint wie ein Mosaik aus kleinen runden Scheiben. Nur fast schwarz. Kaum kommst du näher, raschelt es irgendwie, vile der kleinen Spiegelchen drehen sich, ergeben ein Bild. Du staunst, irgendwie kommen dir – vielleicht erst im zweiten Hinsehen die Konturen und die Form nicht unbekannt vor.
Was hier in der Folge für ein paar Sekunden als Standbild erhalten bleibt ist eine Art „Foto“ von dir in bunt schillernden „Flip-Discs“. Sobald du das ge-checkt hast, beginnst du vielleicht damit zu spielen – näherst dich in verschiedenen Posen, von unterschiedlichen Richtungen diesem Teil an. Es ist das erste Objekt in der Ausstellung „Khroma“ in einem Keller in einem Hinterhaus in Wien-Neubau.
Verspielte New-Media bzw. digitale, teils interaktive Kunstwerke, sind in unterschiedlichster Form seit Jahrzehnten in Linz im berühmten Ars Electronica Center zu sehen und erleben, in Wien eher noch selten und diesfalls fast ein bissl versteckt.

Die Ausstellung „Khroma“ (Russische und Griechisch für Farbe) mit ihren 13 Kunstwerken, kuratiert von Vasily Fedotov, Gründer und Leiter des New Media Art Centers und des Lighthouse of Digital Art in Berlin, war zuvor schon in der deutschen Hauptstadt zu sehen. Davor hatte er marketingmäßig Star-Ups in Sachen digitaler Strategien beraten. Und verlegte sich, wie er am Rande einer Führung für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erzählt, „immer mehr auf den künstlerischen Bereich von digitalen Medien, Künstliche Intelligenz und virtual Reality.
Das eingangs geschilderte Kunstwerk mit dem Titel „Portraits in Pink, Blue, & Silver“ stammt von Andrew Zolty alias Breakfast Studios aus New York. Er hat sich darauf spezialisiert, Echtzeitdaten aus der natürlichen Welt in digitale, kinetische Kunstwerke zu „übersetzen“. Im Laufe der bisherigen rund eineinhalb Jahrzehnte dauernden künstlerischen Arbeit waren Werke von ihm schon bei der Weltausstellung 2021 in Dubai und im Vorjahr bei der Biennale in Venedig zu erleben.
Fast am Ende der Kellerräume entsteht beim Näherkommen an die bunt leuchtende Wand ein an das erste Werk erinnernder Eindruck. Irgendwie fühlst du dich hier noch bunter und größer, besser erkennbar, zu sehen. „Enter“ heißt diese interaktive Lichtinstallation des polnischen Künstlers Ksawery Kirklewski. Wenn die Technik funktioniert, dann soll sogar Sound dazu ertönen (was beim Besuch von KiJuKU nicht der Fall war). Diese interaktive digitale „Spielerei“ ist aber neben der künstlerischen auch eine Forschungsarbeit in Sachen Computer-Steuerung ohne Maus und Tastatur „nur“ mit Gesten.
Kirklewski hat zuletzt unter anderem für den US-Schauspieler, Comedian und Musiker Donald Glover alias Childish Gambino für seine Auftritte digitale Bühnenbilder geschaffen.
Fantasievolle Fische und Quallen kannst du dir in verschiedensten Größen und Farben per Knopfdruck beim digitalen Kunstwerk Aquatics von Philipp Artus auf den Riiiiiesen-Screen „zaubern“. So „nebenbei“ will der multimediale Künstler (u.a. auch Filmemacher) mit dieser Installation auch sanft einladen über Natur und Technik zu sinnieren.
Ein goldglänzender Totenkopf am Ende des oberen Teils einer Sanduhr „spuckt“ schwarze Tropfen in den unteren Teil dieser Uralt-Zeitmessung. „Killing Time“ nannte der Künstler Mesplés aus Los Angeles diese interaktive Skulptur. Da die Zähflüssigkeit mit Metallspänen versetzt ist, führt der Unterteil der Sanduhr das verblüffende nach oben „Spucken“ – dank eines Magneten im Mund des Totenkopfes.
Diese und noch neun weitere, verschiedenartige digitale Medien-Kunstprojekte laden zum verspielten Staunen und– nicht bei allen – zur Interaktion ein. Was allerdings so „nebenbei“ auffällt, die Auswahl fiel offenbar ausschließlich auf von Männern programmierte Werke.

„Wir lachen auch sehr gern über uns selber“, sagte die in Österreich wohl bekannteste Austro-Tschetschenin Maynat Kurbanova unter anderem im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Stimm*Raum“ Freitagabend (1. März 2024) im IFP (Institut für Freizeitpädagogik) von wienXtra).
Über Sprache, den mehrmaligen Wechsel der Schrift von Kyrillisch auf Lateinisch und wieder retour, die Zurückdrängung der Landessprache zugunsten der Amtssprache Russisch, was zur Folge hat, dass Tschetschenisch mittlerweile zu den vom Aussterben bedrohten Sprachen wurde, Bräuche, Witze und natürlich auch Folgen der zwei Kriege Russlands gegen das unabhängig gewordene Land, Flucht, Diaspora, Pendeln zwischen den Kulturen, Gemeinsamkeiten mit Österreich ebenso wie viele Unterschiede auch unter den hier lebenden Tschetschen:innen … gibt es mehrere Kartontafeln einer Ausstellung.
„Stimm*Raum“ lautet der Titel. Unter diesem laufen seit mehreren Jahren Kulturprojekte mit Jugendlichen. In Schreibwerkstätten verfassten junge tschetschenische Österreicher:innen oder österreichische Tschetschen:innen literarische Texte. Gemeinsam mit künstlerischen Fotos entstand daraus ein zweisprachiges Buch (Deutsch und Tschetschenisch – in kyrillischer Schrift). Im Vorjahr erarbeiteten Jugendliche ein gemeinsames Theaterstück und in diesem Jahr haben sie begonnen, an einem Film zu arbeiten.
Maynat Kurbanova leitete Schreibworkshops, drei der jungen Teilnehmer:innen – Rayana Cany, Sara und Fariza Bisaeva – lasen vor der offiziellen Ausstellungseröffnung Auszüge aus den jugendlichen literarischen Texten aus dem erwähnten Buch. Fariza Bisaeva las einen neuen Text – der in Band 2 erscheinen wird – und sich mit dem Leben in Österreich beschäftigt, das ihr die schönsten ebenso wie die schmerzhaftesten Momente beschert hat

Zwei kurze Text-Auszüge hat sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die schriftliche Veröffentlichung hier zur Verfügung gestellt: „Ich bin österreichische Tschetschenin. Also tschetschenische Österreicherin. Ich meine Österreicherin mit tschetschenischen Wurzeln. Oder doch muslimisch-tschetschenische Wienerin?…
… Gleichzeitig ein Land (Tschetschenien, Anm. d. Red.), das du Österreich, zu oft mit paar Schlagzeilen abtust, dessen Leid du nach Gebrauch instrumentalisierst, dessen Komplexität du zu selten würdigst. Und Stück für Stück, mit jedem Mal, indem du das machst, bricht mein Vertrauen in dich…“
Ein bisschen mehr ist Fariza Bisaeva im Originalton in dem am Ende des Beitrages verlinkten Video von der Veranstaltung zu hören und sehen. Wobei so manche dieser Gedanken, die auf ihren Erfarhungen und Erlebnissen beruhen für viele Menschen mit Wurzeln in vielen anderen Ländern ähnlich sind – konfrontiert mit Vorurteilen, nicht selten auch Rassismus.
Kurbanova würzte mit schwarzhumorigen Witzen, die dort auch im genannten Buch – siehe Info-Block – zu finden sind. Als Fun Fact nannte sie noch, dass Tschetschen:innen nicht ungern darauf hinweisen, dass der höchste Berg (Dakoh Kort) ihres kleinen Landes (1,3 Millionen Einwohner:innen, weniger als 16.000km2 (kleiner als die Steiermark) 4.493 Meter hoch ist – immerhin fast genau 700 Meter höher als Österreichs höchster Gipfel, der Großglockner (3.798 Meter).
Barkal – Danke für die Infos an die jugendlichen Autor:innen und ihre Mentorin!
Follow@kiJuKUheinz
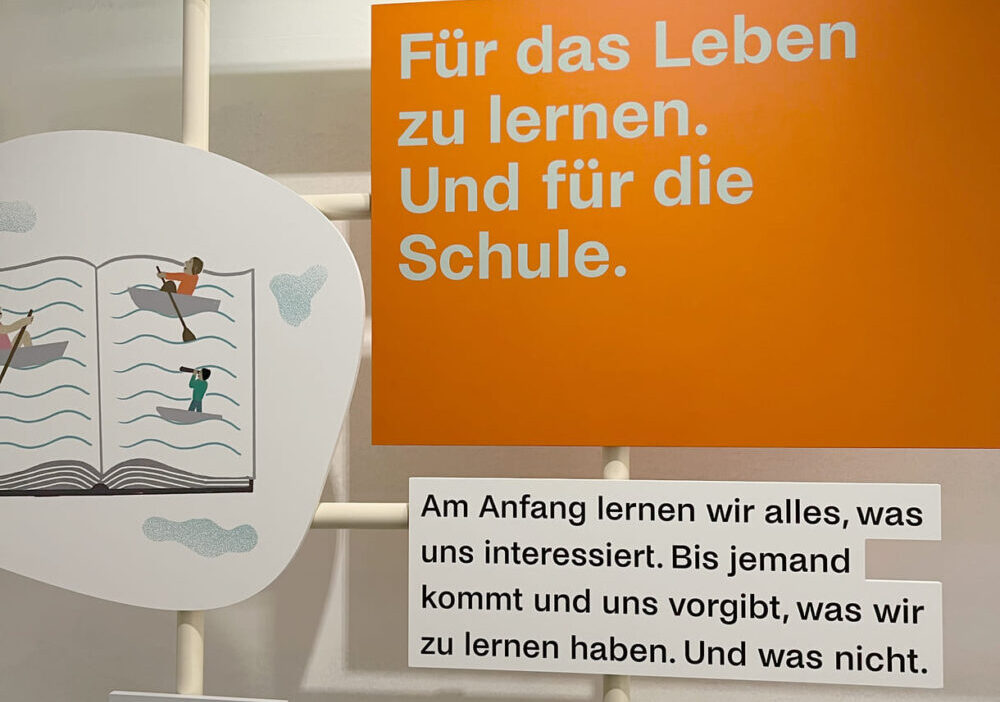
Ein riesengroßer Sessel dominiert den ersten Raum in dieser Ausstellung. Da können Erwachsene in das Gefühl eintauchen, wie es sehr jungen Kindern tagtäglich geht. Die Sitzgelegenheiten, der Tisch oder was auch immer ist für sie ähnlich hoch wie bei „Kind sein“ in der Schallaburg (Niederösterreich, bei Melk, Bahnstation – Shuttlebus). Und Kinder können sehen, dass sich da Erwachsene ganz schön schwertun würden, raufzuklettern. In den beiden Ecken des besagten Raumes stehen nachgebildete Erwachsenenbeine – für deren Oberkörper ist der Raum zu niedrig 😉
Die Herbstferien könnten vielleicht für einen Tagesausflug zu dieser Ausstellung genutzt werden, läuft sie doch nur noch bis 5. November 2023. Übrigens einige Räume weiter findet sich in der Mitte zwischen den Bildern und Objekten an oder vor den Wänden eine eigene kleine Welt, in die Kinder locker hineinkriechen oder wenn sie noch jünger sind -gehen können. Es ist praktisch ein Areal für sie allein, Erwachsene schaffen’s kaum sich da reinzuzwängen.
Eine spätere Spielstation mit mehreren Zimmern und unter anderem einer Leiter zum Raufklettern in eines davon, ist hingegen so groß, dass auch Erwachsene in den einzelnen Zimmer Platz finden. Und in einem zu ebener Erde können sich Erwachsene in kurzen Videos, die Schüler:innen aufgenommen hatten, Begriffe erklären lassen wie Beef, Bro, Cringe, Flexen, GG oder Swag…
Neben solch durchdachten spielerischen Objekten findest du verschiedene Themen – Spielzeug ist natürlich eines. Bei uraltem Spielzeug ging’s meistens darum, die Kinder an das spätere Leben als Erwachsene zu gewöhnen – bis hin zu Ritterrüstungen in Kindergrößen oder einem Jagdgewehr für die 14-jährige Erzherzogin Maria Amalia ;( Aber auch modernstes Spielzeug ist nicht nur fein, so findet sich in der Ausstellung die sprechende Puppe „My friend Cayla“. Hinter der süß lächelnden Maske findet sich im Innenleben eine elektronische Sende-Einheit, womit die Puppe zur versteckten Spionin wurde, die Kinder dauernd überwachen kann, weswegen sie auch verboten worden ist.

In thematisch gegliederten Ausstellungsbereichen kannst du noch Dinge sehen wie einen Original-Milchzahn der Kaiserin Elisabeth samt dem metallenen Behälter, in dem dieser aufbewahrt worden ist. Oder eine Kinderzeichnung aus der Römerzeit, aber auch beispielsweise – knapp vor dem Ende der Schau – die echte Tür eines Mitarbeiters der Schallaburg aus seiner Jugendzeit, in der er einen Totenkopf draufgemalt und „Eintritt lebensgefährlich“ draufgeschrieben hatte. So hat er seinen Eltern mehr als deutlich zu verstehen gegeben: Das ist meine Privatsphäre.
In einer Glasvitrine sind so manche Schummel„zettel“ aus unterschiedlichsten Epochen zu sehen, woanders eine Schulordnung – die sehr alt ausschaut und doch in so manchem an heutig Diskussionen erinnert wie Kleidungsvorschriften.
Kinder kommen in der Ausstellung – wie oben schon erwähnt bei den Erklärungen für Erwachsene – zu Wort. Einige wurden auch für den umfangreichen Katalog zur Ausstellung befragt. Der ist übrigens keine – wie oft üblich – Ansammlung von Fotos der Objekte und Bilder samt Erklärung dazu, sondern vor allem ein interessantes Werk rund um Kindheit von vielen Seiten betrachtet – unter anderem mit Texten von literarischen Autor:innen, unter anderem Julya Rabinowich, Heinz Janisch oder Cornelia Travnicek.
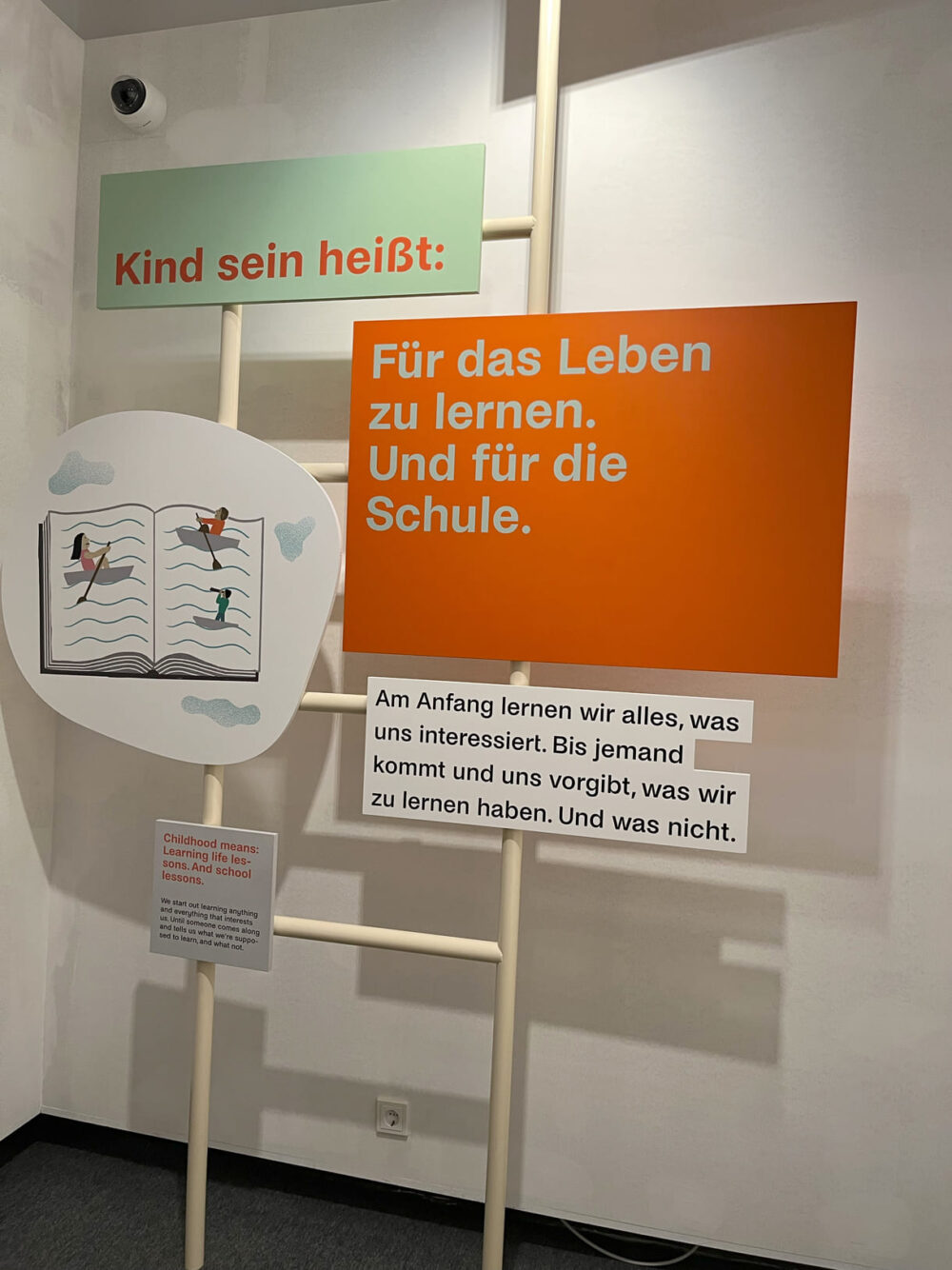
Unter dem Titel „Wir Kinder stellen viel mehr Fragen“ kommen Helene, Anna M., Clara, Emma, Valerie, Ferdinand, Isabel, Emil, Jonathan, Lukas, Ella, Anna H., Sara, Josefine, Iris, Johanna und David (zwischen 4 und 11 Jahren) zu Wort – einleitend und immer wieder in verschiedenen Kapiteln. Ein bisschen bedrückend ist, dass sie mehrfach Schule als Last empfinden – wozu die Ausstellungstafel mit folgenden Sätzen passt (oder auch davon inspiriert worden ist?): „Am Anfang lernen wir alles, was uns interessiert. Bis jemand kommt und uns vorgibt, was wir zu lernen haben. Und was nicht.“
Immer wieder sind in der Ausstellung übrigens die Kinderrechte (die nun bald 34 Jahre alt werden – am 20. November 1989 von der UNO-Generalversammlung beschlossen) ein Thema – mit so manchem „Aha“-Erlebnis für Erwachsene, etwa wenn es in einem Quizspiel unter anderem um die Privatsphäre geht. Was zu kurz kommt, sind Blicke über den Tellerrand – auf die Welt von Kindern in der ganzen Welt.

Vierundachtzig (84) – hat sich als DIE Zahl für Dystopien etabliert. Weil George Orwell seinen Roman „1984“ über einen auf totale Überwachung und schönfärberische Umbenennungen basierenden Staat 1948 fertig geschrieben hatte, verwendete er den Zahlendreher für seinen Titel. Vor knapp einem Jahrzehnt veröffentlichte Jostein Gaarder (bekannt nicht zuletzt von „Sofies Welt“) „2084 – Noras Welt“, das er in einem Interview mit dem hier schreibenden Journalisten und zwei jugendlichen Schnupperschülerinnen „nicht meine bestes, aber mein wichtigstes Buch“ nannte. Klimawandel, dystopische Vorstellungen vernichteter Natur und ein Brief aus der Zukunft an die vor zehn Jahren lebende Urenkelin Nora, um aufzurütteln – Link zu diesem Artikel am Ende dieses Beitrages.

Nun switchen wir mit „Theater Ansicht“ ins Jahr 4084 zur Performance „Coming Soon“. In den Ottakringer SoHo-Studios (Details siehe Info-Block) spielen, singen und tanzen zwei Darsteller:innen in goldenen großen „Babystramplern“ (Christoph-Lukas Hagenauer und Johanna Ludwig) und in der selben Farbe geschminkt zwischen künstlerischen Ausstellungsobjekten und Bildern von archäologischen Ausgrabungen unserer Gegenwart. In federnden Gängen und einer mit englischen Einsprengseln irgendwie vorarlbergisch gefärbten Sprache, begrüßen sie das Publikum und beziehen es in der Wanderung zwischen den Bildern und Skulpturen immer wieder mit ein.
Die Besucher:innen sind Menschen aus der mehr als 2000 Jahre zurückliegenden Vergangenheit, also der Jetztzeit. Lange tiefgefroren, eben wieder aufgetaut, sollen sie für die beiden Forscher:innen das Mysterium erklären, haben sie den Planeten zerstört (Ökozid) oder konnten sie das doch aufhalten?
Wobei dieses „Vehikel“, um auf die aktuelle umweltzerstörerische Handlung – eines Teils der Menschheit vor allem des globalen Nordens – aufmerksam zu machen, aufzurütteln, zum Handeln, um die Klimakatastrophe zu verhindern, vielleicht doch ein bisschen zu pädagogisch kommt (Konzept und Co-Regie: Julia Meinx, Flo Staffelmayr). In mehr als 2000 Jahren wird es wohl zu sehen, merken, erleben sein – was der Menschheit ge- oder misslungen sein wird. Die Anstupser zum Nachdenken sind hin und wieder aber auch ironisch verpackt.
Als dritte im Bunde schieben die beiden eine – nicht gold-gefärbte – Kollegin (Katja Herzmanek) in einem durchsichtigen Kobel – von den Theaterleuten „Mama-Mobil“ (als Gegenstück zum päpstlichen Papa-Mobil) genannt – ins Geschehen. Die aus ihrer Vitrine vor allem fast ohrwurmartige Songs liefert, die draußen aufgenommen werden und mitunter recht sarkastisch den Weg in den Weltuntergang besingen. Aus dem Ton-Regiepult im Hintergrund löst sich gegen Ende auch die Musikerin und Co-Regisseurin Julia Meinx, um mitten im Geschehen einen Song mit Gitarre zu begleiten.
Das Publikum wird immer wieder direkt angesprochen, in 1, 2 oder 3-Manier gebeten sich zu entscheiden – etwa ob die Welt an Kriegen, Krankheiten oder der Klimakrise zugrunde gehen werde. Wobei die Welt, der Planet wird so und so noch Milliarden Jahre überleben – die Frage ist nur, ob mit Menschen oder ohne – und damit einer Reihe von Tierarten, die wir, wie schon viele, mit-ausrotten.
Interview mit Jostein Gaarder – damals noch im Kinder-KURIER
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen