
Renate Welsh-Rabady hat bisher rund 90 Büchern für junge und erwachsene Leser:innen geschrieben, viele davon wurden mit preisen ausgezeichnet. Außerdem initiiert und leitet sie zahllose Schreib-Werkstätten mit Menschen aller Altersgruppen, oft an den Rand der Gesellschaft gedrängten wie beispielsweise Obdachlosen und nicht zuletzt ist sie Präsidentin der IG (Interessengemeinschaft) Autorinnen Autoren. Sie lud KiJuKU.at zum ausführlichen Gespräch in ihre Wohnung in Wien-Neubau.
KiJuKU: Zuallererst einmal, danke und Gratulation – für all deine Bücher, aber nicht zuletzt die jüngsten Bücher wie unter anderem „Ich ohne Worte“, die vielen Schreib-Werkstätten, den Film und die darin dir gegenüber selber auch schonungslose Offenheit; den Mut und die Kraft, aus dieser Sprachlosigkeit nach dem Schlaganfall dich zurückzukämpfen. Schwächen in Stärke zu verwandeln, die auch anderen Menschen Mut machen kann und wird.
Dennoch die sich aufdrängende Frage, woher nimmst du diese Kraft, was ist dein „Zaubermittel“? Ist es nicht mitunter frustrierend, wenn du – wie auch andere Autor:innen seit Jahrzehnten durch ihre Geschichten für (mehr) Mit- statt Gegeneinander, gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, für eine bessere Welt schreiben – und dann schaut sie so aus wie eben jetzt?
Wählen vielleicht sogar nicht wenige, die die „Vamperl“-Bücher gelesen haben über den kleinen Vampir, der den Menschen ihre Giftigkeit raussaugt, Parteien, die Gift und Hass verbreiten?
Renate Welsh: Es sind nicht die großen Dinge, es sind die einzelnen Menschen, die diese Energie geben. Wenn ich merke, dass jemand aus meinen Büchern Kraft holt – und ich kriege immer wieder Briefe von heute Erwachsenen, aber auch von Kindern, die mir schreiben, dass das eine oder andere meiner Bücher ihnen Mut gemacht hat oder noch immer macht.
Vor 30 Jahren hat mir ein Bub aus Athen geschrieben: „Keiner versteht, dass ich traurig bin, dass meine Katze gestorben ist. Ich glaub, Sie können mich verstehen.“ Ich hab ihm zurückgeschrieben und seither schreiben wir einander immer wieder.
Das ist für mich die Bestätigung, dass das Zuhören, das aufmerksame Lesen von Briefen, Nachrichten… an das ich unbedingt glaube, funktioniert. Nicht, dass ich glaub, dass es so wichtig ist, was ich sage oder schreibe, dass dies eine Art Knöpferl bewegt und alles ist gut. Aber, solche Reaktionen zeigen mir, dass die eine oder der andere beim Lesen der Geschichten auf was Eigenes draufkommt.
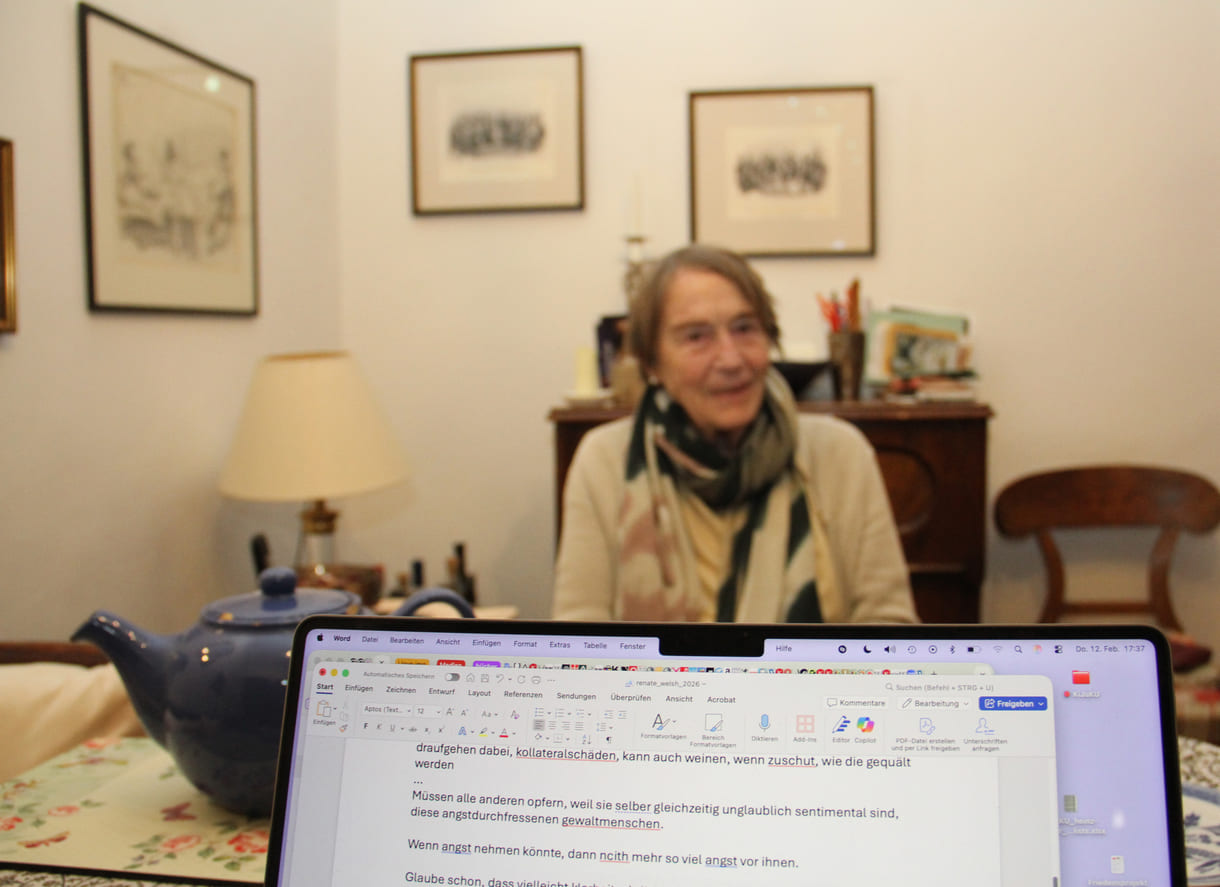
KiJuKU: Wie der Bub, den du auch im Film zitierst, der dir geschrieben hat, dass er gar nicht gewusst hat, dass Nachdenken so viel Spaß machen kann. Und dass er nach dem Lesen eines deiner Bücher dieses jetzt öfter tun werde…
Renate Welsh: Genau, das war übrigens ein wunderbarer Brief in einer herrlichen Orthografie, dass ich drei Mal lesen musste, bis ich gewusst hab, was er meint 😉
Oder der Bub, der meine Geschichten mag, „weil in ihnen auch Platz für mich ist“. Das alles sind immer wieder Bestätigungen, die wir als Schriftstellerinnen und Schriftsteller so dringend brauchen, um nicht im echolosen Raum zu schreiben.
Wenn du nicht weißt, wo du das letzte Zipferl von Hoffnung heranziehst, du trotz alledem dranbleiben kannst, dann hilft die bloße Tatsache, dass dir immer wieder Menschen das Gefühl geben, dass sie froh sind, dass man einen Augenblick zweistimmig gedacht hat.
Oder dass die eine oder der andere durch einen deiner Text auf die Idee kommt, dass es vielleicht doch eine bessere Idee ist, selber zu denken. Das ist ein, nein DER Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaub, nein bin fest davon überzeugt, dass die kleinen Schritte, die einzige Chance sind, die wir haben.
Die großen Entwürfe sind ja leider letztlich alle schief gelaufen, ob es das Heil im Osten, Modelle wie China waren, von denen viele meinten, sie würden die Welt retten – ich erinnere mich, wie wir mit roten Wangen „Arzt in China“ (J. S. Horn, 1972) gelesen haben -; letztlich haben die alle mit Denkverboten geendet.
KiJuKU: Es gibt ja nicht „nur“ die Reaktionen auf deine Bücher bzw. die Lesereisen mit direktem Kontakt zu Leser:innen, sondern vor allem die dir sehr wichtigen Schreib-Werkstätten, wo es noch viel intensivere Begegnungen gibt, wo du Räume für Gedanken öffnest, bei Menschen, die sich solches vorher oft gar nicht zugetraut hätten.
Renate Welsh: Ich hab da dann immer wieder auch die eine oder andere Methode aus der Situation heraus entwickelt, was und wie gut passen könnte. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine dreiwöchige Werkstatt mit Jugendlichen vor viiiielen Jahren in Norddeutschland. Damals haben wir noch mit Tonband gearbeitet. Die Aufgabe, die ich ihnen gestellt hab: Sie sollten bei einer Geschichte die Stopp-Taste drücken, wenn sie an einem Punkt anders handeln könnten. Meistens haben sie dann davon erzählt, wie die anderen anders reagieren könnten. Das war ein schwieriger Lernprozess, zu sich selbst zu kommen. Aber es hat dann gut funktioniert, auch wenn ich mich zwischendurch mal anbrüllen lassen musste, Wir haben aber auch viele gelacht und Blödsinn gemacht. Ich glaube an die kreative Kraft des Blödsinns.

KiJuKU: Magst du unseren Leser: innen verraten, woran du aktuell schreibst und arbeitest?
Renate Welsh: Das Archiv der Zeitgenossen hat meinen Vorlass übernommen. Die haben nicht nur analoge Unterlagen, sondern auch alles Mögliche aus meinem Computer geholt. Sie wollen alte Texte oder Entwürfe, von denen ich von vielen gar nicht mehr gewusst habe – herausbringen. An deren Überarbeitung schreibe ich.
Außerdem an „Bruchstücken von Erinnerungen von diversen Lesereisen“, Impressionen von Begegnungen, zum Beispiel der fast unglaublichen Kommunikation mit der Mutter des Chauffeurs als ich in Teheran (Iran) war. Sie konnte weder Englisch noch Französisch noch Deutsch und ich außer „bitte“ und „danke“ nichts auf Farsi. Sie hat mir erzählt, dass sie drei Stunden vor Sonnenaufgang aufstehen muss, um für all ihre Familienmitglieder, die nicht mehr fromm sind, zu beten. Ich hab das alles verstanden, wie mir der Sohn später erklärt hat, aber nur, weil ich kein Wort verstanden habe. Wenn du wenige Wörter kannst, bleibst du bei dem einen oder anderen hängen. Wenn du gar nix verstehst, schaust du auf die Körpersprache, die Mimik.
Solche Aha-Erlebnisse aus verschiedenen Teilen der Welt will ich in diesen Impressionen aufschreiben.
KiJuKU: Hast du dir das alles aufgeschrieben?
Renate Welsh: Manches schon, vieles andere hab ich brühwarm Shiraz (Ehemann) erzählt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Viele davon auch gut 1000 Mal und so erzählt er sie mir, dass ich sie aufschreiben kann.
KiJuKU: Jetzt läuft der Film „Renate“ über dich im Kino, wie war das, dich so groß auf der Leinwand zu sehen?
Renate Welsh: ich finde den Film sehr gelungen, der Martin (Nguyen, Filmemacher) hat mich da über Jahre hindurch sehr sanft begleitet, so dass oft die Kamera „verschwunden“ ist. Aber so groß, das ist nicht einfach, auch auf der Straße dem Plakat mit der Filmankündigung zu begegnen – da reißt’s mich jedes Mal.
KiJuKU: Du hast mir im Herbst geschrieben, dass auch „Vamperl“ verfilmt werden soll, wird es das – als Spiel- oder Zeichentrickfilm?
Renate Welsh: Ja, jetzt kann’s ich offiziell sagen, Verträge sind unterschrieben. Es wird ein Spielfilm. Beim Drehbuch will ich nix dreinreden, davon versteh ich nix. Aber die Dialoge will ich schon beeinflussen, Dialoge schreiben kann ich.
Außerdem wird ein altes Buch von mir „Alle Kinder nach Kinderstadt“ (Jugend & Volk, 1974) in Vorarlberg für die Bühne dramatisiert. Kinder kommen in die Kinderstadt, die Alten in die Seniorenstadt, alle Gruppen werden getrennt. Aber ein kleines Mädchen hat enge Verbindungen zu ihrem Großvater – die beiden beginnen zu buddeln und einen Tunnel zu graben, um diese Spaltungen zu überwinden.
Dann soll „Johanna“ (erstveröffentlicht 1984, zuletzt neu 2021 im Czernin Verlag) verfilmt werden und das „Theater Spielraum“ (Wien, Kaiserstraße) bringt „Die alte Johanna“ (ebenfalls 2021, Czernin Verlag) auf die Bühne (April, Mai 2026).

KiJuKU: Anknüpfend oder besser gesagt / geschrieben den Bogen zu unserem letzten Interview kurz vor deinem 80er im Jahr 2017: Damals war dein Wunsch ein „Spiegel, in dem sich groß und allmächtig gebende Männer, die oft nur von Speichelleckern und Kriechern umgeben sind und keine Kritik an sich heranlassen, sehen wie sie im Grunde genommen wirklich sind, oft lächerlich.“
Ein Spiegel, der sozusagen die Rolle des Kindes übernimmt, das in „Des Kaisers neue Kleider“ sagt: „Der Kaiser ist ja nackt!“ Reicht ein solcher Spiegel heute, sieben Jahre und zwei Monate später, noch?
Renate Welsh: Die Trumps, und es ist ja eben nicht nur er, es herrschen derzeit viele solcher Typen, sind furchtbar gefährlich, weil sie so von Angst zerfressen sind, irgendwann nicht (mehr) die Allmacht zu besitzen von der sie glauben, dass sie sie haben. Die meinen, die Rettung der Welt würde von ihren jämmerlichen Egos abhängen. Wenn man ihnen diese ihre Angst nehmen könnte, dann bräuchten die vielen, vielen anderen keine Angst mehr vor diesen angstdurchfressenen Gewaltmenschen haben.
KiJuKU: Sozusagen ein „Vamperl 2.0“?!
Renate Welsh: Ich glaube an die Klarheit und Ehrlichkeit. Im Grunde braucht es einen ehrlichen, konstruktiven Egoismus, einen der sich nichts vormacht. Der wäre eine bessere Form des Umgangs miteinander. Es kann mir nur gut gehen, wenn die Kluft zwischen mir und den anderen nicht größer ist als die Natur sie verlangt. Es gibt schon genug Ungerechtigkeiten in der Natur durch unterschiedliche Voraussetzungen und Lebensbedingungen. Menschen sollten diese Ungerechtigkeiten nicht noch vergrößern.
Dann muss der Mensch nicht so schrecklich Angst vor den Nachbarn haben. Nur, wenn’s den anderen gut geht, kann’s mir auch gut gehen.
Ein Grundübel sind die ständigen Vergleiche. Warum kann ich nicht einfach etwas schön, gut, wert… finden, sondern nur, wenn es größer, besser und so weiter sein soll?!
Wir müssten lernen, uns an der Vielfalt der Welt zu freuen, statt immer alles zu benoten, zu be- und abwerten.
Ich bin ja überzeugt, dass der Mensch im Grunde gut ist, oder zumindest gut sein möchte.
KiJuKU: Viiiiielen, herzlichen Dank, liebe Renate – auf noch viele Bücher, Schreibwerkstätten und Gespräche!
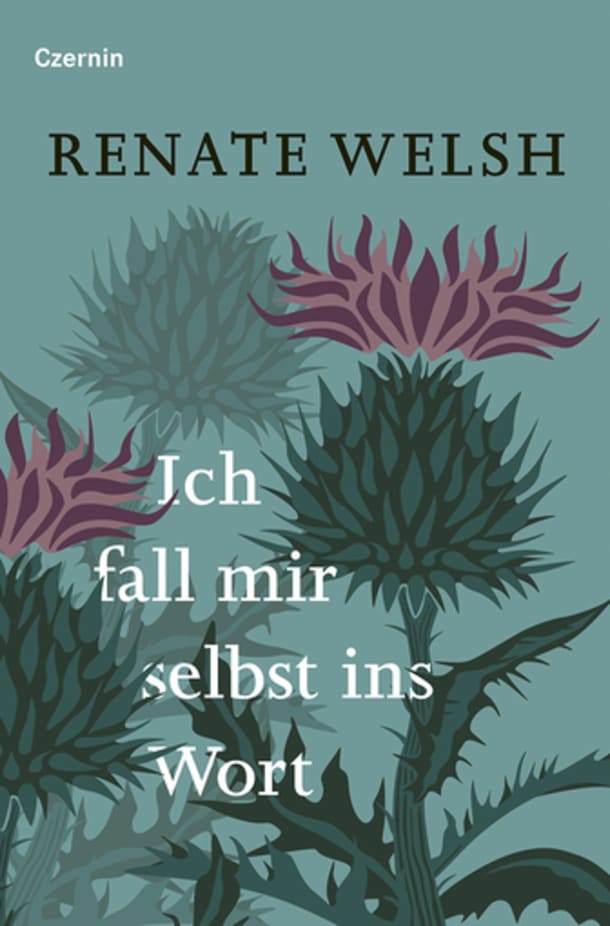

Rund um den Start des Kinofilms „Renate“ – Filmbesprechung unten am Ende dieses Beitrages verlinkt – über die vielfältige Arbeit und das Leben der Autorin Renate Welsh fand in der „Alten Schmiede“, einem Kunst- und Kulturzentrum in Wien ein Symposium – gemeinsam mit dem Archiv der Zeitgenossen statt: „Geschichten hinter den Geschichten“ – (Re-)Lektüren des Werks von Renate Welsh“.
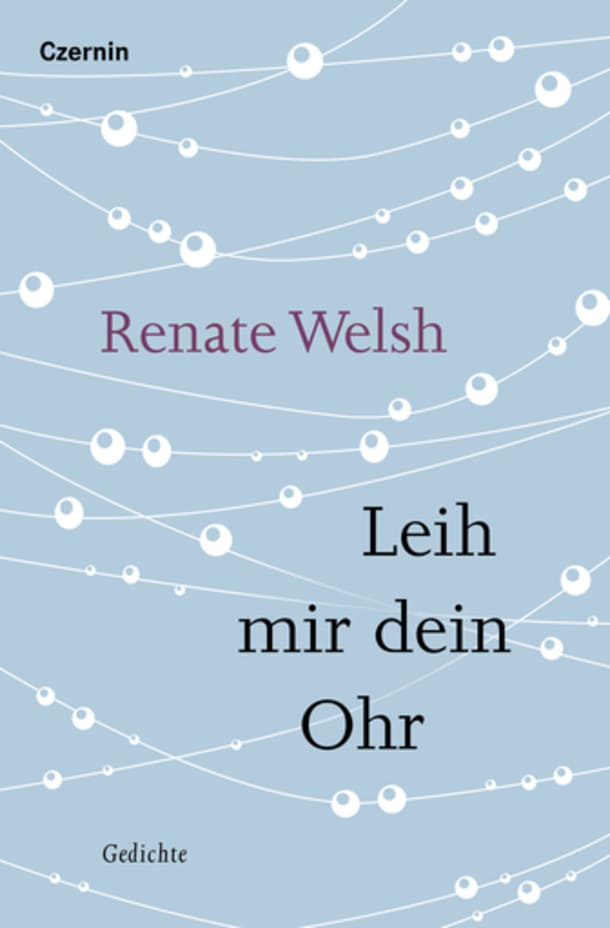
Vortragende, die sich meist schon sehr lange mit dem schriftstellerischen Schaffen, aber auch den Schreibwerkstätten, beschäftigten, referierten über einzelne, wichtige Aspekte dieses Schaffens. Und alle freuten sich darüber, dass überraschenderweise die Autorin selbst gleich zu Beginn erschien und die gesamte Zeit den Vorträgen lauschte, sich in den Diskussionen danach zu Wort meldete – obwohl sie selbst am Abend der Veranstaltung noch einen Stock tiefer eine Lesung zu halten hatte.
Michael Hammerschmid, selber Lyriker sprach über Haltung und Poesie in Renate Welshs Gedichten. Obwohl sie mit „Leih mir dein Ohr“ erst 2024 ihren ersten Lyrikband veröffentlicht hatte, analysierte er nicht nur diese – im übrigen zum Teil auch schon viel früher entstandenen Gedichte. In „Erfahrungen festgezurrt in Worte“ zog er auch einen Bogen zu ihren Dutzenden Prosa-Büchern – und der auch dort präzisen Sprache.
Fermin Suter, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Archivs der Zeitgenossen an der Universität für Weiterbildung Krems (NÖ) befasste sich mit der innovativen, engagierten Arbeit Welshs in den Schreibwerkstätten und nannte seinen Beitrag „Kleine Schritte und Quantensprünge“.
Die Obfrau der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung sowie Mitherausgeberin von libri liberorum, der Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung, Susanne Blumesberger, präsentierte die literarische Vernetzung der Autorin in der Gruppe, die keinen Namen hatte, aber vieles in der Kinder- und Jugendliteratur zum Realistischeren veränderte (u.a. Christine Nöstlinger, Mira Lobe…). Den meisten ist auch heut „Das Sprachbastelbuch“ bekannt. „Manchmal wussten wir selbst nicht mehr, wer einen bestimmten Text geschrieben hatte“, lautete ein Zitat, das Blumesberger als Titel für den Vortrag verwendete.
Hanna Prandstätter, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Archivs der Zeitgenossen an der Universität für Weiterbildung Krems (NÖ) sprach über feministische Schreibweisen bei Renate Welsh unter dem Titel „Ich habe mir erlaubt, Lücken aufzufüllen.“ Sie arbeit den Vorlass der Autorin auf.

Julia Danielczyk, Lehrende an der Uni Wien, Abteilung für Vergleichende Literaturwissenschaft, referierte – per Online-Video über Aufbegehren und Aufbruch in Renate Welshs „Johanna“ und „In die Waagschale geworfen“ und betitelte den Vortrag „In der Sprache liegt ein kleines Prinzip Hoffnung.“
Schließlich sprach noch die Obfrau des Netzwerks Archiv und Gender (NAG), Susanne Rettenwander, über „Versteckte Selbstzeugnisse. (Auto-)Biographisches Schreiben in der Jugendliteratur am Beispiel von Renate Welsh und Vera Ferra-Mikura
Und bei der abendlichen Lesung aus „Ich falle mir selbst ins Wort“ durch die Autorin selbst, bezogen sich die beiden österreichischen Schriftstellerinnen Elke Laznia und Margit Schreiner in „Respondenzen zu Renate Welsh“ eben auf das Schaffen bzw. einzelne Werke der 88-jährigen Autorin und Bögen zu ihrem eigenen Schreiben.

Von mutigen Frauen, die in knappen Sätzen heftigste Schicksale zu Papier bringe über kreative Sprachspielereien von Kindern und Obdachlosen, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben sich zutrauten, Texte zu verfassen erzählt dieser Film. Auch. Denn nicht nur die genannten Menschen(gruppen) kommen in den wenig mehr als 80 Minuten des aktuell in Kinos angelaufenen Film zu Wort. „Renate“ kreist um – eben Renate mit Nachnamen Welsh-Rabady, mit dem ersten Nachnamensteil schon viel länger bekannt.

Die Mutmacherin in unzähligen Schreibwerkstätten in verschiedenen Ländern der Welt hat mittlerweile rund 90 Bücher veröffentlicht. Kein einziges davon so rasch mal hingefetzt. Fast immer brauche sie für ein Werk neun Monate – wie sie (nicht nur) im Film von Martin Nguyen (Kamera: er selbst und Astrid Heubrandtner, Montage: Esther Fischer; mehr Details in der info-Box am Ende des Beitrages) – auf die Frage eines Kindes erklärt. Und so wie sie in ihren Werkstätten den Teilnehmer:innen Mut darauf mache, ihre Gedanken und vor allem Gefühle zum Ausdruck zu bringen, so machen ihre Bücher ebenfalls Mut. Sie rückt oft an den Rand der Gesellschaft gedrückte Menschen in den Mittelpunkt. Da spielen sie einerseits eine zentrale Rolle und andererseits helfen sie mit, das eine oder andere Vorurteil – zumindest – in Frage zu stellen.
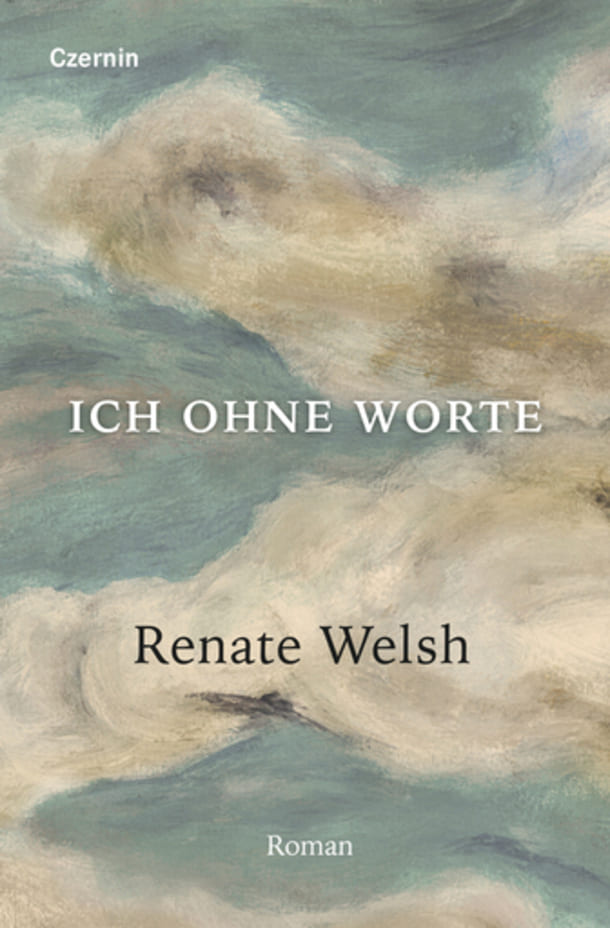
Der berührende, behutsame Film, in dem das Team die Autorin über mehrere Jahre begleitet hat, enthält aber auch noch eine dritte Mutmach-Ebene: die zutiefst einschneidende gesundheitlich-persönliche des Schlaganfalls 2021. Renate Welsh die heuer (2026) zwei Tage vor Weihnachten 89 wird – was für sie als Fan von Primzahlen vielleicht bedeutender ist als der nächstjährige 90er – musste danach (fast) alles wieder neu lernen: Von der Motorik – Arme und Beine taten oft nicht, was sie wollte – bis hin zu jener ganz essentiellen Welt der Schriftstellerin: Sprache.
In „Ich ohne Worte“ (wie einige andere ihrer Bücher im Czernin Verlag) beschreibt sie offen und sich selber gegenüber schonungslos diese anfängliche fast Hilflosigkeit, auch die Wut, dass fast alles, was sie wollte, nicht gelang. Aber eben auch ihren Kampfeswillen, sich diese Fähigkeiten zurückzuerobern.
Die Literatin, studierte Übersetzerin, gewährt im Film auch sehr nahe Einblicke in diese Phase der Physio- und Sprach-Wiedererlangung. Samt dem Erlernen, Hilfe auch annehmen zu können und sich darüber zu freuen. Ein wichtiger Begleiter – nicht nur in dieser Phase – ist ihr zweiter Ehemann, der Arzt Shiraz Rabady, mit dem sie seit fast 60 Jahren zusammen ist. Als zweiter Protagonist im Film ist er wie auch sonst fast immer zurückhaltend, Ruhe und Geduld ausstrahlend, Teil des harmonischen Duos, das einander ergänzt.

Und last but not least baut der Film ein weiteres wichtiges Element dieser Schriftstellerin, die mittlerweile längst als Autorin sowohl für Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene bekannt und ausgezeichnet ist: Austausch mit anderen, Vor allem als Teil jener – namenlosen, aber wichtigen – Gruppe von damals jungen vor allem Autorinnen (u.a. Christine Nöstlinger, Mira Lobe), die völlig neues in die Kinder- und Jugendliteratur einbrachten – sprachlich und inhaltlich. Aufwachsen in anderen als Normfamilien, Gewalt in der Erziehung, Ausgrenzung und Strategien dagegen, Behinderungen… kurz und gut das echte Leben statt vorgeblich heiler Welt.
Und zu den Geschichten, auch wenn sie oft fiktiv waren und sind, kamen diese Autor:innen durch Hinschauen und Hinhören auf eben echte Lebensgeschichten. Aktives Zuhören – und das nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Körper – ist eine der ganz großen Eigenschaften von Renate Welsh-Rabady (seit 2000 verheiratet). Das im Film auch ziemlich gut zum Ausdruck kommt. Wie „Renate“ überhaupt das schafft, was die Protagonistin auszeichnet: Eine unglaubliche Einheit zwischen der Person und ihrem Werk.

Ein hoher Berg von Matratzen. Während das Publikum den kleineren Saal des Theaterhauses im MuseumsQuartier, Dschungel Wien, betritt, liegt eine märchenhaft verkleidete Spielerin drauf, stellt sich schlafend, also recht lange. Auch wenn irgendwann aus dem Off eine Stimme mit den bekannten Worten „es war einmal“ beginnt, legt das zweite „e“ im Titel „Prinzessen“ der Gruppe Plaisiranstalt mehr als nahe, dass dies kein klassisches Märchenstück ist.

Das macht der heftige, wilde Auftritt der zweiten Schauspielerin nach wenigen Augenblicken noch klarer. Die schwarz irgendwie punkähnlich gekleidete (Ausstattung: Alexandra Burgstaller) Frau zuckt richtiggehend aus. „Na supa, scho wieder a Turm!“ Durch Dornenhecken hindurch wurde sie hierher verbannt. Dann entdeckt sie die Schlafende, erinnert sich an Märchen, geht einige durch und – eh klar Dornröschen. Sie erklimmt den Matratzenberg und küsst die Prinzessin wach.
Die meint zunächst – ganz im klassischen Märchen verhaftet – von einem Prinzen erweckt worden zu sein. Und dann? Weder Prinz, ja nicht einmal Prinzessin! Und dann noch geküsst auf den Mund!?

Rapunzel, so gibt sich die Wachküsserin zu erkennen, gelingt es nicht und nicht Dornröschen, die hier mit Roswitha sogar einen richtigen Namen hat, schmackhaft zu machen, dass sie doch jetzt aus der vorgesehenen Rolle ausbrechen könnte.
Von dieser Dynamik mit viel szenischem Humor und Wortwitz lebt das Stück über lange Zeit. Da die wilde, Freiheit und Unabhängigkeit liebende Rapunzel (Sophie Berger), die sich aus dem Turm befreite – einfach schlau genug, ihr uuuurlanges Haar abzuschneiden, um sich selbst abzuseilen.

Als Gegensatz die der Tradition verhaftete Prinzessin (Charlotte Zorell), die vom Prinzen träumt. Alles will sie regelkonform und brav machen, versucht das auch von der anderen zu verlangen, pocht auf feine Sprache, immer wieder oberlehrerinnenhaft korrigierend… Und doch stets mit einer Spur Überspitzung, die dieses Verhalten in Frage stellt.
Autor Raoul Biltgen, Regisserin Paola Aguilera und das gesamte Team woll(t)en von Anfang an diesen Druck zum sogenannten Brav-sein-müssen bzw. -sollen thematisieren und in Frage stellen, was witzig und immer wieder abwechslungsreich gelungen ist. Natürlich macht Roswitha eine Wandlung durch. Aber auch Rapunzel wird auf die Probe gestellt. Sie weiß zwar gut, was sie alles nicht möchte, aber was sie denn wirklich wolle – da muss sie auch erst hinfinden.

Ach ja, im letzten Drittel, so viel darf schon verraten werden, taucht dann doch noch ein Prinz auf, Charly mit Namen (Paul Graf). Auf „Retter“ vorprogrammiert, strahlt er aber auch aus, so ganz taugt ihm die auferlegte Rollenzuschreibung nicht. Was er letztlich ziemlich am Ende als seinen Berufswunsch gesteht – nein, das wird hier nicht gespoilert.
Was schon noch verraten werden soll: Sophie Berger greift immer wieder zum Mikro, um zu singen (Lieder: Thorsten Drücker).

Wie viele Bücher sie genau geschrieben hat, weiß sie nicht. „Ich glaube so um die 80“ und diese Antwort ist nicht kokett. Und obwohl Schreiben seit Jahrzehnten ihr Beruf ist, strahlt jedes ihrer Bücher auch die Berufung aus, mitzuhelfen, Leserinnen und Leser mutiger, die Welt ein Stück besser zu machen.
Dieser Beitrag stammt übrigens aus dem Dezember 2017, ist also mehr als acht Jahre alt. Er ist noch im Kinder-KURIER erschienen, dem Vorläufer von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Ich durfte fast drei Jahrzehnte lang die auch von mir gegründeten Seiten für junge Menschen dieses großen Medienhaues betreiben und kurz vor dem 80er von Renate Welsh dieses Gespräch in ihrer Wohnung in Wien-Neubau führen. Schon vor dem Gespräch schenkte die Autorin, der nun ein berührendes, bewegendes, bewegtes filmisches Porträt gewidmet ist – dazu eigene Beiträge, unten verlinkt – über den Kinder-KURIER einer Wiener Schule einen Schreib-Workshop – aus dem diese Reportageteile und Fotos stammen.
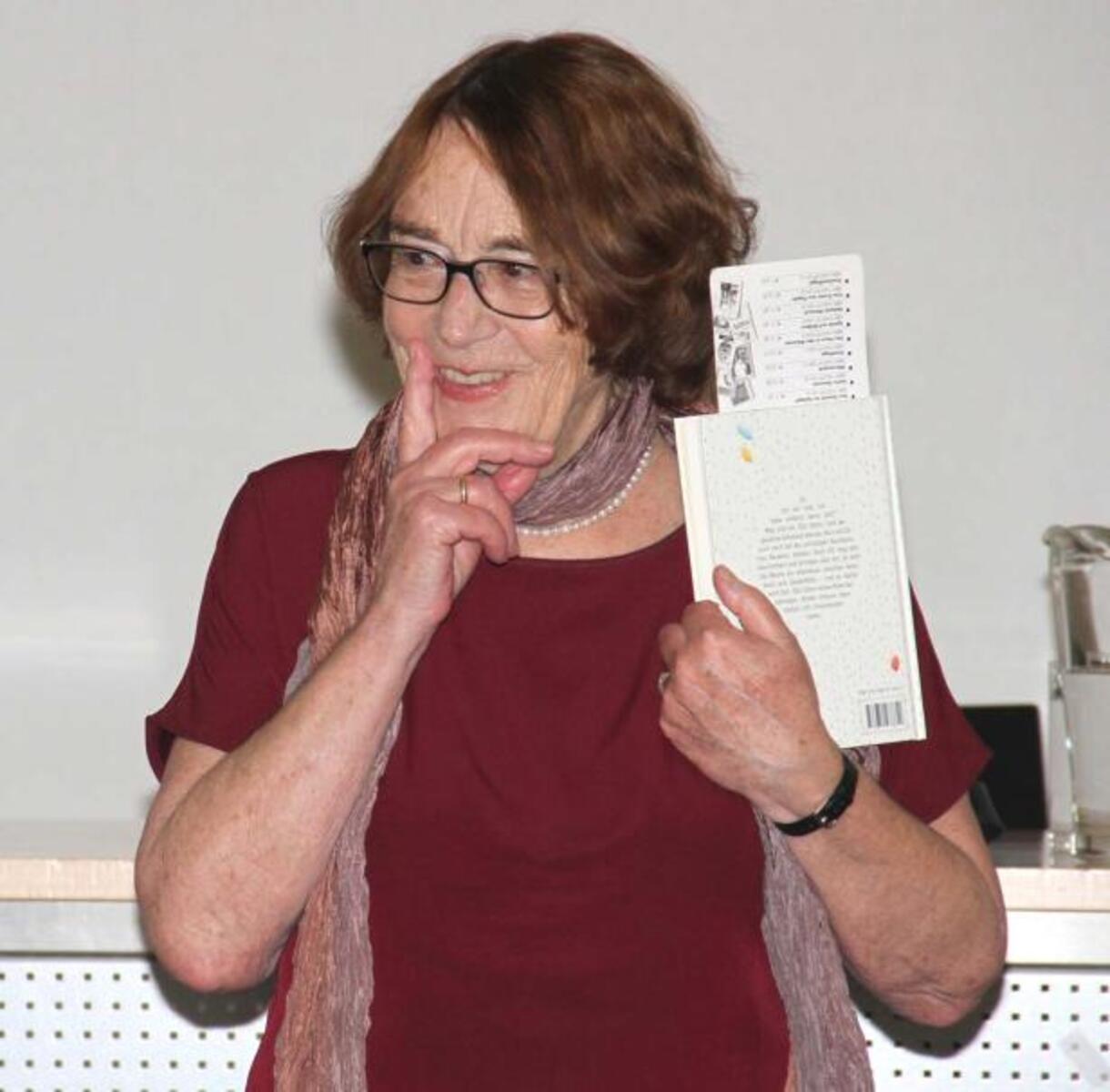
Schreiben ist „nur“ eine von vier Säulen des Schaffens von Renate Welsh-Rabady.
Die tiefgreifende Begründung für ihr Engagement in Schreibwerkstätten formuliert sie selbst am Treffendsten in der Eröffnungsrede für einen internationalen Psychologie-Kongress, wo sie unter dem Titel „Der Phantasie ein Fenster öffnen“ u.a. sagte: „… war ich immer davon überzeugt, dass Sprachlosigkeit die gemeinsame Wurzel vieler Übel ist, die mir Angst machen… Wer sich selbst nicht achtet, kann anderen kaum auf Augenhöhe begegnen, er braucht jemanden, den er verachtet, aber ebenso dringend jemanden, dem er aus welchen Gründen auch immer Gefolgschaft leisten kann…“
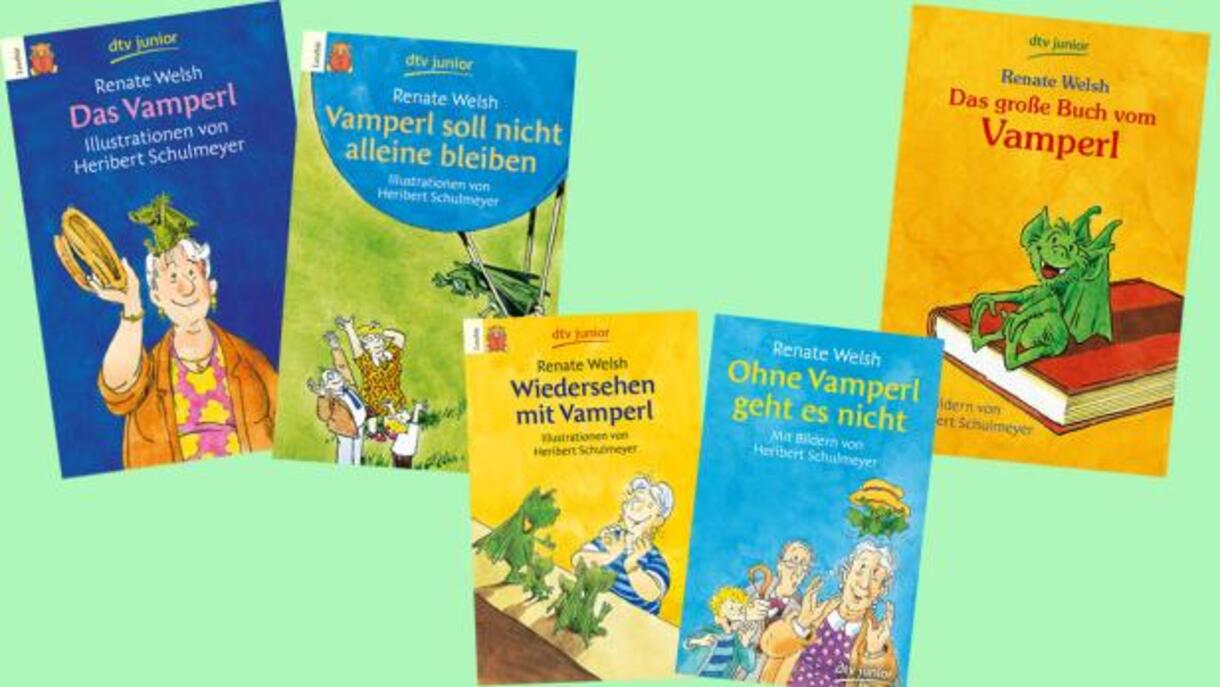
Und bei der Begegnung mit Kindern erfreut sich Renate Welsh-Rabady vor allem an deren Neugier, der Lust zu fragen und in den Werkstätten deren Fantasie – wenn sie noch nicht zerstört wurde. Denn hin und wieder muss sie erleben, „dass Kinder mich mit sooo großen Augen anschauen und ganz ungläubig feststellen: Das interessiert sie ja wirklich, was wir denken!“
Partei ergreifen für Außenseiter:innen, Ausgegrenzten Mut machen, Vorurteile zumindest in Frage stellen – Themen ihrer Bücher baut die Autorin in glaubhafte Geschichten samt dazugehöriger Charaktere ein, klar und virtuos geschrieben und nie vordergründig oder plakativ. Geschichten erzählen und schreiben zu können, hat ihr als sehr junges Mädchen in der Volksschule zunächst einmal sozusagen das (Über-)Leben ermöglicht. Sie sei ein kleines, aber neugieriges, aufgewecktes und schlaues Kind gewesen, aber eher so „ein aufg‘stellter Hühnerdreck“. In der Schule hätten ein paar deutlich größere und stärkere Buben sie immer wieder verdroschen. Bis, ja bis eines Tages der größte und stärkste von denen der kleinen Renate einen Deal angeboten hätte: Sie schreibe für ihn die Hausübungen und müsse ihm obendrein auf dem Heimweg Geschichten erzählen und die dann aufschreiben – und dafür würde er dafür sorgen, dass Renate von allen in Ruhe gelassen würde. Dieser Junge brüstete sich dann mit den geschriebenen Geschichten – „was ich schon ungerecht empfunden habe, aber dafür musste ich keine Angst mehr haben.“
In ihre Geschichten „stolpere ich oft“, vertraut sie dem Journalisten an. Der „Renner“ unter ihren Kinderbüchern sind die vom „Vamperl“. Dieser kleine Vampir saugt Gift aus der Galle. In einem Verkehrsstau habe sie diese verärgerten, oft eben richtig giftigen Menschen erlebt und sich „gedacht, da müsste man was erfinden, das dieses Gift aus den Menschen saugt“. So kam’s zu diesem kleinen Vampir. Eine 2-Seiten-Fassung habe sie ihrem Vater, mit dem sie oft heftig darüber streiten konnte, ob eher die Gene oder mehr das Umfeld für unser Verhalten verantwortlich wäre, zu dessen 80. Geburtstag geschenkt. „Du bist mit deinen 40 Jahren noch ein genauso frecher Fratz wie als Kind“, quittierte der die Story. Aus der 2-Seiten-Version schreib die Autorin später ein Hörspiel fürs Radio und auf Anraten eines Redakteurs im Rundfunk ein ganzes Buch – und in der Folge Fortsetzungen. Mindestens die 42. Auflage ist mittlerweile vom „Vamperl“ erschienen.
Neben dem „Stolpern“ gibt es auch Bücher, die auf Anregungen von Kindern zurückgehen – „Drachenflügel“ oder „Schneckenhäuser“.
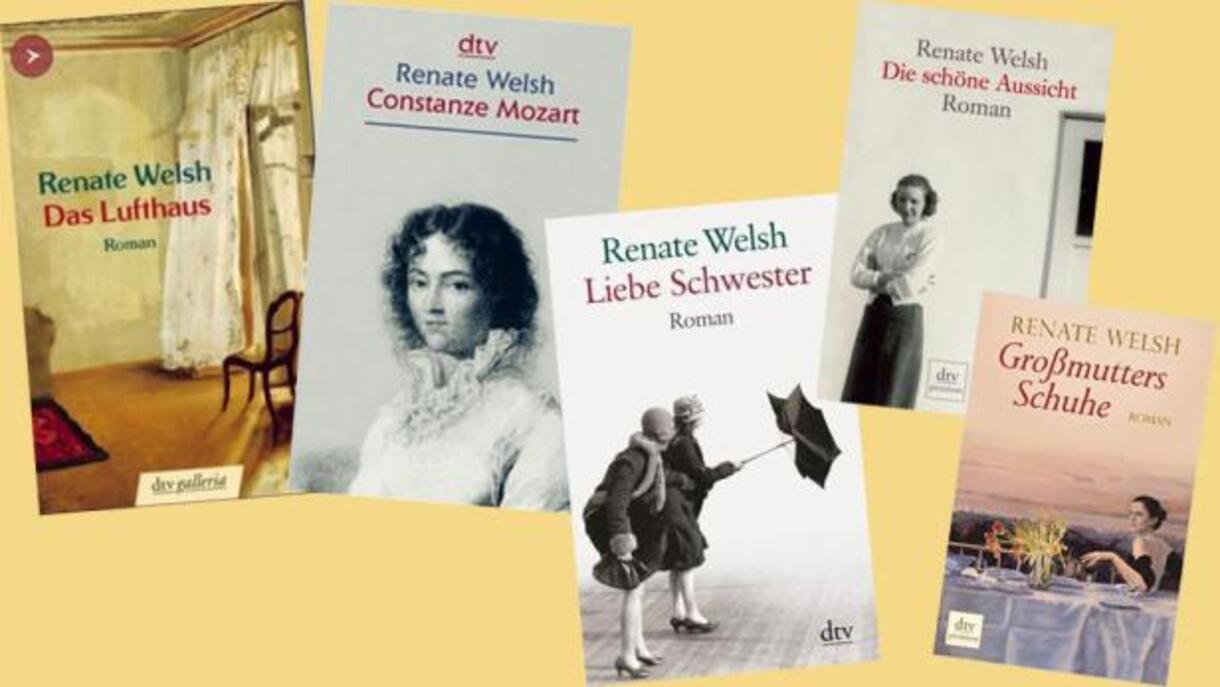
Ihr erstes Buch, das sie für Erwachsene geschrieben hat (das aber erst später veröffentlicht wurde) ist „Lufthaus“. In das stolpert sie über die Frage ihres Vaters, ob sie als Geschenk lieber einen Ring oder eine Schachtel alter Briefe hätte. Na was wohl?
Die Briefe stammten von einem Vorfahren der Familie, von Maximilian Joseph Gritzner und der war bei den Aufständen von 1848 führend beteiligt. Briefe und Zettelchen waren der Anfang, intensive Recherchen erfolgten, „doch dann war er mir in seiner Selbsteinschätzung zu selbstgefällig und darum habe ich die von seinem Sohn entführte Frau, also seine Schwiegertochter Pauline zur Hauptfigur des Romans gemacht“. Die Lektorin des Verlags fragte die Autorin allerdings, ob sie sich nicht vorstellen könnte, über Constanze Mozart zu schreiben, wo sie sich doch so gut im 19. Jahrhundert auskenne. Die wäre doch eher fad, meinte Welsh. Wie wäre das mit Vorurteilen und ihrer Haltung, solche in Frage zu stellen, wollte die Lektorin wissen. Das war Anreiz genug für Welsh, sich in die Geschichte der Ehefrau des berühmten Komponisten zu vertiefen – „ihre Entwicklung vom jungen Ganserl zur gestandenen Frau hat mich dann doch interessiert“.
Was sie sich zu ihrem 80. GEburtstag wünsche (heuer wird sie am 22. Dezember 89), wollte damals KiKu (Kinder-KURIER) wissen.
Renates Antwort: Einen Spiegel, in dem sich groß und allmächtig gebende Männer, die oft nur von Speichelleckern und Kriechern umgeben sind und keine Kritik an sich heranlassen, sehen wie sie im Grunde genommen wirklich sind, oft lächerlich.“ Ein Spiegel, der sozusagen die Rolle des Kindes übernimmt, das in „Des Kaisers neue Kleider“ sagt: „Der Kaiser ist ja nackt!“
https://www.schule.at/lernwelt/lesen-mit-edi/detail/das-vamperl
Erstveröffentlicht im Kinder-KURIER hier
Bericht über eine Lesung von Renate Welsh-Rabady damals im Kinder-KURIER
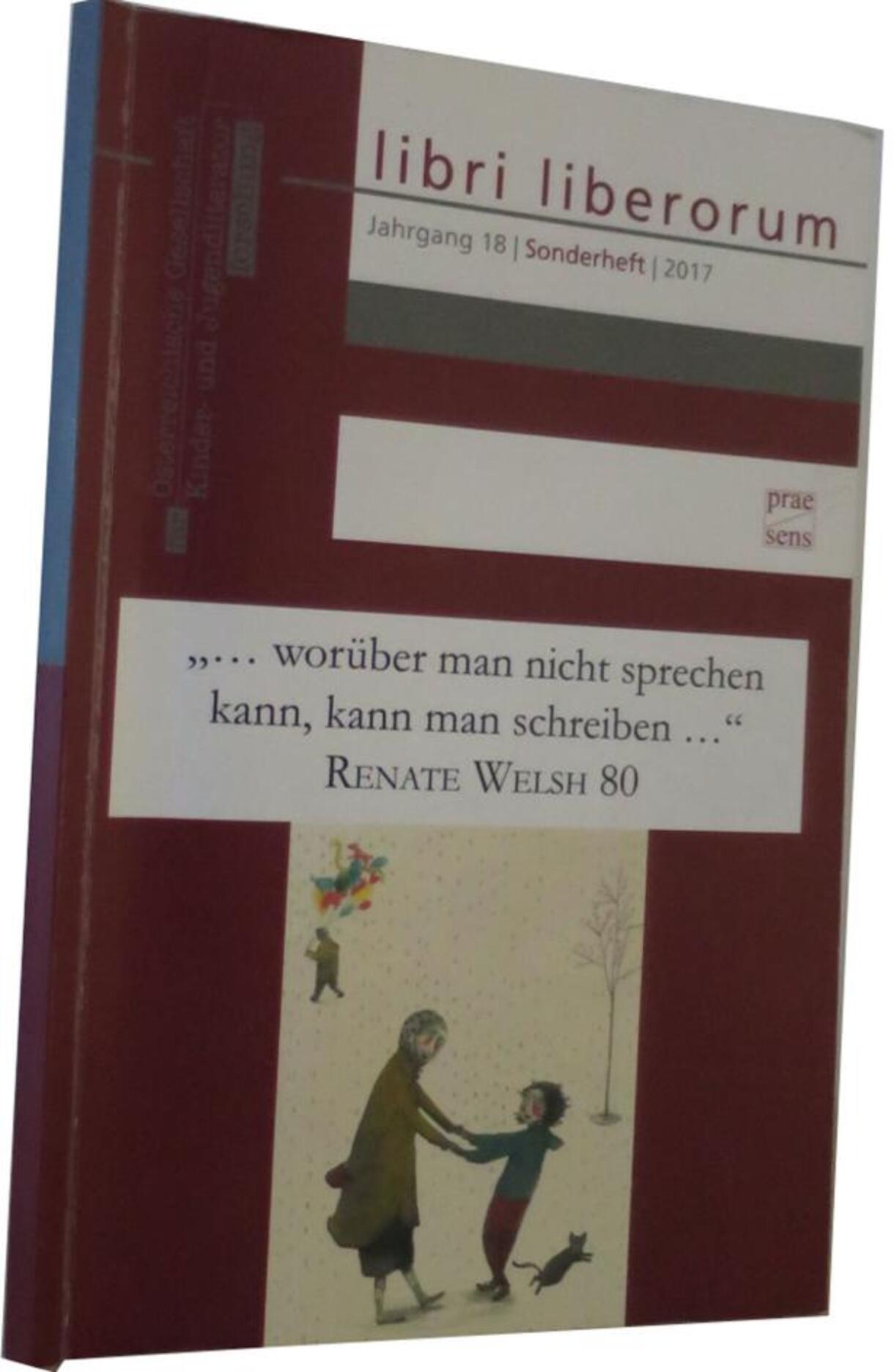
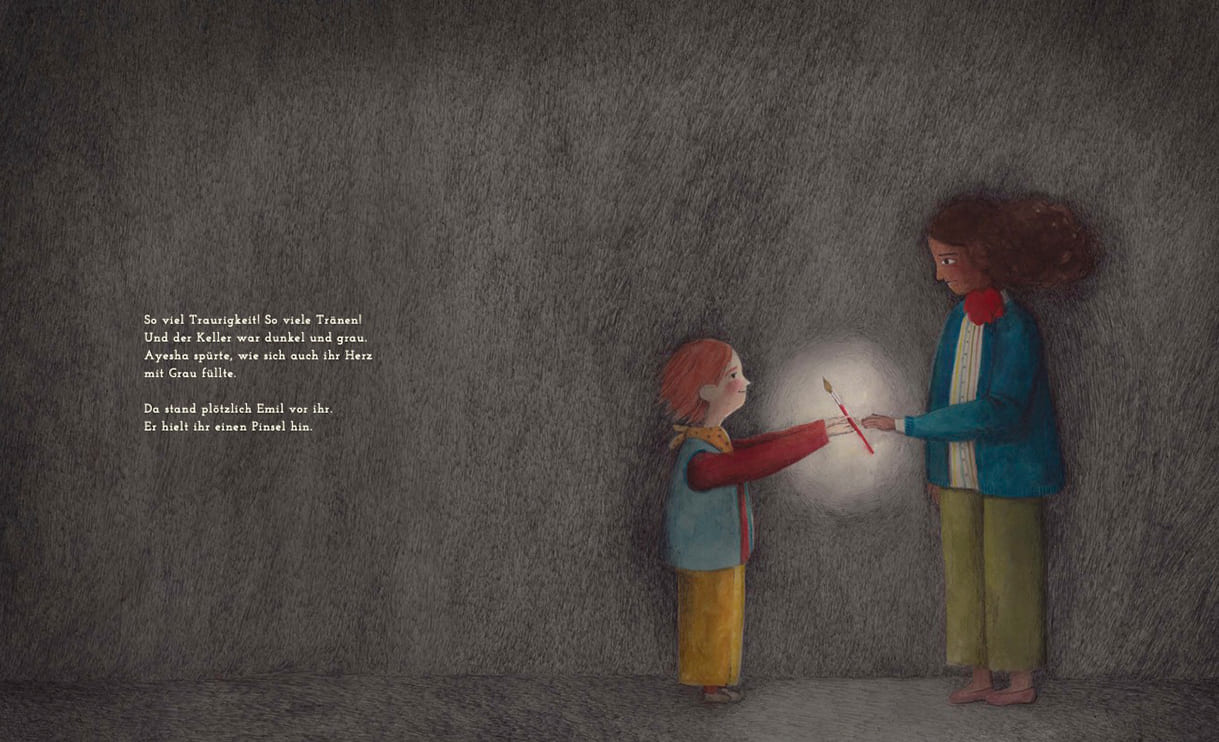
Dunkelgrau bis schwarz dominiert eine der Doppelseiten dieses Bilderbuchs – siehe oben. Doch von einem Pinsel und dessen Übergabe von Kind Emil an Malerin Ayesha geht ein heller Kreis aus. Der im eigenen Kopf spürbar auch dieses Dunkel zumindest mit einer Portion Hoffnung erleuchtet.
„Ayeshas Pinsel“, geschrieben von Cornelia Funke, illustriert in unterschiedlichsten Techniken (Aquarell, Kugelschreiber, Buntstifte, Tusche) und gestaltet von Pauline Pete, beginnt bunt und (bild-)freudig. Das Bilderbuch erzählt von Ayesha, die lebensfrohe, farbkräftige Bilder malt und in einer bunten Stadt lebt.
Doch eines Tages oder Nachts vermeinten Menschen, die Krieg führten, auch diese Stadt zu bombardieren. Die Düsternis zieht ein. Höchstens durch Feuerblitze von Bomben „erhellt“. Die Menschen müssen in die – hoffentlich – bombensicheren Keller flüchten.
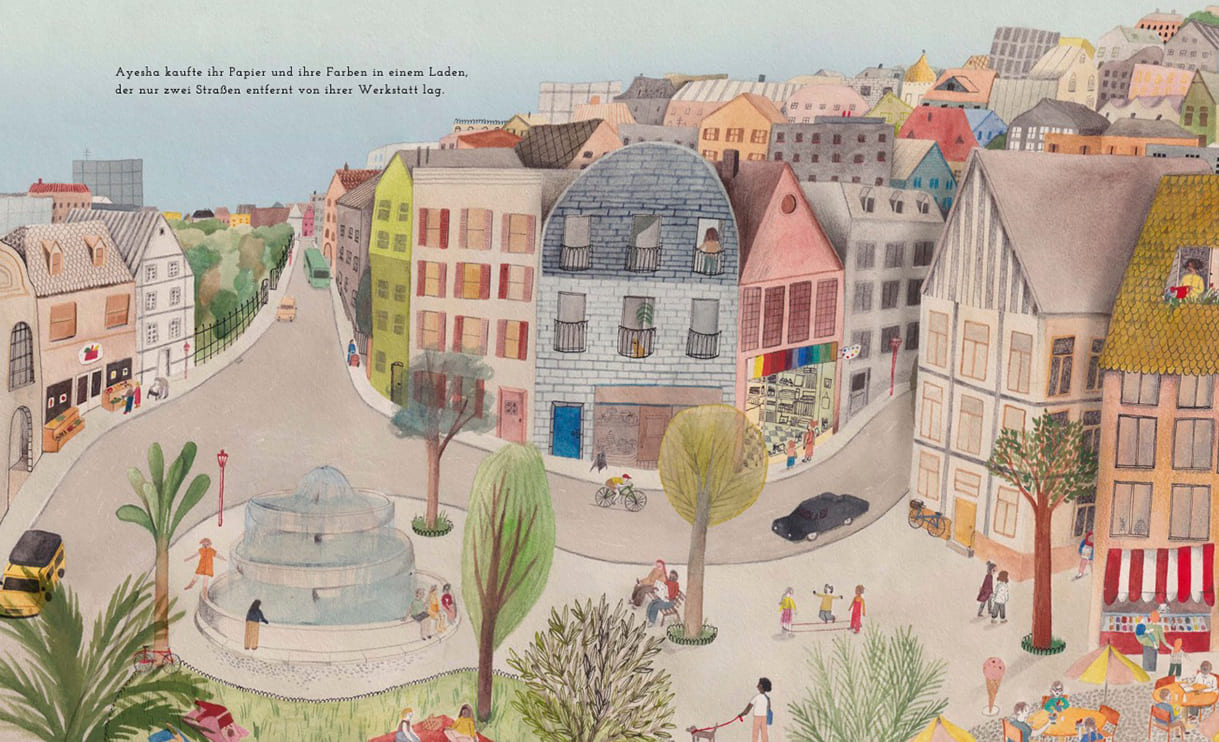
… So viele Tränen! Und der Keller war dunkel und grau. Ayesha spürte, wie sich auch ihr Herz mit Grau füllte. Da stand plötzlich Emil vor ihr. Er hielt ihr einen Pinsel hin.“ – Dies ist der Text auf der ganz oben beschriebenen Doppelseite.
Von da an kehrt Hoffnung in die Kellerräumlichkeiten ein. Alle, die hier Zuflucht suchen, beginnen, wenigstens die Wände bunt zu bemalen. Was sie einerseits durch die kreative Tätigkeit aus der Tristesse wenigsten ein bisschen herausbrachte und sie durch die Bilder, die sie schufen trotz alledem aufzuheitern vermochte. Sie malten nicht, wie zerstört die Stadt oben nun geworden war, sondern all das Schöne, das ihnen der Krieg gestohlen hatte. Das gab / gibt gleichzeitig Raum und Zeit für die Trauer, aber auch gepaart mit Hoffnung auf ein Leben jenseits des Krieges.

Gestern, heute, morgen, übermorgen … – jeden Tag wurde 2024 allein im südamerikanischen Kolumbien ein Kind mehr als gezwungen, schon ganz junger Soldat oder Soldatin zu sein. Auch auf der karibischen Insel Haiti hat die Zahl der Kindersoldat:innen deutlich zugenommen. Auf diese beiden länderspezifischen Beispiele weist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, am 12. Februar (2026) hin. Anlass: dieser Tag ist seit mehr als zwei Jahrzehnten der internationale Red Hand Day – mit runden Handabdrücken wird dagegen protestiert, dass Kindern als Soldat:innen ihre Rechte als Kinder, ihre Kindheit geraubt und sie unter Waffen gezwungen werden.
Und Anlass dafür war, dass am 12. Februar 2002 die UNO-Kinderrechtskonvention (schon 1989 beschlossen) um einen Vertrag erweitert wurde, sich aktiv gegen die Rekrutierung von Kindern als Soldaten einzusetzen.
„Kinder in Kolumbien geraten nicht nur ins Kreuzfeuer, sie werden seit Jahren aktiv rekrutiert und eingesetzt. Die Auswirkungen auf sie und ihre Familien sind verheerend“, sagte die UNICEF-Vertreterin in Kolumbien, Tanya Chapuisat. „Dringendes Handeln ist erforderlich, um Kinder vor Rekrutierung, sexueller Gewalt und anderen schweren Rechtsverletzungen zu schützen.“
Zehntausende Kinder sind durch die anhaltende Gewalt im bewaffneten Konflikt gefährdet. Besonders betroffen sind ländliche Regionen, in denen Armut, fehlender Zugang zu Bildung sowie eine unzureichende soziale Infrastruktur die Verwundbarkeit von Kindern weiter erhöhen.
„Kinder in Kolumbien geraten nicht nur ins Kreuzfeuer, sie werden seit Jahren aktiv rekrutiert und eingesetzt. Die Auswirkungen auf sie und ihre Familien sind verheerend“, sagte die UNICEF-Vertreterin in Kolumbien, Tanya Chapuisat. „Dringendes Handeln ist erforderlich, um Kinder vor Rekrutierung, sexueller Gewalt und anderen schweren Rechtsverletzungen zu schützen.“
Mehr als 1,4 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben, über die Hälfte davon Kinder. Sie sind mit sich überlagernden Krisen konfrontiert: bewaffnete Gewalt, Naturkatastrophen und extreme Armut. Diese Bedingungen haben das Wachstum bewaffneter Gruppen begünstigt und erhöhen den Druck auf Kinder, sich ihnen anzuschließen.
Kinder werden häufig unter Zwang angeworben, um ihre Familien finanziell zu unterstützen, aus Angst vor Gewalt im eigenen Umfeld oder aufgrund direkter Drohungen. Viele werden rekrutiert, nachdem sie von ihren Bezugspersonen getrennt wurden und ohne Schutz oder Überlebensmöglichkeiten sind. Bewaffnete Gruppen nutzen zunehmend soziale Medien mit falschen Versprechungen von Arbeit oder einem besseren Leben. Ein Austritt aus den Gruppen ist in der Regel nicht möglich.

Anlässlich des Red Hand Days, des internationalen Aktionstages gegen den Einsatz von Kindersoldaten, warnt Unicef vor einem sich verschärfenden Kreislauf aus Gewalt, Vertreibung, Armut und fehlenden Schutzmechanismen.
„Die Rechte von Kindern sind nicht verhandelbar“, sagte Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell. „Jedes Kind muss geschützt werden. Und jedes Kind, das von bewaffneten Gruppen rekrutiert oder eingesetzt wurde, muss freigelassen und unterstützt werden, damit es heilen, wieder lernen und seine Zukunft neu aufbauen kann.“
Die Rekrutierung und der Einsatz von Kindern durch bewaffnete Gruppen stellen eine schwere Verletzung ihrer Rechte dar und sind nach internationalem Recht – einschließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen – verboten.
Kinder, die rekrutiert werden, sind vielfältigen Gefahren ausgesetzt: Verletzungen, Verstümmelung oder Tod in Kampfhandlungen, sexuelle, psychische und körperliche Gewalt, willkürliche Inhaftierung sowie der Verlust des Zugangs zu Bildung. Ihre Sicherheit, ihr Wohlbefinden und ihre gesamte Entwicklung werden nachhaltig beeinträchtigt.
Zu den sechs schweren Rechtsverletzungen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten zählen: Tötung und Verstümmelung, Rekrutierung und Einsatz, Sexuelle Gewalt, Angriffe auf Schulen oder Krankenhäuser, Entführung, Verweigerung humanitären Zugangs
Kinder, die tatsächlich oder mutmaßlich mit bewaffneten Gruppen in Verbindung stehen – auch wenn ihnen Straftaten vorgeworfen werden –, müssen vorrangig als Opfer betrachtet werden, nicht als Täter.

Unicef arbeitet in beiden Ländern mit Regierungen, lokalen Institutionen, Zivilgesellschaft, UN-Organisationen und humanitären Partnern zusammen, um Rekrutierung zu verhindern und betroffene Kinder zu schützen.
Die Unterstützung umfasst unter anderem: Psychosoziale Betreuung, Fallmanagement und Überweisungen an Gesundheits- und Schutzdienste, Zugang zu Bildung und temporären Lernräumen, Familiensuche und -zusammenführung, wenn im besten Interesse des Kindes, Reintegration und Rehabilitation
In Haiti unterstützt das PreJeunes-Programm Jugendliche dabei, bewaffnete Gruppen zu verlassen oder schützt gefährdete Kinder durch Stärkung sozialer Inklusion und schützender Umfelder. Seit Unterzeichnung des Übergabeprotokolls im Januar 2024 konnten dort mehr als 500 Kinder mit spezialisierten Schutz- und Wiedereingliederungsdiensten unterstützt werden.
In Kolumbien hat die Präventionsarbeit zur Einführung einer nationalen Strategie zur Verhinderung von Kinderrekrutierung beigetragen. Unicef setzt auf einen systemischen Ansatz, der den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen innerhalb von Familien und Gemeinschaften stärkt und konfliktbedingte Risiken – auch unter Berücksichtigung ethnischer Perspektiven – gezielt adressiert.
Unicef ruft nationale Behörden und alle relevanten Akteure auf, Kinderschutzsysteme zu stärken, sicheren und nachhaltigen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu gewährleisten und Programme zur Prävention und Reintegration auszubauen.
Zugleich appelliert die UN-Organisation an Geberregierungen, den Privatsektor und die internationale Gemeinschaft, dringend benötigte Programme für von Gewalt betroffene Kinder und Familien finanziell zu unterstützen, da diese weiterhin erheblich unterfinanziert sind.
„Kinder dürfen nicht zum Ziel bewaffneter Gruppen werden. Ihr Schutz ist keine Option, sondern eine Verpflichtung!“, heißt es abschließend in der medien-Aussendung von Unicef anlässlich des Red Hand Days 2026.
Rote Handabdrücke werden auf Transparenten, Plakate usw. als Aktion gemalt, gedruckt, gezeigt, um diesen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu stoppen. Die zentralen Forderungen zum Red Hand Day, dem internationalen Aktionstag an das Schicksal von Kindersoldat:innen im Folgenden

Der 12. Februar ist in Österreich der Jahrestag (1934), an dem die Führung des damals autoritären, austrofaschistischen (Stände-)Staates bewaffnete Einheiten (Polizei, Gendarmerie, Bundesheer) und die paramilitärische Heimwehr auf Gemeindebauten und aufständische Arbeiter:innen schießen ließ.
Dieser Tag ist aber auch seit mehr als 20 Jahren der „Red Hand Day“, Aktionstag dagegen, dass dass Kinder und Jugendliche zu Soldat:innen gezwungen werden. Anlässlich des Red Hand Days 2026 veröffentlicht KiJuKU hier einen recht alten Bericht aus der Zeit des Kinder-KURIER, gleichsam Vorläufer von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, verfasst und fotografiert aber eben von dem hier tätigen Journalisten. Dieser Bericht ist der einzige, noch online verfügbare auf kiku.at, obwohl nicht nur 2013, sondern einige weitere Jahre das Heeresgeschichtliche Museum in Wien sich an diesem Aktionstag beteiligte und jedes Jahr ehemalige Kindersoldat:innen einlud, über ihre bitteren Erfahrungen und den von verschiedenen Organisationen unterstützten Weg aus diesem brutalen Elend heraus schilderten.
Da die Berichte auf der kurier.at-Site (fast) alle nur mit Abo-Zugang verfügbar sind, erlaube ich mir hier, ihn – ein wenig verändert – Absatzreihenfolge und kleine Formulierungen – kopiert zu veröffentlichen; aber durchaus mit Link zum Original.

Wie alt, viel mehr jung er genau gewesen ist, das weiß John Kon Kelei gar nicht mehr. „Ich wurde entführt, als ich so irgendwas zwischen vier und fünf Jahren war. Ich kam in ein Camp mit vielen anderen Kindern. Und dachte eigentlich, dass ich am Abend wieder zu meiner Familie gebracht würde. Das war aber nicht so. Da war ich dann ganz traurig und trotz der vielen anderen Kinder fühlte ich mich einsam und verlassen. Wir wurden zum Soldaten-Dasein gezwungen, mit zehn hatte ich das Glück flüchten zu können. Ja, du bist nach diesen Jahren in Uniform und Drill kein Kind mehr, du bist schon sehr erwachsen. Ich konnte in die Hauptstadt Khartum (Sudan, Afrika) entkommen und dort dann in eine Schule gehen. Später konnte ich in die Niederlande kommen.“
Dort studierte er Jus, machte seinen Master im internationale europäischem Recht und gründete – gemeinsam mit Zlata Filipović und Ismael Beah, der Kindersoldat in Sierra Leone (Afrika) war, die Hilfsorganisation NYPAW (Network of Young People Affected by War – Netzwerk junger Leute, die Opfer von Kriegen wurden). John Kon Kelei gründete außerdem die Cuey Machar Secondary School Foundation im neuen Staat Süd-Sudan. „Ich hab die Chance auf höhere Schulbildung gehabt und so wollte ich helfen, dass in meiner Heimat auch andere Kinder mehr lernen können – das ist für sie gut, aber auch für die Entwicklung unseres jungen Staates.“
Auf der Homepage zu diesem Projekt zitiert er ein sudanesisches Sprichwort: „Gib einem hungrigen Menschen heute zu essen, er wird morgen wieder hungrig sein. Lehre ihn zu fischen und er kann auch morgen essen, aber schaffe Bildung für seine Kinder – dann hast du ihm eine Zukunft gegeben!“

„Eine ältere Schülerin hatte ein Tagebuch. Und das war sehr cool. Als ich ungefähr 8 oder 9 war, hab ich auch eines gekriegt und begonnen Tagebuch zu schreiben“, beginnt Zlata Filipović im Rahmen der Ausstellung über Kindersoldaten im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) in Wien zu erzählen. „Es war aber ziemlich langweilig, Sätze die ungefähr nur aussagten wie eh alles gut oder so. Und dann war von einem Tag auf den anderen alles anders. Aber nicht nur für mich kam der Krieg überraschend, auch meine Eltern hatten nicht im Geringsten damit gerechnet. Von einem Tag auf den anderen war das Leben ganz, ganz anders. Sarajevo war von den Bergen, die ringsum sind und vorher schöne Ausflugsziele warn, belagert.“
Bald waren die wichtigsten Versorgungsleitungen zerstört. „Wir hatten keinen Strom, kein Gas, kein Wasser. Wasser zu holen war aber sehr gefährlich, viele sind dabei durch Schüsse von den Bergen getötet worden. Bei Fliegerangriffen mussten wir in die Keller, um Schutz zu finden. Dort konntest du nichts machen, nur warten.“
Rund zwei Jahre – von 11 bis 13 – lebte Zlata Filipović mit ihrer Familie und anfangs auch noch einem gelben Kanarienvogel in der belagerten Stadt, „aber es gab kein Futter für ihn und außerdem war’s viel zu kalt für ihn, wir konnten ja nicht heizen“, erinnert sie sich traurig daran, dass er gestorben ist.
Auf die plötzlich spannenderen Einträge in ihrem Tagebuch hätte sie gern verzichten können, wenngleich die ihr und ihren Eltern das Entkommen aus dem Krieg ermöglichten. Journalisten aus Frankreich suchten nach Tagebüchern von Kindern, die die Schrecken des Krieges erzählen. Meines wählten sie dann aus – und dafür halfen sie unserer Familie rauszukommen, Wir lebten dann zuerst in Frankreich, bevor wir nach Irland übersiedelten.“
In Dublin lebt sie heute (2013) noch – als Dokumentarfilmerin, kommt aber seit bald nach dem Krieg möglichst jedes Jahr mindestens einmal nach Sarajevo, „wo viele Verwandte und Freundinnen und von mir leben“.

Nicht zuletzt die kriegerischen Auseinandersetzungen im vormaligen Jugoslawien zeigten die neuen Dimensionen: War im zweiten Weltkrieg jedes zweite Opfer eine Zivilistin/ein Zivilist (also Nicht-Soldaten), so waren hier – und in den meisten Kriegen heute – neun von zehn Toten KEINE Soldaten.
Viele kleine Fähnchen mit roten Händen als deutliches „Stopp“-Schilder stecken im Schnee vor dem Haupteingang zum Heeresgeschichtlichen Museum auf dem Gelände des Wiener Arsenal. Gebastelt wurden sie von Kindern am (damals an mehreren Jahren rund um den) Red hand Day – gegen Kindersoldaten. Es soll ein (kleiner) Beitrag dazu sein, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, dass schon ganz jungen Buben, aber auch Mädchen ihre Kindheit geraubt wird und sie zum Soldaten-Dasein gezwungen werden. Das Museum, das die Geschichte von Militär und Waffen zeigt, will damit nicht zuletzt zeigen, wie grausam Kriege sind.

Nicole Krenn, Katrin Frühaus und Tamara Milosavljević aus der2. Klasse der Berufsschule für Verwaltungsberufe in Wien, die der (damals) Kinder-KURIER beim eigenen Lokalaugenschein im HGM trifft, erzählen dem KiKu nach ihrem Rundgang in der Ausstellung und ihrer Diskussionsrunde mit Zlata Filipović über ihre Eindrücke. Und die waren einerseits bedrückend, andererseits aber auch sehr berührend, „weil es toll war, mit Menschen reden zu können, die das echt erlebt haben“. Deshalb sei dieser Besuch „überhaupt das interessanteste Museum, in dem wir bisher waren“ gewesen. „Es ist sehr schrecklich, dass sogar so junge Menschen schon so Grausames erleben mussten und immer wieder auch müssen“. „Und dass sie dann so einfach darüber erzählen können, dazu gehört schon viel Kraft und Mut, Respekt!“
„Irgendwie hat man ja schon vorher auch davon gehört, aber so viel haben wir nicht gewusst. Und außerdem ist es dann schon noch einmal etwas anderes, wenn du dann wen vor dir hast, die das echt erleiden musste. Das war schon auch schockierend. Und du fühlst dich dann doch richtig machtlos. So was aufzuhalten ist nicht leicht.“
„Außerdem ist das ja alles völlig sinnlos und unnötig, wir können nur froh sein, dass wir in einer Gegend leben, wo’s schon mehr als halbwegs harmonisch zugeht!“
Originalbeitrag erstveröffentlicht im Kinder-KURIER
unicef.de –> Ishmael Beah, ehemaliger Kindersoldat, heute Unicef-Botschafter

Triggerwarnung vorweg. Die sechste und in der Reihenfolge – nicht nur hier, sondern auch am vergangenen Wochenende als sich die jeweils rund 174-stündign Stückentwürfe in der dritten Ausgabe des Theater-Nachwuchsbewerbs im Dschungel Wien – gemeinsam mit dem Drama Forum (Graz) präsentierten: Erst ab 12 Jahren und mit kriegerischen Kampf-Szenen. Letztere nicht als Schauspiel, sondern in einem Set von Legofiguren als Video projiziert: „Kampfbaukasten in 4K“ (Text: Laura Bernhardt; Regie und Sound: Lori Brückner).
Constanze Winkler verkriecht sich als zockender sehr junger Bub, angegeben wird weniger als die 12, die als untere Altersgrenze fürs zuschauen gilt, in einer Art Zelt (Bühne und Kostüm: Julie Fritsch, Stefanie Edlhofer), in dem gleichsam Video gekämpft wird. Mit einschlägigen Sounds und Wortfetzen.

Als reale Gegenspieler:innen treten Merle Zurawski als Mutter, Jakob merkle als älterer Bruder sowie Alexandru Weinberger-Bara als Vater in Erscheinung. Alle drei mit Ganzkopf-Masken, die jede Mimik verbergen. Was einerseits noch präziseres Spiel erfordert. Aber andererseits auch von vornherein eine extreme noch dazu paradox erscheinende Distanz aufbaut. Da die Schauspielerin, die einen Jungen darstellt, der eigentlich in der virtuellen Welt unterwegs ist und dort die in der Realität angesiedelten Figuren, engste Verwandte, die durch die Masken eher künstlich wirken.

Der Kampf des Gamers in der scheinbar digitalen, jedenfalls via Film übertragenen Schlachtenwelt setzt sich in der realen Welt vor allem als Fight mit dem älteren Bruder, dessen (Geld-)Forderungen und Sagern aus seinen aufgesaugten Manosphere-Influencer-„Weisheiten“ fort. In dieser Familie herrscht eine Atmosphäre nicht nur ausgesprochener Feindseligkeiten, die im Raum schwebenden „unsichtbaren“ sind die viel brutaleren.

Doch irgendwie fragwürdig wirkt der mehrfache Bezug der Lego-Maxerl-Videoschlacht auf Stalingrad. Das mögen vielleicht auch schon Jugendliche dieses Alters das eine oder andere Mal, insbesondere im Zusammenhang mit World War II Videospielen gehört haben. Die historische Einordnung dieser Entscheidungsschlacht zwischen der Wehrmacht Nazideutschlands gegen die Armee der Sowjetunion im zweiten Weltkrieg fehlt jedoch meist. Von den Faschisten als die Eroberung des bolschewistischen Feindes gedacht, wurde dieses Gemetzel zum Wendepunkt. Die Rote Armee gewann und so begann – später im Bündnis mit alliierten Kräften aus dem Westen (USA, Großbritannien und dem befreiten Frankreich) – die Niederringung der Nazi-Herrschaft und die Befreiung weiter Teile Europas von der faschistischen Diktatur. Und das in irgendeiner Form einzubauen wird schwierig, Stalingrad ist noch immer eine Art Mythos. Und wäre wohl verzichtbar, Krieg ohne ihn zu verorten als Produzent menschlichen Leids, würd’s auch tun. Noch dazu, wo derzeit allgegenwärtig eine neue Aufrüstungsspirale in Gang gesetzt wurde und wird.
Übrigens, am 12. Februar ist – seit mehr als 20 Jahren – der Red Hand Day, der internationale Gedenktag an das Schicksal von Kindersoldat:innen. Rote Handabdrücke werden auf Transparenten, Plakate usw. als Aktion gemalt, gedruckt, gezeigt, um diesen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu stoppen.

Trümmer einer riesigen Uhr kugeln verstreut auf der Bühne herum (Ausstattung: Killian Chyba, Hanna Masznyik, Marina Schütze). Dieser, der hier besprochene fünfte, ¼-stündige Stückentwurf für den Theater-Nachwuchsbewerb Magma in seiner dritten Auflage, dreht sich also um Zeit. In „Kairos“ (Text und Dramaturgie: Hannah Zauner; Regie: Lukas Schöppl) spielt Caroline Szivak die achtjährige Tilda, die einerseits nach und nach Ziffern und andere Teile der (Kuckucks-)Uhr (wieder) zusammenbaut, die sie unachtsam zerschlagen hat. Und andererseits und noch viel mehr macht sie sich Gedanken über Zeit – ausgesprochen und szenisch dargestellt.

Es ist fast ein – Achtung Wortspiel – zeitloses Thema. Schon DER Klassiker „Momo“ Michael Endes Roman ist vor mehr als einem halben Jahrhundert (1973) erschienen, dutzendfach auf Bühnen dramatisiert und mehrfach – zuletzt im Vorjahr in den Kinos – verfilmt worden, dreht sich genau darum. Das Mädchen Momo, aber auch der alte Straßenkehrer Beppo, schätzen den Moment, den Augenblick, während die Gegenspieler, die grauen Herren, Zeitdiebe sind.
Hier philosophiert Tilda, was alle kennen, warum in einem Fall Zeit uuuuurlangsam und bei anderen Gelegenheiten rasend schnell vergeht, wenngleich vielleicht ein bisschen zu viel auf Klischeebilder zurückgegriffen wird. Schule ist – zum Glück – längst nicht für alle insbesondere jüngere (Volksschule-)Kinder ein Feindbild, bei dem sich Stunden wie Strudelteig ziehen.

Der Kuckuck aus der zerlegten Uhr tritt – in Person von Stanislaus Dick ebenso in Erscheinung wie die Uhroma, deren Uhr es war/ist (Achtung aufs bewusst gesetzt, leider auf der Bühne zu wenig hörbare, h) in Gestalt von Evgenia Stavropoulou-Trska. Sie hat zunächst nur andeutungsweise Auftritte im Hintergrund, im Uhrenrund wird sie zur Zeigerin.

Für die Musik sorgt Philipp Pettauer – auch als Art Chronos, eines zweiten (alt-)griechischen Wortes für Zeit und zwar jenes, das der messbaren, also der Uhrzeit entspricht, während Kairos für den idealen Zeitpunkt steht, an dem Entscheidungen zu treffen wären / sind. Aiṓn (Äon) als dritte Zeit-Bezeichnung aus der antiken Sprache, der in diesem Stückentwurf (noch?) nicht vorkommt, steht für Zeitalter oder auch Lebenszeit.
In der Begegnung des Trios spielen stoffliche und wörtliche Falten – oft als Symbol für zunehmendes Alter – noch eine gewisse Rolle – und auch da wieder mit Wortspielen, denn die Achtjährige pocht auf schon möglichste viele davon, schließlich wolle sie sich ent-falten können.
Wird fortgesetzt mit einem weiteren Beitrag über den sechsten bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwurf.

Ein viereckiges, einige Zentimeter erhöhtes Podest auf der großen Bühne, viel (Theater-)Rauch und ein Weiß-Clown, der – naja, zumindest recht traurig dreinschaut. Und das liegt nicht nur an der Schminke. Er, Kevin Bianco, verkörpert Niedergeschlagenheit in all seinen Bewegungen, in seiner Mimik. Mit einem kleinen Schuss Bemühung, andere vielleicht mit dem einen oder anderen Anflug von gespielter Tollpatschigkeit erheitern zu wollen.
Und dann wird er aus der ersten Publikumsreihe recht unfreundlich angeherrscht: „Das ist mein Zimmer!“ Und er solle sich von dannen machen. Klar, es ist nicht wirklich wer aus dem Publikum, sondern eine Schauspielerin, Gesa Bering. Und auch bald offensichtlich, er wird es nicht tun und die beiden – nun ist sie bereits auf dieser Bühne und gleich auf dem Podest – kommen aus diesem anfänglichen Gegensatz miteinander ins Gespräch. Erst stark contra gebend und dann doch immer versöhnlicher werdend.
Was sich hier offenbar in einem Krankenhaus abspielt, setzt einerseits auf gedankliche Verbindungen zu den seit Jahrzehnten bekannten Humor-Doktor:innen in Spitälern. Weltweit – ausgehend vom US-amerikanischen Arzt, Profi-Clown und „Sozial-Aktivisten“ Patch Adams – setzen mittlerweile meist gut ausgebildete Clown:innen in Krankenhäusern auf „Lachen als (beste) Medizin“, die professionelle ärztliche Behandlungen nicht er-, sondern unterstützen.
Das ist aber – trotz der doch dominierenden Figur des hier (bewusst) recht traurigen Clowns – nur die eine Seite. Viel tiefer gehend, wenngleich natürlich stark damit verwandt, dreht sich das Spiel von Kind und Clown um – vor allem in und nach der Corona-Zeit, stärker in den Blickpunkt gerückte – Mental Health (psychische Gesundheit). Und subtil, ohne es groß auszustellen, wird auch angespielt, dass sich gerade Jungs und Männer noch immer eher schwertun, Gefühle zuzulassen oder gar darüber zu reden – „nein, ich bin nicht traurig“ manifestiert der Clown recht lange.
Schon der Titel dieser ebenfalls „nur“ ¼-stündigen Performance, die ja lediglich, wie fünf andere ein Stück-Entwurf im Rahmen des Wettbewerbs Magma (2026, dritte Ausgabe) war: „Uns geht’s gut – ein Fiebertraum“ von einem Kollektiv, das sich „The dark comedy united“ nennt. Und damit schon die Doppeldeutigkeit mitschwingen lässt (Text: Text: Mario Wurmitzer; Regie: Ira Süssenbach). Und so „nebenbei“ vielleicht auch die Oberflächlichkeit formelhafter Begrüßungen demaskiert. Wird doch in Begegnungen immer mehr statt „wie geht’s?“ – wo übrigens auch meist keine Antwort erwartet oder gar erwünscht wird – durch „Geht’s gut?!“ ersetzt.
Die beiden jedoch reden tatsächlich miteinander, öffnen sich jeweils und lassen damit auch Hoffnungs(träume) zu.
Wird fortgesetzt mit weiteren Beiträgen über die anderen bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwürfe.

Eine kinderlebensgroße Puppe in einem Kinderbett starrt auf ein Handy, neben sich im Bett ein großes, grünes Stoff-Krokodil, vor dem Bett ein Stoffball. Rund um diese Installation auf dem Platz der Menschenrechte beim Wiener MuseumsQuartier stellten sich junge Erwachsene in roten bzw. hellblauen Westen auf. Sie sind Teil des neuen Jugendbeirates des Österreich-Zweiges von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Michael, Harleen, Naomi, Jad, Florian, Sabrina und Jasmin und dazu noch Charlotte (bei der UN-Organisation für Jugend-Partizipation und Engagement verantwortlich) wollten mit der auffälligen Aktion auf ihre Anliegen in Sachen Schutz und Sicherheit in der Online-Welt, insbesondere auf den unsozial gewordenen Plattformen hinweisen.
Zentrale Themen, die ihnen dabei besonders wichtig waren, fassten sie in Adjektiven zusammen – positive im Unicef-blau: Respektiert, informiert, geschützt und geliebt. Die negativen, Gefahren und Risiken trugen die Kolleg:innen in den roten Warnwesten in schwarzer Farbe: sexualisiert, desinformiert, ausspioniert und gemobbt.
Eine erste konkrete Sicherheitsmaßnahme setzten sie selber, indem sie für die Fotos mit den genannten Begriffen, ihre Gesichter gut zur Hälfte vermummten, um zu verhindern, dass ihre Fotos mit gut erkennbaren Gesichtern und diesen Begriffen missbräuchlich verwendet werden.
Mit der Aktion „Digitalen Schutz im Kinderzimmer“ im aktuellen Safer Internet Monat und vor dem internationalen Safer Internet Day (2026 am 10. Februar, immer am zweiten Februar-Dienstag) wollte bzw. will der Jugendbeirat, aber auch Unicef Österreich insgesamt „deutlich machen: Digitaler Kinderschutz ist kein Randthema, sondern eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Kinder und Jugendliche wachsen heute in dieser digitalen Welt auch online auf – doch Schutz, Aufklärung und klare Regeln halten damit oft nicht Schritt. Unser Ziel ist es, Bewusstsein für die Risiken digitaler Räume zu schaffen, Gespräche mit Passant:innen, Eltern und Großeltern anzuregen und gleichzeitig konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen. Wir wollen zeigen, dass echte Sicherheit nicht durch oberflächliche oder rein technische Maßnahmen entsteht, sondern durch Bildung, Aufklärung und klare politische Rahmenbedingungen“, wird die 20-jährige Sarah zitiert.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… interviewte selber drei der Jugendbeiratsmitglieder – das Gespräch mit Florian, Jad und Jasmin folgt in einem eigenen Beitrag, der am Ende unten verlinkt ist.
Jugendbeiratsmitglied Michael (19) betont die Wichtigkeit von Jugendpartizipation bei der Erarbeitung von Lösungen: „Junge Menschen wollen bewegen und mitgestalten. Egal ob es um moralische Fragen von Datenschutz und Kontrolle, um die Regulierung von Inhalten oder um den Schutz von Meinungen geht. Wir müssen eine digitale Welt schaffen, fernab von für Kinder schädliche Inhalte und mit Blick auf die mentale Gesundheit aller. Wir müssen den digitalen Raum aktiv mitgestalten dürfen und ihn gemeinsam mit anderen Generationen und Kulturen so einfordern wie wir ihn wünschen.“
Zur Aktion der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen auf dem Platz der Menschenrechte gesellte sich mit Barbara Meier, Schauspielerin, Model und Ehrenbeauftragte von Unicef-Österreich auch prominente Unterstützung. „Als Mama mache ich mir Sorgen, wie es künftig für meine beiden Töchter einmal in der digitalen Welt sein wird. Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir Kinder mit den Online-Gefahren nicht alleine lassen und dass wir sie als Eltern und als Gesellschaft zu Hause und in der Schule bei diesem Thema begleiten.“
Unicef Österreich fordert Regierungen, Regulierungsbehörden und Unternehmen auf, über einfache Slogans und pauschale Verbote hinauszugehen und gemeinsam mit Kindern, Familien und Fachexpert:innen daran zu arbeiten, Social-Media-Umgebungen zu schaffen und zu regulieren, die von Grund auf sicher, inklusiv und rechtskonform sind.
Außerdem verweist Unicef anlässlich des Safer Internet Days nochmals auf die eigene Petition „Online sicher – für jedes Kind“ für mehr Kinderschutzmaßnahmen auf Plattformen, digitale Bildung für jedes Kind sowie Einbeziehung junger Menschen, über die KiJuKU.at schon berichtet hat – Beitrag unten verlinkt; ebenso auf die Verurteilung von KI-generierten sexualisierten Bildern von Kindern – ebenfalls unten verlinkt.

Ein generelles Social Media Verbot unter einem gewissen Alter berge auch Risiken und könnte nach hinten losgehen, meinte Unicef Österreich rund um diese Aktion. „Wenn Kinderrechte missachtet werden, könnte das etwa dazu führen, dass Kinder von Informationen, Freundschaften und Unterstützung abgeschnitten werden, die sie anderswo nicht finden können – besonders bereits ohnehin marginalisierte Kinder. Junge Menschen könnten in unsichere, unregulierte Räume gedrängt werden und viele Kinder umgehen Altersgrenzen ohnehin.
Klara Krgovic-Baroian, stellvertretende Leiterin der Abteilung Advocacy & Kinderrechte, betont: „Es ist eine genaue Abwägung und ein ganzheitlicher Ansatz notwendig. Kinder bis zu einem gewissen Alter von Social Media auszuschließen kann zum Schutz beitragen, darf aber keine Ausrede dafür sein sonst keine weiteren Schutzmaßnahmen auf Plattformen zu setzen. Zudem muss sichergestellt sein, dass Kinder den Umgang mit Plattformen lernen, bevor sie Zugang zu diversen sozialen Netzwerken erhalten.“
Darüber hinaus braucht es bessere Moderation von Inhalten, altersgerechte Designs und vorgegebene Kinderschutzeinstellungen, die ihre Daten schützen. Bei der Umsetzung von Altersüberprüfungen müssen Kinderrechte wie Datenschutz und Nicht-Diskriminierung beachtet werden – es gilt genau hinzuschauen: Wie wird die Überprüfung durchgeführt? Welche Informationen über die Kinder erhalten die Plattformen? Haben alle Kinder die Möglichkeit, ihr Alter nachzuweisen, oder sind manche Kinder davon ausgeschlossen, weil etwa Dokumente fehlen oder nur eine einzige zu komplizierte Methode zugelassen ist?

Am Tag vor dem internationalen Safer Internet Day (heuer am 10. Februar 2026, zum 23. Mal, immer am zweiten Februar-Dienstag) stellte der – neue – Jugendbeirat von Unicef Österreich ein Kinderbett auf den Platz der Menschenrechte vor dem MQ-Wien. In das legten sie eine kindegroße Puppe, die in ihr Handy starrt – mehr dazu in einem eigenen Beitrag, am Ende des Interviews verlinkt. Dem Jugendbeirat gehören zwölf Jugendliche bzw. junge Erwachsene an, sieben konnten zur Aktion in Wien kommen. Florian, Jad und Jasmin sprachen mit KiJuKU.at

KiJuKU: Zunächst einmal, aus dem riesigen, umfangreichen Thema Sicherheit im Internet, digitaler Kinderschutz, wie haben Sie was ausgewählt, um es in dieser Aktion darzustellen?
Jad (18): Wir als Jugendbeirat haben uns im Unicef-Büro getroffen. Uns ist ein sicheres Internet, Safer Internet, ein riesengroßes Anliegen und dachten uns, wie können wir als Jugendliche dazu beitragen, dass es ein sicheres Netz für Kinder gibt. Wir haben diskutiert und dachten uns, dass eine öffentliche Aktion mit einem Kind auf einem Bett die beste Möglichkeit wäre, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu schaffen. Damit Passant:innen darauf aufmerksam werden, dass Kinder auch in Gefahr sind, wenn sie auf dem Bett liegen – nur durch das Smartphone.
KiJuKU: Da war also die Umsetzung, die aufmerksamkeitserregende Aktion da. Was waren oder sind für Sie die wichtigsten Gefahren, die Sie thematisieren wollten?
Florian (20): Die, die man an den Schildern, die wir auf unseren Westen tragen, sieht: Ausspioniert, gemobbt, sexualisiert, desinformiert. Es war uns auch wichtig, das zu personifizieren, zu repräsentieren, dass also immer eine oder einer von uns stellvertretend eine solche Erfahrung zeigt. Um zu dokumentieren, wie alltäglich und wie nah diese Gefahren sind.
KiJuKU: Wie gehen Sie selber mit möglichen Gefahren um? Haben Sie schon ungutes in der Online-Welt erlebt?
Jasmin (18): Am besten umzugehen, finde ich, ist mit Desinformationen, weil man da mit Nachfragen, Recherchieren und Wissen dagegen ankann. Am schlimmsten ist es, glaube ich, bei Sexualisierungen. Natürlich sind eben auch ausspionieren, Absaugen persönlicher Daten und Mobbing große Gefahren. Da finde ich, ist immer die beste Lösung, mit anderen – echten Menschen, auch Erwachsenen – zu reden, Hilfe zu suchen…
KiJuKU: Und machen Sie das auch selber? Manchmal ist es ja so, dass du dir sagst, das wäre gut, aber in der Wirklichkeit, naja? Und bleibt dennoch auch auf unguten Videos hängen…?
Jad: Ich glaub, dass das vor allem bei KI-Videos passieren kann, wo du dann oft nicht weißt, ist das echt oder gefaked. Und das kann schon verunsichern.
KiJuKU: Nachdem derzeit ja massiv über Verbote und Altersgrenzen diskutiert wird, wie stehen Sie dazu?
Florian: ich denke, dass es zwar gut gemeint ist, es greift aber zu kurz. Meiner Meinung nach sind es oft oder fast immer die einfachsten Lösungen, die gut klingen, aber nicht so gut funktionieren.
Jad: Das ist meiner Meinung nach eine sehr oberflächliche Lösung, denn Jugendliche können sehr wohl VPN (virtuelle private Netzwerkverbindungen), Darknet nutzen oder was auch immer. Verbote werden nicht helfen. Was wir brauchen, ist Medienbildung und Medienkompetenzen, sodass Jugendlichen sich in Medien auskennen.
KiJuKU: Finden Sie, gibt es davon genug oder zu wenig? Und wenn zu wenig, wo und von wem sollten diese Kompetenzen vermittelt werden?
Jasmin: Es gibt zu wenig. Es gibt zwar das Fach digitale Grundbildung in dem Kinder ein bisschen über digitale Plattformen lernen, aber kaum bis nichts über Social Media. Da befinden sich aber Kinder und Jugendliche die meiste (Frei-)Zeit und nicht auf Word, Excel oder Powerpoint.
KiJuKU: Könnte das aber auch daran liegen, was die, die unterrichten selber wissen oder nicht wissen?
Florian: Auf jeden Fall, ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer, die uns heute unterrichten, haben ja eine ganz andere Digitalisierung mitbekommen. Und ich glaube, alles gleich zu verbieten, wäre der falsche Schritt. Aber man muss eben schauen, dass Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte eben auf den neuesten Stand kommen bei der Digitalisierung, die sich eigentlich auch fast täglich verändert.
KiJuKU: Danke, Shukran Dzasilan, Modsha kheram / Kheli mamnoon / Sepaz
kijuku_heinz

„Gekommen, um zu bleiben“ seien die eher schon unsozialen Medienplattformen ebenso wie „KI, die größte technische Disruption“, so der unter anderem für Digitalisierung (neben Verfassung, öffentlichem Dienst und Kampf gegen Antisemitismus) zuständige Staatssekretär Alexander Pröll am Montag. Seine Aussagen erfolgten beim Mediengespräch zur aktuellen Studie von Safer Internet.at zu KI-Chatbots, die von 94 Prozent der befragten 500 Jugendlichen (11 bis 17 Jahre) genutzt werden – ausführlicher Beitrag zu dieser Studie weiter unten verlinkt.

Während er (1990 geboren also ein Mitt-30er) sich noch per Telefon mit Freunden zum Fußballspielen verabredet habe, würden heutige Kinder und Jugendliche stundenlang am Handy abhängen. „Im Idealfall wird es – gemeinsam mit dem Koalitionspartner – eine europäische Regelung zur Altersbegrenzung des Zugangs zu Social Media geben.“ Wenn dies zu langsam kommen würde, dann lieber ein österreichischer Alleingang, so Pröll.
Aber noch wichtiger sei die „digitale Kompetenz-Initiative mit Gratis-Workshops und mehr digitale Bildung in den Schulen. Als Gesellschaft haben wir alle miteinander Verantwortung, Kinder und Jugendliche bestmöglich zu schützen. Die KI bietet enormen Chance, die sollten wir nutzen, aber auch die Risiken bestmöglich“ in den Griff kriegen, so der Staatssekretär.
Die vielen Ergebnisse und Antworten der befragten Jugendlichen präsentierten Barbara Buchegger von Safer Internet, Birgit Satke von Rat auf Draht und Stefan Ebenberger von ISPA – Internet Service Providers Austria. Buchegger, die übrigens vorschlug, statt Social Media bzw. soziale Netzwerke „Kurzvideoplattformen“ zu sagen, wies unter anderem darauf hin, dass viele der Befragten blauäugig viel zu viele private Daten und Informationen in Gesprächen mit KI-Chatbots preisgeben.
„Wir müssen transparenter machen, warum es nicht gescheit ist, allerpersönlichste Informationen weiterzugeben, bewusster machen, dass KI ein Werkzeug ist und dürfen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nicht die Fehler wiederholen, die wir bei den Plattformen gemacht haben“, nämlich sie mehr oder minder laufen zu lassen. Es brauche taugliche Schutzmaßnahmen („Safeguards“), Werbung müsse ebenso als solche gekennzeichnet werden, wie Bilder, Videos, Material, das mit KI erstellt wurde. Neben diesbezüglicher Bildung in Schulen und für und durch Eltern brauche es auch die entsprechende Vorbildwirkung Erwachsener.
Buchegger thematisierte aber auch noch die Gefahr einer neuen digitalen Kluft, denn die „Kommunikation mit KI-Chatbots erfordere, gut beim Formulieren zu sein, hohes Sprachvermögen und -gefühl“.
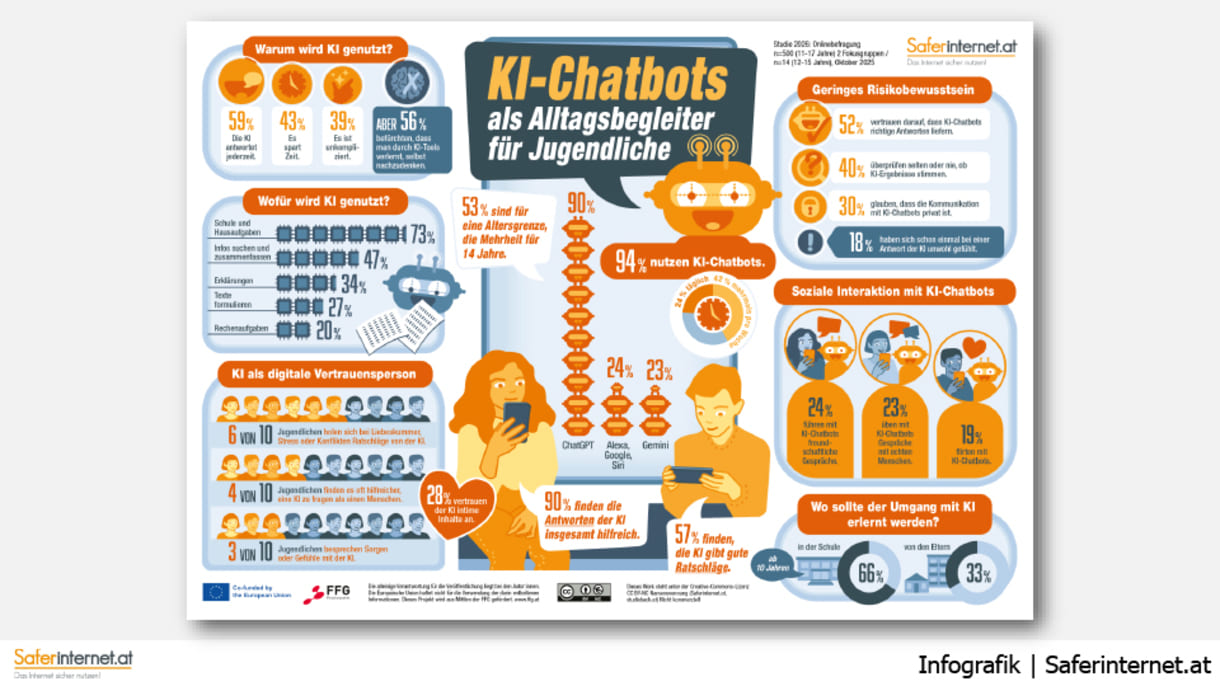
Birgit Satke von Rat auf Draht berichtete unter anderem, dass im Gegensatz zu früher, wo viele Jugendliche sich mit klassischen Teenager-Fragen an die kostenlose, rund um die Uhr erreichbare Hotline 147 gewandt haben, heute oft Anfragen kommen, „wie kann ich ein Gespräch beginnen“ mit vielen Ängsten vor Zurückweisungen oder gar komplizierten Gesprächen“. Dies erkläre, warum sich der Umfrage zufolge viele der 500 Jugendlichen lieber an KI-Chatbots wenden als mit echten Menschen zu reden. „Wobei wir oft am Beginn gefragt werden, ob wir echt oder KI sind.“
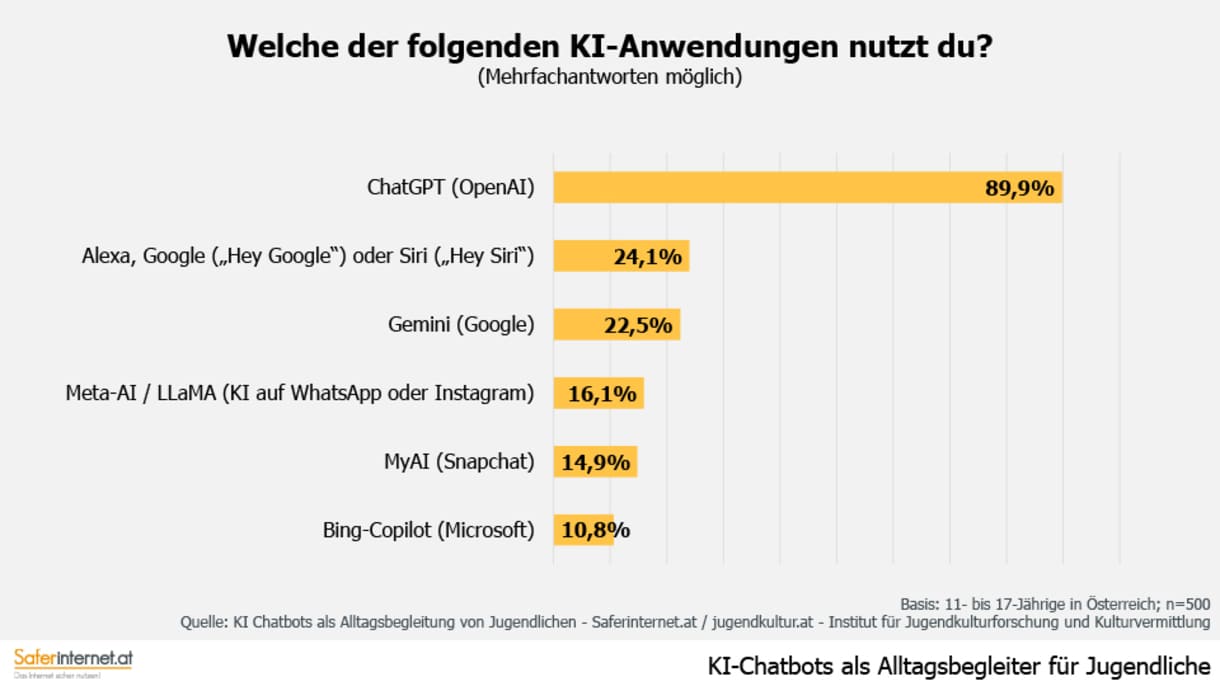
Während die (mediale) Öffentlichkeit heftig über den Plan des Bildungsministers diskutiert, Künstliche Intelligenz in die schulischen Lehrpläne aufzunehmen und dafür Lateinstunden zu kürzen, nutzen Jugendliche längst KI – in einem vielleicht sogar überraschend hohem Ausmaß. Dies ergab die aktuelle für den Safer Internet Day, den mittlerweile 23. dieser von der EU-Kommission ins Leben gerufenen Initiative: Mehr als neun von zehn (94 Prozent) der – online – 500 befragten 11- bis 17-Jährigen nutzen KI-Chatbots; und da wiederum üüüberwiegend (89,9%) ChatGPT, gefolgt von Alexa, Siri, Gemini … (rund ein – weiteres – Viertel). Und dennoch stimmten 53 Prozent der Aussage zu „ich würde gern mehr dazu lernen, wie KI eigentlich funktioniert“. Und zu zwei Drittel wünschen sich die Befragten, dass sie dies in der Schule lernen sollten (66,3%), gefolgt von einem Drittel durch die Eltern sowie einem Fünftel (Mehrfachnennungen waren möglich) durch Videos, Foren usw. im Internet.
Als Motiv, weshalb sie KI-Tools nutzen, meinten fast ¾ (71%) „aus Neugierde“, mehr als die Hälfte – Mehrfachnennungen (!) – „für Ratschläge und Tipps zu verschiedenen Lebensbereichen“ (55%), „zur Unterhaltung, gegen Langeweile“ (43%), „um Sorgen, Probleme oder Gefühle zu besprechen“ (30 %), „um Stress oder Ärger abzubauen“ (26 %), „für freundschaftliche Gespräche“ (24 %), „um Gespräche mit echten Menschen zu üben“ (23 %) sowie „für romantische oder flirtende Gespräche“ (19 %).
Ratschläge von ChatGPT schätzten fast sechs von zehn (57%) als gut ein, auch noch mehr als die Hälfte (52%) „vertrauen darauf, dass KI-Tools wie ChatGPT richtige Antworten liefern“.
Bei der Frage nach den Anwendungsgebieten bzw. Zwecken nannten fast drei Viertel Schule und Hausaufgaben, fast die Hälfte (natürlich überschneidende Auskünfte) „Informationen suchen oder zusammenfassen“ und noch ein Drittel „Erklärungen“. Als Übersetzungswerkzeug bedient rund ein Fünftel (18,3%) künstliche Intelligenz. Jede/r Fünfte nutzt KI als Gesprächspartner:in, fünf Prozent auch um „persönliche oder ernste Themen zu besprechen“ – was allerdings widersprüchlich wirkt zu den oben zitierten Angaben von den selben Befragten in der selben Studie.
Übrigens ergab die von Safer Internet.at in Auftrag gegebene und vom Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung durchgeführte Online-Umfrage (Oktober und November 2025), dass Mädchen öfter täglich ChatGPT nutzen (25,7%, Burschen: 21,6%) und bei schulischen und Haus-Aufgaben bzw. zu Zusammenfassungen von Informationen deutlich öfter die künstlichen Werkzeuge bedienen (78,1 sowie 50,8% vs. 68.1 und 44 %). Sie sind allerdings auch skeptischer, was die Antworten / Ergebnisse betrifft. „Sehr hilfreich“ fanden nur 29,4% der Mädchen die KI-Antworten, während dies fast vier von zehn ihrer männlichen Kollegen taten (39,3%). Dafür fühlten sich Jungs fast zu einem Viertel (23,2%) „schon einmal bei etwas, das die KI gesagt oder getan hat, unwohl“, bei den Kolleginnen lag dieser Anteil mit 13 Prozent deutlich darunter. Und, Mädchen prüfen öfter nach, „ob Ergebnisse von KI-Chatbots stimmen“ – zu fast einem Viertel (24,4 Prozent) gegenüber nur einem Fünftel (20%) bei Jungs.
Die oben schon genannten hohen Vertrauenswert auf die Antworten künstlicher Intelligenzen schlägt sich auch in einem anderen Bereich nieder. Mehr als ein Viertel der Befragten stimmt sehr bis eher zu, dass die via KI-Chatbots gemachten Eingaben vertraulich wären und „von niemandem gelesen oder genutzt werden können“.
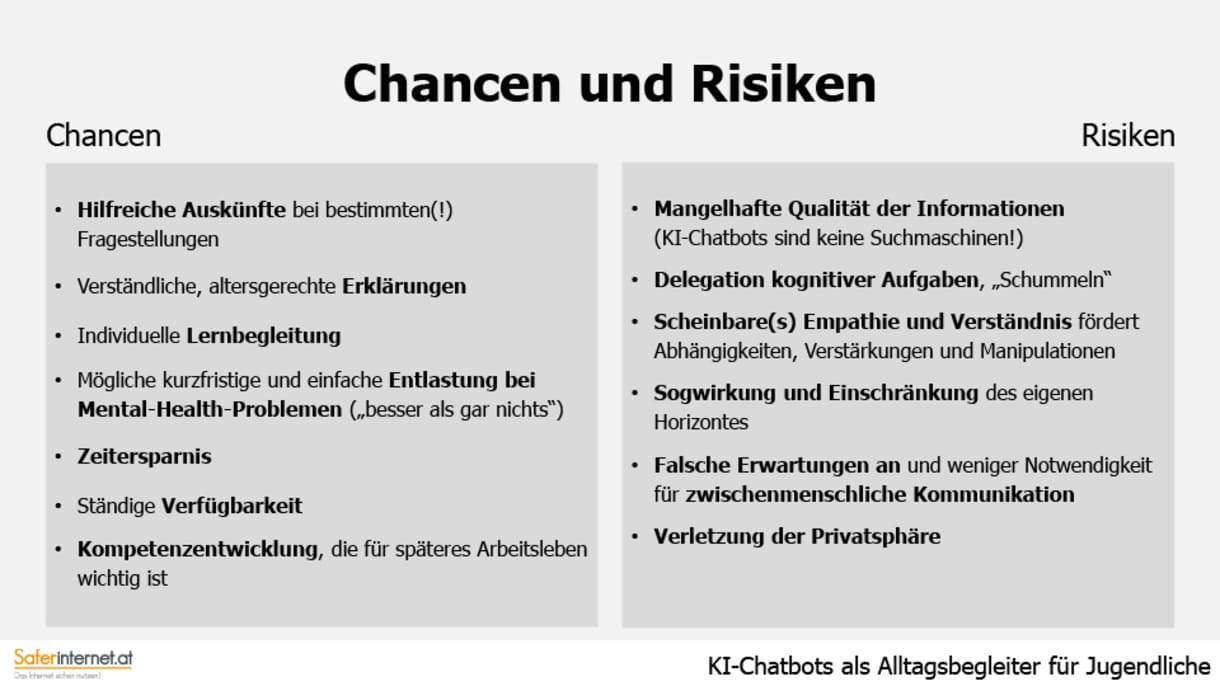
491 der 500 Jugendlichen beantworteten auch mit stimme (eher) zu auf die Aussagen, ob KI-Chatbots zu fragen „oft hilfreicher“ sei „als einen Menschen zu fragen“. Vier von zehn bejahten dies. Mehr als ein Viertel (28 %) vertraut einem Chatbot „eher intime Dinge an“. Und für gar 29 Prozent der 11- bis 17-Jährigen kann KI ein Freund / eine Freundin sein und fast glich viel (28%) erwarten sich Trostspenden, ein Viertel (26%) „glauben, dass sich Jugendliche in einen Chatbot verlieben können“.
Als Gründe für diese hohen Werte nennen die Befragten vor allem, dass die KI immer und zu jeder Zeit antwortet (fast 60%), „es ist unkompliziert“ (38,6%) UND“KI verurteilt mich nicht“ (14,7%).
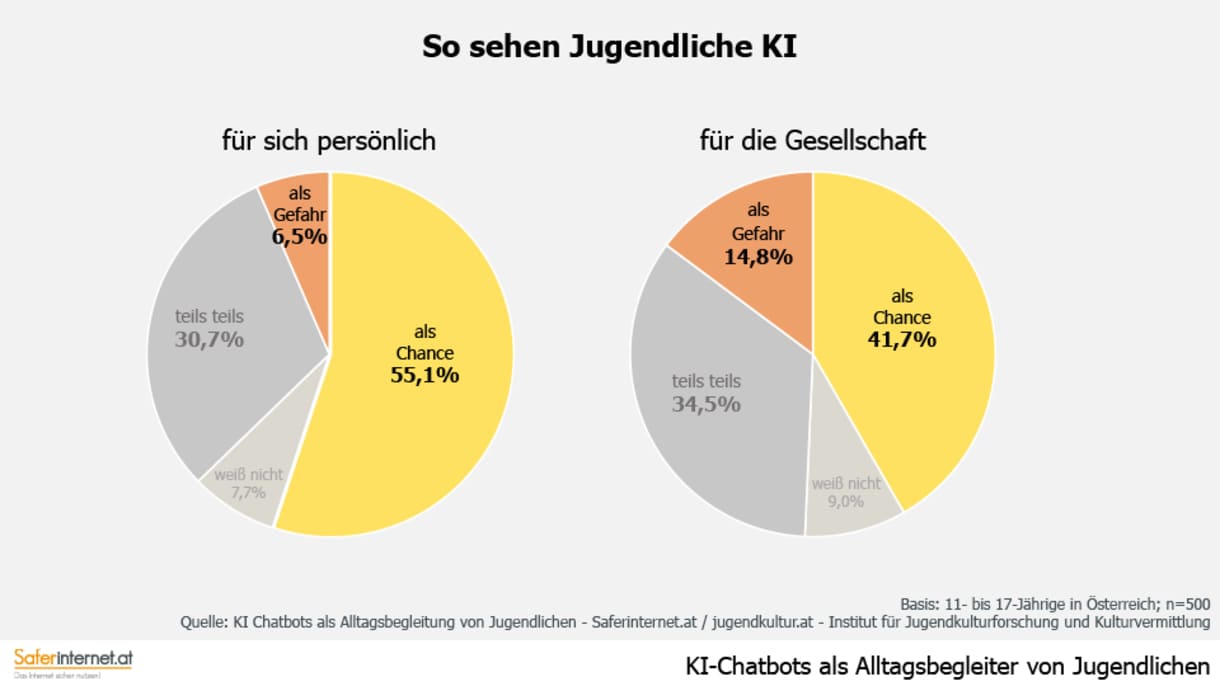
Gefragt wurden die 11- bis 17-Jährigen, wie sie KI einschätzen. Und da meinten mehr als die Hälfte (55,1%) „als Chance für sich persönlich“, aber „nur rund vier von zehn als Chancen für die Gesellschaft (41,7%). „Als Gefahr“ aber schätzen die befragten 500 Jugendlichen KI für die Gesellschaft lediglich zu 14,8%, für sich persönlich gar nur zu 6,5%.
Nachdem ja seit Monaten intensiv über Altersgrenzen für Social Media diskutiert wird, wurden die 500 Jugendlichen auch nach Limits in Sachen KI-Chatbots befragt. Mehr als die Hälfte (53%) sprachen sich dafür und konkret mehrheitlich für 14 Jahre aus. Aber, so die 11- bis 17-Jährigen „ab 10 Jahren soll der Umgang mit KI erlernt werden“.

Ein Dreieckszelt aus Patchwork-Stoff trägt die Buchstaben des Namens der Protagonistin. ANNI. Das I ist durchge-ixt und daneben ein E. Denn Schluss mit der verniedlichten Form.
„Morgen wird ich 11!“ und so müssen auch die bisherigen – auch sehr geliebten – Spielsachen weg. In einen großen braunen Karton. Oder sie werden von Fanny Holzer, die dieses Mädchen verkörpert, in hohem Bogen durch die Luft geschleudert. Alles sozusagen babysch in „Dings – all unsere kleinen Dinge“, einem der sechs jeweils rund ¼-stündigen Stück-Skizzen für die dritte Runde von Magma, dem Nachwuchspreis von Dschungel Wien (Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier) und Drama Forum (Graz); zwei Präsentationen wurden hier schon vorgestellt – Links am Ende des Beitrages, die anderen drei folgen in weiteren Beiträgen der Reihe nach.
So, nun wieder zu „Dings“ bzw. Anne, wie sie nun genannt werden will. Und für die Party auf einschlägige Live-Hack-Videos einer angesagten Influencerin, der DIY-Marie, schaut, um sich vorzubereiten. Auch die richtigen Posen für Selfies zu üben…
Und natürlich geht nicht alles glatt. Dramatik, Spannung braucht’s. Auch und nicht zuletzt im Theater (Text: Nadja Lotz; Regie: Anja Jemc). Und so wehrt sich die jahrzehntelang abgeschnuddelte, mit Bussis, Speichel und Rotz getränkte allerallerliebste Stoffpuppe gegen ihr Ausmisten. Und damit natürlich Annes Innerstes. Oder sind es noch die tiefsten Gefühle von Anni?

Jedenfalls erwacht diese Puppe, die bisher immer nur sagte und machte, was Anni wollte, im Widerstand gegen Anne zum leben – in Gestalt der Schauspielerin Alina Kesselbacher in einem mit unzähligen Kuschel- und anderen Figuren übersäten Kostüm (Bühne und Kostüm: Lena Hirschenberger). Die Anni sei viel eigenständiger gewesen, so „Dings“: Du hingegen, liebe Anne, machst nur, was dir diese Typen aus den Social Media raten, vorschreiben… – wird indirekt ein Aspekt der aktuellen Debatte um Altersgrenzen beim Zugang zu Plattformen angespielt. Und noch viel mehr das Hin- und Her-Gefühl von (Jung-)Pubertierenden, aber generell von Trennungen – von Menschen, aber nicht zuletzt auch von Dingen.
Wird fortgesetzt mit weiteren Beiträgen über die anderen bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwürfe.

Magma – der Begriff für so heiß gewordenes Gestein im Erdinneren, dass es zäh fließt, in Vulkanen an die Oberfläche drängt und dort als Lava rausrinnen kann – ist auch der Titel des nunmehr zum dritten Mal von Dschungel Wien und Drama Forum (Graz) ausgeschriebenen Theater-Nachwuchsbewerbs. Nach mehreren Jahren „Try Out“ – ohne der Grazer Institution – spielten am ersten Februar-Samstag 2026 fünf neue zusammengestellte Kollektive viertelstündige Ausschnitte möglicher künftiger Stücke für Kinder und eines für Jugendliche (ab 12 Jahren) vor. „Brachland“ (ab 6 Jahren) wurde hier im ersten Teil besprochen, nun folgt die Kritiken zu einer weiteren Präsentatio, wie schon oben im Untertitel erwähnt: „Augustine Feuerfluss“; selbstverständlich folgen auch die restlichen vier – in weiteren Beiträgen.
Magma, sozusagen zum Dritten, spielt in „Augustine Feuerfluss“ als laaaaange rote Stoffbahn eine so große Rolle, dass sie Teil des potenziellen Stücktitels wurde, eben Feuerfluss (Text: Katharina Cromme; Regie: Alexandru Weinberger-Bara; Bühne und Kostüm: Veronika Müller-Hauszer; Sound: Alex Huber). Paula Belická spielt das Mädchen Augusta Augustine – „die Eltern konnten sich nicht einigen, so hab ich beide Namen“. Wobei sie – neu in eine Klasse kommend – kaum wer so oder in der anderen Vollversion, sondern eher in Abkürzungen nennt. Wenn überhaupt. Eher ist sie entweder außen vor. Oder sehr innen drin. Zurückgezogen in einer senkrecht von der Decke hängenden Röhre aus verschiedenen Stoffschichten. Und dann verwandelt – in einen Elch. Der hat Angst vor einem Wolf.

Sie, als Kind, hat diese Angst nicht. Allerdings kann Lehrerin Kleinlich ihr schon Angst einjagen. Auch aufgrund von Missverständnissen, die sich aus durchaus wohlgemeinten Sätzen ergeben. Sie möge sich den anderen Kindern der Klasse vorstellen. Und stellte sich einige Schritte nach vor. Oder schließt die Augen, um sich etwas vorzustellen – Vulkane.
Nähren sich Augusta Augustines Ängste aber auch aus ihrem Innersten, sozusagen aus Magma, das siedend heiß nach außen dringen will und als Lava es dann tatsächlich tut – siehe Beginn dieses Abschnitts. Da tanzt die Performerin wild mit der roten Stoffbahn und bringt diese selber zum Pirouetten und spiralförmigen Tänzen.

Passagenweise wirkt die Performance sehr lehrstundenhaft – Hörner vs. Geweih, Vulkan-Erklärungen – und erschließt sich dramaturgisch erst aus dem kurzen Nachgespräche, dass die Solo-Figur eine Autistin darstellen soll, um Neurodiversität vs. Normalität zu thematisieren.
Wird fortgesetzt mit weiteren Beiträgen über die anderen bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwürfe.

Ein Baustellen-Absperrband verschließt an diesem ersten Februar-Samstagnachmittag des Jahres 2026 den Zugang zu Bühne 2 des Theaterhauses für junges Publikum im Wiener MuseumsQuartier. Die Überbreite des rot-weiß-gestreiften Bandes einer- sowie die Ankündigung der drei folgenden Performances, die mit „geheime Hintereingänge“ beginnt andererseits geben Hinweise: Das könnte Teil der Inszenierung sein.
Ist es auch. Vor dem „Hintereingang“ neben der Garderobe steht eine Lautsprecherbox. Eine Person mit Mikro öffnet die Glastür und bitte das Publikum ihr zu folgen. Zwischen Regalen, Boxen, Technik- und anderem Zeugs geht’s mehrmals ums Eck in den kleineren der beiden mit Tribünen ausgestatteten Säle im Dschungel Wien. Die Tribüne ist ebenfalls baustellen-band-gesperrt.
Stattdessen urviel Theaterrauch, ein riesiges aufgeblasenes Ding, das wie eine überdimensionale Sitzpolster-Landschaft ausschaut, aber alles andere als einladend wirkt. Auch so gedacht ist – also nicht zum Sitzen. Einige schwarze Klebelinien auf dem Boden, die an verkohlte Äste erinnern. Kristin Jackson Lerch ergreift die Stimme, rezitiert Gedichtzeilen, wird später auch singen und sich erinnern, hier Star gewesen zu sein. Das Teil ist ein altes, verfallendes, von der Natur Stück für Stück zurückerobertes Theater. „Brachland“ heißt die Performance.
Der Lost Place – aus Sicht vieler Menschen – ist Heimstatt für eine wie aus dem Nichts und schrill auftauchende Fledermaus (Antonia Meier). Ihr droht der Verlust ihrer Unterkunft, denn das Haus soll abgerissen werden. Wer braucht heute noch Theater? Wofür soll das gut sein? Fragen, die auch angespielt werden.
Aber mehr noch das Verhältnis zwischen – von Menschen errichteten Bauwerken und Natur. Verdrängung einer-, Rückeroberung andererseits. Und in dieser zweitgenannten Phase das Dazwischen von Brache. Für viele nichts anderes als mögliches, erforderliches Bauland, für andere Möglichkeit für Zwischennutzungen, oftmals künstlerischer Natur samt der Chance, über den Umgang von Menschheit mit dem Planeten in vielfältiger auch performativer Form nachzudenken. Vor fast zwei Jahren gab’s in Wien ein eigenes Festival dazu: Brachiale mit einem extrem gedehnten groß geschriebenen H als langem Freiraum (siehe Fotos des Buchcovers oben; Logo übrigens: Michael Bigus) auf und rund um den „Zukunftshof“ in Rothneusiedl, samt nachfolgendem Sammelband mit Beiträgen aus unterschiedlichsten Perspektiven – Link zur Website unten am Ende des Beitrages.
Ach ja, aus dem einstigen Bühnenstar wird nun ein Schwammerl, ein Pilz mit Verbindungen zum großen Myzel, dem größer und mächtiger werdenden Aufblas-Ding.
Das Publikum darf, nein muss, übrigens nicht nur auch Schleichwegen in den Theatersaal. „Brachland“ (Text vom gesamten Team gemeinsam; Regie: Anaïs-Manon Mazić; Bühne und Kostüm: David Degasper, Alma Rothacker; Sound: Jan Aimé Fräulin) hat die ¼ Stunde so angelegt, dass Zuschauer:innen an manchen Stellen auch zu Mitwirkenden – ob Rhythmuserzeugend sogenannte Schädlinge bekämpfend, oder eben das alte Theater besetzende Aktivist:innen – werden.
So nebenbei wirkt „Brachland“ wie ein kleiner Schlenker zur beschlossenen, dank zentraler Budgetknappheiten der Republik verschobener Übersiedlung des Hauses der Geschichte Österreich aus den mehr als beengten Räumlichkeiten in der Neuen Hofburg ins ein wenig zu erweiternde MuseumsQuartier. Dem neuen HdGÖ werden Teile der jetzigen Dschungel-Wien-Räumlichkeiten (u.a. Bühne 3) weichen und verlegt werden.
Die oben erwähnte Viertelstunde war kein Fehler. „Brachland“ ist (noch?) kein fertiges Stück, sondern ein Entwurf, ein Teil eines Projekts, das sich – wie fünf andere – an diesem Tag in Aktion vorstellte. Dies ist die dritte Ausgabe des Nachwuchsbewerbs „Magma“, der den vorherigen „Try Out“ ablöste. Wie auch bei letzterem übernimmt der Dschungel Wien, der ihn – beim neuen gemeinsam mit dem Drama Forum aus Graz – die ausgewählte Stück-Skizze zu einem nachmittag-füllenden Stück weiterzuentwickeln und in der kommenden Saison auf den Spielplan zu setzen.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wird nach und nach auch die anderen fünf Magma 2026-Teilnehmer:innen präsentieren; übrigens gelang es bisher auch einigen der – meist neu zusammengekommenen – Kollektive, ihre Ideen über andere Förderschienen ebenfalls umzusetzen und aufzuführen, auch wenn sie diesen Nachwuchsbewerb nicht gewonnen haben.
Wird fortgesetzt mit weiteren Beiträgen über die anderen bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwürfe.
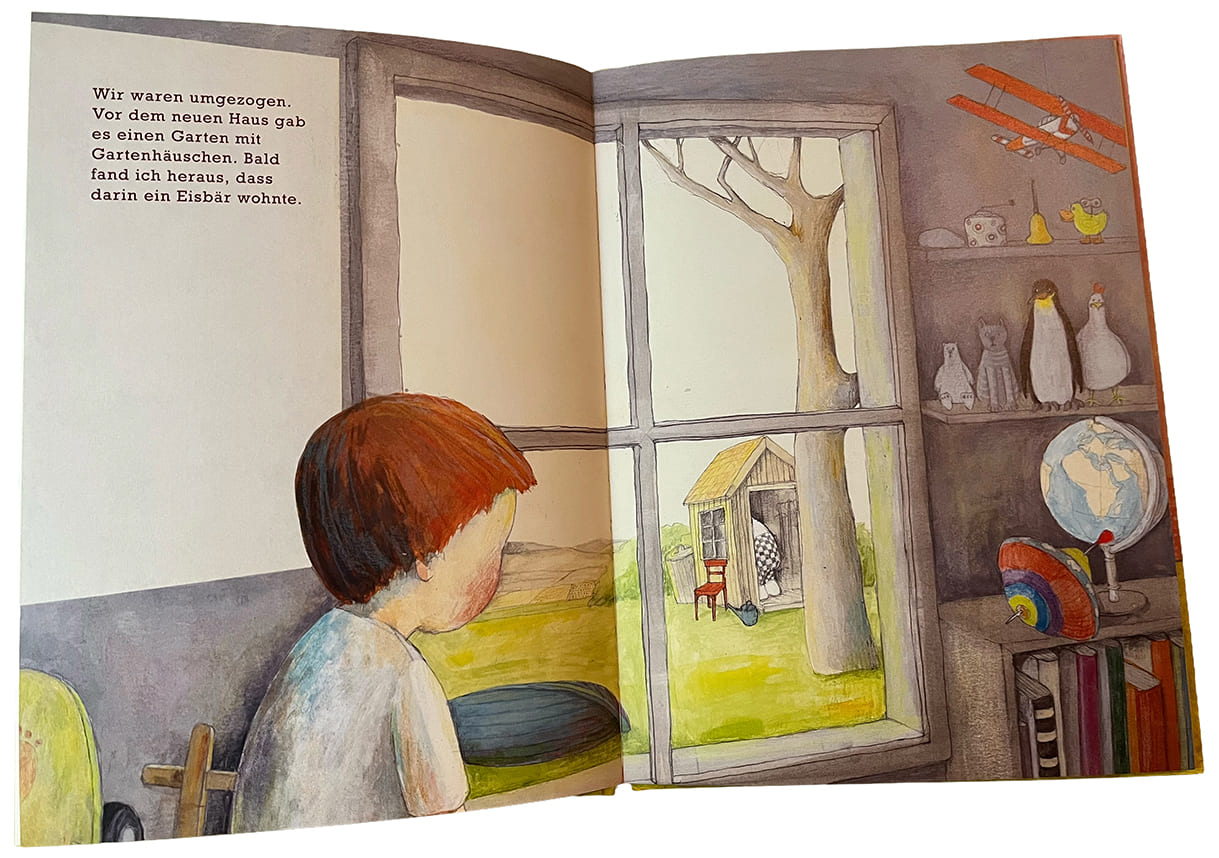
Über ein junges, rothaariges, namenlos bleibendes Kind erzählt die Autorin und Illustratorin die Geschichte einer sicher recht ungewöhnlichen Freundschaft. Dieses Kind sitzt gleich auf der Titelseite neben einem Eisbären in einer blau-weiß gemusterten Badehose.
Liebevoll und neugierig wenden beide ihre Blicke aufeinander. Das Kind offenbar aber „nur“ von einem Buch aufblickend, aus dem es dem kolossalen Sitznachbarn entweder vorliest oder vielleicht auch „nur“ schildert, was es gerade gelesen hat.
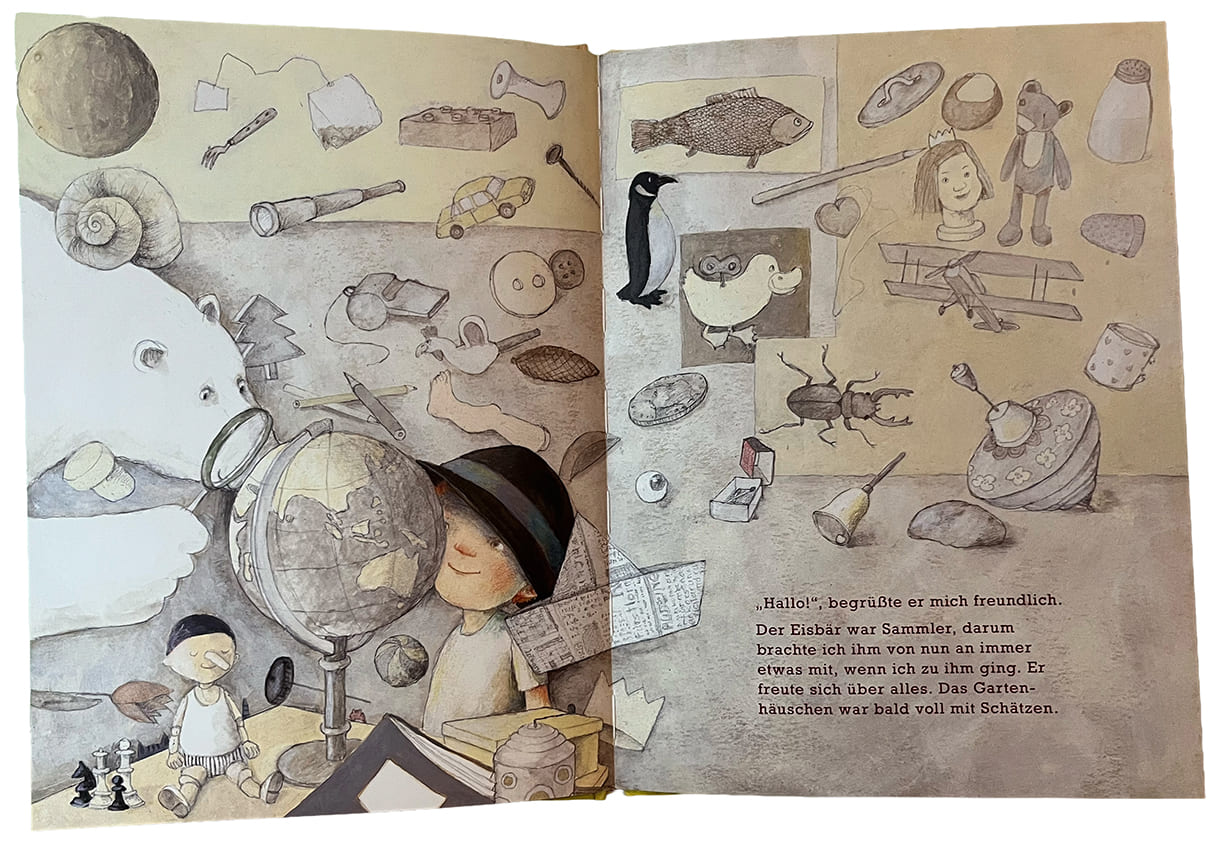
Wie es zu dieser Begegnung – das Kind übrigens eher leicht sommerlich gekleidet, also nicht in natürlicher Eisbärengegend – kam, erzählt Helga Bansch auf der ersten Doppelseite. Sie hat dieses Mal sowohl geschrieben als auch gezeichnet. In einem Gartenhäuschen vor dem neuen Zuhause des übersiedelten Kindes wohnt der große weiße Bär. Und der ist leidenschaftlicher Sammler von allem Möglichen. Weshalb so manche Gegenstände aus dem Kinderzimmer mit den Besuchen beim Eisbären zu diesem wandern. Dabei verlieren sie aber ihre Farben. Die kommen erst dann ins Spiel, als die kindliche Erzählfigur Geschichten vorzulesen begann.
Angeregt davon und auch irgendwie aus Dankbarkeit präsentierte Eisbär eines Tages seiner jungen Besucherin – es könnte auch ein junger Besucher sein – ein selbst verfasstes Buch. Mit vielen bunten Punkten. „Für jedes Glück ein Punkt. Je schöner das Erlebnis, desto dicker der Punkt“, schildert der Eisbär sein Werk und sagt: „Ich bin jetzt Glückssammler.“
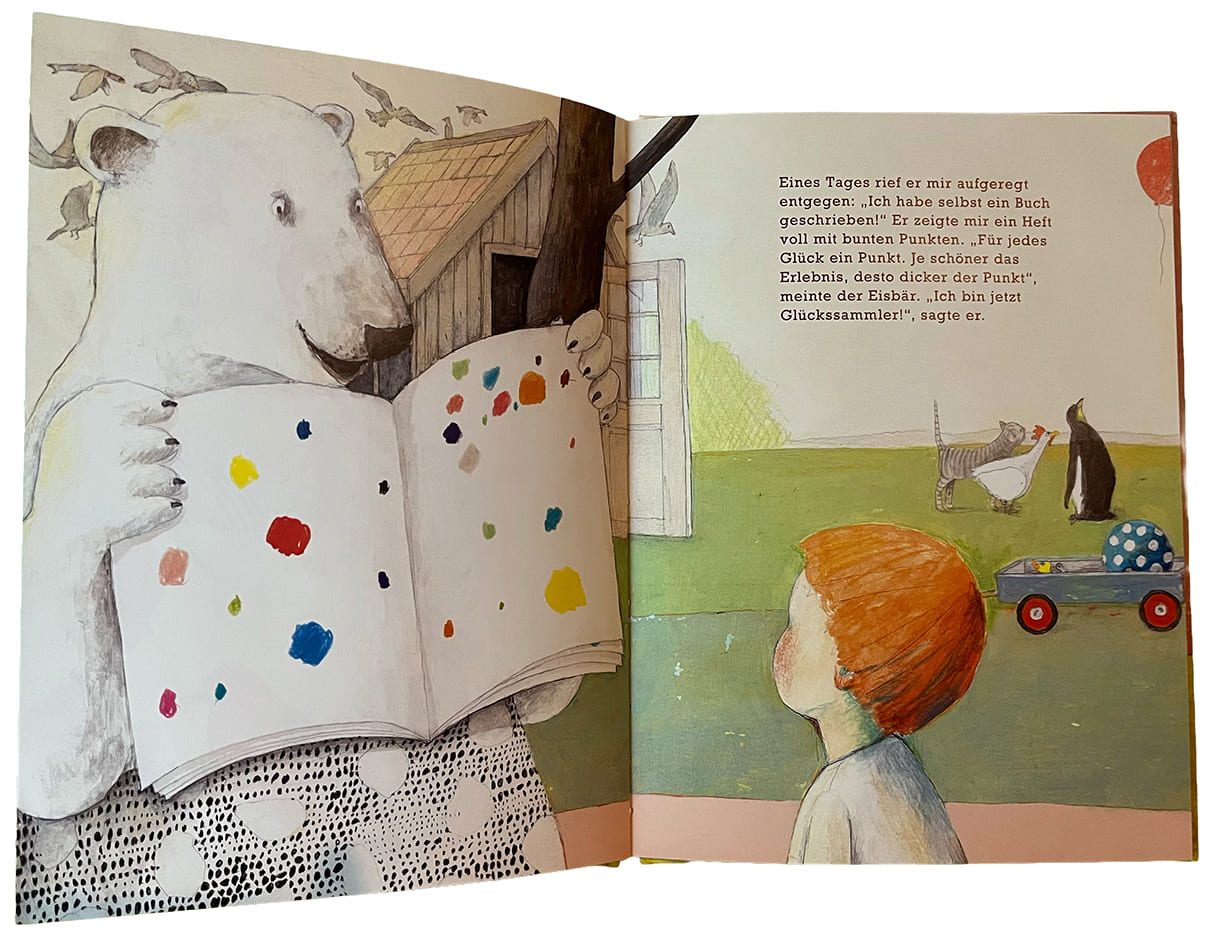
„Hielt ich meinen Finger auf einen Punkt in seinem Glücksbuch, erzählte er mir sofort das entsprechende Erlebnis dazu. In der Baumkrone sitzen und saftige Kirschen naschen war zum Beispiel ein roter Punkt.“ Von dieser Doppelseite ausgehend tauchst du auf den darauf folgenden Bildern und Texten ein in das was der Eisbär erzählt, der nun die Rolle mit dem Kind getauscht hat und der mit dem jeweiligen Farb-Punkt die dazugehörige Geschichte zum Leben erweckt…
Wie „Das Glück ist ein Punkt“ ausgeht?
Lass dich überraschen – und vielleicht auch anregen. Solltest du selber noch nicht schreiben können, oder auch das eine oder andere Mal keine Lust dazu haben, aber dennoch Glücksmomente festhalten wollen, vielleicht malst du Punkt, Kreise, Striche, Vier- oder Viel-Ecke, Wellenlinien oder was auch immer 😉 Beim Erzählen oder auch „nur“ Anschauen werden möglicherweise die Augenblicke, in denen du dieses Glück empfunden hast, wieder lebendig.

Social Media Verbote, Altersgrenzen, wie sie eingehalten werden können oder soll(t)en, mitunter doch auch Appelle samt dem einen oder anderen vorschlage, die Plattformen selber in die Pflicht zu nehmen. Doch aber auch mehr Unterricht in digitalem Wissen bzw. Medienkompetenz… schwirren durch, vor allem zunächst einmal Medien. In dieser fast aufgeheizten Atmosphäre wirft der von der EU-Kommission ausgerufene, kommenden Dienstag (10. Februar 2026) zum 23. Mal ausgerufene Safer Internet Day sozusagen Schatten voraus. Dessen internationales Motto lautet dieses Jahr: „Together for a better internet“.

Die heimische Initiative saferinternet.at wird – wie jedes Jahr, am Vortag eine eigene in Auftrag gegebene Studie vorstellen. Nach dem kürzlich veröffentlichten regelmäßigen Jugend-Internet-Monitor hat sich das Tummeln auf Social Media-Plattformen junger Menschen – auf hohem Niveau – um einige wenige Prozentpunkte verringert. Stark zugenommen hat die Verwendung von künstlicher Intelligenz – und diesem Bereich ist die aktuelle Studie gewidmet.
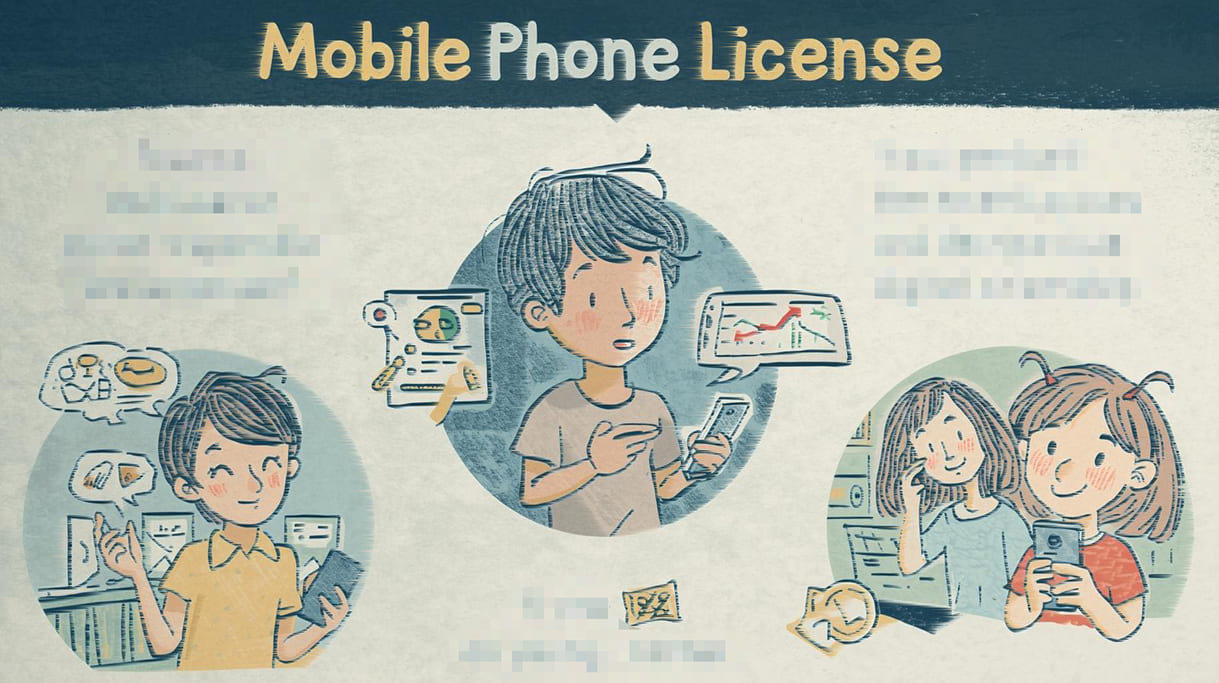
Unmittelbar danach lädt die Österreich-Sektion des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen Unicef zu einer Aktion mit ihrem neuen Jugendbeirat zum Thema digitaler Kinderschutz im Kinderzimmer. „Eine inklusive, respektvolle und gerechte Onlinewelt ist kein Privileg, sondern ein Recht jedes Kindes. Ein sicherer digitaler Raum entsteht dort, wo junge Menschen ernst genommen werden und ihre Perspektiven einbringen können sowie die notwendigen Fähigkeiten erhalten, um sich online sicher zu bewegen. Gleichzeitig müssen technische Schutzmaßnahmen entwickelt werden, die die Kinderrechte stärken und nicht einschränken,“ wird in der Ankündigung des (Medien-) Termins Klara Krgović-Baroian, die stellvertretende Leiterin der Abteilung Advocacy und Kinderrechte von Unicef-Österreich, zitiert.
Schon vor dem Wochenende, am Freitag (6. Februar 2026) meldeten sich die heimischen Mobilfunknetzbetreiber per Aussendung zu Wort und schrieben, dass sie Cybersicherheit sehr ernst nehmen würden und „deshalb Lösungen anbieten, die das digitale Leben sicherer machen“.
Mit Verweis auf Bedrohungen – Viren, Datendiebstahl, Betrug beim Online- Shopping, Missbrauch von Zahlungsdaten und Identitätsdiebstahl und damit technischer Art einerseits sowie Cybermobbing und Hass im Netz, aber auch zu langen Bildschirmzeiten als andererseits gesellschaftlicher Natur – priesen die Mobilfunkbetreiber „Sicherheitslösungen für Smartphones, Tablets, Computer und Router“ an. „Das Forum Mobilkommunikation (FMK) empfiehlt Nutzer:innen dringend, die Sicherheitsangebote der Netzbetreiber zu nutzen.“
Das FMK habe deshalb den offiziellen FMK-Handyführerschein für Schüler:innen ins Leben gerufen. „Die Basis für die Prüfung zum Handyführerschein bildet der interaktive Tablet-Kurs „Mobile Generation“, der für die 6. bis 8. Schulstufe entwickelt wurde. Begleitendes Lehrmaterial steht kostenfrei und ohne Registrierung online zur Verfügung. Ziel ist es, Jugendlichen niederschwellig praxisnahes Wissen zu vermitteln und sie für Themen wie Datenschutz, digitale Sicherheit und die reflektierte Nutzung der sozialen Medien zu sensibilisieren.
Die Prüfung ist als Online-Quiz mit 25 Fragen konzipiert, die den kritischen Umgang mit mobilen Endgeräten und deren Möglichkeiten im Fokus haben. Wer mindestens 22 der 25 Fragen korrekt beantwortet, erhält den offiziellen FMK-Handyführerschein in Form einer personalisierten Urkunde.“ Link zum Kurs und zur „Führerscheinprüfung“ unten am Ende des Beitrages, ebenso ein Link zu einem YouTube-Video, das schon einige Fragen des Tests vorwegnimmt.

„Zunehmend alarmiert über Berichte von einem rasanten Anstieg der Menge an KI-generierten sexualisierten Bildern… darunter auch Fälle, in denen Fotos von Kindern manipuliert und sexualisiert wurden“, zeigt sich das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef in einer Medien-Aussendung wenige Tage vor dem Safer Internet Day (immer am zweiten Dienstag im Februar).
Deepfakes – Bilder, Videos oder Audiodateien, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt oder manipuliert werden und real erscheinen sollen – werden zunehmend zur Herstellung sexualisierter Inhalte mit Kindern genutzt, unter anderem durch sogenannte ‚Nudification‘, bei der KI-Werkzeuge Kleidung auf Fotos entfernen oder verändern, um fingierte Nackt- oder sexualisierte Bilder zu erzeugen.

In einer Studie in elf Ländern (Armenien, Brasilien, Dominikanische Republik, Kolumbien, Mexiko, Montenegro, Marokko, North Mazedonien, Pakistan, Serbien, Tunesien) gaben im vergangenen Jahr mindestens 1,2 Millionen Kinder (12 bis 17 Jahre) an, dass ihre Bilder zu sexuell expliziten Deepfakes manipuliert worden seien. In manchen Ländern entspricht dies einem von 25 Kindern, also etwa einem Kind in einer durchschnittlichen Schulklasse. Erstellte wurde die Erhebung von Unicef, Ecpat (End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes;internationales Netzwerk zivilgesellschaftlicher Organisationen für die Beendigung sexueller Ausbeutung von Kindern) und Interpol (Teil von „Disrupting Harm Phase 2“, Link am Ende des Beitrages).
Auch Kinder selbst sind sich dieses Risikos sehr bewusst. In einigen der untersuchten Länder sagten bis zu zwei Drittel der Kinder, sie hätten Angst davor, dass KI zur Erstellung gefälschter sexueller Bilder oder Videos verwendet werden könnte. Das Ausmaß der Sorge variiert stark zwischen den Ländern und unterstreicht den dringenden Bedarf an verstärkter Aufklärung, Prävention und Schutzmaßnahmen.

Sexualisierte Bilder von Kindern, die mithilfe von KI-Werkzeugen erzeugt oder manipuliert werden, sind Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern (Child Sexual Abuse Material, CSAM). Deepfake-Missbrauch ist Missbrauch – und an dem Schaden, den er verursacht, ist nichts ‚fake‘.
Wenn das Bild oder die Identität eines Kindes verwendet wird, wird dieses Kind direkt zum Opfer. Selbst ohne identifizierbares Opfer normalisiert KI-generiertes Material sexuellen Missbrauchs von Kindern die sexuelle Ausbeutung, befeuert die Nachfrage nach missbräuchlichen Inhalten und stellt Strafverfolgungsbehörden vor erhebliche Herausforderungen bei der Identifizierung und dem Schutz von Kindern, die Hilfe benötigen.
Unicef begrüßt daher Bemühungen jener KI-Entwickler, die Security-by-Design-Ansätze und robuste Schutzmechanismen einbauen, um den Missbrauch ihrer Systeme zu verhindern. Zu viele KI-Modelle werden jedoch ohne ausreichende Schutzvorkehrungen entwickelt. Die Risiken können sich weiter verschärfen, wenn generative KI-Werkzeuge direkt in soziale Medien integriert werden, wo sich manipulierte Bilder rasend schnell verbreiten.

Unicef hat schon vor einigen Wochen eine Petiton „Online sicher – für jedes Kind“ für einen besseren Kinderschutz im digitalen Raum initiiert – Link ebenfalls am Ende des Beitrages.
Außerdem läuft seit einiger Zeit eine Petition der Plattform #aufstehn.at speziell gegen Elon Musk KI Grok. „Wer für seine Plattform X (früher: Twitter) zahlt, kann Kinder und Frauen auf hochgeladenen Bildern entkleiden und damit sexualisieren. Das verstößt gegen Gesetze“, merkt aufstehn an. „Die EU zieht aber bislang keine klaren Konsequenzen – weil man US-Präsident Donald Trump nicht verärgern möchte. Doch Österreich kann handeln“, verlangt die Initiative und weist darauf hin, dass „Malaysia Grok bereits gesperrt hat. In Frankreich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die KI.“
Die EU‑Kommission sammle zwar Beweise für den Bildmissbrauch durch Grok. „Das Problem: Personen, die mit Grok Kinder und Frauen entkleiden und entstellen, holen keine Einwilligung für verwendete Bilder ein. Betroffene können also nicht wissen, ob die Missbrauchs‑KI auch eigene Fotos verfälscht hat. Darum fordern wir mit unserem Appell Missbrauch stoppen, Grok sperren!, dass auch Österreich tätig wird und die Missbrauchs-KI abdreht.“
Mehr als 25.000 Menschen haben den Appell bereits unterzeichnet, „aber damit der für KI zuständige Staatssekretär Alexander Pröll rasch handelt“, bräuchte es noch rund 5000 Unterschriften. „Bei 30.000 Unterschriften tragen wir unsere Botschaft vor Prölls Büro“, so #aufstehn.at
Eine weitere Initiative, „Die schweigende Mehrheit“ startete eine ähnlich genannte Petition wie Unicef „Kinderrechte im digitalen Raum schützen“, aber mit weiterreichenden Forderungen, u.a. EU-weites Verbot von Tiktok – ebenfalls unten verlinkt.

Durchscheinende Vorhänge zaubern Wälder aber auch Projektionsflächen für Bilder aus dem Schloss der Moors und nicht zuletzt das Ambiente einer urigen Wirtsstube bald nach Beginn. Hier kriegt der mit seinen Kumpels trinkende und Karten spielende Bummelstudent Karl den verhängnisvollen Brief (Bühne und Kostüme: Birgit Leitzinger). Den hat sich der berühmte Autor Friedrich Schiller als Intrige im reichen Haus ausgedacht. Franz, der sich ständig benachteiligt fühlende zweitgeborene Sohn des alten Schlossherren, schreibt einen frühen Fake-Brief an seinen Bruder. Der Vater habe mit ihm, dem Lieblingssohn Karl, gebrochen…
Was die Dynamik in Gang setzt. Karl gründet mit den Freunden eine Bande, die dem ersten und am berühmtest gewordenen Dramas Schiller auch den Titel gab / gibt: „Die Räuber“. Mit – vorgeblich – guten Absichten. In Robin-Hood-Manier: Reiche bestehlen, Arme beschenken.
In der Inszenierung (Mia Constantine) des niederösterreichischen Landestheaters, die seit Kurzem in der St. Pöltner Bühne im Hof oft auch in vormittäglichen Schulvorstellungen spielt, im Mai dann im Stadttheater von Wiener Neustadt gastiert, wird die Bande immer wieder zur musikalischen Band. Die Schauspieler:innen Laura Laufenberg, Julius Béla Dörner, Julian Tzschentke und Bettina Kerl wechseln dann von gesprochenen zu gesungenen Stimmen, hauen in Tasten (Keyboard), zupfen Saiten (Gitarre, E-Gitarre) oder blasen Trompete. Für die Songs bedienen sie sich mintunter bei bekannten Melodien (unter anderem „You’v got a Friend“). Musikalisch steigen sie meist aus den gespielten Szenen aus, um das eine oder andere sozusagen zu kommentieren oder Grundstimmungen zu vermitteln (Musik: Kilian Unger).
Und greift damit zu einem der Erfolgsrezepte neuerer Inszenierungen. So tourte im Herbst das Volkstheater in der Version des innovativen Bronski- und Grünberg-Theaters mit einer rockigen Version durch Veranstaltungszentren in den Wiener Bezirken mit „Charly Moors Band“. Und schon vor drei Jahren setzte die Gruppe „Plaisiranstalt“ in ihrer „Räuber“-Überschreibung im Dschungel Wien (MuseumsQuartier) auf Disco-Sound und wildes Abtanzen – auch mit der Frage Familie oder Kumpels. Erster kann sich bekanntermaßen keine/r aussuchen 😉 – Links zu Besprechungen dieser beiden Versionen unten am Ende des Beitrages.
Das Räuberbanden-Dasein als Mix aus einer Art Rache des (vermeintlich) vom reichen Hof Verstoßenen mit Suche nach einerseits Freundschaft und andererseits Sinn im Leben „läuft aus dem Ruder“ – wie gleich zu Beginn noch vor dem Einstieg ins szenische Spiel als Triggerwarnung dem Publikum mit auf den Weg gegeben wird (Stückfassung: Felix Krakau). Mehr noch als die Räuber- und Robin-Hood-Beweggründe spielen die erwähnten Elemente Freundschaft und Sinnsuche eine große Rolle. Frischer Wind, neue Ideen – Schlagworte wie sie immer wieder recht aktuell klingen – fallen; wie die ganze Inszenierung weitgehend in heutiger Sprache immer wieder mit Zitaten aus dem Original organisch verknüpft wird.
Aufkeimende Machtkämpfe – Spiegelberg hält sich für die besser geeignete Führungspersönlichkeit – kommen auch ins Spiel. Eine ausführliche(re) Phase stellt hingegen die erweiterte Sinnfrage dar: Die Reflexion der eigenen Taten. Um einen der ihren, Rolle, der nicht wirklich mitspielt, vom Galgen zu retten, steckt die Bande eine ganze Stadt in Brand – mit Dutzenden Todesopfern. Wollten für eine besser Welt kämpfen, doch was haben wir letztlich getan!?
Während Laura Laufenberg als einzige des Bühnen-Quartetts ausschließlich eine Figur, sehr stark in seinen wechselnden Gefühlen nachvollziehbar, den Karl Moor gibt, schlüpfen die Mit-Räuber Bettina Kerl (Spiegelberg), Julian Tzschentke (Razman) und Julius Béla Dörner (Schweizer) zunächst in Videos (Hannah Strobl), später dann auch live adelig kostümiert in der hier angegebenen Reihenfolge in die Rollen von Vater Moor, dem intriganten Bruder Franz sowie Karls Verlobter Amalia.
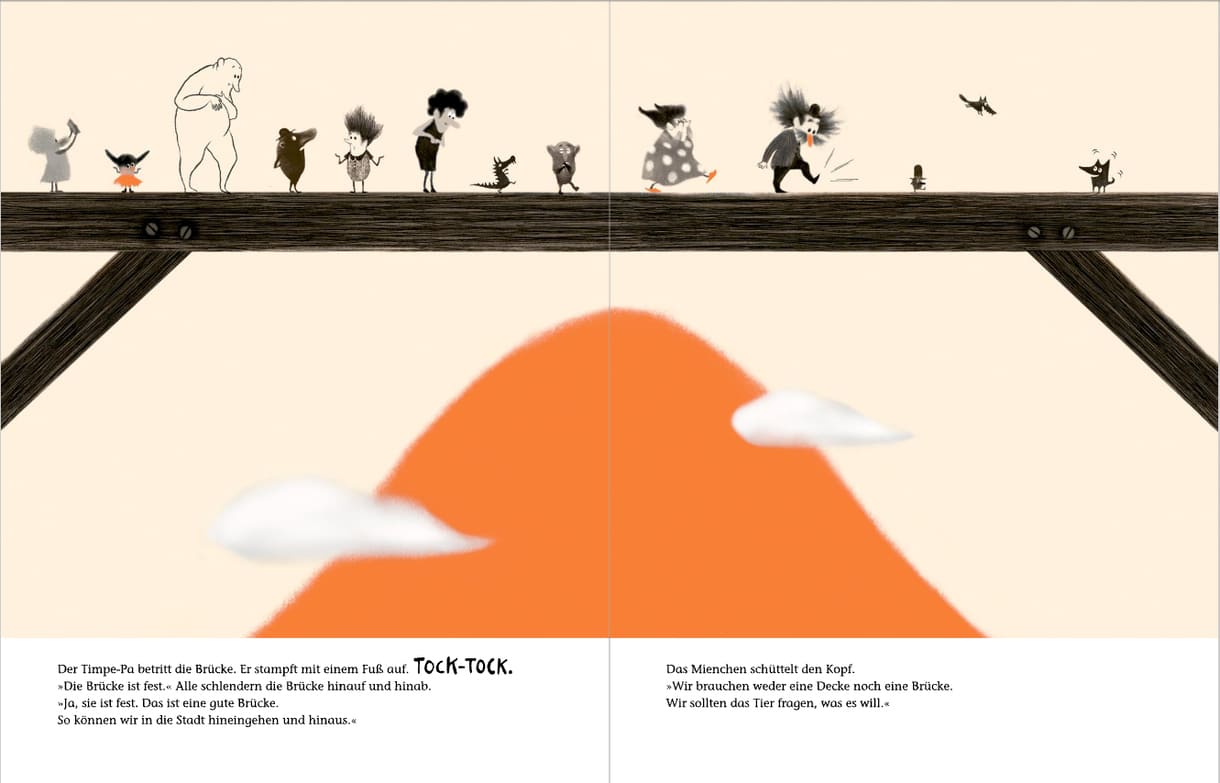
Ein schwarz-weißer Mix aus tierischen, eher kleinen Fantasiewesen mit dem einen oder anderen orangefarbenen Tupfer bevölkert die Stadt, in der sich dieses Bilderbuch abspielt. Da entdeckt Wimpf, der ganz oben wohnt und über den besten Aus- und Überblick verfügt, eines Morgens: „Da liegt ein RIESIGES Tier vor unserer Stadt!“ und diesen Ausruf beginnt er mit dem Wort „Obacht!“, das dem ganzen Buch auch den Titel gab.
Diese Warnung vor so etwas Unbekanntem, das jedenfalls gefährlich sein muss… Die einen jammern, die anderen fürchten sich, nur das kleine Mienchen „fragt neugierig: Ach ja?“
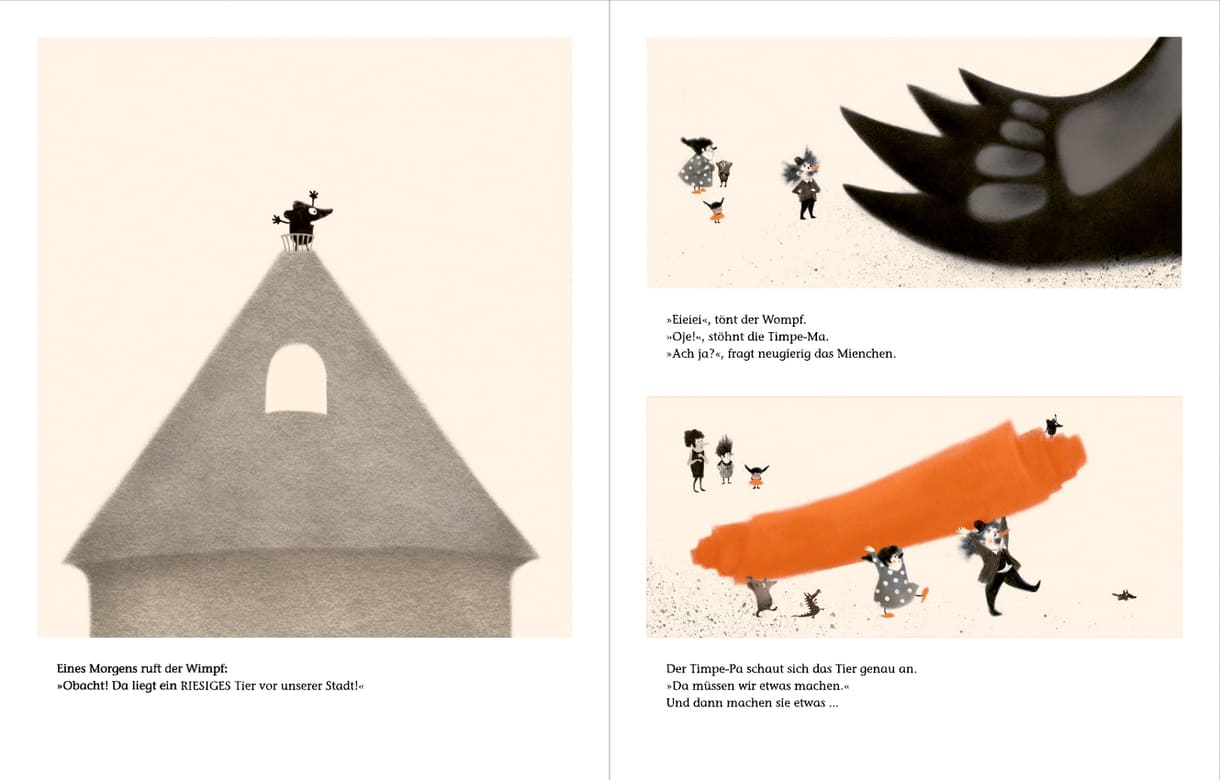
Aber schon Timpe-Pa bestimmt: „Da müssen wir etwas machen.“, schnappt eine große orangefarbene Decke: „Problem erkannt. Gefahr gebannt. Jetzt sehen wir das Tier nicht mehr.“
Denkste, ein bisschen ist es – wie Stella Dreis zeichnet, was sich Kerstin Hau von der Geschichte und den wenigen, knappen Sätzen ausgedacht hat – noch zu sehen. Und es ist so RIESIG, dass es den Zu- und Ausgang der Stadt versperrt.
Also braucht’s andere Problemlösungen: Brücke, Tunnel, Umfahrungsstraße… Eins nach dem anderen – wie und warum’s doch nicht funktioniert? Nein, hier wird nicht zu viel verraten, in ein paar Tagen erscheint dieses spannende Bilderbuch – zu einem weltweit allgegenwärtigen, überall recht aufgeblasenen Thema: Angst vor Fremdem / Fremden, Unbekannten / Unbekanntem. „Alles ist unbekannt, bis du es kennenlernst“, preist der Nord Süd Verlag die Botschaft von „Obacht!“ an.
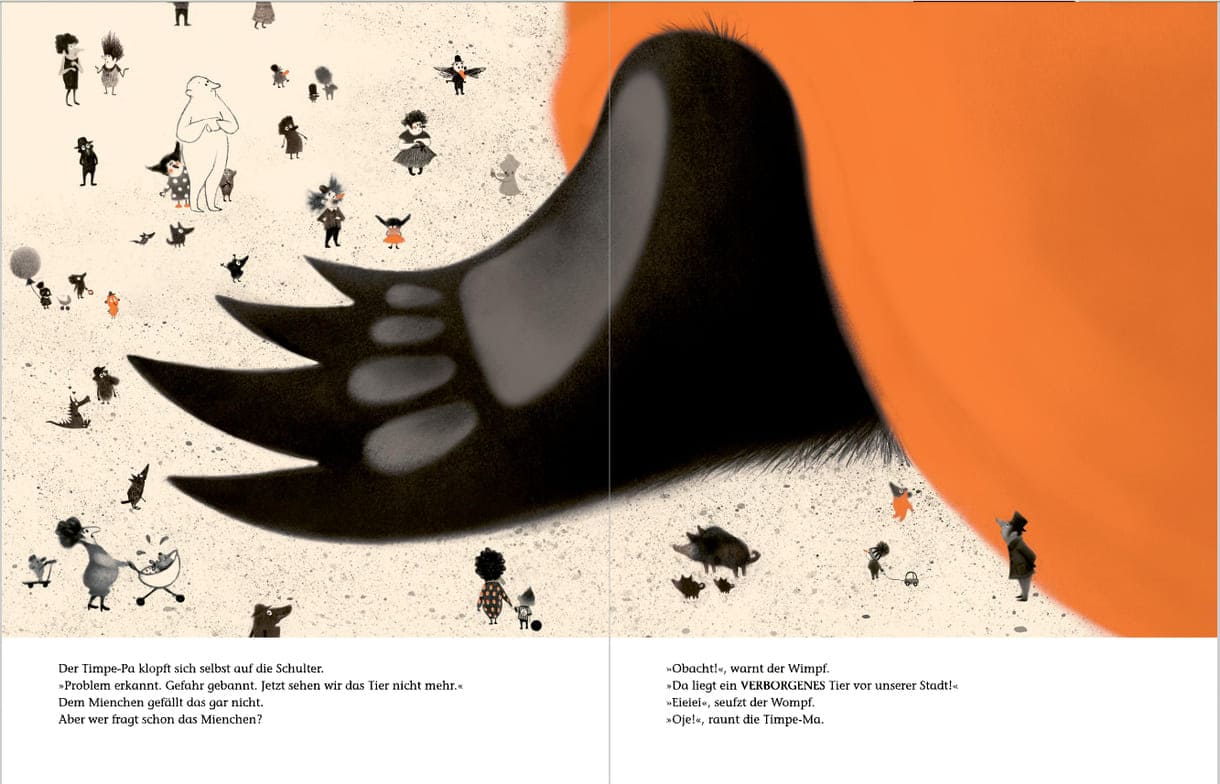
Kerstin Hau und Stella Dreis lassen immer wieder als Gegenpol das schon erwähnten „Mienchen“ in Erscheinung treten. Schon relativ früh versucht es, Wimpf, Wompf, Timpe-Ma, Timpe-Pa und den anderen Stadtbewohner:innen zu verklickern: „Wir sollten das Tier fragen, was es will.“ – Und stößt damit laaaaaange auf gar kein Gehör, ja im Gegenteil auf krasse Ablehnung. Aber dann… – nein, bitte, nicht spoilern!
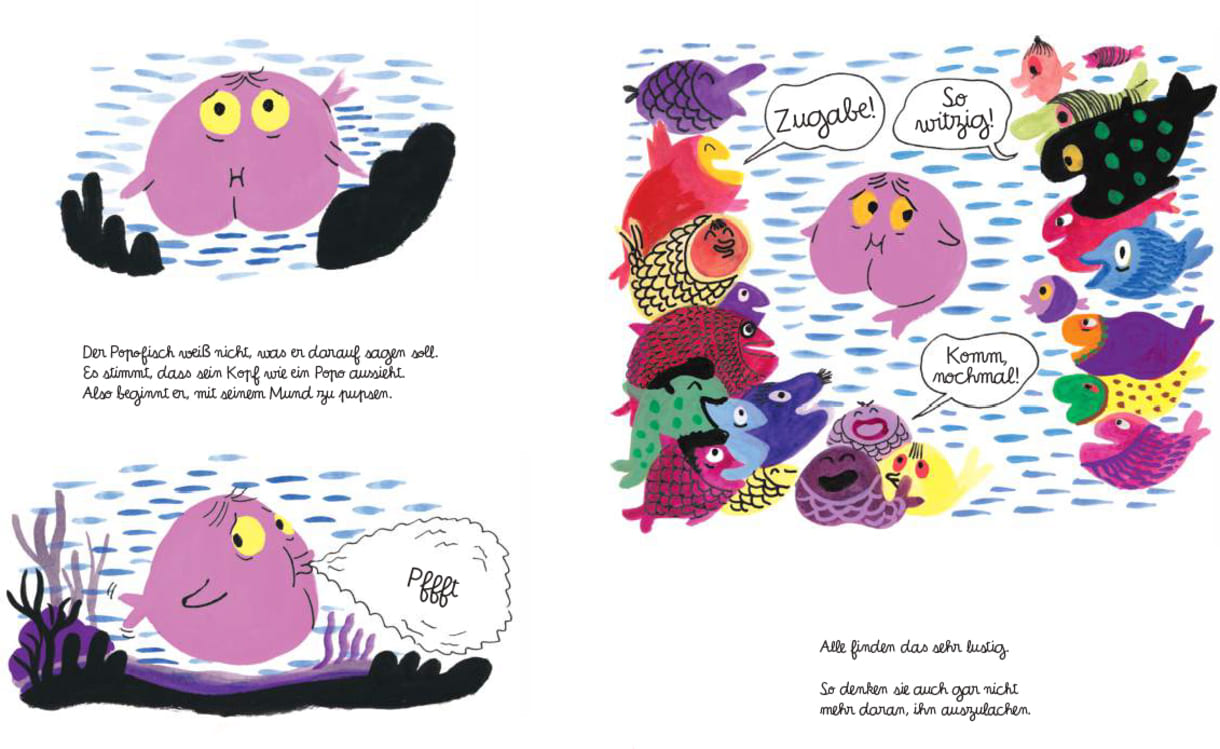
Pech gehabt, sich kränken, ärgern, vielleicht sogar ziemlich wütend werden über so viel Gemeinheit. Das alles wäre nicht nur möglich, sondern auch mehr als verständlich für die Hauptfigur dieses neuen Bilderbuchs. Sein Aussehen – auf den ersten, den zweiten, vielleicht sogar dritten Blick gab dem Buch sogar den Titel: „Popofisch“. Pauline Pinson (Übersetzung aus dem Französischen: Marie Gamilscheg) und Magali Le Huche haben sich diesen rosa Fisch ausgedacht; in – genau einer Form, die an ein Hinterteil, allerdings gar keines eines Fisches, sondern eines Menschen – erinnert.
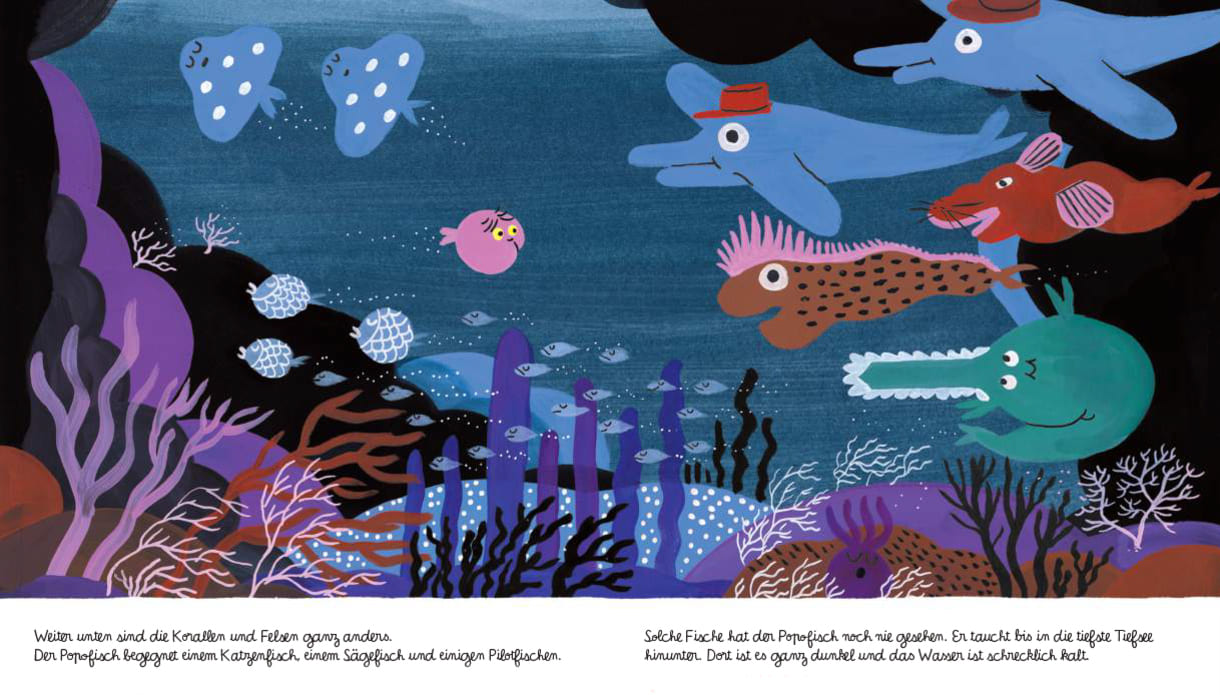
Autorin und Illustratorin haben dem Popofisch allerdings von Anfang an eine ziemlich schlaue, wirksame Gegenstrategie auf den Leib geschrieben und gezeichnet. Gelcih auf der zweiten Doppelseite geht das so: „Der Popofisch weiß nicht, was er darauf sagen soll“ (dass ihm alle sein Aussehen vorhalten, Anm. der Redaktion) … „Also beginnt er, mit seinem Mund zu pupsen.“
Und schon erschallt es von anderen Fischen- in Sprechblasen: „Zugabe!“, „So witzig!“, „Komm, noch einmal!“
Und im Text – übrigens durchgängig in der zusammenhängenden Schreibschrift was das Selbstlese-Alter allerdings nach oben verschiebt (!?) – darunter heißt es: Alle finden das sehr lustig. So denken sie auch gar nicht mehr daran, ihn auszulachen.“
Könnte eine Anregung sein, möglichen Mobbing- und Ausgrenzungsversuchen mit Humor den sogenannten Wind aus den Segeln zu nehmen. Sollte aber keinesfalls bedeuten, nicht Verspottungs-Versuchen nicht auch entschieden entgegenzutreten.
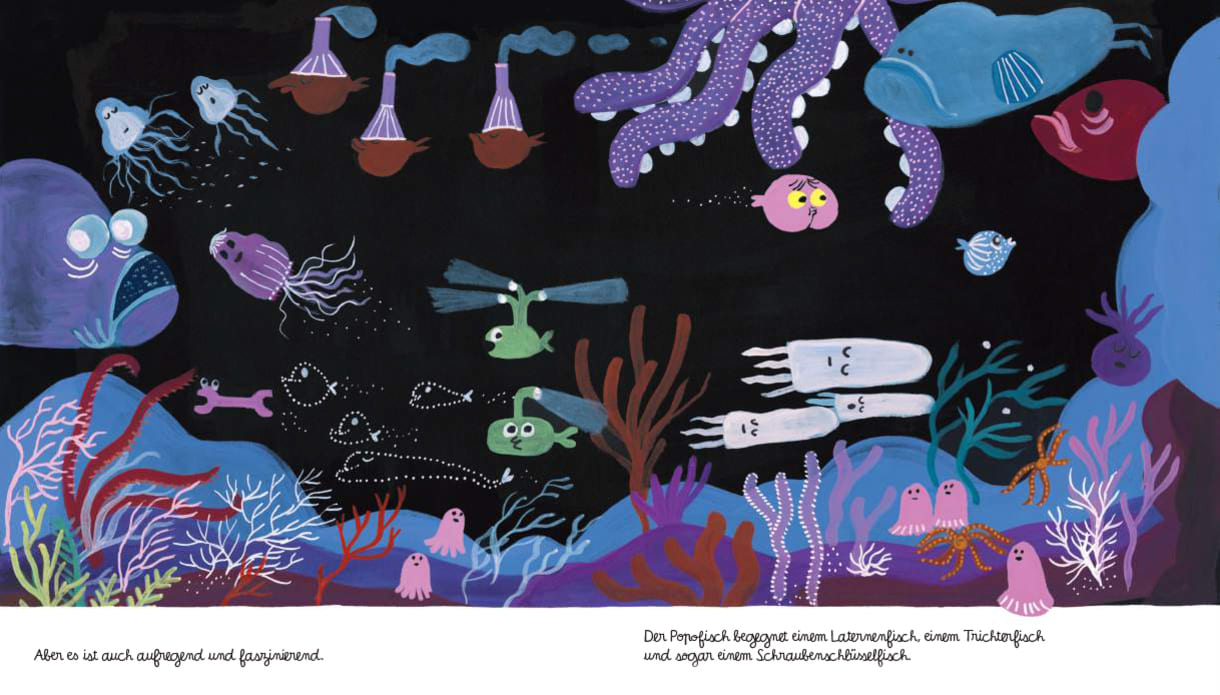
Außerdem will der Protagonist des Buches nicht immer nur lustig sein, sondern einfach als einer von vielen verschiedenen Fischen akzeptiert werden. Und so macht er sich aus dieser Region auf den Weg, andere Gegenden und Meerestiere zu erkunden. Was auf weiteren Seiten spannende Begegnungen bringt und stößt auch auf einen anderen Außenseiter in seiner Umgebung…Übrigens hat der Titelheld auch einen Namen, der viele Seiten später enthüllt wird – aber hier nicht gespoilert werden soll.
Noch weniger wird hier verraten, dass der „Popofisch“ – fast ganz am Ende von einem Meeresbewohner aus anderem Blickwinkel ganz anders betrachtet und bezeichnet wird – auch wie ein menschlicher – innerer – Körperteil. Vielleicht kommst du da ja schon durch Drehen der Titelseite drauf, wenn nicht, dann viele Spaß beim Entdecken dieses letzten Geheimnisses.

Die einen – Australien – haben es schon beschlossen. Dort gilt Social Media erst ab 16 Jahren seit 10. Dezember des Vorjahres (2025). In verschiedenen europäischen Ländern werden unterschiedliche Altersgrenzen diskutiert: 16, 15, 14, 13… – 14 lautet der Vorschlag vom unter anderem für Digitalisierung zuständigen Staatssekretär Alexander Pröll.
Nur: Während die US-amerikanischen Plattformen wie Instagram als Mindestalter für den Beitritt von 13 angeben, gilt in Österreich – eigentlich – ohnehin 14 als untere Altersgrenze!
„Für Nutzer:innen in Europa wird das Mindestalter durch die 2018 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt. Dieser zufolge müssen alle Nutzer:innen ausdrücklich zustimmen, dass ihre personenbezogenen Daten (z. B. Name, Geburtsdatum, Wohnort) an Soziale Netzwerke übermittelt und von diesen verarbeitet werden“, weist Safer Internet auf seiner Website – detaillierter Link am Ende des Beitrages – hin.
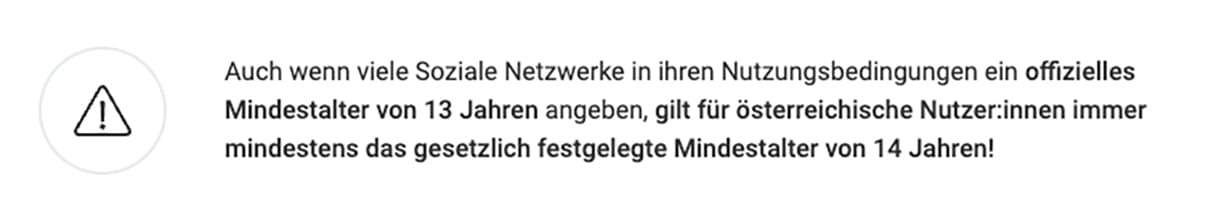
Safer Internet listet auf dieser erwähnten Site auch die Nutzungsbedingungen der Plattformen selber in Bezug aufs Mindestalter auf:
WhatsApp: Mindestalter 13 Jahre, in Österreich 14 Jahre, „wobei auch jüngere Kinder die App problemlos installieren und nutzen können. WhatsApp empfiehlt Kindern unter 18 Jahren, die Nutzungsbedingungen gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten durchzulesen.
YouTube: Mindestalter 14 Jahre, ist auch das Alter, ab dem in Österreich die Verwaltung eines eigenen Google-Kontos möglich ist – und ein solches ist für die eigenständige Anmeldung bei YouTube erforderlich. „Allerdings benötigen Unter-18-Jährige laut Nutzungsbedingungen dennoch die Erlaubnis ihrer Eltern, um YouTube nutzen zu dürfen. Ist das Kind noch nicht 14, können die Eltern mit der App Google Family Link ein Google-Konto für ihr Kind einrichten und dieses verwalten. Für jüngere Kinder können Eltern zudem ein Benutzerkonto auf YouTube Kids einrichten.
Instagram: Mindestalter 13 Jahre, wobei bei der Registrierung das Geburtsdatum angegeben werden muss. Dasselbe gilt für das ebenfalls zum Meta-Konzern gehörende Netzwerk Facebook. Jüngeren Kinder ist die Nutzung beider Dienste untersagt: Meta gibt an, Konten von Kindern unter 13 Jahren bei Bekanntwerden sofort zu löschen. Bei Instagram werden die Accounts von Nutzer:innen, die jünger als 18 sind, zudem automatisch auf „privat“ gestellt: Dadurch können nur Freund:innen die veröffentlichten Inhalte sehen. Dies kann allerdings jederzeit in den Einstellungen geändert werden, d.h. auch Unter-18-Jährige können ihr Konto problemlos öffentlich machen.
Snapchat: Mindestalter 13 Jahre, wer unter 18 ist, darf die App zudem nur mit Einwilligung der Eltern nutzen. Das Alter wird bei der Registrierung zwar abgefragt, aber nicht überprüft.
TikTok: Mindestalter 13 Jahren, TikTok gibt an, die Konten Minderjähriger gegebenenfalls zu schließen. Je nach Alter ist zudem der Zugang zu bestimmten Funktionen eingeschränkt: So kann die Direktnachrichtenfunktion erst ab 16 Jahren genutzt werden, einen Livestream zu hosten oder virtuelle Geschenke zu machen ist überhaupt erst ab 18 möglich.
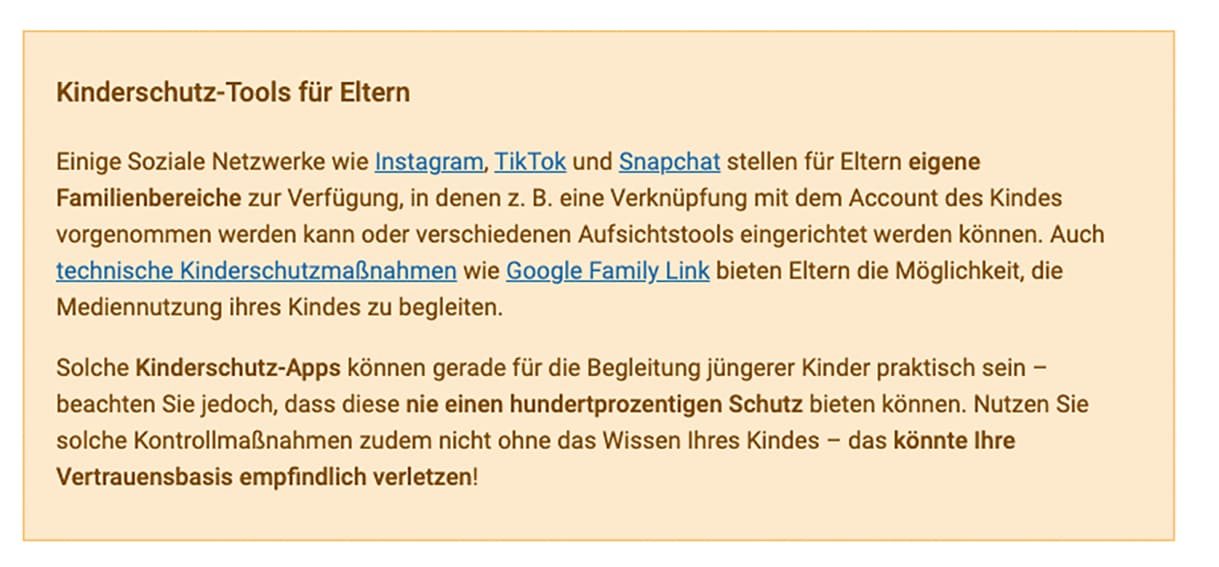
„Auch wenn viele Soziale Netzwerke in ihren Nutzungsbedingungen ein offizielles Mindestalter von 13 Jahren angeben, gilt für österreichische Nutzer:innen immer mindestens das gesetzlich festgelegte Mindestalter von 14 Jahren!“, so nochmals Safer Internet ausdrücklich.
saferinternet.at –> mindestalter
schau-hin.info –> ab-welchem-alter
„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“ ist eine gemeinsame Initiative des – deutschen – Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, von ARD und ZDF sowie der AOK – Die Gesundheitskasse.

Auch am Sonntag demonstrierten Kurdinnen und Kurden in Wien lautstark, immer wieder unterstützt auch von Musik, vor allem für die in Syrien nun bedrohte Autonomie der Region Rojava. Diese Autonomie, ein Modell für demokratisches, gleichberechtigtes Zusammenleben, ist vom zentralsyrischen Regime bedroht.
Deshalb erklangen unter anderem der schon lange, im Westen erst seit der Tötung der iranischen kurdischen jungen Jîna Mahsa Amini 2022 in iranischem „Polizeigewahrsam“ bekannt gewordene Slogan „Jin îyan, Azadî“ (Frau – Leben – Freiheit). Und die Losungen: „Jolani Terrorist, Erdoğan Terrorist“. Sowohl der letztgenannten türkische als auch der erstgenannte syrische Machthaber nach dem Sturz von Diktator Assad bedrohen die demokratischen, gleichberechtigten, unabhängigen Bestrebungen der Kurd:innen.
In Wien wehen seit gut zwei Wochen beinahe täglich die rot-weiß-grünen Fahnen mit gelber Sonne bzw. die gelb-rot-grünen Fahnen. Am Sonntag trugen jeweils sechs Demonstrant: innen übrigens neben einer großen kurdischen auch eine ebenso große österreichische Fahne. So aufgesplittet Kurd:innen auf die Staaten Türkei, Syrien, Irak, Iran und teilweise Aserbeidschan leben, so viele Konflikte sie mitunter untereinander haben, in der akuten Bedrohung demonstrieren sie meist gemeinsam für die Verteidigung Rojavas – übrigens von ganz junge bis mit dem Rolator. Und wiesen immer wieder auch darauf hin – so auch bei der Demo am Sonntag, die am Stadtpark vorbei über Ring, Urania, Schwedenplatz, Taborstraße zum Praterstern zog – dass kurdische Einheiten es waren, die gegen den sogenannten islamischen Staat (ISIS), unter hohem eigenen Blutzoll kämpften und Gebiete von der Herrschaft der islamistischen Terroristen befreit haben. Und anschließend von türkischem Militär immer wieder bombardiert wurden.

„Sehr gemütlich, aber auch sehr kreativ und es macht starken Spaß, diese Dinge zu erkunden“, fanden Dunja und Clara die künstlerisch-verspielte Rauminstallation auf Bühne 3 im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… sprach mit den beiden 12-Jährigen – und durfte sie beim Bespielen einiger der Installationen – so fotografieren, dass sie nicht erkennbar sind. Die beiden sind, vertrauen sie dem Journalisten an, sehr Theater- bzw. Schauspiel-begeistert, schon jeweils ihr halbes Leben lang. Dunja: „Ich hab mit fünf Jahren das erste Mal gespielt. Und ich hab auch schon in drei Kurzfilmen mitgespielt.“ Ihre Freundin Clara: „Ich hab mit sechs angefangen, hab auch schon in der Josefstadt gespielt und war im Fernsehen“.

Zurück zur Rauminstallation. Dunja und Clara konnten hier die Leidenschaft für Schauspiel mit der Lust auf spielerisches Entdecken verknüpfen. Die bespielbare Ausstellung war leider nur für einen, den Samstagnachmittag für Kinder zugänglich. Studierende der Uni für Angewandte Kunst haben unter dem Titel „Misfits“ (Außenseiter) in Gruppen unterschiedlichste ganz ohne Anleitung, spontan zu entdeckende bespielbare Kunstwerke geschaffen. Da fand sich ein Puzzle aus unterschiedlichsten großen Legeteilen am Boden – das keine „richtige“, dafür viele unterschiedlichen „Lösungen“ ermöglicht. Daneben stand ein großer Holzrahmen mit ausgeschnittenen Apfel-Formen und drei große Pappmaschee-Äpfel – rot, grün, gelb. Das Ding erinnert an die pädagogischen Formen-Loch-Würfel für sehr junge Kinder, meist mit drei-, vier- und sechs-eckigen Öffnungen für Objekte in diesen Formen. Doch die Apfel-Löcher luden gar nicht ein, die großen, leichten Äpfel reinzustecken, sondern deren eigene Öffnungen zu verwenden, um sie sich über den Kopf zu stülpen.
Eine Art mehrstöckiger Plattenspieler mit einem Wurm oder einer Raupe (?) aus mehreren Kugeln, dazu noch Flug-Insekten und einem quallenartigen Gebilde war drehbar über zwei Fußt-Taster. Und das Ding lud die meisten, so auch die beiden oben zitierten Bespielerinnen zum Sprung-Spiel – ohne, dass irgendwer das anregen musste / wollte / sollte.
Davor hingen gefüllte Stoffschläuche von der Decke – fast zum Schaukeln einladend verknotet, dafür aber zu wenig stabil. Sie berühren teilweise eine „Landschaft“ aus unterschiedlichst geformten Pölstern mit „Armen“, „Beinen“ oder was auch immer.

An anderer Stelle der Bühne war eine Art Labyrinth aus beweglichen verschieden hohen, bunten, transparenten Wänden aufgebaut. Die Transparenz ermöglicht, dass sich bei Beleuchtung die Farben mischen. Die Flexibilität der Stellwände erlaubt den „Bau“ von „Mauern“ ebenso wie von Wegen…
Was sich hier ausbreitete, ist das Ergebnis einer Semesterarbeit von Studierenden an der Uni für Angewandte Kunst. Sie hatten sich mit Arbeiten der Künstler:innen Bruno Munardi (Italien, 1907 – 1998), Lina Bo Bardi (Brasilien, 19914 – 1992) und Josef Schagerl junior (Österreich, 1923 – 2022) beschäftigt. Von Ersterem borgte sich das Projekt den Untertitel für die Installation aus „Bequemlichkeit im Unbequemen“, Zweitere vertrat die Haltung, allüberall sollten bespielbare Räume für Kinder Teil der baulichen Konzepte sein und der Dritte, Bildhauer wie sein Vater, schuf vor allem bespielbar Skulpturen im öffentlichen Raum, unter anderem in Wohnhausanlagen.
„Gewürzt“ wurden die auch schon sehr jungen Kindern eroberten bespielbaren Installationen durch Lesungen von (noch?!) unveröffentlichten Bilderbuch-Texten Studierender eines anderen Zweigs der Angewandten, der Abteilung für Sprachkunst. Katharina Karl verfasste ihre beiden Bände in speziellen Gedichtformen, die ihnen auch die Titel gaben: „Haiku“ (aus Japan kommende kurze Gedichtform, meist 5 – 7 – 5 Silben), gezeichnet von Abel Dijkstra. Immer lässt sich die Hauptfigur Haiku aber durch irgendetwas aus dem Gedichtrhythmus rausbringen, weshalb auf der folgenden Seite diese „verloren“ geht; vor allem sucht Haiku nach (s)einem Schuh

Ihr Kollege Étienne Thierry las Auszüge aus seinem recht umfangreichen „Nach Norden“, illustriert von Janka Kočíšen: Igel Hérisson (französisch für das Stacheltier), Beutelmeise Remiz (lateinische Gattungsbegriff für diese Vogelfamilie) und Glisglis (lateinische Bezeichnung für Sieben-Schläfer). Dunja und Clara vertieften sich in die Lektüre des Buches nach Norden, so dass sie spontan eine Episode vor Mikro den anderen vorlasen.
Was dann Katharina Karl veranlasste das Duo zu bitten, ihr zweites Buch „Limerick lauscht in den Wind“ mit ihnen mit verteilten Rollen zu lesen. Limerick ist auch eine kurze Gedichtform, angeblich auf die gleichnamige irische Stadt zurückzuführen – fünzeilig; erste, zweite, fünfte Zeile gereimt, 3. und 4. Zeile gereimt)
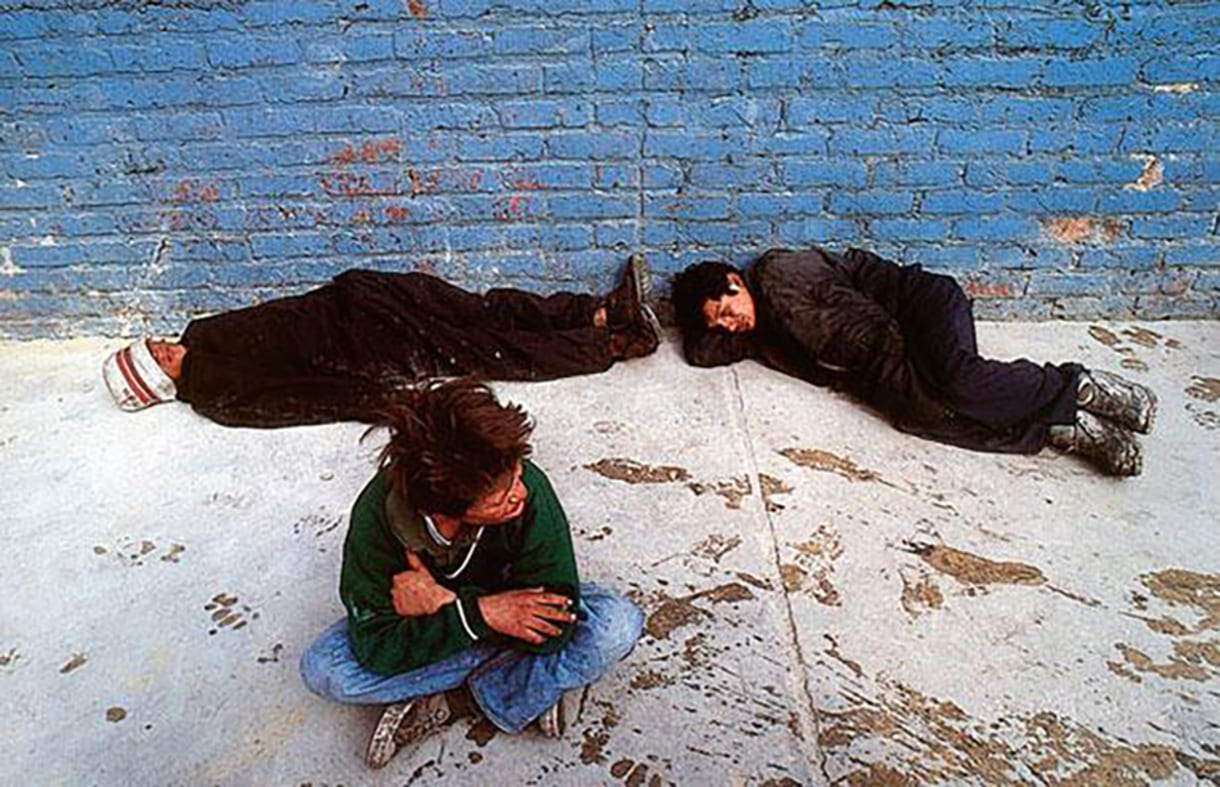
Mehr als (doppelt so viele) Kinder und Jugendliche wie in der gesamten Europäischen Union leben (rund 67 Millionen) leben weltweit mehr oder minder auf der Straße; zwischen rund 100 bis zu 150 Millionen Kinder und Jugendliche haben kein Zuhause, auch in einigen Ländern der EU, aber da noch am wenigsten. Der 31. Jänner gilt seit fast 30 Jahren (seit 1997) als „Tag der Straßenkinder“, ins Leben gerufen von der Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“, ausgehend von den Salesianern Don Bosco. Und dessen Namensgeber, den italienischen katholischen Priester, Jugendseelsorger und Reformpädagogen (1815 – 1888), der im Turiner Stadtteil Valdocco aus einem Schuppen eine Zufluchtsstätte für (Straßen-)Jugendliche machte uns später gemeinsam mit den Salesianern in weiteren Ländern Europas aber auch Lateinamerikas Häuser für Jugendliche aufbaute und (Aus-)Bildungen anbot.

Anlässlich des Straßenkinder-Tages 2026 ist Pater Rafael Bejarano Rivera aus Kolumbien zu Gast in Österreich. Seit vielen Jahren setzt er sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Besonders Kinder in Straßensituationen, junge Menschen in extremer Armut sowie ehemalige Kindersoldaten stehen im Mittelpunkt seines Wirkens.
„Pater Rafael kennt in seiner Funktion als Generalrat der Salesianer Don Boscos, als oberster Vertreter und Experte für Jugend- und Sozialarbeit, alle von Jugend Eine Welt unterstützten Projekte aus der Sicht eines Projektpartners. Er kann somit gute Einblicke in die weltweite Arbeit unserer Entwicklungsorganisation in den Bereichen Straßenkinder, aber auch Schul- und Berufsausbildung geben“, so Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt.

„Seit Beginn meines priesterlichen Wirkens habe ich stets im sozialen Bereich gearbeitet – dort, wo junge Menschen Begleitung brauchen, um ihre Rechte und ihre Würde wiederzuerlangen“, so Rafael Bejarano Rivera aus Kolumbien, einem Land, das über Jahrzehnte von Gewalt, sozialer Ungleichheit und bewaffneten Konflikten geprägt war. Früh entschied er sich für den Weg der Salesianer Don Boscos und stellte sein Leben in den Dienst junger Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Nach seinem Studium der Philosophie und Theologie sowie einer zusätzlichen Ausbildung im Bereich Soziales Management und Entwicklung übernahm er verantwortungsvolle Aufgaben in der Jugendarbeit der Salesianer.
Ein zentraler Meilenstein seines Werdegangs war seine Tätigkeit in der Ciudad Don Bosco in Medellín, einer der größten salesianischen Sozialeinrichtungen Kolumbiens, die auch von Jugend Eine Welt unterstützt wird. Dort arbeitete Bejarano Rivera über Jahre hinweg direkt mit Kindern und Jugendlichen, die auf der Straße lebten, aus zerrütteten Familien stammten oder Gewalt, Missbrauch und den Einsatz als Kindersoldaten erlebt hatten. „Heute sprechen wir bewusst von ‚Kindern in einer Straßensituation‘ und nicht mehr von reinen ‚Straßenkindern‘, da es sich um eine vorübergehende Lebenssituation handelt und ihre Rechte wiederhergestellt werden müssen“, so der Jugend Eine Welt-Projektpartner.

Viele Jahre lebte Michelle in Nairobi (Hauptstadt von Kenia, Afrika) dort, wo andere ihren Abfall entsorgen: auf Dandora, der größten Mülldeponie ihrer Heimatstadt. Zwischen meterhohen Müllbergen suchte sie nach Essen, Schutz und Hoffnung.
Dandora ist größer als 50 Fußballfelder. Verfaulte Essensreste und brennender Müll liegen in der Luft. Schweine und wilde Hunde streifen durch die Abfälle. Über allem kreisen Marabus, die nach Nahrung suchen. Bis zu 10.000 Menschen leben hier – ohne Sicherheit, ohne medizinische Versorgung, ohne Perspektive. Kinder sind dieser Realität besonders schutzlos ausgeliefert. Viele verlieren den Kontakt zu ihren Familien. Mädchen schließen sich Gangs an oder geraten in ausbeuterische Abhängigkeiten. Für die meisten scheint ein Ausweg unerreichbar.
Für Michelle aber änderte sich alles. Sozialarbeiterin Mary Gatitu ist täglich in Dandora unterwegs. Sie begleitet Mädchen wie Michelle, hört zu, stärkt sie – und greift ein, wenn Hilfe dringend nötig ist. Im Rescue Dada Center, Partner der Dreikönigskation, finden sie Schutz, regelmäßige Mahlzeiten, medizinische Versorgung und Zugang zu Schule und Ausbildung.
Michelle hat diese Chance genutzt. Heute geht sie in die Schule, wächst in Sicherheit auf und blickt mit Hoffnung in die Zukunft. Aus einem Leben im Müll wurde eine echte Perspektive. Für Michelle und anderen Kinder in vergleichbaren Situationen sammelt die DKA – mehr dazu im Link am Ende des Beitrages.

Zurück nach Kolumbien, wo – wie überall in nachhaltigen Projekten Bildung eine zentrale Rolle spielt. „In mehreren Städten begleiten wir diese Kinder. Während man früher Kinder dauerhaft auf der Straße lebend antraf, hat sich die Situation verändert: Heute haben viele von ihnen Familien, verbringen jedoch viel Zeit auf der Straße und sind dort großen Risiken ausgesetzt – insbesondere Gewalt, Drogenhandel und Prostitution.“, so Pater Rafael Bejarano Rivera. Ziel sei es, jungen Menschen Schutz zu bieten und ihnen durch Bildung, psychosoziale Begleitung und Berufsausbildung echte Zukunftsperspektiven zu eröffnen.
Viele der Kinder und Jugendlichen, die mehr oder minder auf der Straßen leben müssen, besitzen keine Geburtsurkunde, wurden nie offiziell registriert und haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung oder Schulbildung. „Diese Kinder bleiben oft unsichtbar, obwohl sie großen Risiken ausgesetzt sind“, so Bejarano Rivera.

Heute wirkt der Jugend Eine Welt-Gast auf internationaler Ebene. Als Generalrat für Jugendpastoral und soziale Werke im weltweiten Leitungsteam der Salesianer koordiniert er Bildungs- und Sozialprojekte in 138 Ländern. Mit Jugend Eine Welt verbindet Bejarano Rivera eine langjährige und enge Partnerschaft. Gemeinsam mit der österreichischen Entwicklungsorganisation arbeitet er daran, nachhaltige Bildungs- und Sozialprojekte für Straßenkinder und gefährdete Jugendliche umzusetzen – insbesondere in Lateinamerika.
„Über viele Jahre hinweg haben wir gemeinsam Programme entwickelt – zur Bewusstseinsbildung, zur Begleitung junger Menschen und zur Förderung von Bildung und Ausbildung. Dabei gab es Kooperationen mit österreichischen Unternehmen sowie zum Beispiel mit der österreichischen Botschaft in Kolumbien“, erzählt Bejarano Rivera.
„Die Unterstützung von Jugend Eine Welt ist von zentraler Bedeutung. Internationale Zusammenarbeit wirkt auf vielen Ebenen, doch entscheidend ist die Beziehung zwischen den Menschen. Spenderinnen und Spender – etwa in Österreich – können durch ihr Engagement Entwicklungsprozesse in ganz unterschiedlichen Realitäten ermöglichen. Jugend Eine Welt trägt dazu bei, jungen Menschen weltweit neue Hoffnung, neue Wege und neue Chancen zu eröffnen, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Gemeinschaften zu stärken. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Jugend Eine Welt unterstützt unter anderem technische Ausbildungsprogramme, Maßnahmen zur Arbeitsvermittlung und Projekte für Kinder in Straßensituationen. „Besonders wichtig ist auch der Einsatz von Freiwilligen im Rahmen der von Jugend Eine Welt und den Salesianern Don Boscos getragenen Entsende-Organisation ‚VOLONTARIAT bewegt‘, zum Beispiel in den Städten Medellín und Cali meiner Heimat Kolumbien“, unterstreicht der Salesianer. „Diese Einsätze gehen weit über finanzielle Unterstützung hinaus: Sie ermöglichen echte Begegnungen. Für viele junge Menschen, die viel Leid erfahren haben, ist es von unschätzbarem Wert, Menschlichkeit, Nähe und Solidarität aus anderen Kulturen zu erleben. Gleichzeitig ist Freiwilligenarbeit eine der schönsten Ausdrucksformen gelebter Solidarität. Ich habe viele junge Freiwillige, entsendet durch ‚VOLONTARIAT bewegt‘, aus Österreich in Kolumbien erlebt und gesehen, wie sie persönlich gewachsen sind. Sie haben – genauso wie Freiwillige aus dem Senior Experts-Programm von Jugend Eine Welt – unsere Projekte nachhaltig unterstützt. Es ist eine echte Win-Win-Situation – fachlich, menschlich und auch spirituell.“ Darüber hinaus hilft Jugend Eine Welt auch mit Stipendien für Bildung, Lernmaterialien, Lebensmittel und berufliche Qualifizierung.
Im Zuge des von Jugend Eine Welt ins Leben gerufenen „Tages der Straßenkinder“ am 31. Jänner 2026 berichtet Bejarano Rivera bei zahlreichen Veranstaltungen in Österreich aus erster Hand über die Lebensrealitäten von Kindern in Straßensituationen, spricht über globale Herausforderungen und zeigt, wie konkrete Hilfe wirkt. Einen eindrucksvollen und nachhaltigen Einblick in die Lebensrealitäten von Kindern in Straßensituationen lieferte der Gast aus Kolumbien am Tag vor dem Straßenkinder-Tag rund 100 Schüler:innen der fünften und sechsten Klassne des GRG13 Wenzgasse (im selben Bezirk Hietzing hat die Organisation Jugend Eine Welt ihren Sitz).
dka.at –> kenia-schutz-fuer-maedchen
jugendeinewelt –> tag-der-strassenkinder-2026

„Yippie-Ya-Yay“ schwebt – für (Groß-)Elterngenerationen ein bekannter Ausruf aus diversen meist actionreichen Filme aus dem sogenannten Wilden Westen der USA über dem lange Zeit wortlos bleibenden klassisch-klischee-beladenen Ambiente der Bühne des kürzlich im Dschungel Wien gestarteten Stücks „Cowboys“: Ein riesiger Stoff-Kaktus, eine rötliche stilisierte Berglandschaft, ein Teppich, der an ein überdimensionales Kuhfell erinnert und an Seilen hängt, zwei halbhohe Saloon-Schwingtüren, zwei hölzerne „Pferde“ und vier herumlümmelnde Protagonistinnen in unterschiedlichen aber ebenfalls aus solchen Filmen stammenden Outfits, manche mit dem „einschlägigen“ Hut (Bühne und Kostüm: Flora Valentina Besenbäck). Er bringt vielleicht auch Reminiszenzen an den ersten der digitalen Animations-Filme der Toy-Story-Reihe aus den Kinderzimmern, wo Andys liebste Spielfigur der Cowboy-Sheriff Woody ist.
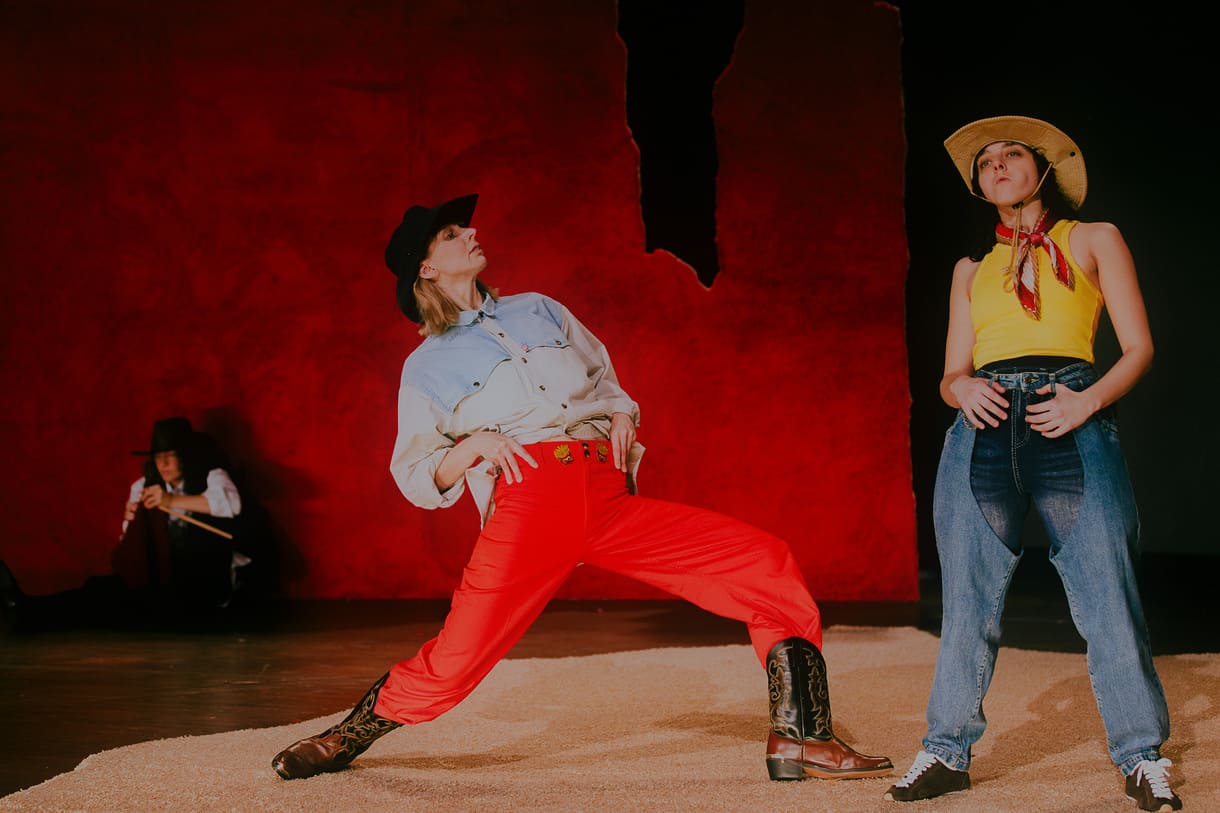
Während Defne Uluer eher schüchtern, verhalten neben dem Kaktus lehnt, breitet sich Emmy Steiner (gemeinsam mit Sarah Gaderer auch künstlerische Leiterin der einstündigen Produktion für ab 7-Jährige) sehr raumgreifend auf der Bank vor dem Saloon aus. Die beiden und dazu zunächst noch Martina Rösler und Elina Lautamäki kämpfen – meist (panto-)mimisch, nur selten mit einigen englischen und deutschen Worten um den Platz in der Mitte oder wo auch immer. Mit bekanntem Manspreading- Gehabe, nicht zuletzt dadurch, dass dies von ausschließlich Frauen gespielt wird, schon mit einer gewissen ironischen Distanz. Das zusätzlich übertriebene Spiel von Spuck- und anderen grauslich-abstoßenden Gesten verstärkt die nachvollziehbare szenische Kritik an solchen Verhaltensmustern.
Das Schauspiel, in dem es später zu wilden Ritten auf den hölzernen Pferden und verschiedensten Interaktionen kommt, eröffnet aber auch mehr, denn irgendwann outet sich beispielsweise die oben schon erwähnte schüchtern lehnende Defne Uluer als eine, die Pferde gar nicht mag, weil sie nicht reiten kann. Und wird aber dennoch von den anderen drei nicht ausgegrenzt. Liefert sich aber ein Duell mit Emmy Steiner – auf Mundharmonikas.
Musik spielt auch eine immer wieder kehrende Rolle in „Cowboys“, zum Glück nicht klassische Western-Lieder „vom Tod“, sondern von Elina Lautamäki geschriebene liebliche Songs, mit teils schrägen Texten von einer traurigen Tomate und lächelnden Blumen. Wobei Musik auch in Form rhythmischer Spiele rund ums Reiten auf den Holzpferden eine Rolle spielt und diese Rösser entfernt an den schulischen Turnunterricht und noch entfernten an den alten deutschsprachigen Begriff für Hobby, nämlich „Steckenpferd“, erinnern.
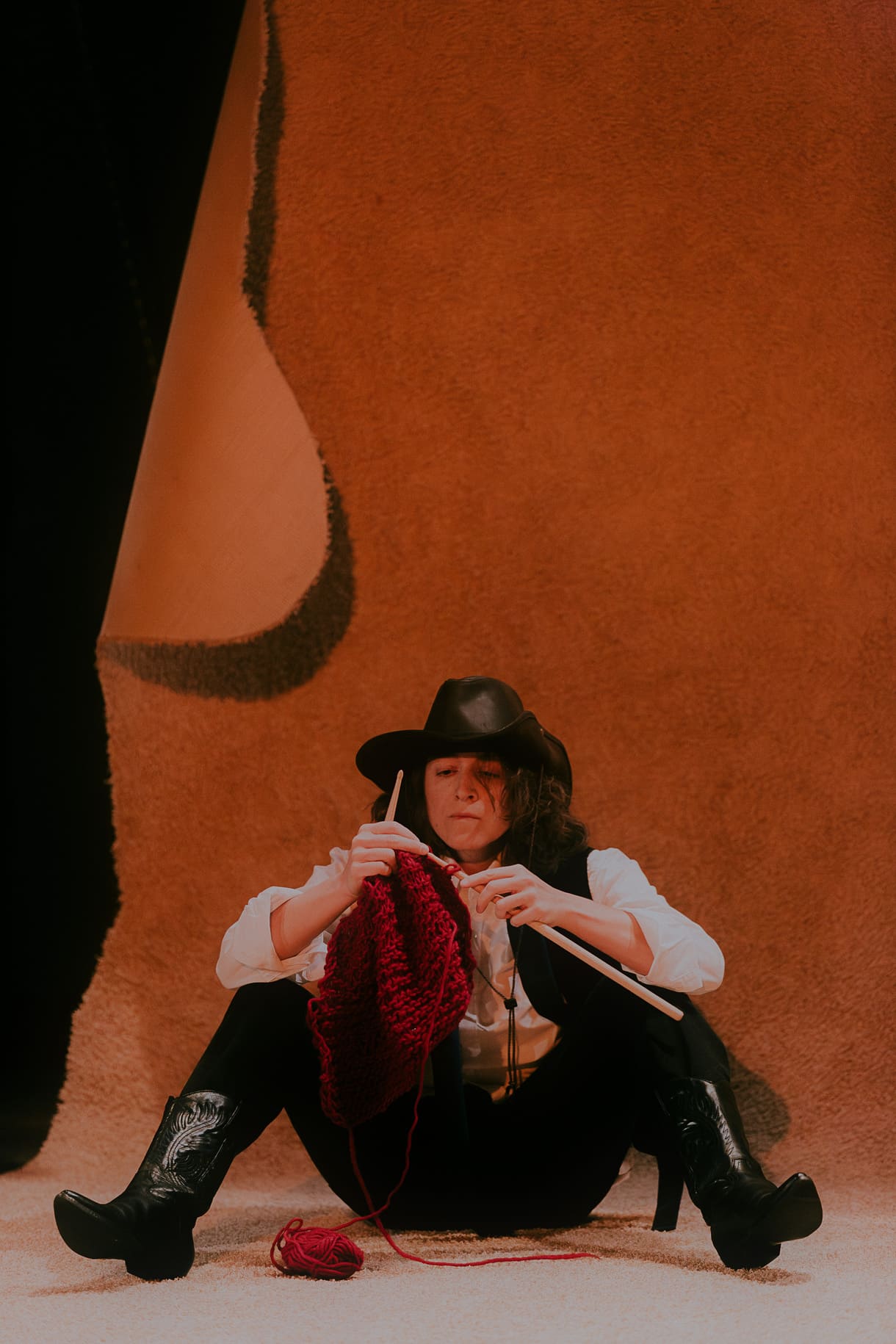
Irgendwann stößt mit Aurora Hackl Timón noch eine fünfte Performerin, die gemeinsam mit den vier anderen und Lina Venegas das Stück entwickelt hat, zur Szenerie. Fast unbemerkt platziert sie sich im Hintergrund, strickt und strickt. Sie hat gegen Ende einen überraschenden – und hier sicher nicht gespoilerten – kräftigen, fulminanten (musikalischen, so viel sei verraten) Auftritt.

Auch wenn klassische „Western“ samt Karl-May-Romanen eher eine (Groß-)Eltern-Kiste sind, sind die raum- und besitzergreifenden Verhaltensweisen vor allem durch Männer „dank“ Manosphere-Influencern auf Social Media selbst für junge Kinder wieder stärker präsent. Ein solcher kam sogar in der Kinoverfilmung von Christine Nöstlingser „Geschichten vom Franz“ als Influencer Hank Haberer vor. Amüsante und sympathisch bricht und hinterfragt diese Vorstellung solches. Und übersiedelt ganz am Ende in sprechgesangähnlicher Tonalität das Geschehen von Texas nach Wien samt dem fast schon pädagogischen Appell, über Gefühle zu sprechen und den Mut, um Hilfe zu bitten, wenn sie erforderlich ist oder wenigstens erscheint.
Allerdings wird eine riesige Leerstelle aufgerissen. Abgesehen davon, dass die „Cowboys“, egal ob als einsame Helden oder doch weniger heroisch und vor allem durchaus divers – die echten solchen waren eben Kuhhirten, Landarbeiter unter wenig ruhmreichen Arbeitsbedingungen. Und doch einfach Helfer, durchaus auch schwarze aus der Sklaverei, jener weißen Eroberer aus Europa, die sich Land und Vieh der angestammten indigenen Bevölkerung unter den Nagel gerissen haben. Und auch das wäre natürlich auch jenseits der „Prärie“ oder des „wilden Westens“ angebracht. Damit sich der Dialog nicht nur unter Privilegierten oder zumindest sich als solche Aufspielenden abspielt und gerade jene, denen sie den Raum wegnehmen, ganz ignoriert werden.

174 Meldungen über Verdacht auf rechtswidrige Inhalte auf Tiktok, Instagram & Co. erhielt Rat auf Draht im vergangenen Jahr. Knapp ein Drittel (64 Inhalte) wurden als rechtswidrig eingestuft – Gewaltverherrlichung, Erpressung mit Nacktbildern, Missbrauchsdarstellungen. Die meisten Plattformen reagierten innerhalb von 48 Stunden und entfernten die Inhalte.
Möglich macht dies der Trusted Flagger Status, den Rat auf Draht seit Anfang 2025 trägt. Trusted Flagger sind so genannte „vertrauenswürdige Hinweisgeber“, die im Rahmen des DSA (Digital-Service-Act) rechtswidrige Inhalte auf Online-Plattformen melden und von diesen bevorzugt behandelt werden müssen.

Seit März 2025 können Kinder und Jugendliche direkt über die Rat auf Draht-Website derartige Inhalte melden. Über das Meldeformular kann die URL eines potenziell rechtswidrigen Beitrags oder Kommentars geschickt werden. Das Team von Rat auf Draht überprüft die Meldungen auf ihre Rechtswidrigkeit. Danach werden diese Beiträge bei der jeweiligen Onlineplattform in einer eigens eingerichteten Möglichkeit für Trusted Flagger gemeldet. Onlineplattformen sind im Rahmen des DSA verpflichtet, vertrauenswürdige Hinweisgeber über die ergriffenen Maßnahmen zu informieren. Rat auf Draht informiert wiederum die Melder:innen über das Ergebnis per Mail.
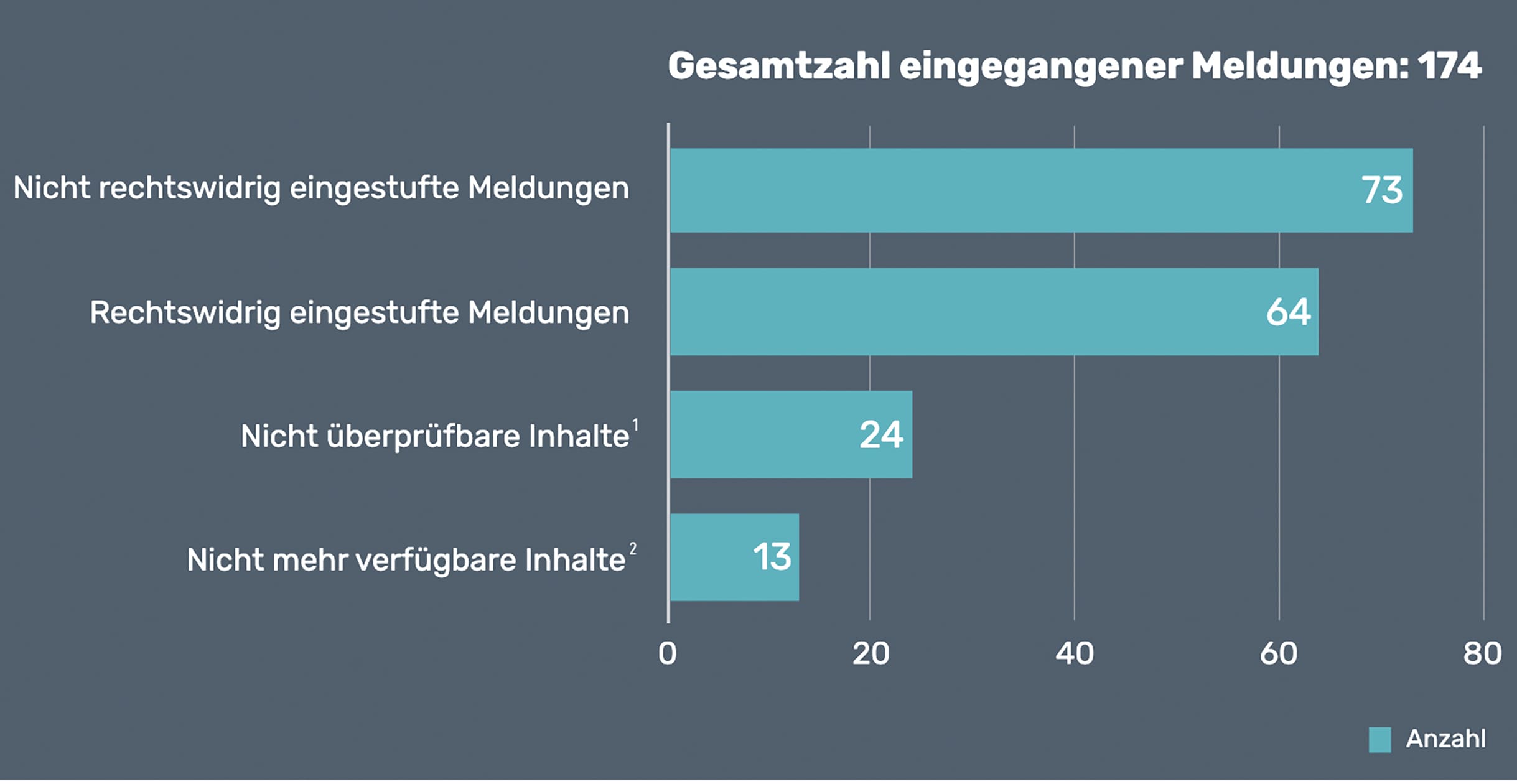
Die meisten Meldungen betrafen die Netzwerke Tiktok (24), Instagram (17) und Discord (15). Auffallend ist auch, dass die Art der rechtswidrigen Inhalte von Plattform zu Plattform stark variiert. So wurden auf Tiktok am meisten Inhalte zu Gewaltverherrlichung gemeldet (17), auf Instagram war die Erpressung mit Nacktbildern (Sextortion) das häufigste Thema (16) und auf Discord Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen (9). „Rechtswidrige Online-Inhalte können für Betroffene mit starkem Leidensdruck und psychischer Belastung einher gehen. Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Anfragen auch auf die Möglichkeit einer begleitenden Unterstützung durch unsere Beratungsangebote hinzuweisen“, sagt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht.
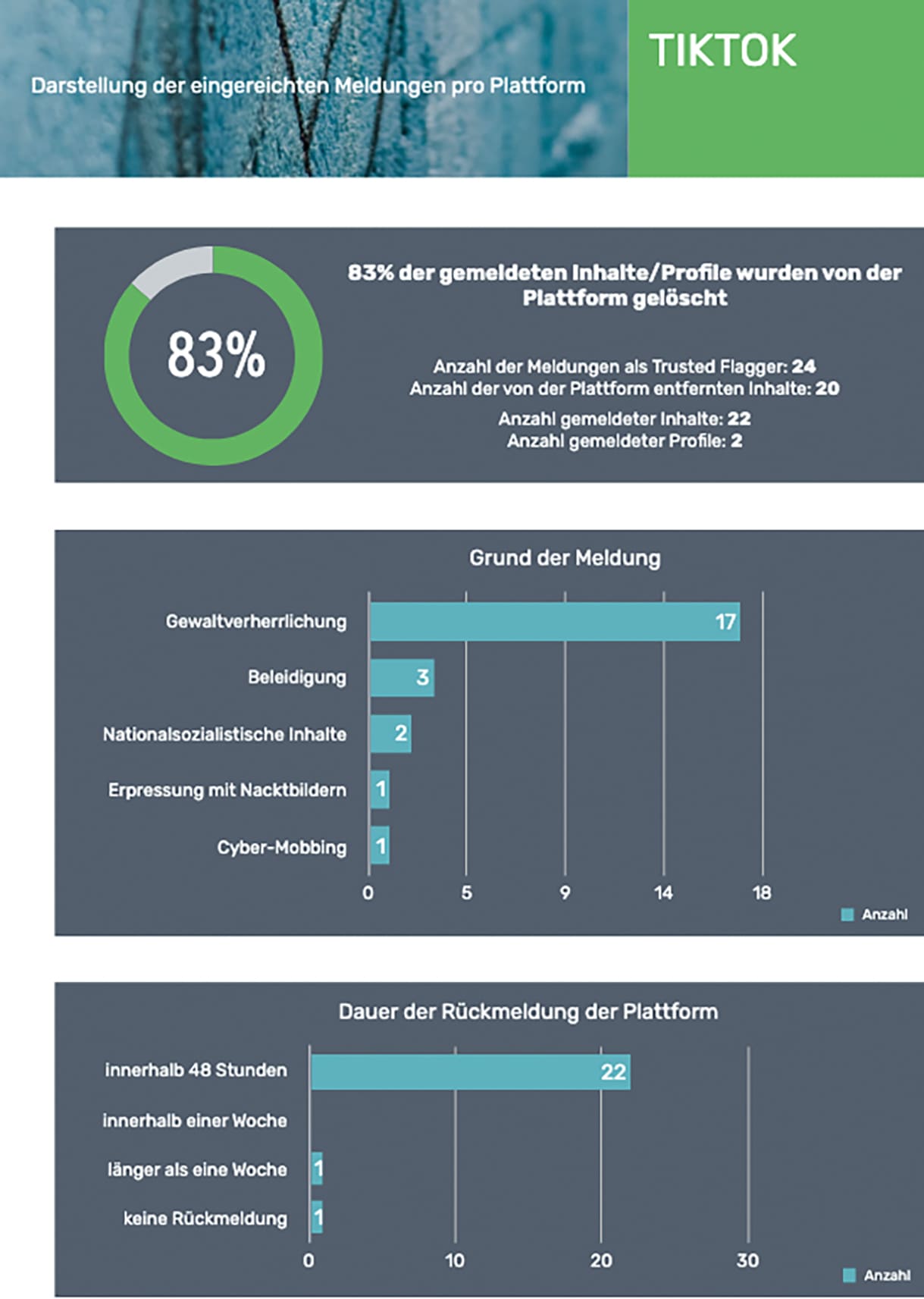
Von den 174 Meldungen, die 2025 eingingen, wurden 64 Inhalte als rechtswidrig eingestuft und bei den jeweiligen Onlineplattformen gemeldet. Beim Großteil der gemeldeten Inhalte konnte eine Entfernung bei den Online-Plattformen erreicht werden. „Einige Melder:innen teilten uns mit, dass sie bereits selbst versucht hatten, die Online- Inhalte bei der Plattform zu melden, jedoch ohne Erfolg. Als Trusted Flagger konnten wir in vielen dieser Fälle dann doch eine Entfernung erwirken. Dies zeigt, dass die meisten Plattformen die Tätigkeit der Trusted Flagger ernst nehmen. Aber auch, dass viele User:innen auf die Unterstützung der Trusted Flagger angewiesen sind“, so Satke.
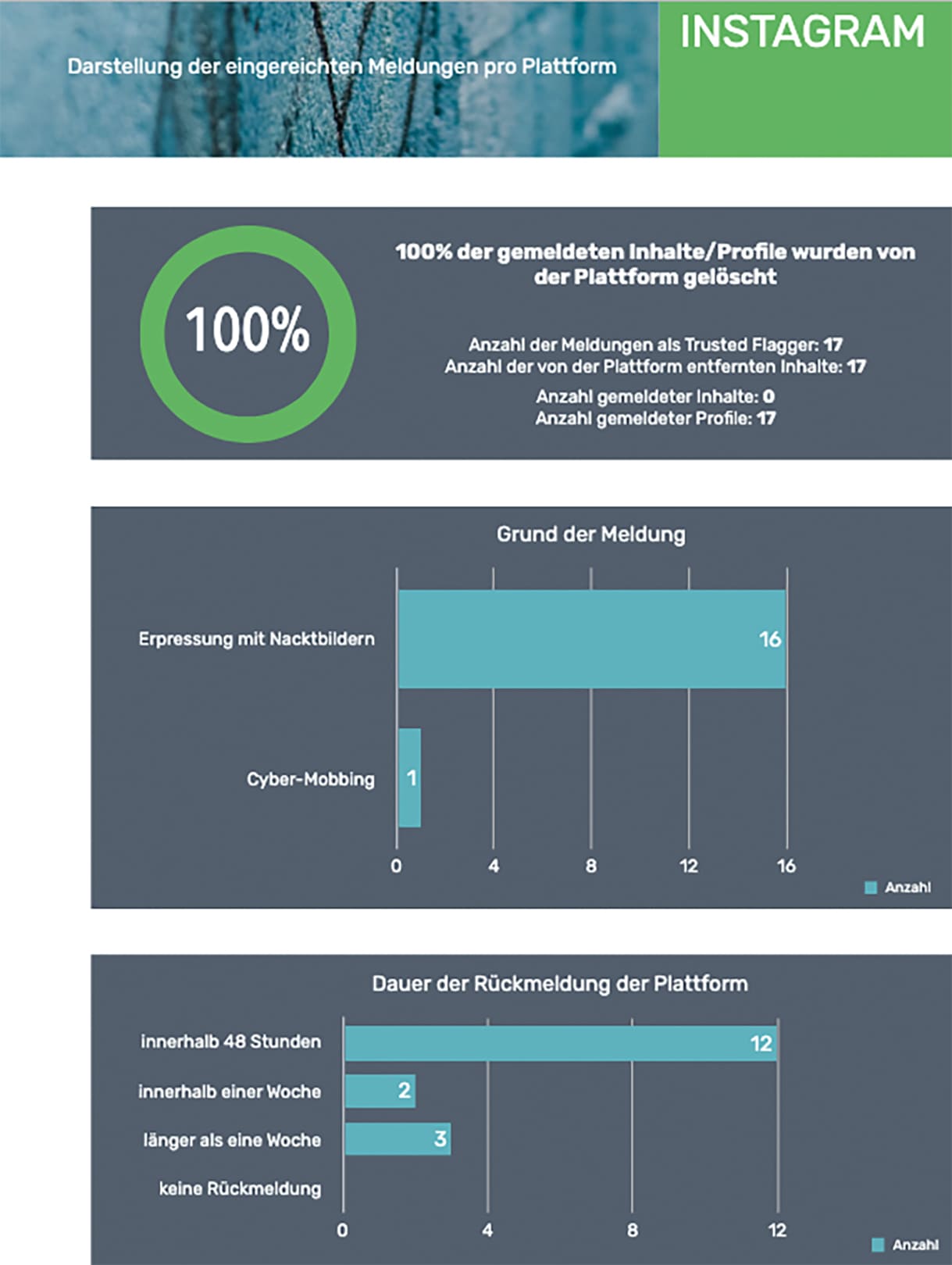
Die bisherigen Erfahrungen zeigen auch, dass sich viele Nutzer:innen nicht sicher sind, ob gewisse Inhalte rechtswidrig sind oder gegen die Nutzungsbedingungen der Plattformen verstoßen. „Auch der Aufbau der Meldemöglichkeiten auf Onlineplattformen ist für viele junge Menschen zu komplex gestaltet. „Einige Plattformen erwarten sich im Rahmen eines Meldevorgangs die Zuordnung zu einem Gesetz, gegen das mit dem gemeldeten Inhalt verstoßen wird. Dies ist insbesondere für Kinder und Jugendliche oft eine unüberwindbare Herausforderung“, erklärt Satke.

Zudem besteht für Online-Plattformen mit dem Digital Service Act eine europaweite gesetzliche Verpflichtung, auf Meldungen der Trusted Flagger zeitnah zu reagieren. Davor hatten viele User:innen die Erfahrung gemacht, dass sie auf gemeldete Inhalte keine Rückmeldung haben oder problematische Inhalte nicht entfernt wurden. Die gesetzliche Verankerung ermöglicht es, die Plattformen bei der Entfernung rechtswidriger Inhalte besser in die Pflicht zu nehmen.
„Wir hoffen, dass noch mehr Kinder und Jugendliche den Mut finden werden, gegen illegale Inhalte im Internet vorzugehen. Gemeinsam können wir mit nur ein paar Klicks viel erreichen“, so Satke.
Zum kompletten Trusted Flagger Jahresbericht von Rat auf Draht geht es hier

Kann Eis wärmen? Rein physikalisch und biologisch wohl eher nicht. Aber vielleicht kommen bei eisigen Temperaturen draußen beim Gedanken an Speise-Eis sommerliche Gefühle ins Spiel.
Nun, so entführt die heutige Buchbesprechung in einen Eissalon. Auf der Titelseite serviert ein Eisbär der fröhlich-freudig lachende Stella ein Stanitzel (eine Tüte) mit drei bunten Kugeln, samt Sonnenschirmchen als Deko. Auf der ersten Seite finden sich neben den beiden Titelfiguren Bären in verschiedenen Farben.

Jutta Treiber, die Autorin, und Illustrator Alex Nemec haben sich ausgedacht, dass die Bären die Farben des Eis-Geschmacks – und gleich dazu die passenden „Namen“ annehmen mit dem Schmäh, dass im Deutschen Beeren und Bären ziemlich ähnlich klingen 😉
Und so treten Heidel-, Erd-, Brom-, Him-, Schwarz- und Stachelbär bzw. -bärin auf den Seiten in Text und Bildern auf und bestellen genau „ihre“ fruchtigen Beeren-Sorten. Und siehe da, die 20 Seiten kommen ganz ohne Streit oder Konflikt aus – „das ist ein Gelächter und Gelecker und Geschlecker und Geklecker“, und das ist kann ja auch ganz schön erwärmend sein 😉
Eine sprachspielersiche Überraschung hat Jutta Treiber dann auf der vorletzten Seite noch eingebaut von einem Bär-Rücken-Bär, vielleicht kommst du selber drauf, welche Fantasie-Bären-Art sie da erfunden hat.

Der große weiße Tisch lässt erahnen – auch wenn er erst später beim Kippen, oder von Anfang an beim Aufstehen mit einem Blick von leicht oben als überdimensionaler Controller erkennbar ist, hier wird gespielt. Auf der Theaterbühne (Bühne & Kostüm: Daniel Sommergruber) rund um und in Computer- bzw. Video- und Online-Games. Der „Held“, der die Stunde über im Stück namenlos bleibt, zockt, was das Zeug hält. Und ist – wie sich herausstellen wird – gar nicht besonders gut darin. Aber lieber als Schule, die für ihn ein „schwarzes Loch“ ist, das alle Energie einsaugt, oder gar mit der Mutter zu reden, ist das Eintauchen in abenteuerliche erfundene Welten allemal. Und das am liebsten eher allein, Single Player Modus. Gemeinschaft ist nicht so sein’s. Aber als Einzelkämpfer da wächst er. Irgendwie.
Bis er auf eine Spielerin trifft. Elli nennt sie sich. Und ist viel besser als er, was er doch anerkennend feststellt. Wenngleich sie ihn auf den Boden der (Spiel-)Realität holt, dass dies im Vergleich mit ihm keine Kunst sei.
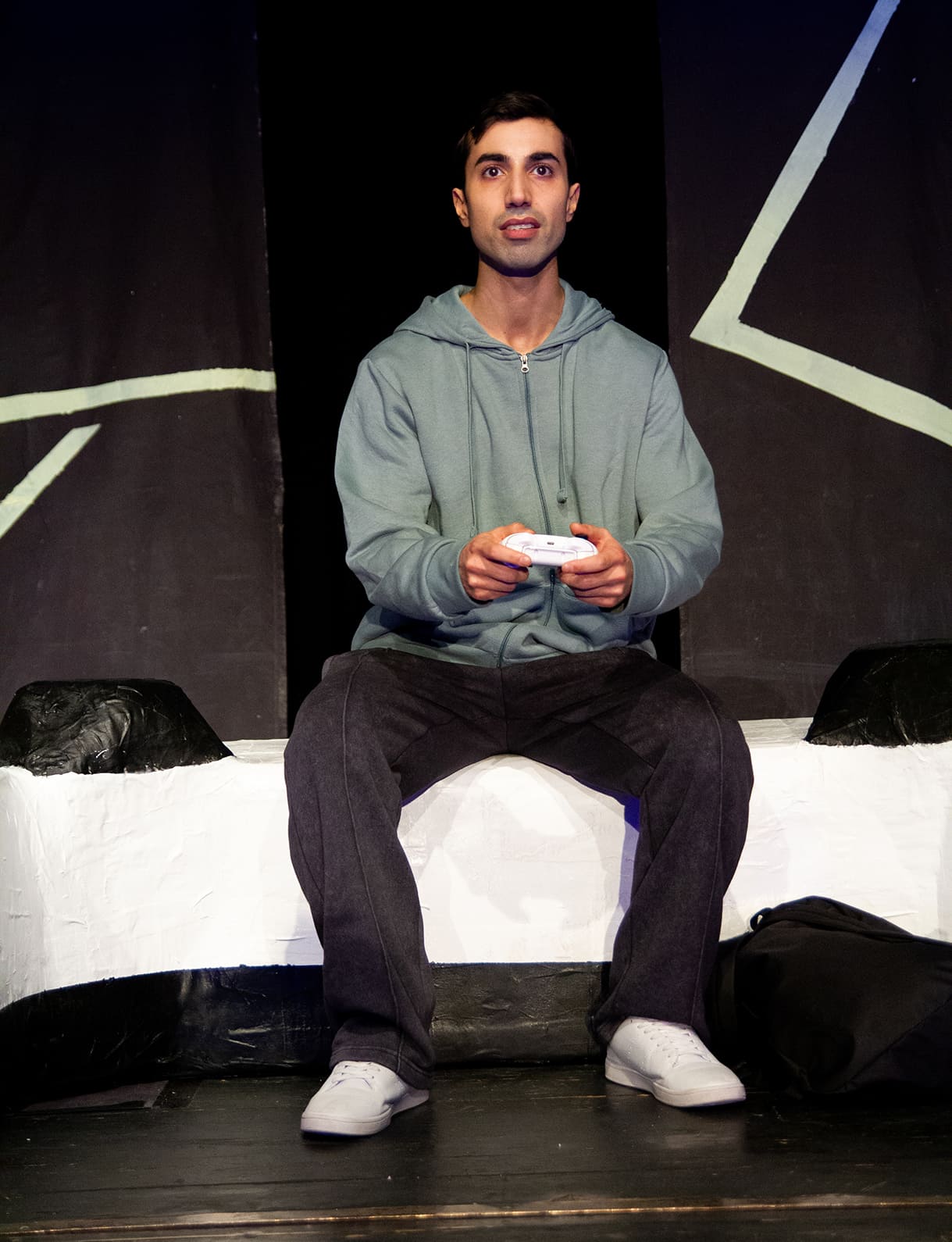
Vor diesem Grundsetting spielt die Theatergruppe „Jugendstil“ ihr diesjähriges Stück „Reset your Mind“ (Setz deinen Geist / deine Denkweise zurück), verfasst von Vielfachtalent Charlotte Zorell – siehe einige der Links am Ende des Beitrages. Regie führte erstmals für Theater Jugendstil Claudia Waldherr.
Mirkan Öncel ist einerseits der Zocker und andererseits in Game-Szenen der Solokämpfer. In einem fiktiven Podcast-Interview mit sich selbst outet er sich als in der Realität schüchtern, unsicher und so weiter und als Interviewpartner als ur-tough – wie er eben gern wäre. Dieses Pendeln lässt er auf der Bühne gut spüren, mit stärkerer Schlagseite auf den nicht so ganz „starken“ Anteilen der realen Figur.

Seine Schauspielkollegin Susanne Preissl ist Tausendsassa, die Umzugs-Queen. Sie schlüpft nicht nur in die Rolle der Gamerin bzw. der Kämpferin im Spiel, wo sie sich Elli nennt. Bald nach Beginn gibt sie die strenge Klischee-Lehrerin, die der – in dieser Szene nicht vorhandenen – Mutter erklärt, dass der Sohn nix fürs Gymnasium ist. Wobei die beiden jugendlichen Charaktere allerdings einiges jenseits der Volksschulzeit angesiedelt sind.
Als Mutter bemüht sie sich um den Sohn, in Sorge um seine Zukunft, kann ihn jedoch erst gegen Ende wirklich erreichen, wo sie selber auch zugibt, in der Schule nicht die beste gewesen zu sein. Weshalb sie bereits zu Hause im Krankenpflege-Gewand auftaucht, irritiert ein wenig – angesichts strenger Hygiene-Vorschriften im Gesundheitswesen. Sie wechselt so überzeugend in ihre jeweiligen Figuren, dass am Ende bei der Verbeugung – da ist sie die Gamerin, nach der Mutter gefragt wurde. Und als sie ihre schwarze Langhaar-Perücke abnimmt, fragen Jugendliche, ob sie wirklich die Mutter des Kollegen ist, der nur ein paar Jahre jünger ist als sie.

Der Zocker anerkennt nicht nur, dass die Gamerin viel besser ist, beide beginnen sich anzufreunden. Er lädt sie ein, dazuzustoßen, wenn er mit seinen Kumpels doch manchmal spielt. Sie äußert ihre Bedenken, dass Jungs sehr oft (mehr als) ungut auf Mädchen reagieren. Seine Gang sei nicht so, meint er. Sind sie aber dann doch. Mehr als. Blöde, abwertende Sprüche, Beschimpfungen und das volle Programm (Stimmen aus dem Off: Curdin Caviezel, Jonas Graber, Philipp König). Und unser „Held“? Der – schweigt.
Ist ihm zwar spürbar unangenehm, aber kein einziges Wort, mit dem er die „Freunde“ in die Schranken weist… Das wird so unangenehm, dass etliche der Schüler:innen der Premierenvorstellung – traditionell für die Theatergruppe im Stadttheater Bruck an der Leitha (Niederösterreich) – im kurzen Publikumsgespräch sagen, er hätte für sie Partei ergreifen müssen. Also – wie der Titel will – seinen Geist / seine Denkweise neu aufsetzen.

„Geh hin und entschuldige dich“, rät ihm die Stimme der „Oma“ aus dem Off, mit der er immer wieder am Handy telefoniert. Doch auch wenn der Draht zu ihr besser zu sein scheint als zur Mutter, schwingt auch da eine ignorante Ebene mit. Die Großmutter (Sehnaz Taftali) ist zweisprachig mit Deutsch und Türkisch, was sie immer wieder einfließen lässt. Doch dem Enkelsohn kommt kein einziges Wort, weder eine Begrüßung noch ein Danke auf Türkisch über die Lippen.
Im Game selber wird der Tisch = Controller zu allem Möglichen, unter anderem einem Auto, da spielt sich Action ab, bei der viele der jugendlichen Zuschauer:innen so richtig mitgehen. Gar nicht so viele zeigen im Publikumsgespräch auf, als gefragt wird, wer gern und viel spielt. Im Gegensatz zu den Schüler:innen einer Klasse, in der die Autorin des Textes zur Recherche war: „Da haben alle gespielt!“
Als Korrektiv aus der Zielgruppe holte sich „Theater Jugendstil (Susanne Preissl und Sophie Berger) erstmals eine jugendliche Hospitantin mit der 16-jährigen Schülerin Lalezar Bülbül.

Das Zurechtrücken von noch immer weit verbreiteten Klischees ist einer der Grund-Anstöße des Stücks. Immerhin ist fast die Hälfte aller, die spielen, weiblich – 47 Prozent der mehr als drei Milliarden weltweiten Spieler:innen wie die Game-Expertin – Spielerin, Designerin und Forscherin (Computerspiele, Virtual Reality, Künstliche Intelligenz) Johanna Pirker (Technische Unis München und Graz) im Buch „Game On – wie Gaming unsere Welt revolutioniert“ schreibt.
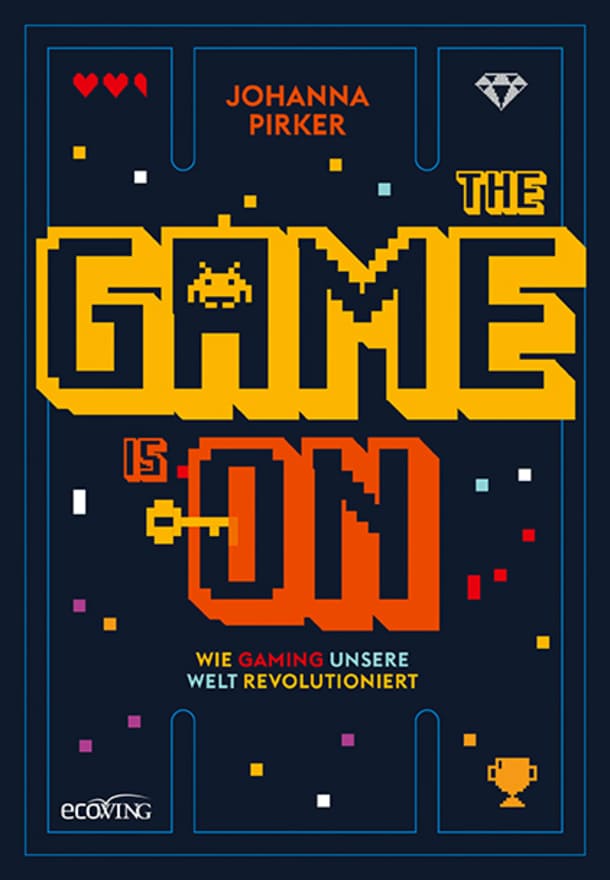
Sie sieht die Welt des Gamings auch weitaus positiver als die Warner:innen vor den Gefahren: „Leider werden Games immer noch oft auf problematische Aspekte wie Gewalt oder Sucht reduziert, anstatt das Spiel als vielfältiges, komplexes Medium zu begreifen.“ (S. 32) Entwicklung von Spielen, das Business darum herum sei außerdem ein wichtiger Wirtschaftszwei, mittlerweile größer „als die Film-, Buch- und Musikindustrie zusammen“ (S. 23).
Über die Gamerin, Moderatorin, Speakerin Rebecca Raschun alias JustBecci in einem der Berichte über die Game City 2025 im Wiener Rathaus, immerhin die siebentgrößte Stadt Österreichs – im ersten Link unten.
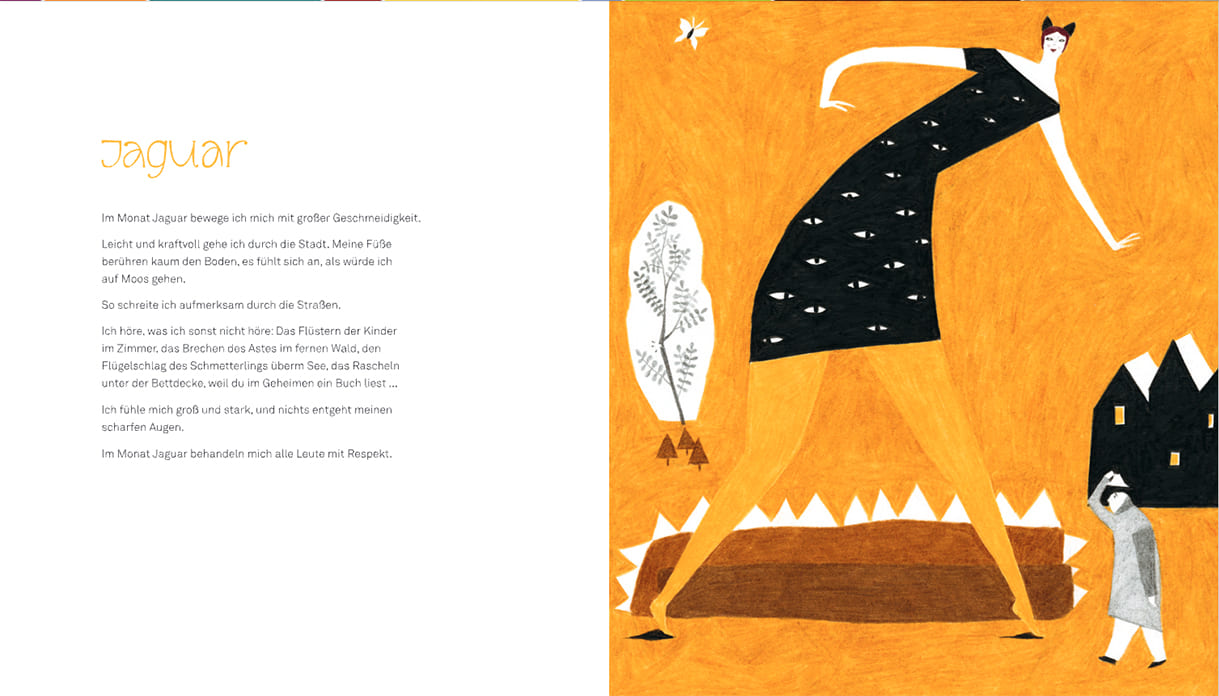
„Im Monat Jaguar bewege ich mich mit großer Geschmeidigkeit“, beginnt Heinz Janisch den Text in diesem Bilderbuch. Monat Jaguar? Hääää??? Wann ist denn der? Und wo? In welchem Kalender?
Nun der Buchtitel „Jaguar, Zebra, Nerz“, deutet schon drauf hin, dass sich wer einen Spaß mit Jänner, Februar, März erlaubt hat. Auch die anderen neun Monate haben Bezeichnungen, die eine hörbare Verwandtschaft zu den echten und mit Tieren zu tun haben. Wobei es nicht alle der zwölf „Tiere“ gibt, etwa den Locktauber, sowie Wespen-, Robben- und Zehenbären.
Der bekannte österreichische Autor Heinz Janisch hat sich von einem alten Gedicht von Christian Morgenstern (1871 – 1914) inspirieren lassen. In zwölf Zeilen unter dem Titel „Wie sich das Galgenkind die Monatsnamen merkt“ hatte er eben „Jaguar, Zebra, Nerz, Mandrill, Maikäfer, Pony, Muli, Auerochs, Wespenbär, Locktauber, Robbenbär, Zehenbär“ erfunden.
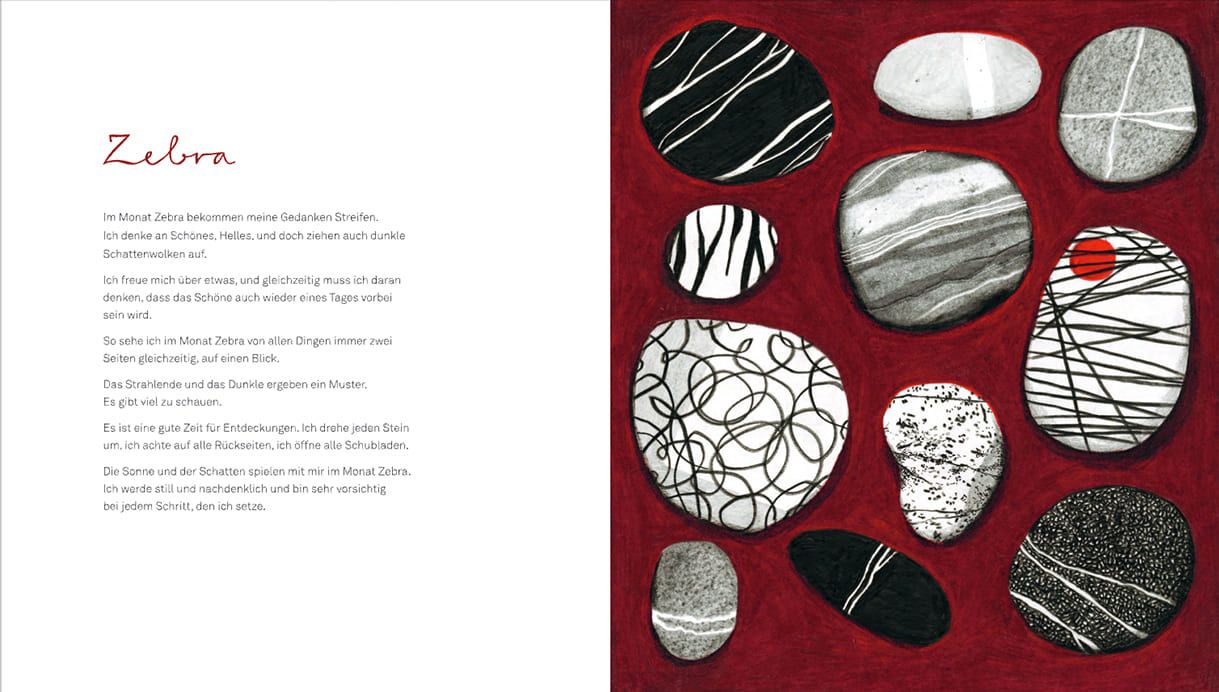
Im Nachwort zum hier besprochenen, vor ein paar Jahren schon erschienenen Buch schreibt Janisch, dass er „große Lust“ bekommen habe, „über diese sonderbaren Monate nachzudenken…“
Und so gibt es hier zwölf gefühls-starke, nicht selten auch -schwankende Texte, die mitunter von der jeweiligen Jahreszeit der Originalmonate bestimmt oder wenigstens beeinflusst sind. Im „Muli“ etwa „Vorfreude auf den Sommer und die langen Ferientage“.
Aber weit über die Jahreszeit hinaus reichen wohl von allen hin und wieder oder auch öfter scheinbar widersprüchliche Empfindungen zwischen urschwer und federleicht wie im Monat Auerochs (August) oder in einer kleinen, riesengroßen Welt wie im Robbenbär (November) wo Janischs Badewanne „groß und größer“ wird, „sie dehnt sich aus, eine Nord-Ost-West-Südsee, die nicht endet.“
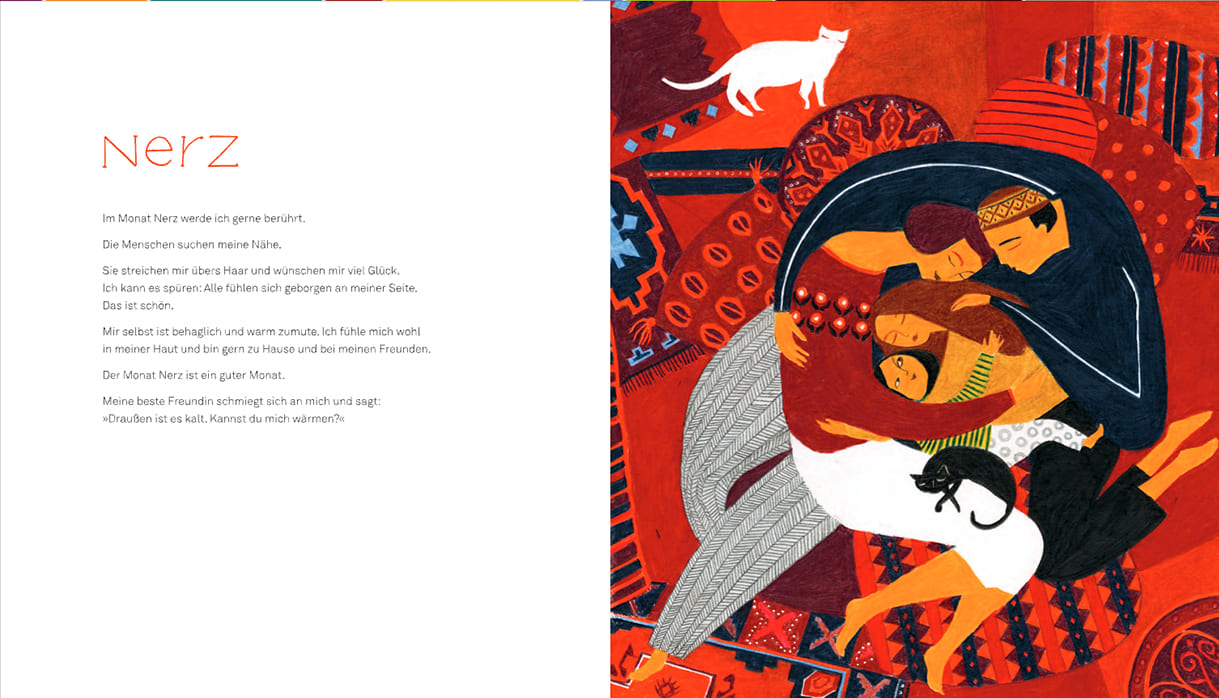
Michael Roher hat die Texte als Inspiration für riesige erweiterte eigene Bilderwelten hergenommen. Die etwa dieses endlose Meer nochmals vergrößern. Oder im Jaguar mit der riesigen Tänzerin mit vielen Jaguar-Augen auf ihrem Kleid die „Geschmeidigkeit“ aus dem Text noch vergrößern lässt.
Sowohl Text als auch Bilder und nicht zuletzt Morgensterns Gedicht selbst drängen sich bei vielen möglicherweise zum Weiterspinnen von (Wort-)Bildern und gänzlich neuen fantasievollen Monatsnamen auf.
Ach ja, noch was: Das Buch wird hier gerade jetzt besprochen, weil seit Kurzem eine musikalische Theaterperformance ausgehend von diesen Monatsnamen und „Jaguar, Zebra, Nerz“ zu erleben ist: „Auerochs Zehenbär und noch viel mehr“ – als Liebeserklärung an Natur(schutz); Stückbesprechung unten verlinkt.
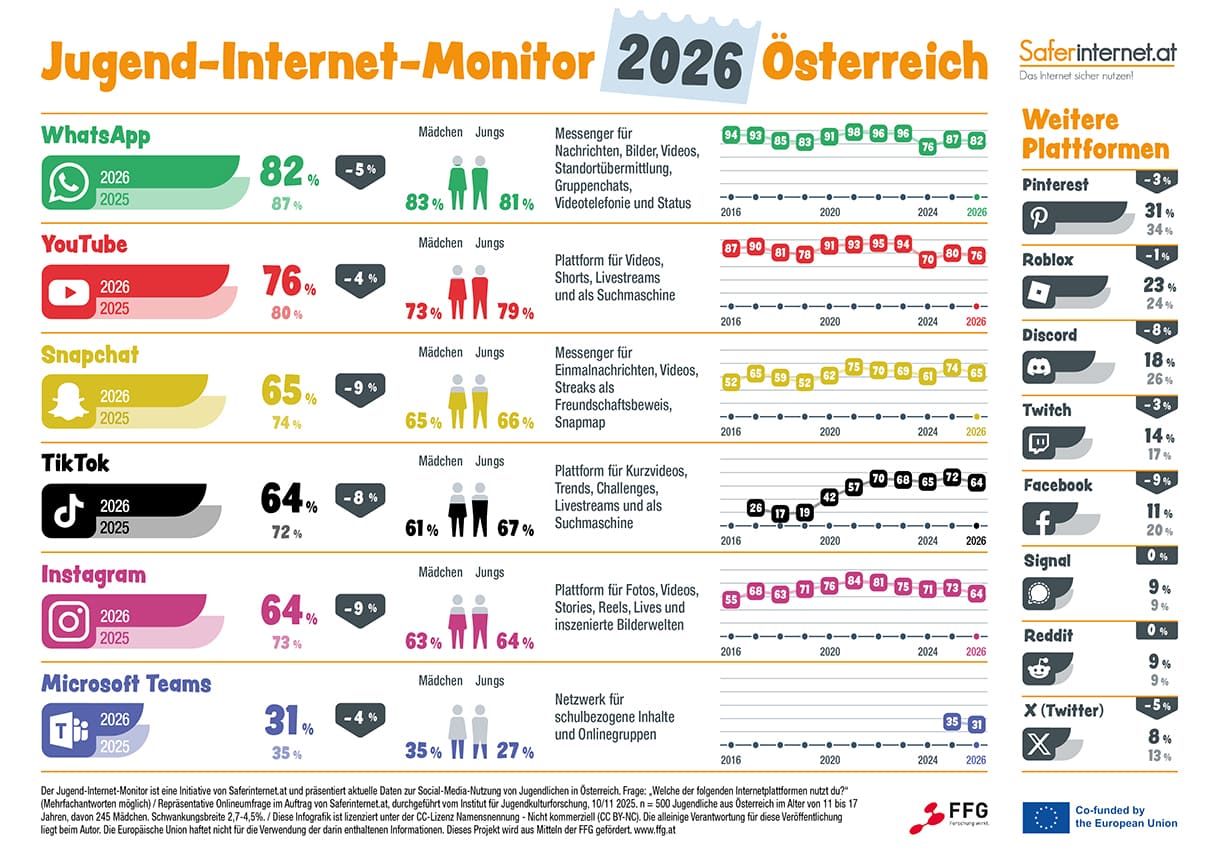
Während Australien seit knapp eineinhalb Monaten Jugendlichen bis 16 Jahre Social Media verbietet, andere Länder, darunter auch Österreich über Ähnliches diskutiert, ging im Vorjahr die Nutzung ohnehin zurück. Dies ergab der jüngste Jugend-Internet-Monitor der EU-geförderten Initiative Saferinternet.at. lediglich per Künstlicher Intelligenz getriebene Chatbots wie Chat GPT weisen Zuwächse auf, alle anderen Plattformen verlieren Zugriffszeiten.
Bereits zum elften Mal erhob das Institut für Jugendkulturforschung für Saferinternet.at in einer repräsentativen Studie mit Unterstützung der EU und der FFG (Österreichische ForschungsFörderungsGesellschaft) die Social-Media-Favoriten der österreichischen Jugendlichen – befragt wurden 500 Jugendliche zwischen 11 bis 17 Jahren aus ganz Österreich. Die Top 6 der beliebtesten Plattformen sind gleichgeblieben, auch in der Reihenfolge gibt es kaum Veränderungen. Allerdings verlieren alle Plattformen an Nutzerinnen und Nutzern.
Der Schwerpunkt sozialer Netzwerke hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschoben: Direkter Austausch mit Freundinnen und Freunden verliert an Bedeutung. Stattdessen rückt das endlose Durchscrollen von Kurzvideos in den Vordergrund.

WhatsApp bleibt auch 2026 die Nummer eins – trotz rückläufiger Nutzung. Mit 82 Prozent Nutzung (davon 84 % tägliche Nutzung) führt der Messenger-Dienst das Ranking an, gefolgt von YouTube mit 76 Prozent (50 % tägliche Nutzung). Während WhatsApp im Vergleich zum Vorjahr 5 Prozentpunkte verliert, büßt YouTube 4 Prozentpunkte ein. Auf dem dritten Platz liegt die Messenger-App Snapchat mit 65 Prozent Nutzung (davon 85 % tägliche Nutzung).
Damit landet Snapchat nur knapp vor TikTok und Instagram, die jeweils von 64 Prozent der Jugendlichen genutzt werden, wobei TikTok (83 % tägliche Nutzung) den vierten und Instagram (77 % tägliche Nutzung) den fünften Platz belegt. Alle Plattformen verzeichnen deutliche Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr: Snapchat und Instagram verlieren je 9 Prozentpunkte, TikTok 8 Prozentpunkte. Auch Microsoft Teams, mit einer Nutzung von 31 Prozent auf Platz sechs, ist um vier Prozentpunkte rückläufig.

Abseits der großen Netzwerke ist die App-Landschaft der Jugendlichen vielfältig. 31 Prozent der Jugendlichen nutzen die digitale Pinnwand Pinterest. Weiters werden die Spieleplattform Roblox von knapp einem Viertel (23 %) und die Kommunikationsplattform Discord von knapp einem Fünftel (18 %) genutzt. Die Streamingplattform Twitch kommt auf 14 Prozent. Auch diese Plattformen verzeichnen Rückgänge gegenüber dem Vorjahr. Lediglich der Messenger-Dienst Signal sowie das Internetforum Reddit (jeweils 9 %) müssen keine Verluste hinnehmen.
Der größte Verlierer des Jahres ist BeReal: Die Instant-Foto-App, die 2024 noch von knapp einem Drittel der Befragten genutzt wurde, verliert seither kontinuierlich an Bedeutung und wird 2026 nur noch von 7 Prozent der Jugendlichen verwendet.
Bei den beliebtesten sozialen Netzwerken fallen die geschlechtsspezifischen Unterschiede insgesamt gering aus. YouTube (Jungs: 79 %, Mädchen: 73 %) und TikTok (Jungs: 67 %, Mädchen: 61 %) werden zwar weiterhin etwas häufiger von Jungs genutzt. Bei WhatsApp, Snapchat und Instagram zeigen sich 2026 hingegen keine Unterschiede mehr – ein deutlicher Wandel im Vergleich zum Jahr 2025, als Snapchat vor allem bei Mädchen klar dominierte. Microsoft Teams wird, wie bereits im Vorjahr, häufiger von Mädchen (35 %) als von Jungs (27 %) genutzt.

Deutlicher werden die Unterschiede bei Video-Streaming- bzw. Gaming-Plattformen: Discord (Jungs: 28 %, Mädchen: 8 %) und Twitch (Jungs: 23 %, Mädchen: 5 %) bleiben klar männlich dominiert. Bei der Spieleplattform Roblox ist die Differenz weniger stark ausgeprägt: Ein Viertel der Jungs (25 %) nutzt Roblox, aber auch über ein Fünftel der Mädchen (21 %). Erhebliche Unterschiede gibt es dagegen bei der Nutzung der digitalen Pinnwand Pinterest, die über die Hälfte der Mädchen (55 %) anspricht, aber nur 8 Prozent der Jungs. Weitere deutliche Unterschiede zeigen sich bei Reddit (Jungs: 14 %, Mädchen: 3 %) und X (Jungs: 12 %, Mädchen: 4 %).
Der Schwerpunkt sozialer Netzwerke hat sich – wie oben schon erwähnt – in den vergangenen Jahren deutlich verschoben. Austausch mit Freund:innen, über das eigene Umfeld informiert zu bleiben oder bestimmten Personen gezielt zu folgen, gehen zurück. Stattdessen rückt das endlose Durchscrollen von Kurzvideos in den Vordergrund. Dieses Prinzip, das vor allem TikTok geprägt hat, bestimmt inzwischen die Funktionsweise fast aller großen Social-Media-Plattformen. Jugendliche konsumieren deren Content überwiegend passiv und lassen sich von Inhalten, die der Algorithmus vorschlägt, berieseln. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass viele von ihnen kaum mehr benennen können, welchen Content-Creatorinnen und -Creatoren sie tatsächlich folgen. Der algorithmische Konsum ersetzt zunehmend das bewusste Abonnieren und Verfolgen einzelner Persönlichkeiten.
KI-Chatbots sind im Alltag von 11- bis 17-Jährigen bereits fest verankert. Aus diesem Grund hat Saferinternet.at diesem Thema eine zusätzliche Erhebung gewidmet. Diese ergab: Bereits 94 Prozent der Jugendlichen nutzen Chatbots, was den beobachteten Rückgang der Social-Media-Nutzung zum Teil erklären dürfte. Hinzu kommt die enorme Vielfalt digitaler Angebote: Neben sozialen Netzwerken werden auch Streaming-Dienste wie Spotify, Netflix oder Disney+ genutzt. Unter den Jugendlichen zeigt sich zudem ein zunehmendes Sättigungsgefühl: Obwohl soziale Netzwerke weiterhin ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags sind, äußern viele junge Menschen in Fokusgruppengesprächen mit Saferinternet.at Kritik. Als besonders störend empfunden werden die große Menge an Werbung und die ähnlichen Inhalte auf den verschiedenen Plattformen. Auch belastende Inhalte und Hasskommentare machen soziale Netzwerke für viele Jugendliche unattraktiv.

Vor zwei Wänden mit Wiesenmuster und einigen dort hinein gesteckten künstlichen Blumen tauchen zunächst abwechselnd die beiden Performerinnen Regina Picker und Karin Steinbrugger wie aus dem „Nichts“ aus diesen Wiesen-Wänden auf. Ähnlich gekleidet, wirkt’s aufs erste, als würde sich die eine in die andere verwandeln.
Mit einem Schmäh steigen sie in Wortspiele, die sich durch das Stück ziehen, ein. „Auer“ – wie meist fast wie „Aua“ ausgesprochen – bringt die eine dazu, zu fragen, wo die andere denn Schmerzen habe. Auch wenn da schon klar ist, dass es eben um Auer… geht, heißt das Stück, das am letzten Jänner-Wochenende des nicht mehr ganz neuen Jahres (2026) im Wiener WuK Premiere hatte, „Auerochs, Zehenbär und noch viel mehr“.

Die beiden Tiere haben sich die beiden, die das Stück entwickelt haben und gemeinsam mit dem Live-Musiker Carles Muñoz Camarero spielen, sozusagen doppelt ausgeborgt. Das Bilderbuch von Heinz Janisch und Michael Roher „Jaguar, Zebra, Nerz“ versammelt die von Christian Morgenstern (1871 – 1914) gedichteten zwölf Tiergattungen, mit denen er verspielt die Monate mit ähnlich klingenden Bezeichnungen benennt: Neben Jänner, Februar, März, die’s tierisch in Janischs und Rohers Buchtitel geschafft haben, noch: Mandrill, Maikäfer, Pony, Muli, Auerochs, Wespenbär, Locktauber, Robbenbär und schließlich Zehenbär für den Dezember.
Morgensterns Gedicht „Wie sich das Galgenkind die Monatsnamen merkt“ – nur mit den zwölf tierisch-verspielten Monaten, regte vor einem halben Jahrzehnt den bekannten Autor Heinz Janisch dazu an, jedem dieser Monate einen eigenen gefühlsstarken Text zu widmen. Und Michael Roher „übersetzte“ diesen in eine riesig erweiterte fantasievolle eigene Bildsprache. Neben den Monatsnamen waren das fantasievolle Spiel mit Worten und Bildern merkbar eine weitere Anregung für das nunmehrige genannte Stück.

Doch Picker und Steinbrugger machten – im Wechselspiel mit Camarero – eine völlig neue Geschichte aus den Anregungen. Abgesehen davon, dass neben den beiden titelgebenden Tieren nur mehr das Zebra als weiteres der fantasievollen Monatstiere, dafür so manch andere vorkommen, lässt das Trio vor allem in die Schönheit und Vielfalt der Natur – von Tieren UND Pflanzen – eintauchen.
Es sei auch gar nicht so einfach gewesen, aus der Fülle der anregenden Wort- und gezeichneten Bilder dann zum eigenen Stück zu kommen, erzählt Regina Picker Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nach einer der ersten Aufführungen. „Wir haben zuerst viele der Tiere gehabt, das war eindeutig zu viel, zu verwirrend. Wir mussten streichen, streichen, streichen. Das ist jetzt so ungefähr unsere 25. Fassung…“

Konzentration auf wenige, um näher auf diese einzugehen einerseits. Der Auerochs hat’s dem Team deswegen angetan, weil es eines der ersten Tiere ist, das die Menschen ausgerottet haben. Seit mehr als zehn Jahren gibt es erfolgreiche Projekte, mühevoll in Naturparks vor allem mit Hilfe moderner Gentechnik – aus DNA von rund 7000 Jahre alten Fossilen – dass Auerochsen einigermaßen „rückgezüchtet“ werden konnten.
Dieser sorglose Umgang und die mühsame Arbeit, Natur (wieder) zu schützen, nicht zuletzt subtil und „nebenbei“ Klimakrise ins Spiel zu bringen, ist dem Team ein Anliegen – und kommt aber ganz ohne Zeigefinger, schön eingebettet in der Geschichte vor.

Als Gegenstück zur doch wuchtigen Hörnermaske sollte dann der Zehenbär in Erscheinung treten – mit bunten Zehensocken Pickers – und dem fast naheliegenden Wortspiel zu zehn – Fingern, Zehen, Blumen, Schritten rund um ein blaues Stück Stoff als „See“ oder „Meer“, naja jedenfalls „mehr“… Bis gar gegen Ende die Zuschauer:innen nach ihren Lieblingstieren gefragt werden. Vor allem der Komponist und Live-Musiker Carles Muñoz Camarero versucht, die Genannten mit Tönen auf dem Cello und einem eher ungewöhnlichen Instrument, einer schwedischen Nyckelharpa (Schlüsselharfe oder auch -geige), einem Mix aus Saiten- und Tasteninstrument, klingend und mimisch zum Bühnenleben zu erwecken.

Ein dunkler Erdhügel, allerlei Grünzeug sprießt daraus hervor und einige Karotten schauen aus der Erde, verstreut kugeln zwei grüne Gummistiefel irgendwo in der Gegend und eine Gießkanne ist von einer Art Hut mit schneckenförmigem Muster bedeckt (Bühnenbild: Gernot Ebenlechner). Gina, so heißt die Schnecke, die Schauspielerin Cordula Nossek (Regie: Beate Sauer) hervorzaubert – unter dem Hut mit ihrer Hand und zwei Fingern, die dank Fingerhüten mit Augenpunkten zu deren Fühler werden.
Fast eine ¾ Stunde zieht sie in dem Stück, mit dem sie derzeit durch einige Spielorte von Junge Theater Wien tourt (siehe Info-Box am Ende des Beitrages), junges und jüngstes Publikum in ihren Bann. Lässt die Schnecke Salat speisen – zum Gaudium der Zuschauer:innen dabei rülpsen.

Doch hat es nun schon lange nicht mehr geregnet, Trockenheit droht. Vielleicht hilft eine Art Regentanz. Und in der Tat „zaubert“ sie Wasser herbei – was bei einer Aufführung in der VHS Großjedlersdorf Kinder fragen ließ „ist das echtes Wasser?“ In ihrem Spiel spricht Nossek immer wieder das eine oder andere Kind mit Merkmalen der T-Shirts oder deren Bewegungen an.
Lediglich der Stücktitel ist mit „Schneckenalarm“ naja verwirrend, bedeutet er doch für Gärnter:innen eher Angst, dass die (behausten) Weichtiere über das Gemüse herfallen, weshalb die zu unterschiedlichen Fallen und Abwehrmitteln greifen. Das (Schau-)Spiel hingegen macht Lust auf gärtnern, Gemüse und auch auf lebendige Schnecken.

Weißlich Plüschwand in Form eines einfachen Hauses, wie es die meisten schnell mal zeichnen. Der Boden davor in der gleichen Form, als wär’s der gleich helle – nicht verzerrte – Schatten (Bühne und Kostüm: Caro Stark). Auf diesem ein ebenfalls plüschiger Hocker und auf diesem liegt – alle Viere von sich streckend – eine Frau im Business-Kostüm. Ach ja, in der Hauswand unten eine durchsichtige Katzenklappe, die Blick auf Grünlich-Glitzerndes ermöglicht.

Um Katze(n) und Menschen, um die Verwandlung einer Zwei- in eine Vierbeinerin dreht sich der vom „Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung“ inszenierte Monolog von Caren Erdmuth Jeß „Die Katze Eleonore“. In einem extrem körperlichen, kraftvollen, energiegeladenen mit dem assoziativen, teils sprachspielerischen Text lässt Darstellerin Maria Fliri schon die Immobilien-Maklerin mehr und mehr zur alternativen, zur anderen Existenz werden, bis sie sich vollends fellig auf offener Bühne umzieht und auch am Ende die Landschaft verwandelt (Regie: Stephan Kasimir).

Sie schlüpft aber auch kurzfristig in die Rollen ihres Vorgesetzten, einer Kollegin und vor allem immer wieder ihres Therapeuten „Wildbruch“, spezialisiert auf „Identitätsthemen“. Seine Fragen und Sager gehen in Richtung vermeintliche / vermutete / wohlmeinende Existenzängste der Aussteigerin aus dem Business gepaart mit – anfänglich – ziemlichem Unverständnis dafür. Doch seine „Klientin“ lässt sich nicht beirren, geht, springt, tanzt, schleicht, konsequent den Weg in Richtung Unabhängigkeit und Überwindung von Normen der „Normalität“ – wie sie (viele) Menschen sehen.
Und eröffnet Denk- und Gefühlsräume – Abschütteln von Zwängen einer- und menschlicher Sicht auf Tierwelt, die Erde, den Kosmos überhaupt. Reißt aber auch das Spannungsfeld zwischen Instinkt und Vernunft auf.

Wo üblicherweise Publikum Theatervorstellungen oder Tanz- und andere Performances verfolgt, mitunter auf Tribünen-Publikums-Reihen oder wo selbst abgetanzt wird, standen Donnerstagabend (22. Jänner 2026) festlich gedeckte Tische. Fünfgängige Menüs – fleischlich oder vegan – wurden serviert. Jede Speise ein eigenes Kunstwerk. Oft viel zu schade, um zerstört zu werden. Aber der Geschmack – so die Festgäst:innen – stand dem optischen Genuss in nichts nach.
Eingelanden in den großen Veranstaltungssaal des WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) in Wien-Alsergrund hatten Schüler:innen, Absolvent:innen und Lehrpersonen der öffentlichen Tourismusschule Bergheidengasse (HLTW, Wien-Hietzing). Die Festgäst:innen finanzierten mit ihrem Menü- UND Kultur-Ticket das neue Charity-Projekt dieser Schule. Bei dem am Ende 15.000 Euro für das Wiener Integrationshaus zusammenkamen.
Die ersten von gut 100 Jugendlichen, die im Einsatz waren, begannen mit der Aufbauarbeit um 10 Uhr Vormittag, die letzten verließen einiges nach 2 Uhr früh die Eventlocation nach dem Ende des Clubbings.
Mehr dazu auch in der unten verloinkten Reportage über das vorbereitende Kochen in der Schulküche.

Auf einem Kasten mit etlichen Klappfenster liegt ein großes Schachbrett. Auf dem Feld nur mehr die beiden Könige, dazu noch bei Weiß ein Pferd / Springer, ein Läufer und drei Bauern; Schwarz verfügt nur mehr neben dem König über einen Bauern. Im Hintergrund steht mit Kreide geschrieben: „Matt in 8“.
Neben dem Kasten steht noch ein Sessel mit kleinem, handelsüblichem Schachbrett.
So präsentiert sich die Bühne – auf einem geknüpften Teppich – für das Stück „Der kleine Diktator“ mit Untertitel „Chef werden – eine Anleitung“ der vor allem auf Objekt- und Figurentheater spezialisierten Gruppe „Die Kurbel“. Derzeit gastiert sie mit dem Stück bei „Junge Theater Wien“, tourt aber gern auf Anfrage auch durch Schulen und andere Orte.

Am Anfang Schnarchgeräusche aus dem Hintergrund, die Figuren beginnen scheinbar zu sprechen und versetzen und in eine Schulstunde. Der Läufer jammert, die Hausübung nicht gemacht zu haben, das Pferd wiehert, irgendwer ruft warnend „er kommt“. Der Schachlehrer taucht auf, und versucht nach der Lösung für Lektion 421 zu fragen – der Ausgangsposition die zu Schachmatt in acht Zügen führen soll. Im Schnelldurchlauf erklärt er’s einmal, zwei Mal, drei Mal samt „vergifteten“ Zügen, die scheinbar harmlos wirken, aber dann…

Figuren wandern irgendwie magisch über Felder und lehnen sich gegen den Lehrer auf. „Ich mag nicht mehr hier stehen“, bewegt sich der Turm wie von Geisterhand von seiner auf die gegenüberliegende Grundlinie – inzwischen hat der „Lehrer“ (Schau- und Figurenspieler Fabricio Ferrari) alle weißen Figuren in die Ausgangsposition gestellt, der Bauer vor dem Turm hat sich selber entfernt. Aus einem der Klapp-Fenster taucht der Kopf eines zweiten Spielers auf (David Fuchs), was auch die Magie der Figurenbewegungen erklärt. Und an den legendären „Schachtürken“ erinnert – einen angeblichen mechanischen Schachroboter aus 1769, in dem aber ein menschlicher Schachspieler versteckt war.

Der Widerpart aus dem Kasten lässt die Figuren sagen, dass sie nicht tun müssen, was der Schachlehrer anordnet, sie hätten die Wahl, das sei eben Demokratie. Was der Lehrer zunächst mit dem Wortspiel Wahl = Qual beantwortet, um hernach dem König den Kopf abzubeißen, ihm einen Luftballonkopf zu verpassen und diesem aufgeblasenen Kopf auch die Luft auslässt.
Mit der Demokratie hat’s der Herr Lehrer nicht so, aber die alte Monarchie habe auch ausgedient. Er selbst wolle sich gern wählen lassen – zum Chef. Und zwar zu einem unumschränkten – womit wir beim Titel des Stücks „Der kleine Diktator“ und seinem Untertitel wären.
Und – ohne es im Stück anzusprechen – bei einer der Inspirationen für das Stück, neben der anderen von Charlie Chaplins „großem Diktator“: Das Buch der italienischen Autorin Michela Murgia „Faschist werden – Eine Anleitung“ (Übersetzung ins Deutsche: Julika Brandestini, Verlag Klaus Wagenbauch, Berlin).

Ihre acht Schritte absoluter, unumschränkter Chef zu werden – klingt ja viel moderner als Diktator – verwandelt „Die Kurbel“, die als Figurentheater rasch Schach als DAS Machtspiel gefunden hatte, in acht Züge
1. Feindbilder: In diesem Fall wird eine übergroße Playmobilfigur aufs Feld gestellt. Erstens bunt, zweitens Arme und Beine – also anders. Schuld an allem.
2. Angst bei den eigenen Figuren gegenüber diesem Angehörigen der „anderen“ schüren
3. … ach nein, alles soll hier sicher nicht gespoilert werden, das Stück ist spannend zu erleben, auch wie die beiden auf der Bühne im immer stärker werden Wechsel- und Kontraspiel der eine die acht Züge entwickelt, der andere doch versucht dagegen zu halten.
Angeteasert werden sollen hier nur lediglich zwei der weiteren Schritte / Züge: Popolismus – bewusst mit diesem einen anderen Buchstaben gespielt und dem einander nicht zuhören – das beide meisterhaft bis hin zum Schrei-Duell exerzieren. So manches kommt einem da aus dem Gruselkabinett der aktuellen (Welt-)Politik mehr als bekannt vor.
Wobei das Stück viel öfter und leichter die satirisch überhöhte Darstellung bricht als das Buch, das durchaus dazu verleiten könnte, auf diese Ideologie auch reinzukippen.

Verraten möchte ich dennoch, dass Fabricio Ferrari am Ende aus seiner Rolle aus- und in sein Leben einsteigt. Dabei schildert er berührend, wie er als Kind in Uruguay (Südamerika) südlich von Brasilien, östlich von Argentinien, in den 13 Jahren Militärdiktatur aufgewachsen ist. Wie er riesengroße Angst der Menschen aber auch beginnenden und schließlich erfolgreichen Widerstand der Donnerstags-Protestaktionen erlebte, die letztlich zum Sturz der Diktatur und Rückkehr zur Demokratie führten.
Konzept, Dramaturgie und der immer wieder auch gruselig-humorvoll Text stammen von Lisa Fuchs, Regie und Gestaltung von Erik Etschel; Figuren-, Kostüm- und Bühnenbau haben neben Fabricio Ferrari, der ja auch spielt, Emanuela Semlitsch und Sofie Pint vorgenommen – Schachfiguren aus Pappmaschee und die übergroße Playmobilfigur aus dem 3D-Drucker.
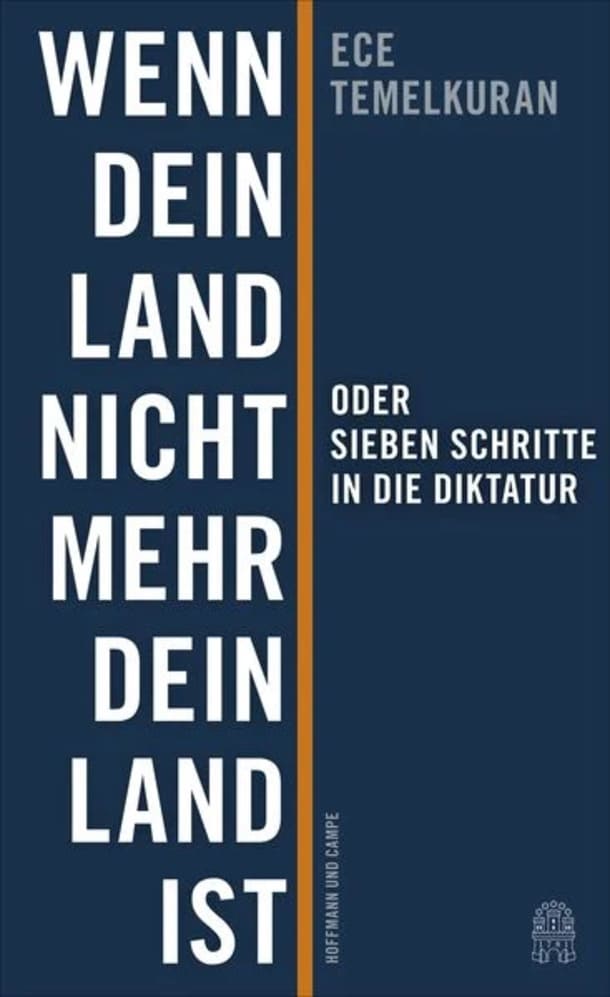
Ausgehend von dem angeblichen, so manche meinen eher inszenierten, Putschversuch Mitte Juli 2016 in der Türkei, beschreibt Ece Temelkuran in „Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist oder Sieben Schritte in die Diktatur“ die Entwicklung ihrer Heimat in ein autoritäres System unter Recep Tayyip Erdoğan.
„Die Verwandlung des Populistenführers von einer Witzfigur in einen furchteinflößenden Autokraten vollzieht sich meiner Erkenntnis nach in sieben Schritten, mit denen er die gesamte Gesellschaft seines Landes von Grund auf korrumpiert“, schreibt die Autorin. Und warnte damals schon, Trump war erstmals Präsident (2017-2021), Großbritannien hatte mehrheitlich für den Austritt aus der EU gestimmt, dass ähnliche Szenarien auch „dem Westen“ nicht erspart bleiben würden. „Ob Sie es glauben oder nicht – das was in der Türkei passiert ist, blüht Ihnen erst noch. Dieser politische Irrsinn ist ein globales Phänomen…“ – und das wurde vor sieben Jahren veröffentlicht.
Gründen Sie eine Bewegung / Zersetzen Sie das Vernunftprinzip und terrorisieren Sie die Sprache / Schaffen Sie das Schamgefühl ab: Im postfaktischen Zeitalter ist unmoralisches Verhalten gefragt / Demontieren Sie die rechtlichen und politischen Grundlagen / Entwerfen Sie Bürger nach Ihrem Geschmack / Sollen sie über das Grauen lachen! / Erschaffen Sie sich Ihr eigenes Land – heißen die einzelnen Schritte / Kapitel ihres Buches – Details unten in der Info-Box.
„So entsteht ein neuer Zeitgeist, ein historischer Trend, der die Banalität des Bösen (Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen von Hannah Arendt, Anm. der Redaktion) in das Böse der Banalität verwandelt.“

Vor, neben, zwischen und unter einer doppelten Bühne spielen die Performer:innen (ihre) Verwirrungen aus. Zwischen sch… auf alles, konfusen (Traum-)Bildern und der Frage: Widerstand oder aufgeben? „Out Loud – Resistance“ ist einerseits ein zweiter Teil einer Trilogie mit dem Titel-Teil „Out Loud“ (Link zur Besprechung von Teil 1 am Ende des Beitrages) und andererseits die erste Produktion eines neuen Kollektivs namens Gobo Performs, hervorgegangen aus der Theater-Akademie DiverCITYLAB.
Wie so manch andere aktuelle Bühnenproduktion kreist diese einstündige Performance rund um ein angesichts der verwirrenden, unerwarteten, bedrohlichen Entwicklungen der (Welt-)Politik rund um diese innere Zerrissenheit vieler Menschen, die mit autoritären, zerstörerischen Mächten nichts zu tun haben wollen: Ich kann nicht mehr, es hat alles keinen Sinn (mehr) auf der einen und jetzt erst recht müsste was und sogar ziemlich viel getan, dagegen gehalten werden.

Und dennoch schaffen die Akteur:innen zwischen einer schwebenden, hängenden Tischplatte mit einem Modell, das Ab- oder Vorbild für die Bühne (Szenografie: Ece Anis Kollinger) im Hintergrund vor der geschwungenen Treppe im Theater am Werk Stephansplatz ist, nicht destruktiven Pessimismus zu verbreiten. Immer wieder mit kräftigen Portionen von Selbstironie spielen Rae (Anillo Sürün), Com (Charlotte Zorell), Ve (Violetta Zupančič), Kuf (Evrim Kuzu) und die Erzählerin Didem Kris – letztere mal aus dem off, dann wieder mitten im Geschehen. Letztere hat auch Regie geführt sowie – gemeinsam mit Berk Kristal und Anna Schober den Text, teils in Englisch, teils in Deutsch – geschrieben.

Mit- und gegeneinander werden diskursiv Sinnfragen gestellt und darüber performativ gestritten. Als weiterer Performer musiziert Aras Levni Seyhan live von einer Art überhöhten Kanzel. Das schon erwähnte Ebenbild der Bühne im Hintergrund als Modell auf der schwebenden Tischplatte hat übrigens noch einen Untergrund, eine bizarre, morbid wirkende Höhlenlandschaft, die Anklänge an das erste „Out Loud“-Stück enthält, das zwischen Wirklichkeit und Träumen im Untergrund spielte.

Die zu Beginn angesprochenen emotionalen und geistigen Widersprüche manifestieren sich gegen Ende besonders stark, wenn Charlotte Zorell einerseits stöhnend, schnaufend ausführt „ich kann nicht mehr“ und ihrem Monolog dennoch eine kämpferische Stärke verleiht. Und dem Publikum keine Antworten auf eigene Zerrissenheiten mit auf den Weg gibt, sondern vielleicht Denk-und Gefühls-Anstöße für eigenes (Hinter-)Fragen.

Die einen schneiden Pilze, die anderen schälen Mandarinen, unter anderem Ines Schatzmayr und Sarah Haczay befreien die Mandarinenschalen vom Weiß, denn die Schalen wandern nicht in den Abfall, sondern werden im Ofen zu Chips getrocknet. Daneben rollen Jugendliche Teig zu dünnen Stangen, schneiden kleine Stückerln ab und drücken mit einem Rundmesser diese zu Muscheln, im Fachjargon Cavatelli (Italienisch für hohl).
In einer anderen Ecke der professionellen Großküche, einer von mehreren in der öffentlichen Tourismusschule Bergheidengasse (Wien-Hietzing, 13. Bezirk), liegen Rinderschultern in Metallwannen. In einer riesigen, beheizbaren Wanne röstet Absolvent Clemens Groß Zutaten für die Bratensoße an, viele Liter dieser gemüsehaltigen Soße können, dank Kipp-Mechanismus dann in einen hohen Topf abfließen und müssen nicht rausgeschöpft werden.
Eine grüne Soße in einer kleinen Metallwanne ist nicht wie’s aufs erste vielleicht ausschauen mag Cremespinat, sondern feingemixter Schnittlauch. In einem Spezialverfahren gewinnen die jungen Köchinnen und Köche daraus Öl: Zunächst gießen sie den Wanneninhalt in ein in einem Metallsieb liegendes Tuch, binden das Tuch zu und hängen es auf. Durch das Eigengewicht – „Wunder“ Schwerkraft – tropft das Öl in einen darunter stehenden Topf.
Woran hier Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Jahrgänge samt dem schon oben erwähnten Absolventen (2020), der Küchenchef im Refugium Lunz ist, und Kochlehrer Kristijan Bačvanin arbeiten, sind Teile eines fünfgängigen Menüs für ein neues Charity-Dinner dieser Schule – samt Kulturprogramm im WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) am 22. Jänner 2026 – für 185 Gäst:innen, nochmals mehr als 100 werden dann zum anschließenden Clubbing dazustoßen (Details siehe Info-Box am Ende des Beitrages).

Eineinhalb Jahrzehnte lang haben Jugendliche dieser HLTW (Höhere (Bundes-)Lehranstalt für Tourismus und wirtschaftliche Berufe) Jahr für Jahr in einem Hotel, zuletzt gut zehn Jahre in jenem am Rennweg, unter dem Titel „Theaterhotel“ für Gäste aufgekocht und ihnen auch Kulturprogramm serviert. Dieses Projekt wurde im Vorjahr von der privaten Tourismusschule Modul übernommen, „aber schon davor haben wir nach einem neuen Projekt Ausschau gehalten, wir wollten jedenfalls wieder unsere Kompetenzen beim Kochen, im Service und beim Organisieren von Kulturprogramm verbinden und das für einen guten Zweck“, fasst Franziska Granzer aus dem Maturjahrgang für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zusammen, bevor sie wieder in den Unterricht muss. Sie ist eine der Projektleiterinnen gemeinsam mit Victoria Nagy. Rund 100 Schülerinnen und Schüler sind für die Veranstaltung im Einsatz, gekocht wird seit Montag, aber viele der organisatorischen Arbeiten haben schon bald nach Beginn des Schuljahres im Herbst angefangen, Vorgespräche wie erwähnt schon im vergangenen Schuljahr.
„Im November 2024 haben wir mit den ersten Ideen begonnen, das WuK als Location war blad klar, weil unsere Schule mit dem Kulturzentrum mehrere Kooperationen hat. Der Titel war nicht so einfach, wir haben viele Vorschläge gehabt. Und weil der Absolventenverein stark involviert ist, sind wir auf „klingt nach“ gekommen. Genauso wichtig war uns, dass es wieder eine Charity-Veranstaltung wird. Dank einiger Kontakte haben wir uns das Integrationshais ausgesucht. Im Herbst waren einige von uns schon dort und haben Interviews geführt. Natürlich kommen auch einige Leute aus dem Integrationshaus zur Veranstaltung.“
Im Hotel konnten die Jugendlichen die in der Schulküche vorgekochten bzw. vorbereiteten Speisen(teile) in der dortigen Küche fertigstellen, kühl lagern, aufkochen… all das geht im WuK nicht. „Da müssen wir auch die Kühlschränke und Öfen mitnehmen“, verraten Manuel Sänger und Daniel Siegmund vom Organisationsteam dem Reporter. „Aber zum Glück haben uns die Absolventen ein großes Transportauto zur Verfügung gestellt.
Die Verwandlung der Mandarinenschalen in Chios ist nicht nur ein Gag, sondern Teil des Konzepts, möglichst nachhaltig zu arbeiten, erklärt der erwähnte Lehrer Kristijan Bačvanin, der vor einem ¼ Jahrhundert die Bergheidengasse absolviert hat (2000) und einer von sieben Lehrpersonen ist, die direkt am Projekt „kochlöffelführend“ tätig sind. „Wir verwenden Bio-Sojasauce aus Oberösterreich, Miso (Paste aus Sojabohnen) aus der Steiermark“, verkündet und zeigt er stolz und gesteht „aber die Algen sind natürlich nicht regional“.
Begleitend zu durchaus ausgefallenen Speisen wie „Buddhas Hand“, eine spezielle Zitrusfrucht aus den Schönbrunner Bundesgärten, Flower Sprouts, einer Mischung aus Kohlsprossen und Grünkohl, und vielem mehr, entführe „lnsingizi feat. Pascal Loponogo“ auf eine musikalische Reise nach Zimbabwe. Die Kabarettistin Aida Loos „serviert“ zum Dessert Auszüge aus ihrem „Best of“-programm, um Lachmuskeln zu stimulieren. DJ Nitkov sorgt parallel zu Tichys Eismarillenknödel für lässige Beats.
Nach dem Dinner verwandeln die Schüler:innen den großen Saal in eine Clubbing-Location, bei der DJ Fisso – DJ Andrea Fissore, Drumatical Theatre, Juicy Crew feat. DJ Jessy Gem & Silybeatz für tanzbare Rhythmen sorgen.
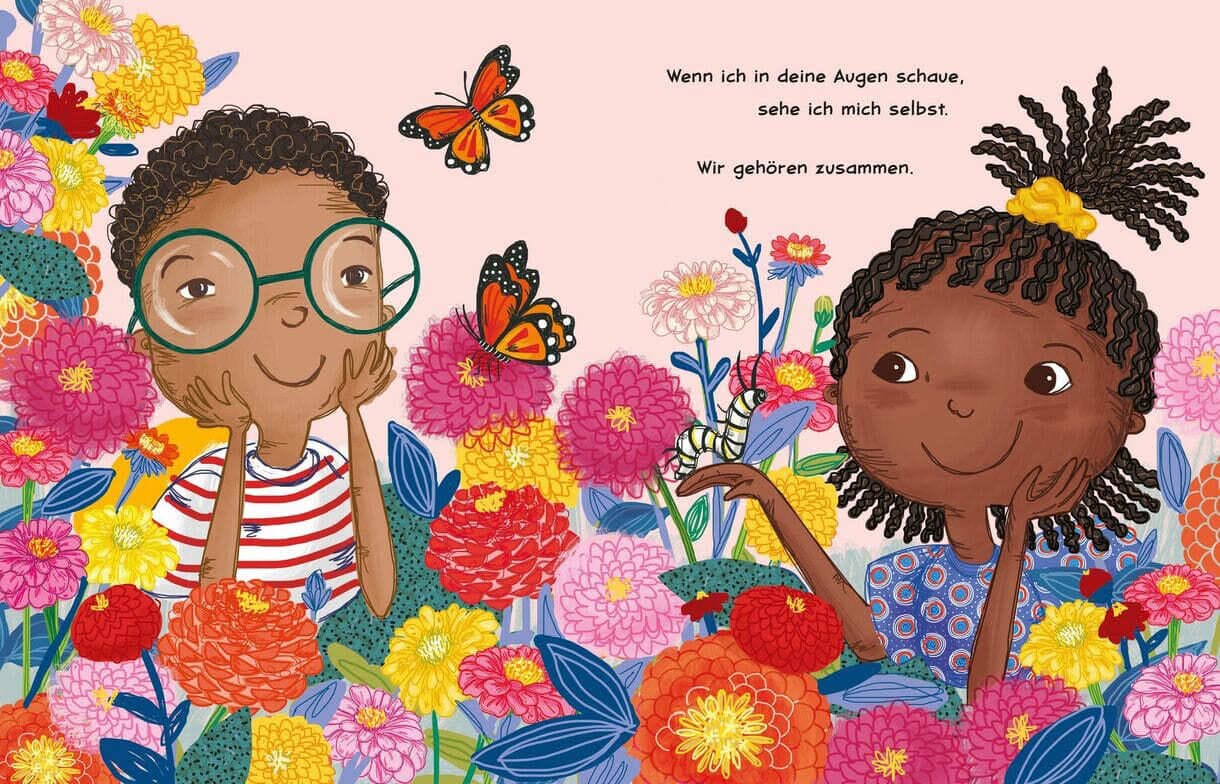
Ein laaanges Fahrrad – gleich Platz für vier unterschiedliche Kinder, drei davon, die in die Pedale treten, das vierte und Jüngste sitze in einem Korb am Ende, ein kleines Hündchen noch dazu in einem Korb vor der ersten Lenkstange. Und vorwärts geht’s nur gemeinsam.
Mit diesem schon so vielsagenden gezeichneten Bild von Zinelda McDonald startet das von ihr und der in Johannesburg lebenden Autorin Refiloe Moahloli Buch „Wir sind eins“ (Übersetzung aus dem Englischen: Africandiva alias Fatima Sidibe).
Und weiter geht’s in dieser Tonart – mit wenigen, knappen Sätzen und farbenfrohen, fröhlichen Bildern. „Wenn ich in diene Augen schaue, sehe ich mich selbst. Ich bin du und du bist ich“, heißt es etwa auf der ersten Doppelseite dieses Bilderbuchs – mit zwei Kindern, großen Augen und mitten unter bunten Blumen.
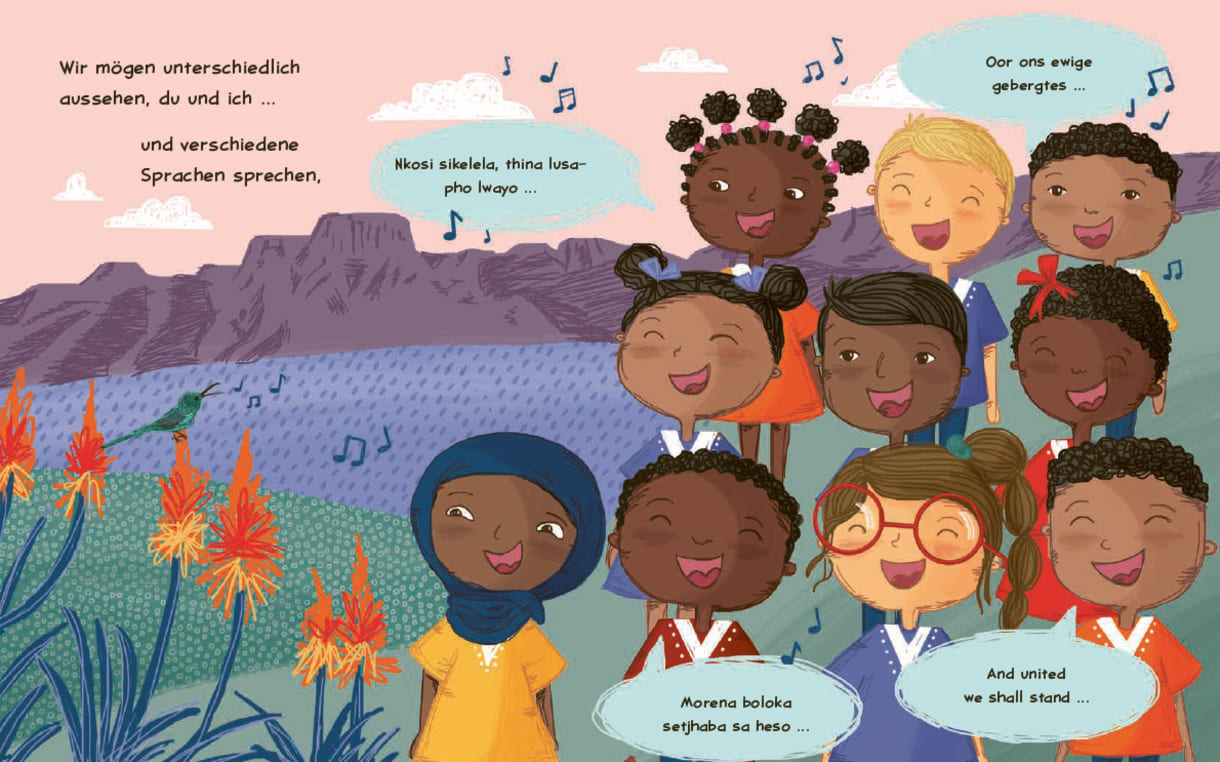
Egal ob weiß oder schwarz, im Rollstuhl oder nicht, mit Blindenstock, spielend, tanzend, springend, auf oder unter Bäumen – jede der Doppelseiten beschreibt und bezeichnet das eine oder andere Element der Philosophie „Ubuntu“ aus dem südlichen Afrika. Respekt füreinander, Achtung voreinander, Leben miteinander… trotz oder gerade weil vielfältig, ob Hautfarbe, Handicaps oder nicht, egal welche Religion oder Sprache. Fein wäre nur gewesen, wenn auf der Doppelseite mit verschiedenen Sprachen noch – vielleicht auch „nur“ im Anhang erklärt worden wäre, dass es sich um Xhosa, Sesotho, Afrikaans neben Deutsch und Englisch handelt – und was die Sätze, die nicht alle das gleiche bedeuten, heißen.

Am Ende des Buches erklärt die Kinderbuchautorin Minitta Kandlbauer, die auch die Umschlaggestaltung des deutschsprachigen Buches gemeinsam mit der Illustratorin vorgenommen hat, den aus den Bantusprachen Zulu und Xhosa kommenden Begriff, der bedeutet: „Ich bin, weil wir sind.“
PS: Unten ist eine Wikipedia-Seite verlinkt, auf der du ein Video findest, in dem Nelson Rolihlahla Mandela (1918 – 2013) in einem Interview Ubuntu mit praktischen Beispielen erklärt – auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Mandela war der vielleicht berühmteste Freiheitskämpfer gegen die Apartheid, die jahrzehntelang die schwarze Mehrheitsbevölkerung Südafrikas rechtlos hielt. Dafür musste er sogar mehr als ¼ Jahrhundert im Gefängnis verbringen. 1994 wurde er dann der erste schwarze Präsident des Landes.

Zu einem Ausflug auf den afrikanischen Kontinent in eines der nicht näher bestimmten 55 Länder lädt die Schauspielerin ein. Knallrote Sonne auf der schwarzen Stoffrückwand, ein blaues geschwungenes Stoff-Flussband, ein Hocker aus Zweigen, „Erde“ und eine Art Baum aus geflochtenen Seilen – Naturmaterialien, die sie einst unter anderem in Nigeria erworben hatte. Und dann liegt da ein großes Ei mit schon angedeutetem Knacks.
Natürlich erraten die zuschauenden Kinder, dass da wohl ein Krokodil rausschlüpfen wird, heißt das nicht ganz ¾-stündige Stück von Dachtheater, mit dem Cordula Nossek derzeit bei Junge Theater Wien (Details siehe Info-Box am Ende) an mehreren Spielorten auftritt „Krokodilstränen“ (Text von ihr und Gernot Ebenlechner, der auch für Regie und Bühnenbild verantwortlich ist).
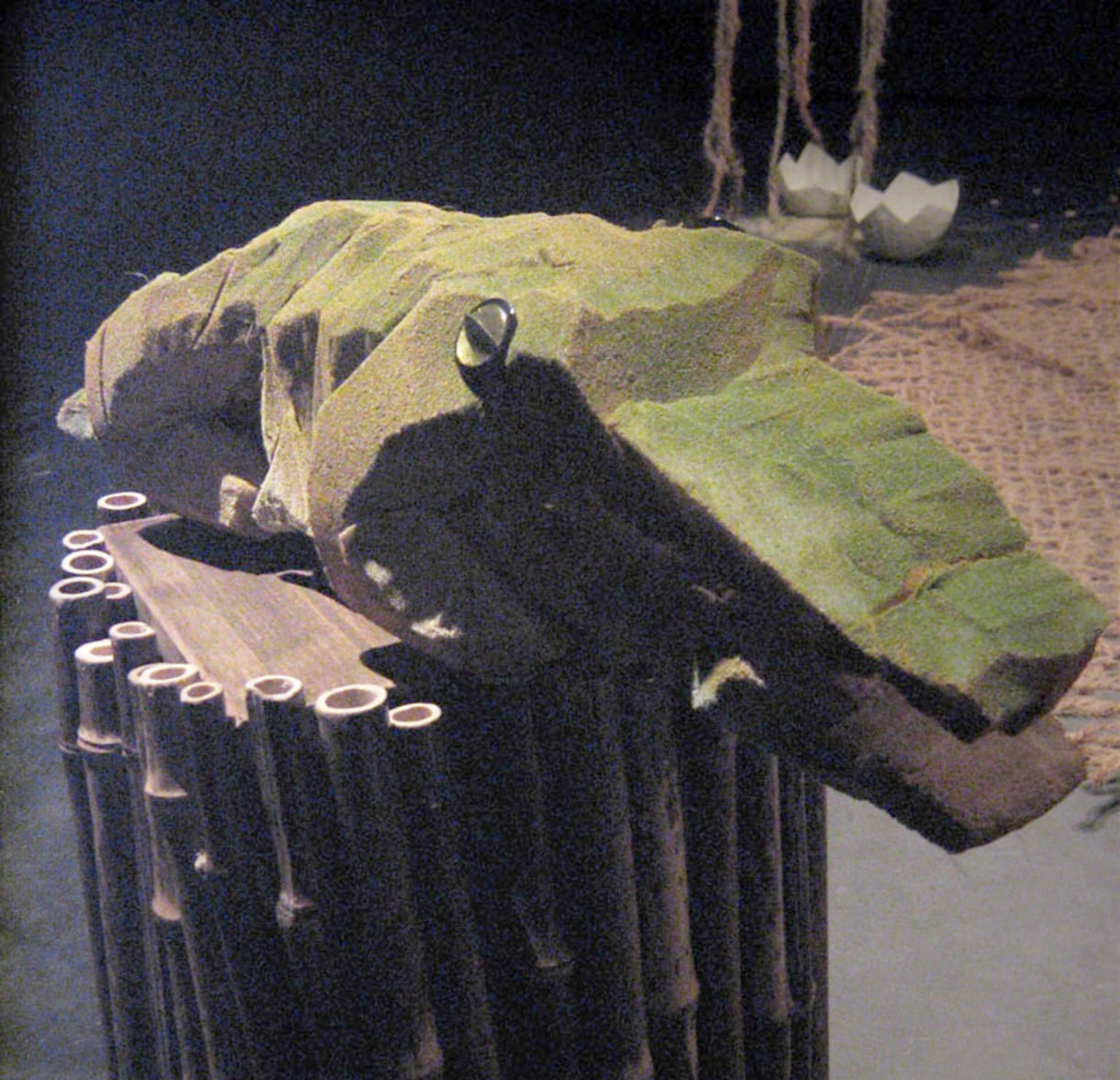
Das später entschlüpfende Krokodilbaby ist eine Schaumstoff-Handpuppe, der die Schauspielerin Stimme und Gefühle verleiht. Sie gibt aber unter anderem auch einen Vogel Strauß – wofür ihr zwei zu Augen „verzauberte“ Kugeln zwischen Fingern und ein entsprechender Gang über die Bühne reichen. Aus dem „Fluss“ lässt sie auch das Wasser mit einfachsten Mitteln steigen und sogar scheinbare Spritzer ins Publikum fliegen. Die Bilder entstehen in den Köpfen der Zuschauer: innen.

Ach ja, von wegen Tränen, der Begriff wird ja meist dann verwendet, wenn Menschen nicht echt, sondern nur vorgetäuscht weinen. Er beruht darauf, dass bei Krokodilen Tränen fließen und Laute ausstoßen, die an kindliches Weinen erinnern, wenn sie Beutetiere fressen. Ihnen wurde seit Jahrtausenden unterstellt, so erst Beute anzulocken. Dabei dürfte einfach das weit geöffnete Maul auf die Tränendrüsen der Reptilien drücken.
Jedenfalls sind diese lautstark in eine Schüssel fallenden, schweren, glänzenden Tränen aus geschliffenen Kugeln aus Nigeria, ein Erlebnis für das mit dem kleinen Krokodil mitfiebernden (nicht nur) jungen Zuschauer:innen bei dem Ausflug in brennheiße Hitze in kalten Wintertagen.

Ein Text vier Mal gleich hintereinander gespielt – und doch weder gleich und damit auch nicht fad. „Staatsfragmente“, geschrieben von Kiki Miru Miroslava Svolikova, „zerlegt“ Herr-schaftsformen derzeit im Theater Drachengasse. Regisseurin Valerie Voigt siedelt das „Königsmärchen“ (so der Untertitel) einmal in der ersten Runde in der Steinzeit an. Die Menschen bewegen sich da eher äffisch mit überlangen Armen auf allen Vieren voran. Das Auftauchen eines – längst ausgestorbenen – Dinosauriers irritiert doch, oder ist es ein Element von Humor?
Die Wiederholungen spielen sich dann zunächst im 13. Jahrhundert rund um eine Papstwahl ab, hernach im monarchistischen Absolutismus und schließlich zwischen Gegenwart und Zukunft ab.

Die vier Schauspieler:innen – Johanna Sophia Baader, Lukas Haas, Nataya Sam, Sebastian Thiers – wechseln dabei jeweils in einer der Perioden in die Rolle des „Königs“ bzw. Papstes, das heißt eigentlich der Päpstin. Die anderen drei sind Berater:innen, die immer wieder darüber stöhnen, dass die herr-schende Person stets zu nächtlichen Treffen „einlädt“, um die Frage zu klären, soll sich Monarch:in, Päpst:in… dem Volk zeigen und wenn ja, in welchem Gewand (üppige Kostüme: Kostüm: Katia Bottegal, im Gegensatz zur schwarz-weißen Bühne von Thomas Garvie).

Mit dem Volk zeigen sich alle eher bis sehr unzufrieden, raten dazu, ein neues zu wählen. Und bleiben damit immer auf der Seite der Machthaber:innen. Was das Volk will, und ob sich dieses nicht lieber einen anderen oder gar keinen „König“ wünscht oder angesichts diktatorischer Regimes lieber selber das Land verlässt – das interessiert nicht einmal auch nur eine der Beratungspersonen, geschweige denn die jeweils herrschende Figur. Die immer wieder mit Wortspielen ausgehend vom untertänigen „Durchlaucht“ humorvoll bis hin zu „Knob-lauch“ in Frage gestellt wird.

Auch wenn in jeder der vier Wiederholungs-Episoden ein anderes Thema – in schwimmender Schrift projiziert: Sprache und Gewalt / Glaube / Inszenierung / Technik – in den Fokus rückt und damit nicht nur die Rollen getauscht werden, so demaskiert das 1½-stündige Stück die (fast) immer gleichen Mechanismen Mächtiger. Mit einem dezenten Anflug von Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, wenn die vier am Ende ihrer Kleider entledigt werden und – nicht nackt, aber in Unterwäsche – dastehen bzw. -sitzen.

„Jin îyan, Azadî“ (Frau – Leben – Freiheit), die Demonstrations-Losung, die nach dem gewaltsamen Tod der kurdischen Iranerin Jîna Mahsa Amini 2022 weltweit bekannt wurde, war Samstagnachmittag (17. Jänner 2026) vielfach und lautstark am Wiener Stephansplatz zu hören. Eine andere der Losungen bei dieser Kundgebung „für Freiheit im Iran“ war: „Nieder mit der Diktatur!“ Und natürlich durfte der All-Time-Slogan-Hit „Hoch die internationale Solidarität!“ nicht fehlen.

Iranische Flaggen – ohne das vom Mullah-Regime eingeführte Hoheitszeichen in der Mitte bzw. ältere Versionen der Fahne -, und viele kurdische Flaggen hatten Teilnehmer:innen mitgebracht. Erinnert wurde dabei nicht nur an den oben erwähnten Tod der 23-Jährigen in der „Obhut“ uniformierter Kräfte, die sie bei einer Demonstration festgenommen hatten. Kurd:innen sind eine der Volksgruppen im Iran, die diskriminiert werden. Angesprochen wurde aber auch, dass die neue syrische Regierung ebenfalls Kurd:innen bekämpft. Ähnliches gilt für die Türkei. Wo die Kampfparole „Jin îyan, Azadî“ (Frau – Leben – Freiheit) schon jahrzehntelang erklingt. Dort wo linksdemokratische, kurden-affine Parteien – die müssen sich in der Türkei immer wieder neu gründe, weil das dortige autoritäre Regime Erdoğans sie häufig verbietet – bei Wahlen antreten, tun sie das übrigens stets mit einer gleichberechtigten Doppelspitze aus weiblichen und männlichen Kandidat:innen.

Zur Kundgebung – eine von vielen Aktionen in den vergangenen Tagen – und weitere folgen – aufgerufen hatten mehrere säkular-demokratische Gruppen. Sie klagen nicht nur das seit fast 50 Jahren herrschende Regime, sondern verlangen nach Demokratie und wenden sich auch gegen die vielfach ins Spiel gebrachte Wiederinstallierung des Kaiserhauses Pahlavi.
„In diesen schicksalhaften Augenblicken hat die Regierung der Islamischen Republik einen Massenmord unmenschlicher Natur begangen. Um ihre Repression fortzusetzen und das Ausmaß ihrer Verbrechen zu verschleiern, hat dieses Regime das Internet und den freien Informationsfluss gekappt, um die Stimmen der freiheitsliebenden und wehrlosen Menschen zum Schweigen zu bringen.

Wir, die iranischen säkularen Demokrat*innen in Österreich, stehen an der Seite aller freiheitsliebenden Kräfte, an der Seite der Protestierenden im Iran. Wir sind entschlossen, die Stimme der Menschen zu sein, die sich mutig der Tyrannei widersetzen. Lasst uns der Welt zeigen, dass das verbrecherische Regime im Iran illegitim ist.
Mit internationaler Solidarität kann unser Ruf nach Freiheit das Ende der Tyrannei und den Beginn von Freiheit, Demokratie und nationaler Souveränität einläuten und ein Licht in der Dunkelheit sein.“

Auf diese tödliche Aktualität hätte die Theatergruppe liebend gern verzichtet. So widmen „Die Fremden“ ihr jüngstes Stück „Fighting Dušman“ im Wiener Off-Theater den mutigen Menschen im Iran. Trotz massenmörderischer Schüsse des wankenden Systems der Ajatollahs gehen sie zu Zehntausenden auf die Straße. Protestieren nicht nur wegen der unleistbaren Preissteigerungen, sondern fordern immer wieder auch das Ende der Diktatur.
Und dennoch ist das aktuelle Stück, an dem die multikulturelle außerberufliche (früher Amateurtheater) Gruppe intensiv ein Jahr lang gearbeitet hat, nicht (nur) auf dieses Land, das derzeit im Fokus der Nachrichten steht, fokussiert. Die Story des rund 1½-stündigen Stücks richtet sich gegen jede Form undemokratischer Herrschaft. So tritt Herr Dušman (Markus Payer), der gern Länder annektieren bzw. Wahrheit oder Pflicht spielt samt Todesschüssen für unerwünschte Anworten, tritt in einer antiken Toga auf; mit Blumentopf als Krone auf dem Kopf. Lächerlich machen ist schließlich eine Form des Widerstandes. Frau Dušman (Sabrina Bee) ist mit einer Art Turban bestätigend an seiner Seite.

Das Wort steht sowohl in den BKS-Sprachen (Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) als auch im Türkischen (Düşman) sowie auf Farsi / Persisch als Dashman) für Feind.
Alle Protagonist:innen treffen zu Beginn immer wieder auf einem Flachdach aufeinander – mit guter Aussicht ins gegenüberliegende Theater bis hinein zur Bühne. Die beiden Mädchen Elena (Rabia Alizada) und Pegah (Yasmin Navid) sind Vorkämpferinnen gegen das Regime; Letztere ein bisschen mutiger, erstere rät immer wieder zur Vorsicht.
Das Flachdach ist nicht nur Aussichts„warte“. In der Fantasie der hier aufeinander Treffenden mutiert es mitunter zum fliegenden Teppich oder zum Nest für Greifvögel.

Pegah landet eines Tages im Gefängnis, dessen Wärter Yuri (Garegin Gamazyan) lange Zeit nicht einmal mit ihr spricht, sie dafür aber immer wieder, wenn sie auch hinter Gittern sich nicht einschüchtern lässt, schlägt. Wobei die Schläge völlig kontaktlos gespielt werden, weit voneinander entfernt führt der Wärter Schlag-Bewegungen aus. Armbewegungen des einen und das Zusammenzucken samt Schreien der anderen reichen aus, um die Zuschauer:innen bis tief unter die Haut zu berühren.

Zeitsprung: 30 Jahre später, Elena und Pegah haben unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht und sich weit voneinander entfernt, nachdem Erstere die Freundin, die sich bei ihr vor Verfolgung versteckte, weggeschickt hatte. Die ältere Pegah (Sofie Leplae) ist nach wie vor Widerständlerin – und jetzt im Gefängnis. Elena (Katerina Rumenova Jost) ist nun mit dem regimetreuen, speichelleckenden Theaterregisseur Andrej (Armen Abisoghomyan) verheiratet. Seine Sklavin trifft’s viel eher. Dass sie ab 5 Uhr früh in der Fabrik arbeitet, ist ihm egal, sie muss ihm sein Hemd richten, im Theater in der Garderobe einspringen, seine Texte korrigieren und noch der immer wieder anrufenden Tochter Miriam (Bojana Djogović) helfen und für die Star-Schauspielerin Olga (Vanda Sokolović) noch deren Lieblings-Bluse umschneidern, damit diese beim Treffen mit dem Präsidenten und seinen Freunden glänzen kann.

Vom Treffen mit den hohen Herren kommt Olga sehr zerstört wieder bei Elena an, die hohen Herren interessierte die Schauspielkunst nicht im Geringsten, sie dürften sich an der Künstlerin heftig „vergriffen“ haben. Elena hat mittlerweile in alten Sachen gekramt und einen Rucksack ihrer damaligen Freundin Pegah gefunden – mit Heften, in denen diese kritische Texte aufgeschrieben hatte – von den beiden damals Jugendlichen. Und nun einen neuen Text für den Monolog der Schauspielerin ergibt.
Und zum Wiedersehen (nicht nur) dieser beiden, sondern der einstigen Flachdach-Gemeinschaft führt – ein trotz der herrschenden Verhältnisse Mut machendes Symbol.

Übrigens: Die Requisiten – ob Leiter, Kübel, Holzböcke, gewellte Kunststoffwand oder Betonziegel – haben alle etwas mit den persönlichen, von den Mitwirkenden erzählten und ins Stück eingebrachten, Erlebnissen zu tun.
Und: Was ansatzweise in professionellen Theaterhäusern als relativ junge Errungenschaft eingebracht wird, spielt bei dieser 1992 von Dagmar Ransmayr gegründeten und seither geleiteten Gruppe „Die Fremden“ gegründeten Theatergruppe von Anfang an eine große Rolle: Verschiedene (Herkunfts-)Sprachen der Mitwirkenden sind – neben hauptsächlich auf Deutsch gespielt – zu hören; dieses Mal Armenisch, Bulgarisch, Farsi, Flämisch, Italienisch, Kroatisch und Slowakisch.
Die Leiterin führte auch bei „Fighting Dušman“, das sich gegen jede Version undemokratischer Herrschaft bzw. autoritäre Anwandlungen richtet, Regie, für die Choreografie – in einigen Szenen spielt sich Erzähltes fast wortlos in Tänzen ab – sorgte Garegin Gamazyan.
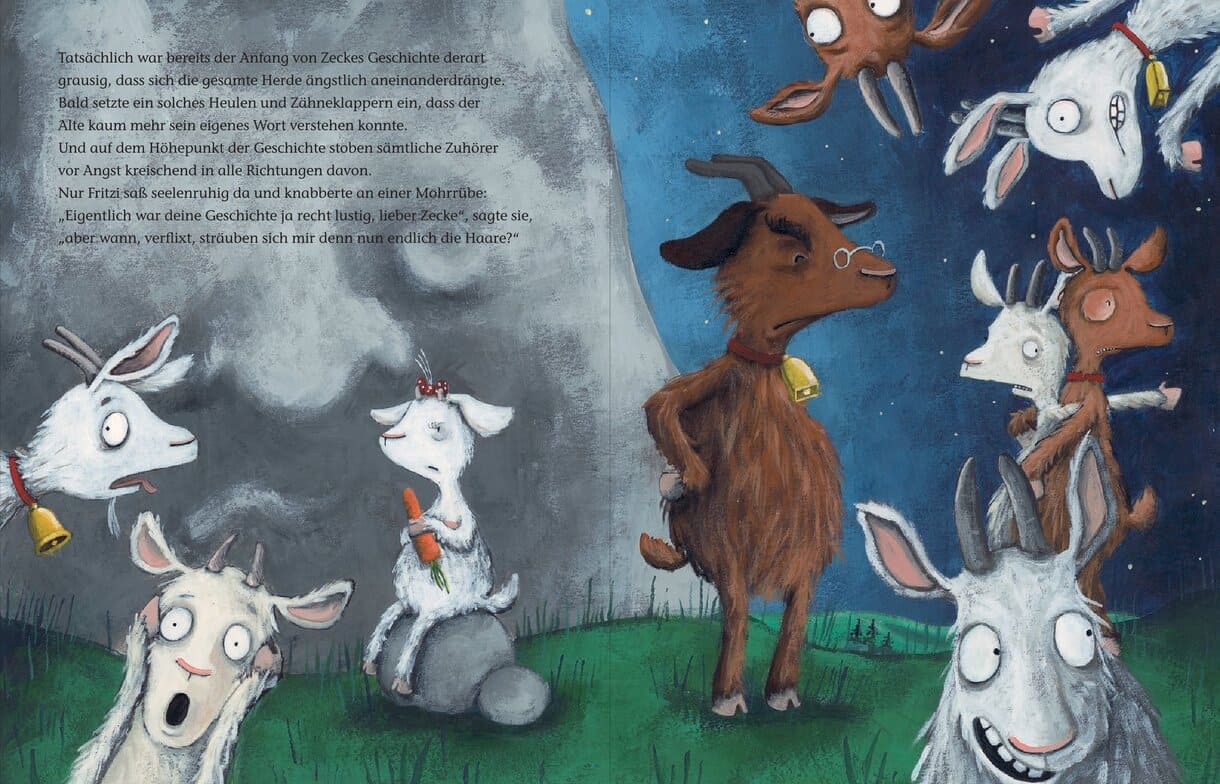
Furcht und Angst – eine Reihe von (Bilder-)Büchern erzählen Geschichten, wie die eine oder der andere – ob Kind oder Tier – mit Angst umgehen lernt, sich ihr stellte, sie verarbeitet… Dieses über Fritzi, die Ziege geht vom Gegenteil aus. Denn dieses Tier ist, wie schon der Titel klar macht, „Furchtlos“.
Was aufs erste super wirkt, ist für die Hauptfigur alles andere als toll. Weder „vor der D-d-dunkelheit“ noch „vor dem sch-sch-schrecklichen Schrei der Eule“ ängstigt sich Fritzi. Auch Gedanken an einen Wolf können ihr nichts anhaben.

Die Ziege ist damit aber nicht nur Außenseiterin in ihrer Herde, die anderen Ziegen fürchten, dass Fritzi nicht nur Gefahren für sie selbst unterschätzt, sondern die ganze Gruppe gefährdet sein könnte. Und so wollten alle Fritzi das Fürchten lernen. Es begann damit, dass der alte Bock Zecke der ganzen Schar Schauergeschichten erzählte.
Doch – und das ist jetzt sicher keine Überraschung – während die anderen heulten, deren Zähne klapperten und sie letztlich gar davonrannten, meinte Fritzi: „Eigentlich war deine Geschichte ja recht lustig… aber wann, verflixt, sträuben sich bei mir endlich die Haare?“

Nächster Versuch: Fritzi sollte eine Nach allein im Wald verbringen. Selbst wenn du das Buch noch nicht kennst, kannst du dir wahrscheinlich denken, hilft auch nix in Sachen Furcht lernen. Erschrecken mit Wolfsmaske – auch Fehlanzeige. Wäre da jetzt ein echter Wolf – dann große Gefahr für die ganze Herde. Und so schickten sie Fritzi in die weite Welt – ganz allein – um… eh schon wissen.
Und klar, irgendwann wird das Buch „Fritzi Furchtlos – von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen“ genau damit enden, dass die angstbefreite Ziege sich das aneignet. Dass dies nicht über Grusel, Grausamkeiten und Finsternis passiert, sondern aus Angst um einen Weggefährten, den sie kennenlernt, ist nur folgerichtig von der Autorin Katja Reider mit gezeichneten Bildern von Thorsten Saleina.
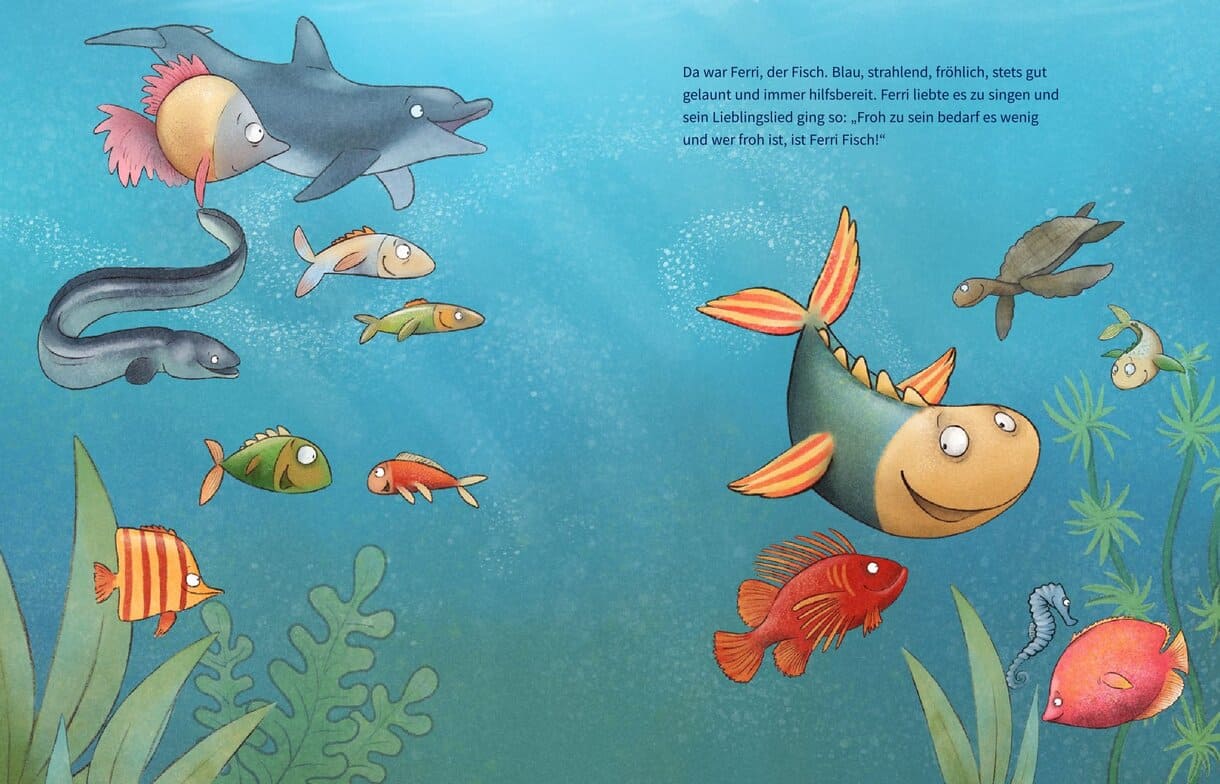
Mobbing – schon für jüngste Kinder leicht und anschaulich ist in diese Bilderbuchgeschichte, die unter Meerestieren spielt, eingebaut. Und sie beginnt schon auf der ersten Doppelseite mit dem Happy End: „Tief unten im Meer leben alle Tiere friedlich miteinander und füreinander. Jeder achtet nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf den anderen, damit es allen gut geht.“
Das war aber – ist ab dem nächsten Satz zu lesen und auch viel zu schauen – „nicht immer so…“
Die Hauptfigur ist ein Fisch mit gelb und rötlich gestreiften Flossen namens Ferri. Der war urgut drauf, immer fröhlich, obendrein hilfsbereit und sang gerne. Was nicht allen gefiel. Rocho, der Rochen, pöbelte Ferri an „schrei nicht so!“, und das ziemlich heftig und lautstark. Da merkte Ferri an, dass doch Rocho schreie. Und schon ging der Knatsch richtig los. Der griesgrämige Rochen drohte dem kleinen Sänger mit Gewalt.
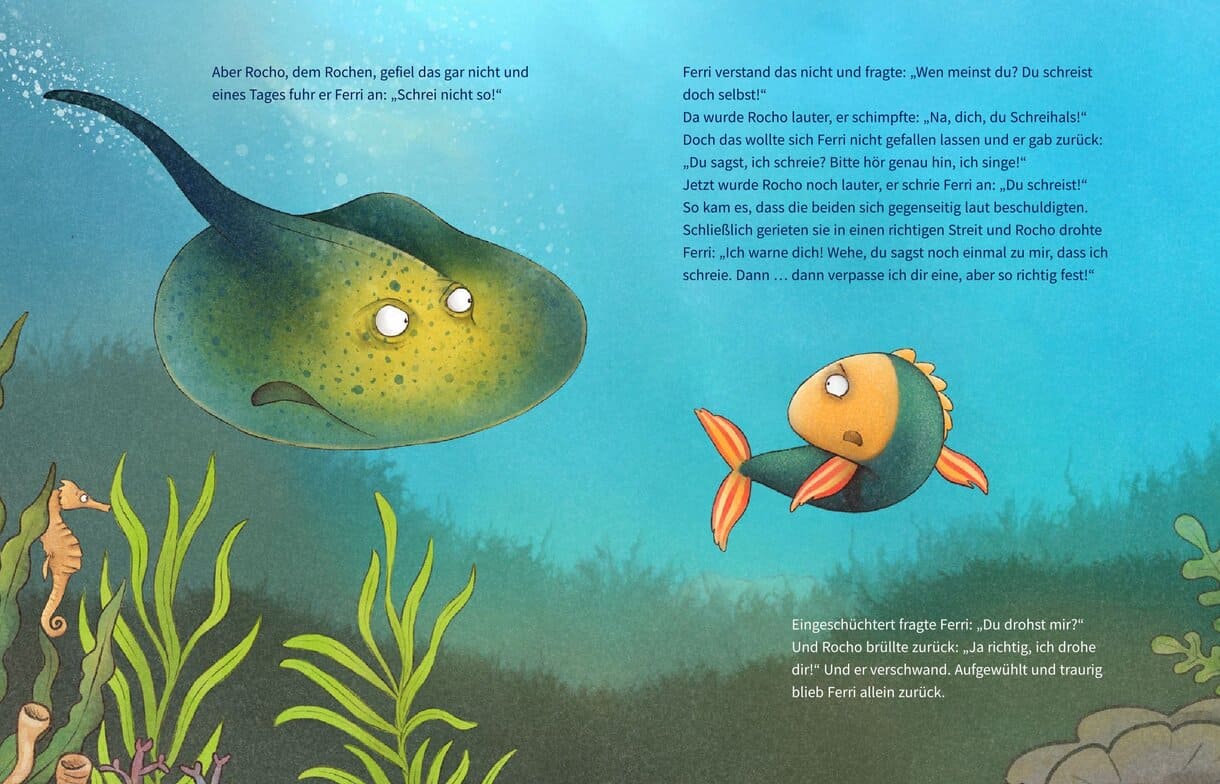
Und – so die Dramaturgie, die sich die beiden Autorinnen Gertraud Mesner und Beate Welsh ausgedacht haben – kam gleich die nächste angeschwommen, die Ferri einschüchterte: Krabbe Krabbi, es folgte Kraki (klarerweise ein Krake). Qualli – du weißt sicher aufgrund des Namens schon, um welches Salzwassertier es sich handelt – fand das Verhalten der anderen gar nicht nett, aber nach kurzen Tröstungsversuchen für Ferri, verschwand die wieder.
Natürlich kann’s dabei nicht bleiben, wissen wir ja seit den ersten Sätzen und Bildern von Antje Bohnstedt.
Für die Wendung zum Guten sorgt der schlaue Wal, den die Autorinnen schlicht Wali nannten. Bei ihm schüttete Ferri sein Herz aus, auch mit der großen Frage in seinem Kopf: „die anderen Tiere mögen mich nicht mehr. Ich weiß eigentlich nicht warum.“

Wali erklärte dem verzweifelten Fischlein, dass es nicht an Ferri, sondern an den anderen, den Mobbern liege, was da abgeht und „so wie du bist, so ist es gut“ und dass die, die zu anderen böse und grausam sind, sicher nicht stark seien. Und der Wal lud alle zum gemeinsamen Spiel ein, wobei er für den ersten in der Reihe derer, die Ferri geärgert hatten, die Rolle eines Außenseiters vorsah. Woraufhin Rocho das ziemlich blöd fand – aber auch kapierte, weil er es selber spürte, wie ungut solches Verhalten ist…
Womit es durch folgendes gemeinsames Spiel in die letzte Kurve ging, die den Kreis zum Happy End am Beginn des Buches „Ferri – Mutig ist, wer Hilfe holt!“ schließt. Wobei sich der Untertitel nicht aus der Geschichte erschließt, kam doch der Wal von selber angeschwommen, sondern eher aus der nach der Bilderbuchgeschichte angeschlossenen Doppelseite „Mobbing verstehen“ wo es unter anderem heißt: „Hilfe holen ist kein Petzen!“

KiJuKU: du hast die Stückversion nach Robert Musils Roman vor rund 25 Jahren geschrieben und sie damals dann auch hier inszeniert. Was ist der wesentliche Unterschied deiner Herangehensweise von damals im Vergleich zu heute?
Thomas Birkmeir: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, wusste schon der englische Philosoph Thomas Hobbes. Dieses Thema wird immer wieder auf Bühnen dargestellt, aber es wird allzu leicht verdrängt. Die Gefahr ist, dass vieles weggewischt wird oder wie C.G. Jung (Schweizer Psychiater, Begründer der analytischen Psychologie, 187 – 1961, Anm. der Redaktion) sagt: Schau dir deine Schattenseiten an. So lange du nicht checkst, dass auch in dir eine Bestie steckt, bist du kein ganzer runder Mensch.
KiJuKU: Aber das gilt ja über alle Zeit hinweg…
Thomas Birkmeir: Ja, aber Törleß wird von vielen als Pubertäts- und Entwicklungsroman gesehen und ich weiß nicht, warum man Entwicklung mit Pubertät gleichsetzt, das ganze Leben ist eine Entwicklung – hoffentlich.

KiJuKU: Wobei Törleß hier ja schon fast so endet, er wird dann zum angepassten, nützlichen Teil der Gesellschaft…
Thomas Birkmeir: Das haben wir bei Büchner (Georg, Schriftsteller, Mediziner, Revolutionär, 1813 – 1837) geklaut: Die drei werden zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft.
Und Verwirrungen – auch das beschränkt sich nicht auf Pubertät. Wenn du dir die heutige Weltlage anschaust, sind doch die allermeisten verwirrt, ich selber bin es auch. Stichworte Trump Venezuela und Grönland, Putin Ukraine, China und Taiwan. Das Zusammenbrechen jeglicher halbwegs erarbeiteter Ordnung. Da kommt das Gefühl auf, Europa ist fast noch die letzte Bastion der Vernunft und Demokratie. Auch da bin ich schon vorsichtig.
KiJuKU: War dies der Grund für die Auswahl dieses Musil-Romans für eine Bühnenversion gerade jetzt, in dieser Saison?
Thomas Birkmeir: Ja, wir haben diese Spielzeit ja unter das Motto Antifaschismus gestellt. Wir hatten „Der überaus starke Willibald“ (Stückbesprechung unten am Ende verlinkt), haben jetzt den Törleß, dann „König Gilgamesch“ (Mitte Februar bis Mitte März) und „Er ist wieder da“ im April. Und dann spielten auch die Vorwürfe gegen meine Person mit in einer Art Selbstjustiz wirst du an den Pranger gestellt. Da laufen noch meine Klagen.
KiJuKU: Zurück zur ersten Frage: Was war der wesentliche Unterschied im Herangehen an die Inszenierungen vor einem Vierteljahrhundert und heute?
Thomas Birkmeir: Damals hab ich das viel mehr als Pubertätsdrama gesehen. Jetzt ist es die Frage, wie kann man sich gegen solche Menschen, die wie die Ajatollahs im Iran für die der Beineberg mit seinem religiösen Wahn steht oder Machtmenschen wie der Reiting und die Indifferenz vom Törleß, der genauso gefährlich ist wie die Täter, wehren. Solche Typen werden ja sogar in demokratischen Systemen gewählt, was bei Trump für die Hälfte der US-Amerikaner:innen gilt.
Was ist dieses Gewaltsame – auch ein ähnliches kolonialistisches Herangehen, siehe Grönland?! Nicht wenige meinen ja, vieles davon erinnere an die Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Und Musil hat seinen Roman ja nicht zuletzt geschrieben unter dem Eindruck dieser patriarchalen Gesellschaft, die später auch im Faschismus mündete. Wir haben als 16-Jährige in der Schule Klaus Theweleit „Männerphantasien“ gelesen, uns mit patriarchalem Verhalten auseinander gesetzt und wie solche Strukturen in den Faschismus geführt haben.
KiJuKU: Geht so etwas verloren?
Thomas Birkmeir: Du hast jetzt immer mehr das Gefühl, es gibt rundum kaum mehr Moralkodizes – und darum geht’s auch im Törleß-Stück. Es erzählen uns Lehrer:innen, dass Jugendliche sagen, warum soll ich mich moralisch verhalten, Herr Trump gebärdet sich unter anderem so, dass er eine Journalistin als Schwein beschimpft (Die Bloomberg-Reporterin Catherine Lucey hatte eine kritische Frage zu den Epstein-Akten gestellt und der US-Präsident sie mit „Quiet, piggy“ / „Sei still, Schweinchen“ angeherrscht).
KiJuKU: Noch eine Frage, die Musikauswahl für die jetzige Inszenierung war anders als vor 25 Jahren?
Thomas Birkmeir: Die war neu, das heißt deckungsgleich waren die Sones „Tears go by“.
Zur Stückbesprechung – samt Detailinofs, wer, wo bis wann spielt im ersten Link unten.

Heftig. Heftiger. Heftigst. Immer wieder musst du (wahrscheinlich) wegschauen, die Augen schließen, vielleicht sogar die Ohren zuhalten. (Fast) nicht auszuhalten. Auch wenn du natürlich weißt, das alles spielt ist nur auf der Bühne gespielt. Schläge, Gürtel-Peitschenhiebe treffen nicht, Blutergüsse sind geschminkt. Schmerzens-Schreie gut gestimmte Laute eines Profis.
Und dennoch, wer nicht gänzlich unter Empathie„befreiung“ leidet, kann so manche Szene dieser 1¾ Stunden im Theater im Zentrum (Wien) schwer ertragen, insbesondere die in gänzlicher Finsternis (Licht: Lukas Kaltenbäck). Bei der – am Ende vielumjubelten – Premiere der Neu-Inszenierung von Robert Musils Klassiker jugendlicher gewalttätiger Mobbing-Attacken „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ verließen einige Zuschauer:innen auch deswegen den Saal des kleineren Hauses des Theaters der Jugend in Wien.

Vor 120 Jahren erschienen, wirkt der erste Roman des damals 26-jährigen Autors lediglich anhand des althergebrachten Begriffs Zögling alt. Die Bühnenversion von Thomas Birkmeir, die er schon vor einem ¼ Jahrhundert – vor seiner Übernahme der Direktion des Theaters der Jugend – geschrieben und inszeniert hat, konzentriert sich auf die vier Haupt-Charaktere in einem Internat. Basini der vielen Mitschülern Geld schuldet, wird bei einem Banknoten-Diebstahl ertappt. Beineberg, dem das Geld gehört und Reiting, dem er es schuldet(e), wollen ihn – entgegen dem Ratschlag von Törleß – nicht anzeigen. Viel ärger, sie schreiten zur Selbstjustiz, machen ihn zum Sklaven, demütigen, schlagen, missbrauchen ihn.

Musil hat die drei unterschiedlich typologisiert: Reiting, der Möchtegern-Diktator genießt die Erniedrigung des Opfers und seinen autoritären Macht-Status. Beineberg fantasiert sich in ein Glaubens-Konstrukt, eine Art religiösen Fanatismus, aus dem heraus er zum Quäler wird. Und schließlich Törleß, dem Musil ja auch den Titel weiht, zeichnet sich durch Abgehobenheit, scheinbare Abgeklärtheit aus, er will nur beobachten, „studieren“, wie sich Basini fühlt, was in ihm vorgeht. Als dieser gegen Ende Törleß auf Knien anfleht, ihm zu helfen, kommt als Reaktion: „Ich werde dir nicht helfen. Ich hatte vielleicht eine Zeit lang ein Interesse an dir…“ und nach längerer Pause: „Nur eines noch: Wie ist dir jetzt zumute?“

Die Inszenierung auf der schiefen Gitterrost-Ebene (Bühnenbild: Ulv Jakobsen) lebt einerseits vom starken Spiel des Quartetts: Robin Jentys als das Opfer Basini bringt dennoch immer wieder die Kraft auf, um sein (psychisches) Überleben zu kämpfen. Haris Ademović in der Rolle des Drahtziehers Reiting, lässt in wenigen Momenten mitschwingen, aus Angst vor eigener Schwäche zum Riesen-A…-loch zu werden – samt Spiel mit einem Weltkugelball und damit unverkennbar einer Anspielung auf Charlie Chaplins Film „Der große Diktator“ (1940) und seinen Anton Hynkel (original Adenoid Hynkel) als Satire auf eh schon wissen.

Beineberg-Darsteller Jakob Elsenwenger versucht in seinem Glaubenskonstrukt eine Rechtfertigung für sein Agieren zu finden, mit hin und wieder aufblitzenden Anflügen, es selbst vielleicht gar nicht so wirklich zu glauben, es aber so „verkaufen“ zu können. Und last but not least verkörpert Ludwig Wendelin Weißenberger den über den Dingen zu schwebend scheinenden Törleß, der aber die ärgste Gewalt gewähren lässt; kein dumpfer Mitläufer, sondern ein „schöngeistig“ Intellektueller, der zwischendurch immer wieder auch live dem Geigenspiel frönt.

Apropos Musik, Regisseur Birkmeir baute mit vielen ohrwurmgängigen Hit-Schnipseln, darunter mehrmals „As Tears Go By“ – sowohl in der Version der Rolling Stones als auch der von Marianne Faithfull gesungenen des von Mick Jagger, Keith Richards auf Drängen des Band-Managesr Andrew Loog Oldham geschriebenen Songs – eine Art Brücke vom Originaltext zum zeitlosen Spiel um „Herr oder Knecht“ bzw. allgemeiner Herrschaft und Unterdrückung.
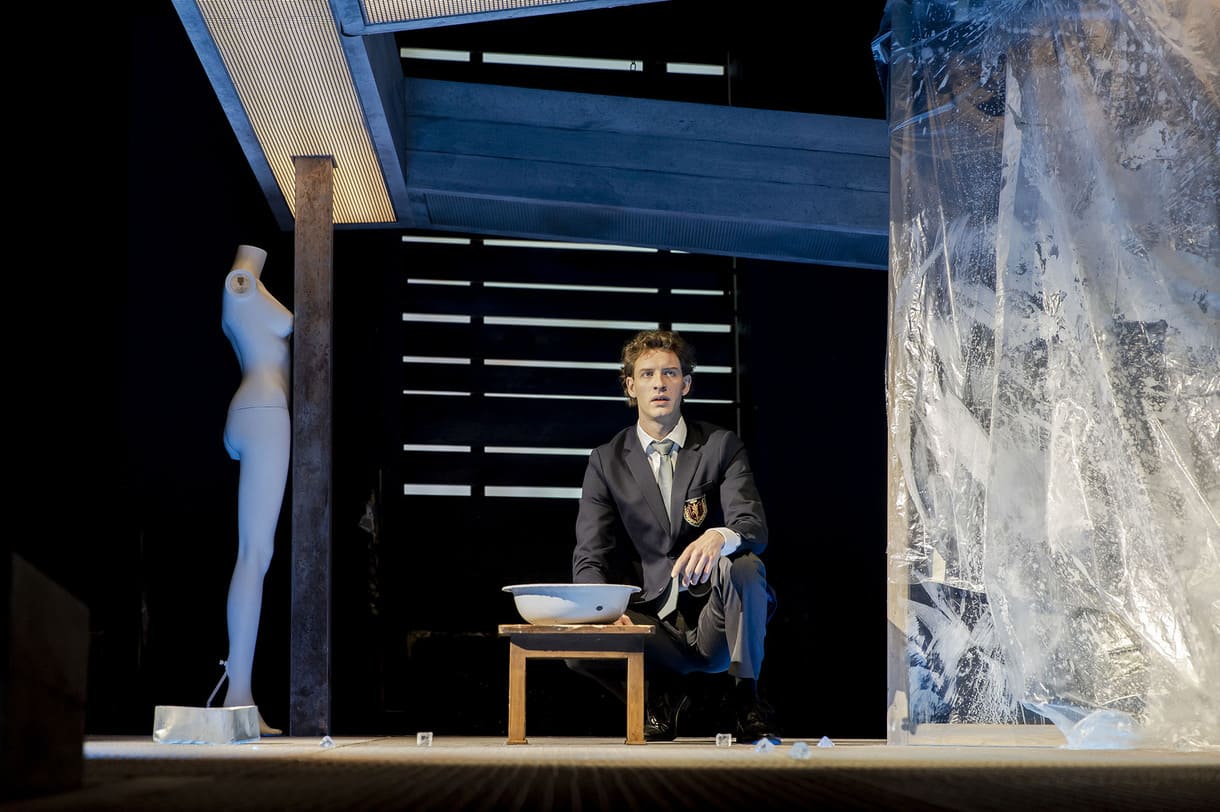
Denn schon Musil beschränkte die Gewalttätigkeit nicht auf das individuelle Verhalten seiner Protagonisten, sondern bettete sie – nicht zu plakativ, mitunter humorvoll – ins autoritäre System – beispielhaft des Internats – ein. Wenn Törleß an einem Konstrukt wie imaginäre Zahlen zweifelt, ihm Lehrer erklären, das seien „Denknotwendigkeiten“ und Beineberg kontert: „Einem vernünftigen Menschen vermögen sie ihre Geschichten nicht vorzuerzählen. Erst wenn er zehn Jahre in der Schule mürbe gemacht wurde, geht es…“
Diese Inszenierung setzt – fast – an den Schluss eine im Roman früher angesiedelte Passage, die (nicht nur) Törleß‘ weitere Entwicklung zeichnet: Als in der Mitte der Gesellschaft angekommener, angesehener Mann, der die „Verwirrungen“ seiner Jugend mitnichten bereute.
Und das trifft erst so richtig mitten ins Herz, samt fast schon Zwang zu fragen, wie steht’s da bei einem selbst!

Manche meinen ja, Törleß wäre „nur“ die jugendliche Version von Ulrich, dem Protagonisten in Robert Musils dreibändigem gut 1500 Seiten starken und wahrscheinlich noch bekannterem, wenngleich eher weniger gelesenem Monumental-Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“. Ist übrigens in einer sehr spannenden Inszenierung mit vier verschiedenen Schauspieler:innen in der Hauptrolle im Theater Arche (1060, Münzwardeingasse) zu erleben – in mehreren Spielblöcken jetzt im Jänner und dann im März 2026.
Gespräch mit Regisseur Thomas Birkmeir hier unten
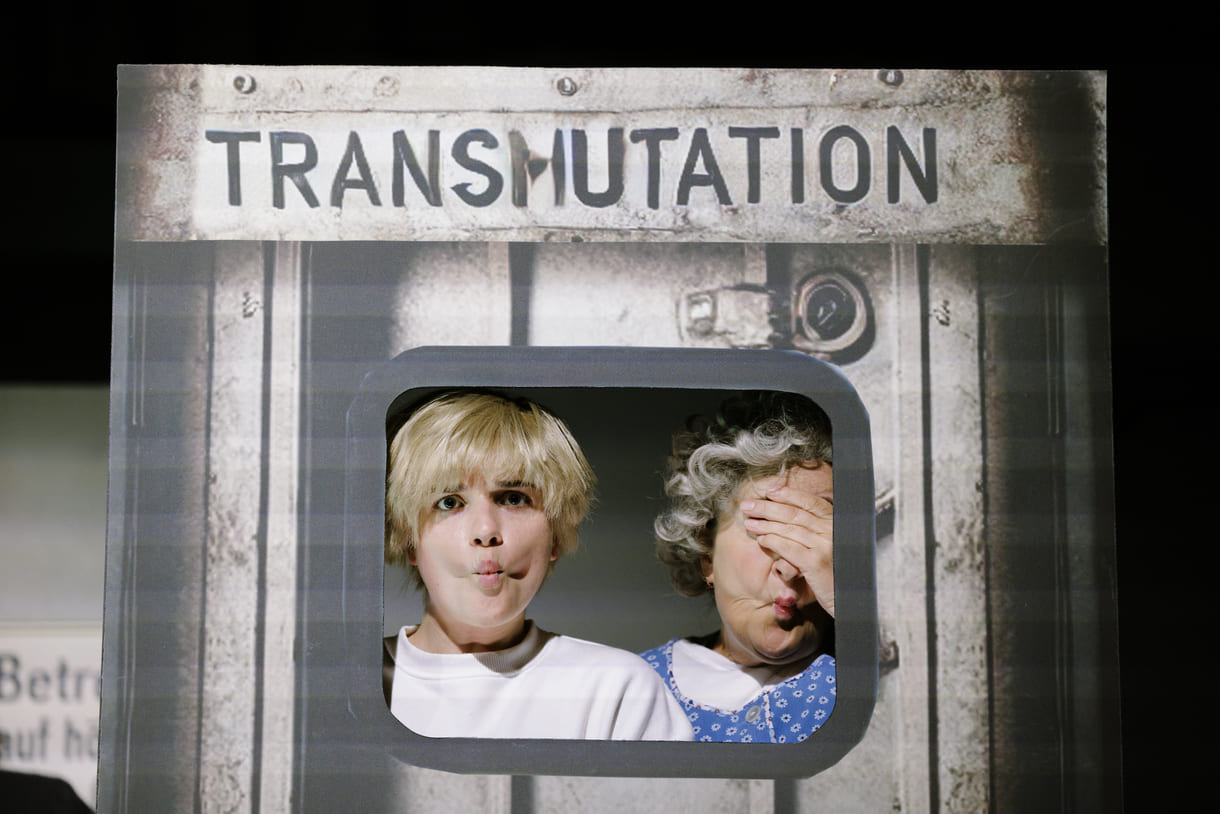
So wie schon der zentral auf der Bühne stehende Tisch mit seinem alten gestickten Deckerl nur zweidimensional und bloß bedruckt ist, so werden im Laufe der gesamten rund 1¼ Stunden alle anderen Requisiten auch nur flach sein und magnetisch am Tisch oder wo auch immer erforderlich „picken“ – ob Schöpflöffel, Schultasche, Hefte, Rucksack, Tasche oder was auch immer.
Dreidimensional und live sind hingegen Schauspiel und Musik. Der Live-Musiker in einer Art Cockpit auf der Bühne sorgt auch für die Schlürf- und anderen Geräusche der Schauspieler:innen. Das Volkstheater tourt durch viele Wiener Bezirke mit einem Stück nach einem Buch von Christine Nöstlinger, dessen Titel für die Theaterversion umgedreht wurde. Aus „Mr. Bats Meisterstück oder Die total verjüngte Oma“ wurde „Die total verjüngte Oma oder Mister Bats Meisterstück“.

Die Story bleibt im Wesentlichen erhalten – mit einigen markanten Änderungen. Robi Seiferitz ist oft bei seiner Oma. Die leidet unter einem schmerzhaften Bein und kann daher nicht mehr so viel mit dem Enkel unternehmen. Der hat von Verjüngungen gehört. Aber neben Salben, Cremen, Tinkturen, Pillen und allem möglichen Zeug, das da so verkauft wird, gibt’s auch die magische Frau Arabella Bat, die aus einer klitzekleinen Tasche große Tafeln Schokolade hervorzaubert und die sogar – wenn wer solche nicht mag – in Wurst verwandeln kann. „Die alte Bat“ (Robi) – „hör mal, die ist drei Jahre jünger als ich“ (Oma) hat noch einen Bruder, der gar über ein großes Versuchslabor verfügt und allerhand erfindet.
Vielleicht… gedacht, gesagt, getan. Robi und Oma, mit Vornamen Alice, machen sich auf den Weg zu diesem Mr. Bat. Der kann zwar über eine Art Telefonzellen-Aufzug genannt „Transmutation“ Leute durch „Dematerialisierung“ in andere Räume und Zeiten schicken, aber …?

Ach, da fällt ihm ein, irgendwo im Keller gibt’s doch eine Kiste mit Erfindungen der Isabella Raubatmeier, einer Urahnin einige Generationen zurück. Und tatsächlich – ein braunes Fläschchen mit Verjüngungstinktur taucht auf. „Aber nur ein Löffelchen bitte“, meint er beim Aushändigen. Was die Oma gar nicht beherzigt, sondern, weil’s nach Eierlikör riecht und schmeckt auf einen Sitz austrinkt.
Folge: Die Oma ist wie der Titel schon verspricht „total verjüngt“ – ein Kind, im Buch ungefähr fünf Jahre, im stück zehn.
Und das gibt Anlass für ziemlich viel Spaß – in beiden Versionen. In der Buchversion führt sie sich im Kindergarten auf, im Stück in der Schule. Da lebt Christine Nöstlinger ihre schon von Beginn an bedingungslose Kritik an so vielen erwachsenen Vorschriften, die Kinder einengen, aus. Dieses Buch – vor mehr als einem halben Jahrhundert, 1971, veröffentlicht – und die jetzige theatrale Umsetzung (Regie: Fanny Brunner) stellt durchaus in Astrid Lindgrens Pippi-Langsgtrumpf’scher Manier Vorschriften in Frage, fordert (mehr) Freiräume für Kinder. Und in diesem Stück bzw. Buch hat Nöstlinger das auch schon zu Beginn der alten Oma ins Gemüt geschrieben. Robi ist so gerne bei der Großmutter, weil die so wenig von den Benimm-Regeln hält, die sie selbst schon nicht ausgehalten, aber dennoch ihrem Sohn, Robis Vater, lange eingetrichtert hat.

Die Oma – sowohl als rund 70-jährige Frau als auch als Kind, dann eben auch körperlich befreiter – wird überzeugend von Claudia Sabitzer gespielt, ihren Enkel Robi – der gegen Ende checkt, Bat, ach Batman und Robin, verkörpert Sana Schmid. Was sich Robi nicht traut, für das angelt sich die Oma dessen Freund Tomi – dargestellt von Stine Kreutzmann, die auch Arabella Bat gibt. Vierter im Bunde der Schauspieler:innen ist Dennis Cubis, der sowohl den verschrobenen Erfinder Mr. Bat als auch die Generationen zurückliegende Tante (Rau-)Batmeier sowie die ganz unentspannte, auszuckende fast ein wenig zu klischeehafte Lehrerin Haslinger spielt.
Live auf der Bühne performt der Musiker Thomas Esser, nur der Song, dessen Titelzeilen aus dem Chor schon auf der Bühne stehen – „One Day Baby, we’ll be old“ wird eingespielt. Dieser Reckoning Song des israelischen Folk-Rock-Musikers Asaf Avidan und seiner Band The Mojos ersetzt Christine Nöstlingers Anspielung im Buch auf den Beatles-Song „When I’m Sixty-Four“ (1967, Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band).
Und noch wer hat immer wieder Kurz-Auftritte im Stück: Die beiden Kulissen- und Requisitenbringer und -wegräumer Georgios Taxifotis und Nicolaus Twerdy, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen.

Die ersten ausgelassenen Lacher erntet die jüngste Premiere für Kinder des Linzer Landestheaters in den Kammerspielen noch beim geschlossenen, edlen, samt wirkenden roten Vorhang. Aus dem Off ertönen Werbesprüche die eindeutig schon zum Stück gehören: „Dieses Ereignis wird Ihnen präsentiert von Matschis süßem Kribbel-Schleim… Kommt oben in die Öffnung rein!… Kann bei „übermäßigem Konsum“ zu unangenehmem Völlegefühl, Übelkeit und Magendruck ohne erlösendes Erbrechen führen… Weiterhin wird Ihnen dieses Ereignis präsentiert von Köttelspeiers Rülpskompott… Kaum gerochen, schon erbrochen!…“
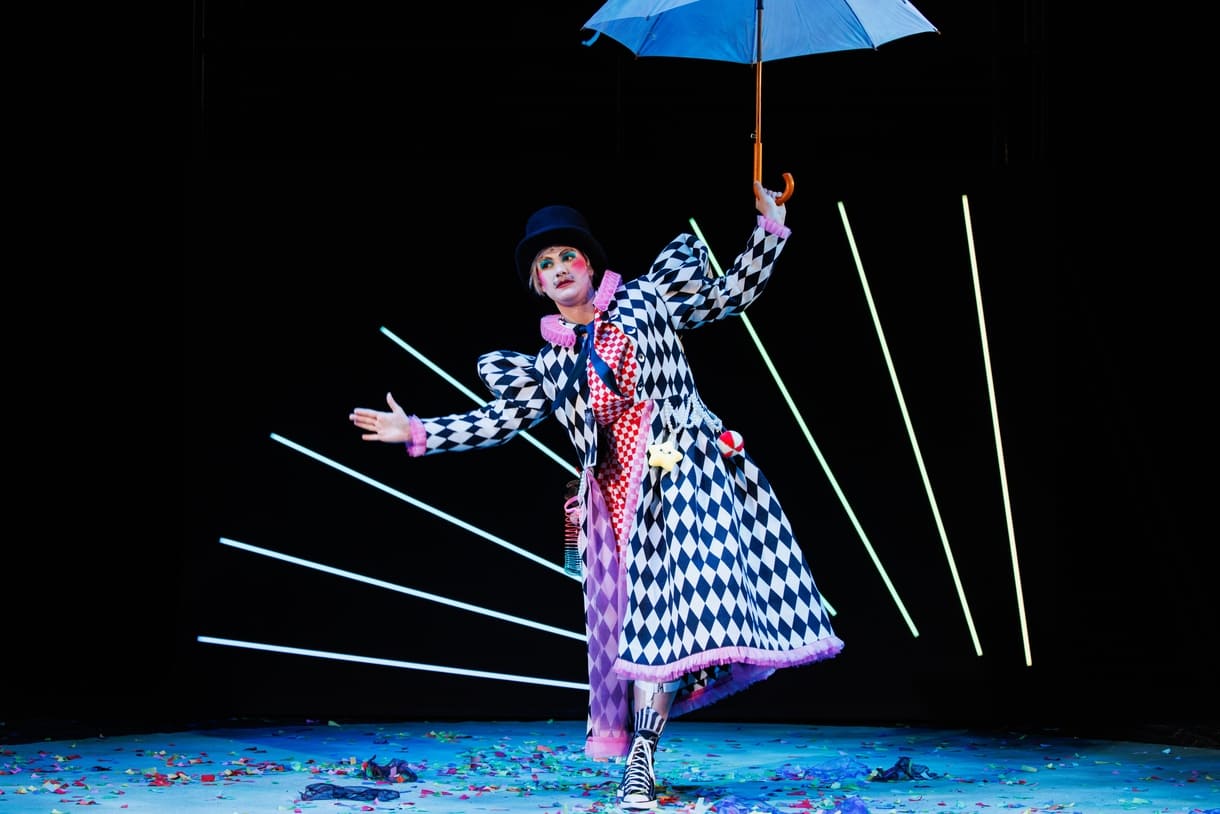
Rülpsen und Furzen zieht allemal. Doch die Sprüche – wie der Großteil des gesamten einstündigen Stücks in Reimen – ertönen selbstironisch und spielen damit schon mit Schein und Sein. „Der fabelhafte Die“, verfasst vom deutschen Schauspieler, Regisseur und Erfolgsautor junger Stücke Sergej Gößner ist in einem zirkus-artigen Setting angesiedelt und jongliert mit Rollen, Identitäten und vielen Wechseln und Wandlungen. Ein, nein DAS Ur-Ding des Theaters an sich: In (andere) Rollen und Geschichten schlüpfen!

Zwei bunt gekleidete und geschminkte clowneske Figuren stürmen links und rechts neben den Sitzreihen die Tribüne hinunter zur Bühne, die dritte Figur schwebt in einem großen leuchtenden Ring aus dem Zirkushimmel hernieder (Bühne und Kostüme: Anne Horny). Die drei Figuren vom Stück und im Programmheft – auf der Bühne jedoch so nie aus- oder angesprochen – tragen jeweils nur einen Buchstaben als Rollennamen: W (Levi R. Kuhr), I (Jakob Schmölzer) und R (Alexandra Diana Nedel) – unschwer als ein Gemeinsames zu erkennen. Alle drei spielen jeweils mehrere Figuren:
W: DIE / eine der klassischen Zirkusfiguren als der stärkste Mann der Welt / einen Jungen namens Ben sowie Fisch Kim namens Barsch;
I: Ente Klaus, den alle nicht zuletzt aufgrund seines Kostüms für einen Schwan halten und Frau Zahn sowie Verein fürs Richtgsein
R: F. Meyer-Schmitt / das aufgeweckte Mädchen Ayla, ein Vetterlein und ebenfalls vom Verein fürs Richtgsein.

So verwirrend das aufs Erste klingen mag, so lustvoll und spielfreudig wechseln die Figuren ihre Rollen, spielen Szenen, die immer wieder zum Lachen anregen. Aber auch zu mehr. Denn das Stück selbst (Regie in Linz: Swaantje Lena Kleff) bricht auch noch in sich mit vermeintlichen Rollenzuschreibungen: „Hinter all den Muskeln, tief in der behaarten Brust / schlug ein musisch talentiertes Herz“ beim stärksten Mann der Welt.
Seine Hobbies: Socken stopfen, Fashion und blonde Locken. Doch das muss er lange verbergen, tanzen doch die beiden anderen mit großen Maßbändern und Linealen an als Leute vom „Verein fürs Richtigsein“, um Normen zu vermessen.
Während Mädchen spätestens seit Pippi Langstrumpf stark sein dürfen, ist es für Buben und Männer noch immer – und in jüngster Zeit erst recht wieder erneut – schwierig, sich offen sanft und fürsorglich zu zeigen. Da hilft zunächst nicht einmal die Ermutigung, dass dem stärksten Mann der Welt doch egal sein könne, was die anderen sagen. Aber natürlich gibt’s in diesem Erzählstrang ein mutiges Outing und nichts da mit den einschränkenden Vorschriften. Und wird dennoch auch wieder relativiert: Alles inszeniert und einstudiert 😉

Der Stücktitel kommt gegen Ende direkt ins Spiel. Was ist mit Herrn F Punkt Meyer-Schmitt? „Vielleicht arbeiten die zwei inzwischen zu dritt… oder er als Schaufensterpuppe … und ganz vielleicht, man weiß ja nie, nennt er sich inzwischen Die. Und fabelhaft obendrein…“
Um gleich danach in weiteren Reimen wieder gebrochen zu werden: „Das kann nur erfunden sein. Bei aller Liebe zur Fantasie. Das ist Quatsch. Das macht er nie…“ Und gleich nochmals eine Wendung… – aber die wird jetzt hier nicht gespoilert.

Jedenfalls ein kurz(weilig)es Fest fantasievoller Wort-, Bilder- und Rollenspiele das dank des mitreißenden Schauspiels und der teils ohrwurmtauglichen Reime – samt Musikalität (Musik und Sounddesign: Ludwig Peter Müller) vielleicht noch zum „weiterspinnen“ animiert. Apropos Spinnen – die kommen – textlich – auch recht witzig vor: „I bzw. Ente Klaus: „Was mich an Spinnen stört / Ist, dass man sie schlichtweg nicht hört“ 😉

„1, 2, 3, 4, vorwärts, Rückschritt…“ zum rasend schnellen, live gespielten, Rhythmus exerziert die erste Performerin, die die Bühne entert, gehetzte Tanzbewegungen. Und schon schwingt Doppeldeutigkeit mit. Werden hier nicht nur Moves gezählt und vorgegeben, sondern auch gleich ein Kommentar zur (gesellschafts-)politischen (Welt-)Lage?
„Speed (kills content)“ heißt die jüngste Produktion vom aktionstheater ensemble beim Wiener Gastspiel. Traditionsgemäß spielt die Gruppe die erste Serie der neuen Stücke in Vorarlberg, wo Mastermind – jeweils Konzept und Regie – Martin Gruber in Dornbirn lebt. Im Herbst war die Gruppe mit „All about me“ übrigens sogar am Off-Broadway in New York eingeladen – mit etlichen Triggerwarnungen für das dortige Publikum.

Die Aufführungen der Gruppe gehen immer von sehr persönlichen, nicht gerade ruhmvollen Situationen aus, die tief berühren. Dennoch bedienen sie nie Voyeurismus, weil die eine oder andere auch vielen im Publikum gleichermaßen bekannt sein dürften. Keine (Welt-)Erklärungen von oben oder außen, sondern aus dem tiefsten Inneren – (Bauch-)Gefühl + hirnige Reflexion miteinander unmittelbar verwoben – und dies symptomatisch für gesellschafts(-politische) Zustände und Entwicklungen.
Das gemeinsam Erarbeitete wird nicht selten auch zum szenischen Gegeneinander. Männer die Frauen erklären, dass sie depressiv oder sicher nicht glücklich seien. Körperliche und seelische Entblößungen inklusive. Aktionstheater-Performances vereinen Gefühl, Geist und (extrem) starke Körperlichkeit miteinander. Dieses Mal vom Tempo her noch heftiger, noch rasanter eben „Speed“ und der killt den Inhalt – scheinbar.

Letzterer manifestiert sich vor allem in Szenen, die den in den Mittelpunkt der meisten Menschen gerückten Kampf mit den Kosten des täglichen Lebens betreffen. Vom unmöglichen Auszug aus einer gemeinsamen Wohnung trotz Trennung, weil die Kosten für eine neue Unterkunft nicht leistbar sind bis zum fast entwürdigend erscheinenden Ringen um Rabattpunkte im Supermarkt.

Oder die auf durchaus tiefstem, untergriffigen Niveau ausgetragene Schrei-Orgie zwischen Klientin und Arbeitsamts-Mitarbeiterin, bei der Isabella Jeschke beispielsweise echte Tränen aus den Augen schießen. Und die trotz der Heftigkeit ihrer Schimpfkanonade dem fiktiven Gegenüber von unbändiger Verzweiflung Zeugnis geben.

Und schon im nächsten Moment wieder kraftvolle Tanzschritte von ihr und den fünf begeisternd mitreißenden Kolleg:innen Zeynep Alan, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Tamara Stern, Benjamin Vanyek auf sowie der drei musizierenden Kollegen Andreas Dauböck, Pete Simpson und Jean Philipp Oliver Viol am Rand der Bühne. Und trotz der rasenden Geschwindigkeit, der volle pulle Power kein Schritt weiter – das aktuelle Lebensgefühl. What the fuck ist auf dieser Welt los? Undenkbares wird Wirklichkeit, Unsagbares poppt in der Mitte vermeintlich aufgeklärter Gesellschaften auf, Teuerungen, Demokratie-Abbau, kaum Hoffnung und DAS große, die Menschheit insgesamt bedrohende Thema Klimakrise – rückt in den Hintergrund.
Überforderung im Großen, die sich im alltäglichen Leben im scheinbar Kleinen, niederschmetternd, niederdrückend auswirkt. Druck, Druck, Druck. Angst. Angst. Angst.
Angst auch vor Stillstand und gar Rückschritt. Hilft da Tempo, Tempo, Tempo? Oder killt die ziel- und planlose Geschwindigkeit eben die Inhalte?
Immerhin aber sind viele der rasanten Gruppenpassagen des gesamten Ensembles Momente der gemeinsamen Bewegung – immer auch synchron zur Live-Musik – ein Hoffnungsbild das wenngleich kraftvoll laut aber doch subtil ins Publikum schwappt.

Von Beginn an tauchen die live auf der Bühne Performenden auch noch in projizierten Bewegtbildern auf durchscheinenden Wänden im Hintergrund auf. Für diese Videos hat die Künstlerin Resa Lut die Darsteller:innen schon im Vorfeld gefilmt, die Videos verfremdet, diffus gemacht, solarisiert – anfangs erscheinen diese schemenhaft, gegen Ende immer klarer, naturlaistischer.

Ausstattung und Kostüme (Raum: Marcus Ganser, Kostüme: Anna Pollack) versetzen Spiel und Publikum in die Mitte des vorigen Jahrhunderts: schwarze, schwere Telefonapparate mit Wählscheiben, Gabel und knochenartigen Hörern stehen auf dem großen langen Tisch im Presseraum des Chicagoer Gerichtsgebäudes. Journalist:innen der lokalen und überregionalen Zeitungen berichten über einen zum Tod verurteilten Kriminellen.

Doch was und wie immer wieder auch humorvoll, (selbst-)ironisch gespielt wird – mit Ausnahme der Muße, die diese Reporter:innen haben und die Zeit mit Kartenspiel vertreiben, was heute wo es auch um darum geht, wer stellt’s als erstes online -, wirkt so gar nicht alt: Konkurrenz um die beste Schlagzeile, einige der Medien, die sich in Übertreibungen überbieten, korrupte Deals zwischen Medienleuten und dem Sheriff sowie dem Bürgermeister. Heftige ideologische Schlagseite mit dem mehrfach zitierten Slogan „nur ein toter Roter ist ein guter Roter“ samt angeblich überall lauernder Kommunisten. Ein Gouverneur, der angeblich nicht erreicht werden kann, weil er fischen ist. Jobangebote vom Bürgermeister an einen Polizisten, um das vom Gouverneur doch unterschriebene Gnadengesuch des Verurteilten nicht in Empfang nehmen zu müssen…

Turbulent, intrigant und – leider – fast zeitlos, wenngleich vom Impresario des Theaters zum Fürchten, Bruno Max, in eine aktuelle Bühnenfassung gegossen, läuft „Extrablatt! Extrablatt!“ frei nach „The Frontpage“ (auch mehrfach verfilmt) von Ben Hecht und Charles MacArthur derzeit im Wiener Theater Scala, nachdem es schon im Dezember im Mödlinger Stadttheater gespielt wurde. Unter anderem hat Max, der auch Regie führte, wenigstens eine Journalistin unter die männlichen Kollegen gesetzt.

Die Story: Die Reporter:innen warten auf die Hinrichtung des Kommunisten Earl Williams (Felix Frank), der einen schwarzen Polizisten erschossen haben soll. Der Bürgermeister (Anselm Lipgens) will ihn noch vor seiner Neuwahl hängen sehen, um Law- and Order-Fans und die Stimmen der Schwarzen zu bekommen. Aber Williams kann beim abschließenden Gespräch mit dem aus Österreich aus der Freud’schen Schule stammenden Psychologen aus dem Büro des Sheriffs flüchten; vor allem, weil ihm Sheriff Hartman (Robert Notsch) mit dümmlich Trump’schen Zügen seinen eigenen Revolver leiht, um die (angebliche) Tat nachzustellen.
Verfolgungsjagd mit vielen Pannen und „Kollateralschäden“. Und die Reporter:innen auf der Jagd nach der besten Story: Bensinger von der „Tribune“ (Hermann J. Kogler), Murphy vom „Chicago Journal“ (Christian Kainradl), Frau Schwartz von der „Daily News“ (Ildiko Babos), Endicott von der „Post“ (Christopher Korkisch), McCue von der „City Press“ (Leopold Selinger), Wilson vom „American“ (Christoph Prückner).

DER Starreporter Hildy Johnson (Paul Barna) hat sich kurz davor eigentlich aus dem Spiel genommen und seinem Chef, dem Herausgeber des „Examiner“, Walter Burns (Alexander Rossi) eröffnet, dass er aussteigt, um seine Verlobte Peggy Grant (Chiara Larson) zu heiraten und ins Werbe-Business seiner Schwiegerfamilie einzusteigen – gemütlicher und lukrativer.
Doch dann – während seine Kolleg:innen im Gerichtsgebäude nach dem Flüchtigen suchen, klettert der Todeskandidat beim offenen Fenster in den Presseraum. DIE Exklusivstory. Da lässt Hildy die Braut im Taxi mit den Koffern warten und …
Jede Menge Verwicklungen, Ungewöhnliches Versteck für den Todeskandidaten, dessen einzige Fürsprecherin, Mollie Maloy (Stephanie-Christin Schneider) aus dem Puff taucht auf. Earl Williams und sie sind die einzigen die einander auf Augenhöhe begegnen, alle anderen blicken auf sie herunter.

Mehr sei über die Handlungsstränge nicht verraten. Neben spannenden Wendungen lebt es mit nicht wenigen Anspielungen auf kleine und größere Deals zwischen Polizei, Politik und Medien(leuten), die leider keine historisch überwundenen sind, wenngleich vielleicht als Gegenpol wenigstens ein Qualitätsmedium mit Bemühen um Wahrheit abgeht. Für eine doch eher kleine Bühne agiert hier ein relativ großes Ensemble von 16 Schauspieler:innen – mit einer reifen Ensembleleistung, unterschiedlichen Journalist:innen-Typen, aber auch sogenannte Nebenfiguren wie etwa Ulrike Hübl als irgendwie schräge Putzfrau Jenny bringt einen eigenen Schwung mit ihren Auftritten in den Presseraum des Gerichtsgebäudes und deutet immer wieder an, dass sie viel mehr Durchblick hat als ihr alle anderen zutrauen.

Neu- und wissbegierige, aufgeweckte, fröhliche (sehr) junge Kinder blicken direkt in die Kamera, zeigen auf dich und dich und dich. Oder zumindest, jene, die sich von den Sprüchen „du bist elementar für… mein Selbstvertrauen / meine Neugier / meine Autonomie / meine Entwicklung“ jeweils mit einem Rufzeichen, gemeint fühlen (könnten).
Mit diesen wortspielerischen inhaltlich zentralen Aussagen startet das Bildungsministerium seine – heuer einzige große – Werbekampagne. Diese soll, zunächst vor allem online und via social Media vorläufig bis April Tausende Maturant:innen oder / und Berufs-Umsteiger:innen ansprechen, sich für die Ausbildung zur Elementarpädagogin oder zum Elementarpädagogen zu interessieren. Um dann idealerweise einen der unterschiedlichen Ausbildungswege zu beschreiten und den anspruchsvollen, wertvollen Beruf zu ergreifen.
Die am Freitag von Bildungsminister Christoph Wiederkehr vorgestellte Werbeoffensive will und soll aber gleichzeitig generell das Image dieser Berufsgruppe und ihrer für die Entwicklung von Kindern im kognitiven und sozialen Bereich wichtigen Grundlagenbildung fördern. Noch immer wird Elementarbildung ja vielfach eher als Kinderbetreuung gesehen und auch so behandelt – bis hin zu veralteten Begriffen (Stichwort „Tanten“).
Erste Stufe, Phase, Grundbaustein der Bildung (junger und jüngster) Menschen – das ist der Kindergarten, der nicht zufällig im Englischen übrigens genau so heißt, manchmal fälschlicherweise auch mit einem d statt t als kindergarden geschrieben. Grund: Er ist eine Erfindung des deutschen Pädagogen Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 – 1852), von Mitchel Resnick, Miterfinder des spielerischen Programmierlernspiels Scratch, vom berühmten MIT (Massachusetts Institute of Technology) immer wieder als die wichtigste Erfindung der vergangenen 500 Jahre genannt: Professionelle, außerhäusliche, ergänzende Früherziehung.
„Bundesweit sind mehr als 388.000 Kinder in institutionellen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen. Insgesamt arbeiten mehr als 71.000 Personen in institutionellen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen“, sind aktuelle Zahlen auf der mit Beginn der Kampagne eingerichteten Homepage (Link am Ende des Beitrages).
„Jährlich werden rund 1.800 Stellen aufgrund von Pensionierungen, Umzügen, Karenz oder anderen Gründen frei. Wird eine Verbesserung der Strukturqualität in Form des Fachkraft-Kind-Schlüssels angestrebt, so werden laut einer Studie bis zum Jahr 2030 voraussichtlich rund 20.200 Elementarpädagoginnen/ Elementarpädagogen gebraucht“, heißt es dort weiter.

Wiederkehr wies auf die Ausbildungsoffensive hin, für die – trotz Sparkurses – 32 Millionen für 4000 neue Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Neben der vielleicht am bekanntesten Ausbildung in BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) sowohl als BHS (berufsbildende höhere Schule) als auch als Kolleg gibt es die Fachschulen für Assistenzberufe, Studien an PH (pädagogischen Hochschulen) sowie FH (Fachhochschulen) und Universitäten, aber auch einen Hochschullehrgang zum Quereinstieg. Neu ab Herbst 2026 wird es flächendeckendberufsbegleitende BAfEP-Kollegs (Zielgruppe20- bis 45-Jährige) geben, neue Bachelor-Studien Elementarpädagogik an einigen PH. Alle Möglichkeiten sind übersichtlich auf der neuen, bunten Homepage – mit den vier Sujets der aufgeweckten Kinder mit der Pose „Wanted“ aufgelistet.
Die – auf KiJuKU-Nachfrage 360.000 €-Kampagne soll helfen, den eklatanten Fachkräftemangel zu verringern. Allerdings hapert es – so Expert:innen aus dem Berufsfeld – an den Arbeitsbedingungen, „um fertig ausgebildete Elementarpädagog:innen auch im Berufsfeld zu behalten.“ Wobei die Bezahlung, die in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich erhöht wurde, aber noch immer nicht auf dem Niveau von Volksschullehrer:innen liegt, wie gefordert, „nicht das Hauptproblem ist. In erster Linie ist es das Fehlen von interdisziplinären Teams, vor allem Psycholog:innen, die bei Inklusion wichtig wären, und es ist noch immer die zu große Anzahl von Kindern pro Gruppe“, so heißt es vom NeBÖ (Netzwerk elementarer Bildung in Österreich).
Bei den Kleinstkindern in Krippen liegt die Spannbreite der Gruppen zwischen 8 und 15 je nach Bundesländern und in den Kindergartengruppen zwischen 20 und 25. Die Forderung der Berufsgruppe lautet seit Längerem pro Jahr um je ein Kind weniger pro Gruppe, für Kindergartengruppen sei – auch wissenschaftlich untermauert – ein Verhältnis von sieben Kindern pro Pädagog:in sinnvoll und wünschenswert.
Auf diese Forderungen angesprochen unterstützte der Bildungsminister sie grundsäzlich, vieles sei eine Frage der Verhandlungen zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Trägerorganisationen. Generell hoffe er, dass im Zuge der Debatten um die Reformpartnerschaft Bund / Länder jedenfalls der aktuellen „Fleckerlteppich“ ein Ende finde und es „endlich gesamtösterreichische Qualitätsstandards“ geben werde.
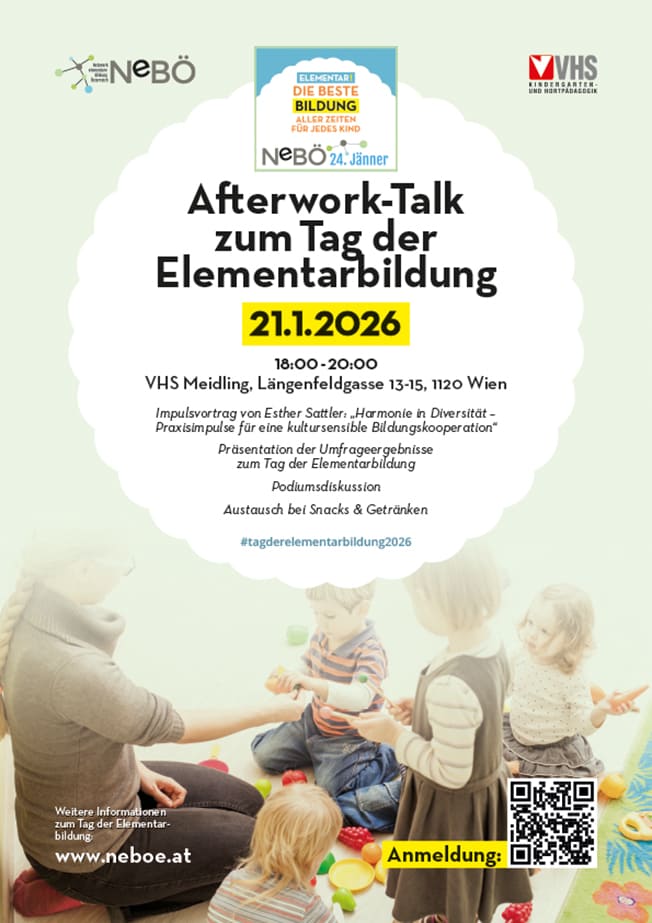
Die oben schon mehrfach erwähnte Image-Kampagne, um Tausende neue Bewerber:innen für Ausbildungen in diesem Berufszweig zu finden, startet somit rund zwei Wochen vor dem Tag der Elementarbildung, der heuer zum neunten Mal am 24. Jänner stattfindet. Dieser geht auf die Initiative Raphaela Kellers zurück, die mit der Gründung des „Österreichischen Berufsverbandes der Kindergarten- und Hortpädagog_innen“ (ÖDKH) am 24. Jänner 2018 diesen Aktionstag ins Leben gerufen hat. Mit dem vierten TdEB (2021) ist der ÖDKH im Netzwerk elementare Bildung Österreich NEBÖ aufgegangen. Verschiedene Veranstaltungen in etlichen Bundesländern werden laufend auf der Homepage von NeBOe veröffentlicht – link ebenfalls am Ende des Beitrages. In Wien wird es einige Tage davor (21. Jänner) neben einem Impulsvortrag samt Diskussion zu „Harmonie in Diversität – Praxisimpulse für eine kultursensible Bildungskooperation“ die Präsentation von Umfrageergebnisse zum Tag der Elementarbildung geben.

„Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Es ist …“ und dann folgt nur mehr ein Bildrauschen auf der uralten Videokassette. Das ist eine der ersten Szenen im neuen, dem dritten Checker-Tobi-Kinofilm: „Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde“.
Die alte Videokamera fällt Freundin Marina (Marina Blanke) beim gemeinsamen Kramen in Tobis alten Sachen in die Hände. Die hier zu Beginn und auch fast am Anfang des Films gestellte Frage kommt vom – erfundenen – achtjährigen Tobi. Den spielt Theodor Lotta. Für den achtjährigen ist das eine Premiere. Und er taucht in der auf alt gemachten, natürlich neu gedrehten, Szene auf, macht mit seiner Freundin Marina (die junge Marina wird von Lilou Jyoti Weerts dargestellt) selber „Tobi TV“ und spielt schon den Checker, der alles ergründen will. In diesen „alten“ Szenen hat es ihm die Erde „unter unseren Füßen“ – und zwar die natürlich, nicht die betonierte oder asphaltierte – angetan. Er schlüpft in ein „selbstgebasteltes“ Regenwurmkostüm und erklärt: Er ist ein Superheld und seine Superkraft ist die Kacke“ (also die des Regenwurms!), weil die für die fruchtbarste Erde sorgt.
Und dennoch ist das nicht die Antwort auf die Frage am Anfang. Dem rund 30 Jahre älteren Tobi (Tobias Krell) aber fällt die Antwort seines (angeblichen) eigenen achtjährigen Ichs nicht und nicht ein. Da spielt der junge Kollege auf sehr enttäuscht, dass aus dem wissbegierigen Checker-Buben ein langweiliger Erwachsener geworden ist.
Bleibt natürlich nicht so. Angestachelt durch diesen Trick macht er sich – nach Wasser im ersten und Luft im zweiten nun im dritten Kinofilm auf in verschiedenste Gegenden der Welt, um nach spannenden Geschichten rund um Erde zu suchen und sie ins Bild zu rücken (Buch und Regie: Antonia Simm).

Mit der in Madagaskar aufgewachsenen, in Deutschland studierten und arbeitenden Biologin Dr. Hanitra Markolf Rakotonirina reist er in deren ersten Heimat, zu Tieren, die es nur dort und sonst nirgends auf der Welt gibt. Aber auch zu einem von ihr mitgegründeten und immer wieder besuchten und betriebenen Umweltprojekt „Chances for Nature“ und einer Baumschule für junge Baobabs, von denen er ausgewachsene 800 und 1000 Jahre alte live erlebt. Und er nimmt eine Kiste solcher Samen mit, um sie in Spitzbergen fast am Nordpol mit dem dort lebenden und arbeitenden deutschen Geologen Malte Jochen in den weltweiten Saatguttresor in einem natürlichen Tiefkühlstollen zu bringen.
Aber weder Regenwurm, noch Madagaskar, noch die 60 Millionen Jahre alten Bäume, die zu Steinkohle geworden sind, bringen den „alten“ Checker Tobi näher an die Antwort auf die Frage des eigenen kindlichen Ichs. Und so reist er weiter nach Mexiko. Die Anthropologie-Studentin aus Österreich Samara Sánchez-Pöll, die in ihrer ersten Heimat bei den Maya in einem sozialen Landwirtschaftsprojekt nach uralten Rezepten kocht, bringt ihn zu einem faszinierenden traditionellen Anbaufeld, wo Mais, Bohnen und Kürbis gemeinsam wachsen, weil die Indigenen wussten, dass alle drei Früchte davon profitieren.

Aber auch das bringt ihn noch nicht nur gesuchten Antwort, ebenso wenig wie die Hilfe beim Archäologen Nicolaus Seefeld – auch wenn sie dabei auf einen Mais-Mahlstein bei einer Ausgrabung stoßen. Beim Aufstieg auf eine der Maya-Pyramiden von Calakmul philosophiert Checker Tobi schließlich, ob es nicht überhaupt egal sei, die oder eine Antwort zu finden, sondern viel wichtiger ständig Fragen zu stellen und nach deren Antworten zu suchen. Und findet letztlich doch eine Antwort – die aber hier sicher nicht gespoilert werden soll.
Was aber schon verraten werden darf, weil es Marina Blanke im Interview für das Medienheft zum Film schon verraten hat: „Tatsächlich sammeln wir auch gerade schon fleißig Ideen, wie ein Film über das Feuer entstehen könnte. Wie die anderen drei, ist auch das Feuer ein spannendes Element, über das man viel erzählen und herausfinden kann. Feuer hängt untrennbar mit den anderen Elementen zusammen, es braucht Luft um zu brennen, Material, das es verzehren kann und Wasser, das es löscht… da lässt sich doch eine spannende Geschichte mit vielen Gesichtern des Feuers draus machen, oder? Ich freue mich besonders darüber, dass wir diesen Film als allerersten Checkerin-Marina-Kinofilm planen. Mal sehen, was sich da so checken lässt!“

Denn beim Erde-Film spielt Marina nur echt eine kleine Nebenrolle und damit auch ihr kindliches Ebenbild, die zehnjährige Lilou Jyoti Weerts, während ihr junger Kollege Theodor Latta immer wieder im Film auftaucht – für alle anderen außer Tobi in den Szenen aber nicht zu sehen. Die Dreharbeiten fand er – laut Medienheft der Filmfirma – „total lustig und spannend am Set. Die Crew war supernett und wir haben viel gelacht. Mit Tobi hab ich mich auch super verstanden. Wir hatten auch vor jedem Dreh ein kleines Ritual. Und ich hatte einen Schauspiel-Coach, Joe, er war beim Dreh immer dabei und hat mir sehr geholfen, in meine Rolle vom kleinen Tobi zu schlüpfen. Mit ihm war’s auch immer lustig.“ Am Coolsten fand er: „Die Reise nach Mexiko war natürlich mega aufregend und ich habe viel erlebt und gesehen. So weit bin ich noch nie geflogen!“
„Die Erde ist ein wahres Wunderwerk, über das sich unzählige Geschichten erzählen lassen“, wird Drehbuchautorin und Regisseurin Antonia Simm im Presseheft des Filmverleihs zitiert und weist auf die bekannte, nicht selten aber zu wenig präsente Erkenntnis hin, dass „in einer einzigen Handvoll Erde mehr Lebewesen“ existieren, „als es Menschen auf der Welt gibt!“
„In dieser Geschichte war es mir besonders wichtig, den Kindern eine Stimme zu geben – sind sie doch die wahren Expertinnen, wenn es um Erde geht: Sie erleben sie hautnah, mit allen Sinnen. Kinder zu bestärken, selbst etwas in die Hand zu nehmen, war mir schon immer ein großes Anliegen. Mit diesem Film möchte ich außerdem zeigen, dass in uns allen ein kleiner Tobi steckt. Ich wünsche mir, dass unsere Kinobesucherinnen – ob groß oder klein – Lust bekommen, die Ärmel hochzukrempeln, die Welt um sich herum neugierig zu entdecken und so die Zukunft aktiv mitzugestalten.“
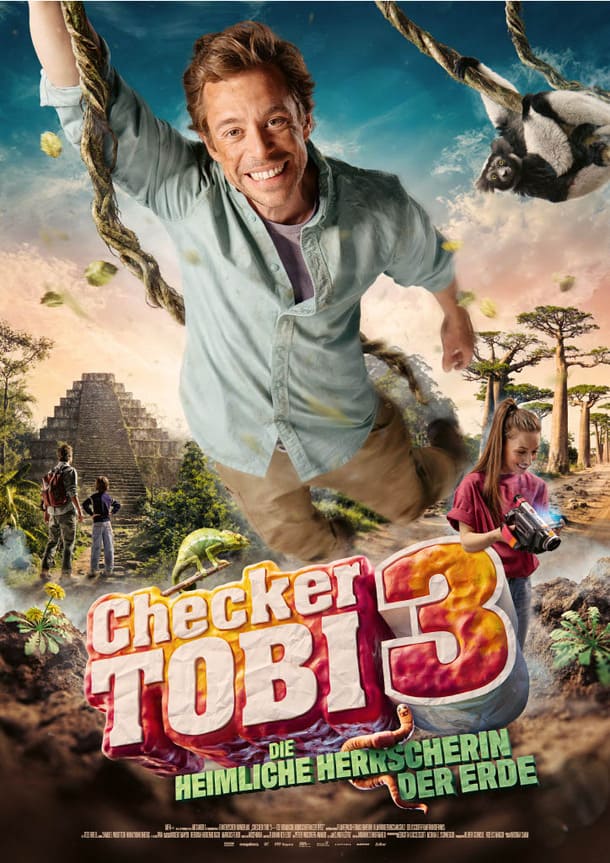

Pendeln zwischen digitaler und analoger Welt – was (fast) allgegenwärtig geworden ist, machen die Autorinnen und die Illustratorin zum Inhalt des Bilderbuchs „Robotti, wir haben ein Problem!“, Untertitel: „Lotti und Robotti auf Entdeckungsreise durch die digitale Welt“.
Lotti, ein junges Mädchen, ist die Hauptfigur der Geschichte. Sie liebt Filme, in denen Roboter zentrale Rollen spielen. Pädagogisch eingebettet, schaut sie diese mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder Konrad. Inspiriert von diesen Videos will sie selber einen Roboter bauen – der muss nicht elektronisch sein und nicht wirklich funktionieren. Das haben sich die Autorinnen Sarah Hofmann und Miriam Prätsch, die in ihrem Hauptberuf Psychologinnen und Psychotherapeutinnen sind, so ausgedacht und Jasmin Hirtl in plastischen, bunten Bildern dargestellt. Am Ende findest du – via QR-Code – unter anderem zu einer Bastelanleitung eines solchen Karton-Gefährten samt alter Computertastatur und altem Handy.

Papas – echtes – Handy verschafft Lotti aber auch einen Video-Kontakt zur Mutter, die nach einer heftigen Fußverletzung bei einem Wanderausflug in die Berge mit Tante Karo im Krankenhaus liegt. Seite für Seite entdeckst du mit Lotti so manches, was Handys, Computer, Internet, Suchmaschinen und Apps können, gut und nützlich ist, so du es nicht ohnehin schon kennst.

Als Lotti und Papa auf dem Weg zum Einkaufen in heftigen Regen geraten, obwohl die Wetter-App meinte, es werde trocken bleiben. „Da hätte ich wohl besser mal in den Himmel geschaut und nicht ins Handy“, lassen die Autorinnen den Vater einbekennen.

Warum der Vater übrigens ein Rezept für Lottis Geburtstagskuchen online sucht, wenn die Tochter mit aufgeschlagenem Backbuch auf dem Küchenboden sitzt und vor sich noch weitere Bücher mit Rezepten liegen hat, bleibt ein ungelöstes Rätsel!
Hin und wieder findest du eigens gekennzeichnete Text-Kasterln mit Fragen an dich und deine digitalen Erfahrungen. Einige Begriffe im Buch wie Roboter oder Künstliche Intelligenz sind blau gedruckt – dazu findest du nach der Bilderbuchgeschichte über Lotti und die natürlich rechtzeitig zu ihrem Geburtstag aus dem Krankenhaus wieder zurückgekommene Mutter zwei Erklärseiten.
Und daran schließen sich 16 Seiten an, mit denen die Autorinnen in einem pädagogischen Begleitmaterial sich an Erwachsene richten, um ihnen Fakten und Gedanken im Umgang mit digitaler Welt und Kindern zu vermitteln.

„Die Lage in Venezuela ist ruhig, aber angespannt. Vor allem in der Hauptstadt Caracas patrouillieren die sogenannten Colectivos, dem Maduro-Regime zurechenbare paramilitärische Gruppen. Die Bevölkerung ist verunsichert, pendelt emotional zwischen Hoffnung auf eine bessere Zukunft und Angst, was nach der Verhaftung von Maduro folgen könnte.“ Das berichtet Wolfgang Wedan, Globaler Nothilfe-Koordinator der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, nach Gesprächen mit den Projektpartner:innen vor Ort.
Ab 2021 koordinierte der Steirer von Caracas aus die weltweiten Nothilfe-Aktivitäten von Jugend Eine Welt, seit drei Monaten befindet sich Wedan allerdings wieder aus Sicherheitsgründen, da sich die Lage für ausländische Staatsbürger:innen in Venezuela konstant zuspitzte, in seiner Heimat Österreich. „Ich bin im täglichen Austausch mit unseren Projektpartnern vor Ort in Venezuela – vornehmlich mit den Salesianern Don Boscos und den Don Bosco Schwestern. Gemeinsam ermitteln wir zur Stunde die wichtigsten Punkte für eine schnelles Nothilfe-Programm für die Bevölkerung vor Ort. Als ersten Schritt sammelt Jugend Eine Welt Spenden, um den Ärmsten der Armen Nahrungsmittelpakete zur Verfügung zu stellen. Denn viele Geschäfte sind aufgrund von Hamsterkäufen mittlerweile leergeräumt bzw. geschlossen“, erzählt Wedan.

„Dazu gehen im ganzen Land Benzin und Diesel aus. LKW können nicht mehr fahren, die Geschäfte somit auch nicht mehr versorgt werden. Besonders schlimm ist die Lage in den ländlichen Gebieten, wo Menschen mittlerweile kein Essen mehr haben und Hunger leiden müssen.“ Zusätzlich werden auch Medikamente für ältere Personen, die von der zusammengebrochenen logistischen Versorgung im ganzen Land betroffen sind, dringend benötigt.
Die unsichere Lage in Venezuela bedingt laut den Einschätzungen von Wedan nach Gespächen mit Helfer:innen vor Ort allerdings auch die Wahrscheinlichkeit eines einsetzenden Flüchtlingsstromes Richtung Kolumbien in den nächsten Wochen. „Ich gehe davon aus, dass sich sehr viele Venezolanerinnen und Venezolaner nach Westen, zur kolumbianischen Grenze aufmachen werden. Erfahrungsgemäß bringen sie ihre Kinder in der Zwischenzeit bei Verwandten unter. Meist sind es Onkeln, Tanten oder Großeltern. Diese sind jedoch zunehmend mit der Situation überfordert. Schlussendlich landen die Kinder dann oft auf der Straße “, schildert der Venezuela- Experte. Neben der Planung von Nothilfe-Maßnahmen gilt das Augenmerk aktuell daher auch der Reaktivierung von Notschlafstellen für Kinder. „Damit sie zumindest in der Nacht einen sicheren Platz in einer kindergerechten Umgebung haben. Wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Straßenkindern, dass das Leben auf der Straße ein täglicher Überlebenskampf ist, oft endet er in der Kinder- Prostitution“, so Wedan.

„Schätzungen zufolge sind in den vergangenen zehn Jahren knapp acht Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner aus ihrem Heimatland geflohen und abgewandert. Schon vor dem Angriff durch die USA bestanden in Venezuela vier große Probleme: Nahrungsmittelknappheit, fehlende Gesundheitsversorgung, eingeschränkte Transportmöglichkeiten und regelmäßige Stromausfälle. Die aktuellen Vorgänge verschärfen die ohnehin prekäre Lage jetzt zusätzlich. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit vor Ort und helfen Sie der notleidenden Bevölkerung mit Ihrer Spende!“, appelliert Jugend Eine Welt-Geschäftsführer Reinhard Heiserer.
jugendeinewelt –> venezuela-hilfe-dringend-noetig
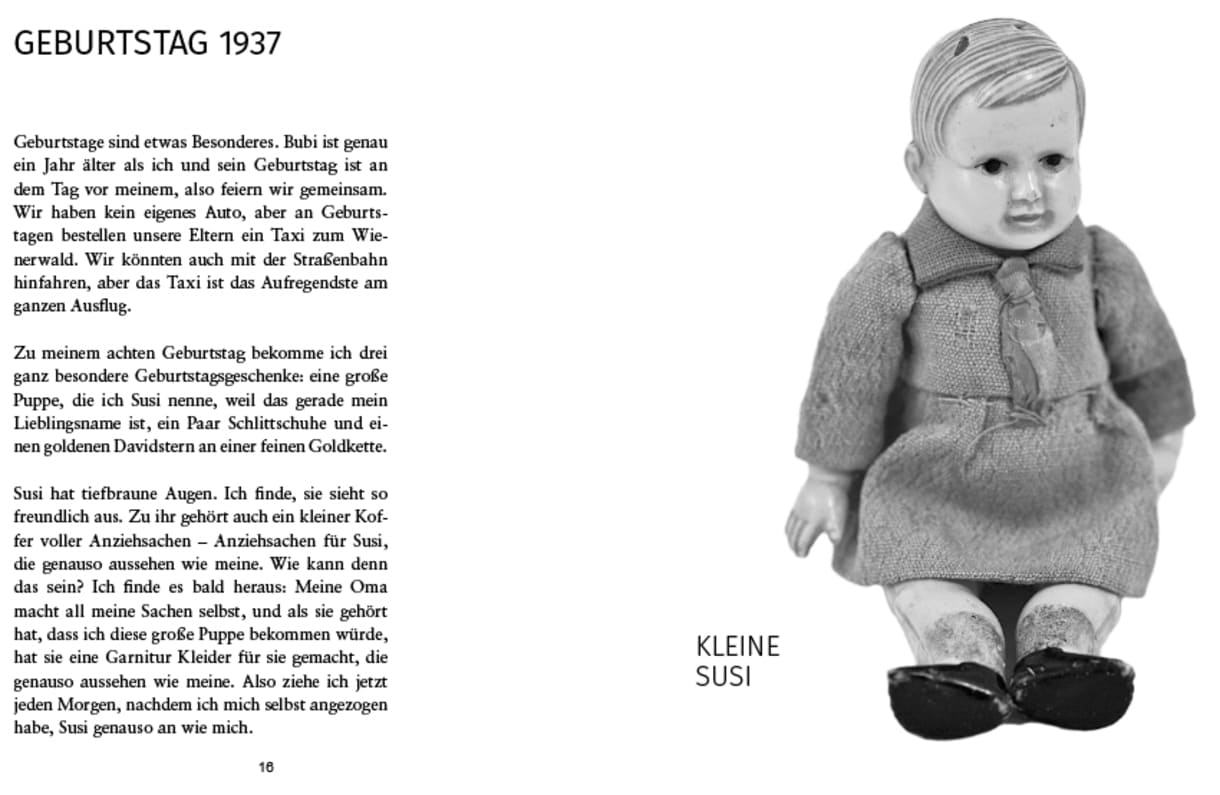
„Eines Tages in Österreich, als ich 4 Jahre alt war, ging ich mit meinem Vater spazieren. Mein Vater war eine besondere Art von Anwalt- er verteidigte Leute, die in Schwierigkeiten waren, aber es sich nicht leisten konnten, viel zu bezahlen. Es war 1933, Hitler war gerade der „Führer“ von Deutschland geworden. Wir waren gerade auf dem Heimweg, als ein Mann, der meinem Vater Geld schuldete, uns anhielt und schrie: „Einen Drecksjuden bezahle ich nicht!“, und dann spuckt der meinen Vater an und lief davon.“
So beschreibt Hedi Schnabl Argent, die heuer 97 Jahre wird, ihre früheste Erinnerung an die Anfeindung die sie als jüdisches Mädchen im niederösterreichischen Schwechat miterleben musste. Vor wenigen Wochen ist ihre Lebensgeschichte auf Deutsch erschienen: „Der Tag, an dem sich die Musik veränderte – Wie ich als Kind vor dem Nazi-Regime fliehen musste“.

Hedi ist Einzelkind, aber mit einem Cousin, den alle „Bubi“ nennen fast wie mit einem Bruder oft beisammen. Und die eingangs geschilderte Szene ist nicht die einzige. Zwei Jahre später an ihrem ersten Schultag wird sie selbst beschimpft. Und was noch härter ist, niemand will mit ihr spielen, „weil ich Jüdin bin… ich mag den Unterricht, aber ich gehe nicht gerne in die Schule.“
Die Autorin ihrer eigenen, echten Geschichte nennt aber auch einen wichtigen Lichtblick. Gerti kam auf sie zu und lud sie ein, gemeinsam zu spielen. Auf die Frage, warum sie sich anders verhalte als alle in der Umgebung zitiert Hedi Schnabl Argent ihre Freundin – bis heute übrigens: „Meine Mutter hat mir gesagt, dass es keine Rolle spielt, was man ist, solange man ein guter Mensch ist.“ Und Gerti lässt sich auch nicht davon abbringen, als nun andere Kinder auch mit ihr nicht spielen und sie als „dreckige Judenfreundin beschimpfen“.

In einfach zu lesenden, aber – selbst beim Wissen um den mörderischen Holocaust, in dem sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet wurden – nur schwer zu verdauen sind, beschreibt Hedi Schnabl Argent auch außergewöhnlich schöne Tage wie ihren achten Geburtstag und die drei Geschenke, Weihnachten samt Besuchen bei nicht-jüdischen Nachbarn, die zu den wenigen Menschen gehören, die sie nicht anfeinden.
Aber auch jenen Tag, der dem Buch den Titel gab: den 13. März 1938, als Hitlerdeutschland Österreich einverleibte („Anschluss“), was von sehr, sehr vielen Menschen bejubelt wurde. Zum letzten Mal lief im Radio die damalige österreichische Bundeshymne. „Doch nach der Hälfte der schönen Haydn-Melodie wird das Tempo schneller: Sie ist nun die deutsche Hymne.“

Und damit war klar, früher oder später muss die Familie das Land verlassen, wenn sie überleben will. „Von heute auf morgen sind wir Flüchtlinge. Wir gehen nicht auf die Straße. Wir haben kein Zuhause mehr und bleiben, wo immer uns jemand eine Woche, einen Monat oder auch nur ein Wochenende lang Unterkunft gewähren kann…“
Die Familie kann – nach einer vorübergehenden Verhaftung ihres Vaters – doch noch rechtzeitig gemeinsam nach England flüchten. „Wir fragen uns, werden wir uns immer wie Außenseiter fühlen? Werden wir immer Flüchtlinge bleiben?“

Und fast natürlich gelingt es dem jungen Mädchen schneller als den Eltern sich in der neuen Heimat zurecht zu finden – ihr Buch ist vor drei Jahren auch im Original auf Englisch erschienen.
Das Buch lebt von den authentischen Erlebnissen des sehr jungen und später jugendlichen Mädchens in nachvollziehbar verfassten Episoden – und nicht zuletzt den echten Fotos von ihr selbst, aber zum Beispiel auch von der kleinen Puppe Susi, die sie als einziges als Ebenbild der großen Susi-Puppe mit auf die Flucht nehmen konnte. Sogar ihre Enkelkinder haben damit noch gespielt. „Jetzt ist sie alt und zerbrechlich und wohnt zu ihrem Schutz sorgfältig eingepackt in Seidenpapier, in einer Schachtel im National Holocaust Museum in Nottinghamshire.“ (ungefähr in der Mitte Englands).

Hedi Schnabl Argent baut in die rund 60 Seiten immer wieder trotz der tragischen Geschichte ihrer Kindheit hoffnungsvolle Momente ein – Freundin Gerti oder die Nachbarn sind hier erwähnt, aber im Buch finden sich noch mehr. Und sie spannt den Bogen von der Verfolgung von Jüd:innen durch Nazis und andere Antisemit:innen zu Menschen, die auch heute flüchten müssen, um zu überleben.

In einer Art Vorwort schreibt sie unter anderem ebenfalls in einfachen Sätzen diese großen Gedanken: „Dass wir alle anders sind, ist großartig, aber kurioserweise sind wir gleichzeitig auch alle gleich, weil wir alle Menschen sind. Egal woher wir kommen, welche Haut-, Haar- oder Augenfarbe wir haben, ob wir Behinderungen haben oder nicht, an was wir glauben oder nicht, welche Sprache wir sprechen, wir sind alle Menschen und Teil der einzigen Menschheit, die es gibt.
Meine Geschichte handelt davon, was passiert, wenn wir Menschen, die anders sind, so behandeln, als ob sie keine Menschen wären.“

Spannend ist übrigens auch das Nachwort des Herausgebers Nikolaus Franz, der die Entstehungsgeschichte dieses Buches ausgehend von einem Dokumentarfilmprojekt „Schwechat im Krieg“ schildert.

Zwischen Wirtshaus und Toren im Packpapier-Design (Bühne: Claudia Vallant) mit einer Vielzahl politischer Graffiti-artigen Zeichnungen bzw. Bildern vom gestreckten Mittelfinger bis zu Diktatoren-Konterfeis bzw. einem Hund, der ein Haxerl hebt und sozusagen politisch brunzt, spielt das Schubert Theater in der Wiener Währinger Straße knackig in einer Stunde „Die Abenteuer des braven Soldaten Švejk“.
Was Jaroslav Hašek, im ersten Weltkrieg selbst Soldat der Habsburger-Armee bis er desertierte und zu den Russen überlief, Anfang der 20er Jahre in einem vierteiligen, unvollendeten Roman auf mehr als 650 Seiten satirisch über Militär geschrieben hat, wurde von Martina Gredler (Textfassung und Regie) verdichtet und nochmals überhöht.
Die Hauptfigur, der nunmehrige Ex-Soldat Švejk (Schwejk), verdiente sich seinen kärglichen Lebensunterhalt in den anschließenden Friedenszeiten mit dem Handel von Hunden. Hier kriegt er selbst glich ein Hundegesicht. Und das auf eine Art Totenkopfmaske (Puppenbau & Ausstattung: Annemarie Arzberger). Sozusagen ein Zombie – als mehr als deutlich sichtbares Zeichen dafür, was Krieg aus Menschen macht. Die psychische Deformation sozusagen ins Gesicht geschrieben.
Mehr noch als mit Hunden zu handeln, säuft der Figurentheater-Švejk wie das sprichwörtliche Loch. Sein „hündischer“ Begleiter entpuppt sich als überdimensionaler Hundefloh. Als dritte Figur lassen die beiden Spieler:innen Andrea Köhler und Markus-Peter Gössler noch eine Raupe aus einem anderen Repertoire-Stück des Figurentheaters für Erwachsene ins Geschehen tanzen.
Die satirische Kritik Hašeks an Krieg und Militarismus wird hier noch eine Runde weiter ins Absurde gedreht, mit versuchten kafkaesken Anwandlungen, manches Mal vielleicht ein wenig zu fest gedreht, wie eine Schraube, die zu stark angezogen wird.
Andererseits – wenige Gehminuten vom Schubert Theater entfernt liegt die US-Botschaft. Wie Möchtegern-König Donald die Kriegsmaschinerie gegen Venezuela fest und immer stärker bis zum Zerreißen fest zurrte bis zum nächtlichen Bombardement der Hauptstadt Caracas am ersten Wochenende des neuen Jahres, da scheint keine noch so absurde Satire heranzukommen…
Jaroslav Hašek, selbst Soldat im ersten Weltkrieg in der kaiserlich-königlichen Armee des Habsburgerreiches – zunächst in České Budějovice (Budweis), dann mit dem 91. Infanterie-Regiment ins niederösterreichische Bruck an der Leitha verlegt, desertierte und lief zu den Russen über. Nach der Oktoberrevolution wurde er Kommissar in der politischen Abteilung der 5. Armee der Roten Armee. Als er nach dem Krieg in die Heimat, dann schon Tschechoslowakei, begann er an dem Roman, erst in Wirtshäusern, zu schreiben, wo er viele der Texte anderen Gästen vorlas und auf ihr Urteil hörte.
So manche der Figuren, des letztlich unvollendeten Romans, haben reale Vorbilder vor allem aus der Zeit in Bruck an der Leitha, weiß Wikipedia zu berichten.
Dort wird auch vermutet, dass er sich den Namen seiner Hauptfigur bei einem Josef Švejk, „einem Reichsratsabgeordneten der tschechischen Bauernpartei (Agrarier)“ ausborgte, „der … in seinen seltenen Wortmeldungen meist Unsinn von sich“ gab. „Auf diesen Abgeordneten soll die damals populäre Redensart Pan Švejk – něco žvejk (etwa: »Herr Schwejk sprach eben – wieder mal daneben“) gemünzt gewesen sein.“
„Inhaltlich hat die literarische Figur Josef Schwejk aber nichts mit dem vermutlich namensgebenden Abgeordneten zu tun. Möglicherweise kam Hašek die Idee für den braven Soldaten Schwejk durch die Lektüre einer Geschichte, die 1905 in der auch in Prag erhältlichen und von Hašek viel gelesenen deutschen satirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus erschien und in tschechischer Übersetzung in der sozialdemokratischen Prager Tageszeitung Právo lidu nachgedruckt wurde.“ Link zum entsprechenden Wikipedia-Eintrag am Ende dieses Beitrages.

„Stop bombing Caracas!“ schallte es vielfach und sehr lautstark Samstagnachmittag (3. Jänner 2026) erst im Sigmund-Freud-Park, einem Teil der Grünfläche vor der Wiener Votivkirche. Anschließend hallten diese Sprech-Chöre durch die Währinger Straße auf dem Demonstrationszug bis zur Boltzmanngasse, wo die Botschaft der USA ihren Sitz in der Bundeshauptstadt hat. Obwohl seit gut eineinhalb Jahrzehnten ohnehin die halbe Gasse davor mit einer Art Käfig weiträumig abgesperrt ist, werden Demos noch etliche Dutzend Meter davon entfernt gestoppt. Umso lauter riefen die Demonstrant:innen diese Losung und dazu noch den All-Time-Hit aller weltpolitischen Aktionen „Hoch die internationale Solidarität!“ In der Nähe der US-Botschaft gesellte sich noch der Spruch „Hej, USA, how many kids did you kill today?!“ (Hej, USA, wie viele Kinder hast du heute schon getötet?!“)
Heftig Kritik gab es aber nicht nur am Angriff der USA, sondern auch an der autoritären Herrschaft Maduros, wenngleich manche ihn noch immer als „Sozialisten“ verklären möchten. Immer wieder wurde auch der Vergleich von Trumps Vorgehen mit dem Putin’schen Überfall auf die Ukraine gezogen.
Die Aktion fand wenige Stunden nach der Bombardierung der Hauptstadt Venezuelas durch Spezialeinheiten der US-Armee samt Kidnapping des autoritären Machthabers Nicolás Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores statt. Schon vor Tagen, als sich der US-Angriff als weitere Eskalation der Gewalt abzeichnete, hatte ein loser Zusammenhang linker Organisationen für Tag X Kundgebung und Demo angekündigt.
Seit Monaten und in den vergangenen Wochen verstärkt hatten die USA angebliche Drogenboote beschossen samt Mord der Besatzungen, Öltankschiffe überfallen und beschlagnahmt. Deshalb hatten Arbeiter*innenstandpunkt, Revolution, Linkswende, Abya Yala DeScolonial, Fem Bloco Descolonial, Migrantifa, Komintern und Young Struggle unter anderem auf Instagram auf Spanisch und Englisch gepostet: „Hände weg von Venezuela“-Marsch am X. Tag gegen die US-Militärintervention in Venezuela“. Das ursprünglich hier irrtümlich genannte Bündnis Anitiimperialistische Koordination (AIK), das eine eigenständige Organisation ist, war bei der Aktion mit dabei.
Als in der Nacht zum Samstag dann der völkerrechtswidrige Überfall stattgefunden hat, wurde dem Ort Sigmund-Freud-Park auch eine Uhrzeit hinzugefügt. Der Tag war ja nun klar.
Übrigens zufällig traf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon Stunden vorher in der U-Bahn einen nicht genannt werden wollenden Solo-Aktivisten, der zu Hause ein Plakat gestaltet hatte – siehe Foto -, von der Aktion gar nichts wusste, aber das Bedürfnis hatte, „was tun zu wollen und zur US-Botschaft zu fahren, ich hoffe, dass dort auch andere sein werden!“ Was dann auch so war – allerdings erst Stunden später.
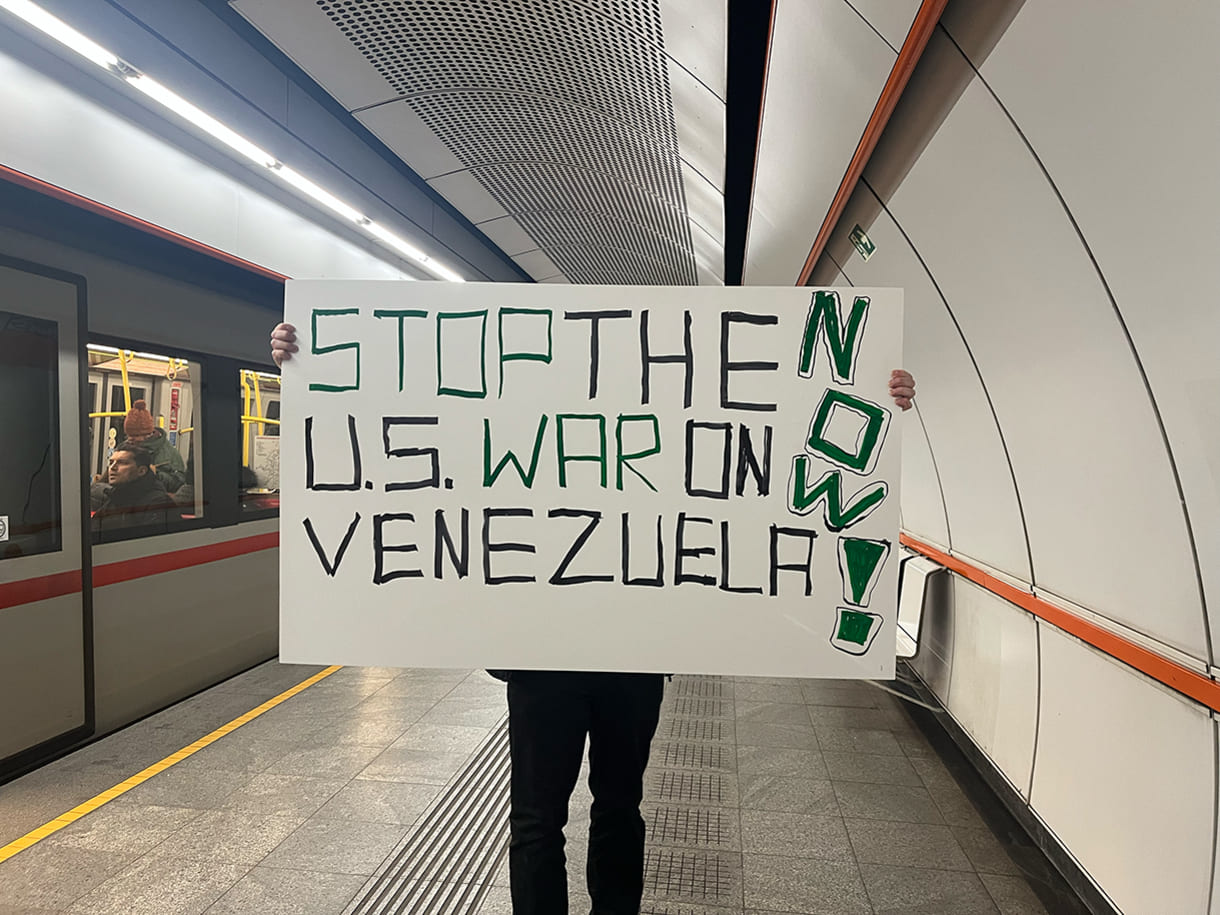
Dass es „nur“ linke Organisationen waren, hängt vielleicht auch mit den doch relativ verhaltenen Reaktionen auch vieler europäischer und österreichischer Politiker:inn zusammen, die es sich scheinbar nicht mit den USA verscherzen wollen, obwohl deren Präsident Donald Trump nicht nur diesen Überfall auf ein anderes Land anordnete, sondern erst kürzlich gegen Europa und vor allem die EU wetterte.
Mehr zu den aktuellen Ereignissen im – unten verlinkten – Beitrag auf orf.at, wenngleich in der Sondersendung nur in Wien lebende Venezolaner:innen zu Wort kamen, die sich über die Gefangennahme Maduros freuen und Kundgebung und Demo ausgespart wurden.
orf.at –> USA-wollen-Venezuela-vorerst-selbst-fuehren
Interessanter Kommentar dazu übrigens von Peter Pilz auf zackzack.at
Wenn Satire die tragische Realität kaum noch toppen kann <— Tagespresse zu Trump und Venezuela
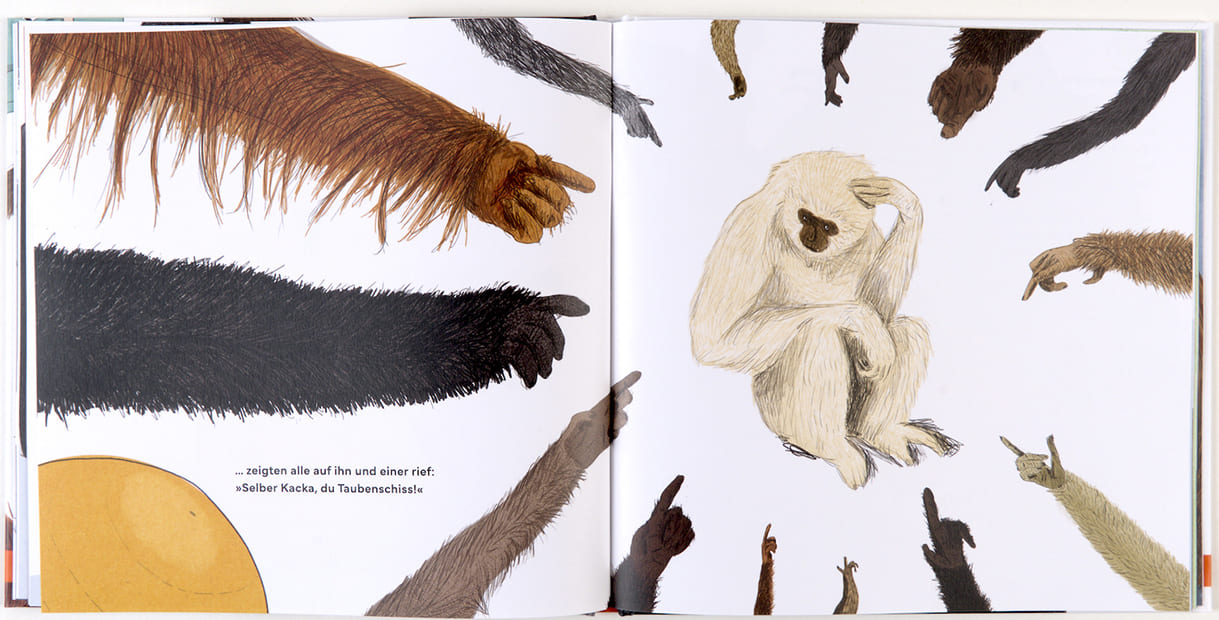
„Affe gesucht“, steht auf einem handgeschriebenen an die Wand geklebten Zettel, darunter zum Abreißen kleine Kontakt-Zettelchen, wie sie von vielen ähnlichen Such-Anzeigen auf Pinnwänden, schwarzen Brettern, Litfaßsäulen, Hausfluren… bekannt sind. Davor steht ein Affe und schaut möglicherweise interessiert, wir sehen auf der Vorsatzseite dieses Bilderbuchs nur seinen Rücken.
Der Sucher: Ein Maler namens Leander, erfahren wir auf der ersten Doppelseite. Er „wollte Affen malen. Da er Affen nur aus Büchern kannte, lud er Affen zu sich ein“, schreibt Autor Christian Duda, der eigentlich Christian Achmed Gad Elkarim heißt, wie auf der Verlagsseite zu finden ist. Ziemlich unschlüssig, irgendwie grübelnd sitzt er da – so zeichnete ihn Julia Friese auf dieser genannten Anfangs-Doppelseite.
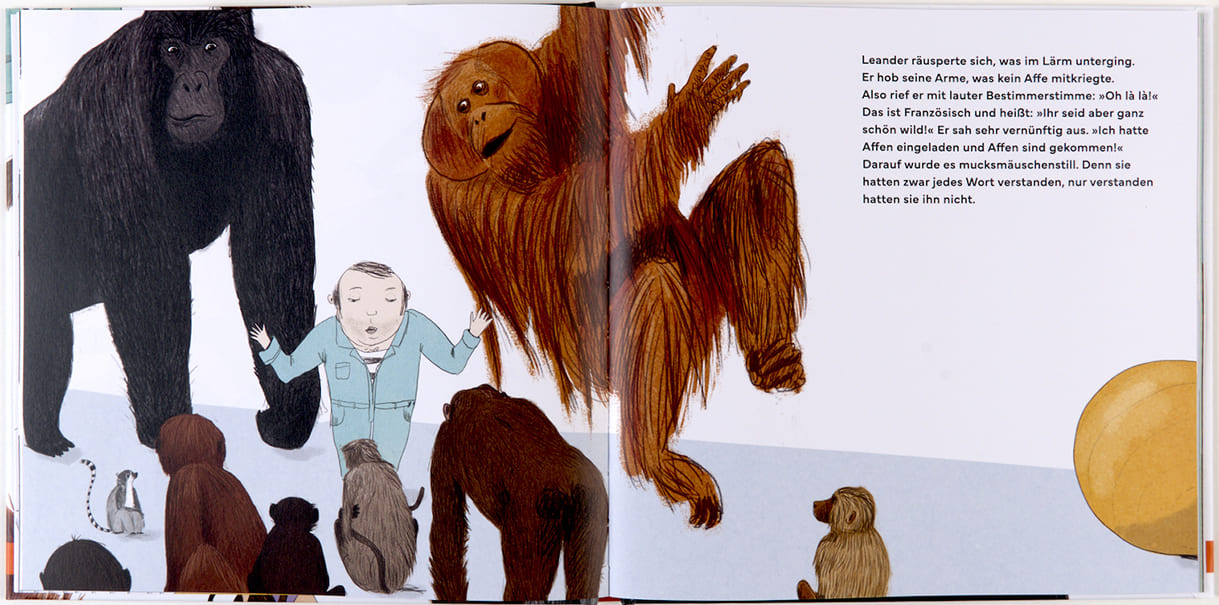
Und er hat – einmal umgeblättert, ziemlich großen Erfolg: eine ganze Reihe unterschiedlichster Affen fand sich bei Leander ein. Seine Freude teilten die Besucher:innen nicht. „Die Affen freuten sich nicht. Nanu, dachte ein jeder still für sich, hier ist nur ein einziger Affe. Und das bin ich…“
Denn was spielte sich ab. Jede und jeder sah nur die Unterschiede und meinte eben, alle anderen wären gar keine richtigen Affen. Nase zu lang, Schwanz zu kurz, falsche Haarfarbe. „Zu klein, zu dumm, zu anders!… Sie sieht das denn aus? …“
Seitenweise geht das so. Die einen beschimpfen die anderen, weil sie anders aussehen. Kommt dir das vielleicht bekannt vor – aus der Welt der Menschen? Hoffentlich musst du es nicht allzu oft miterleben.
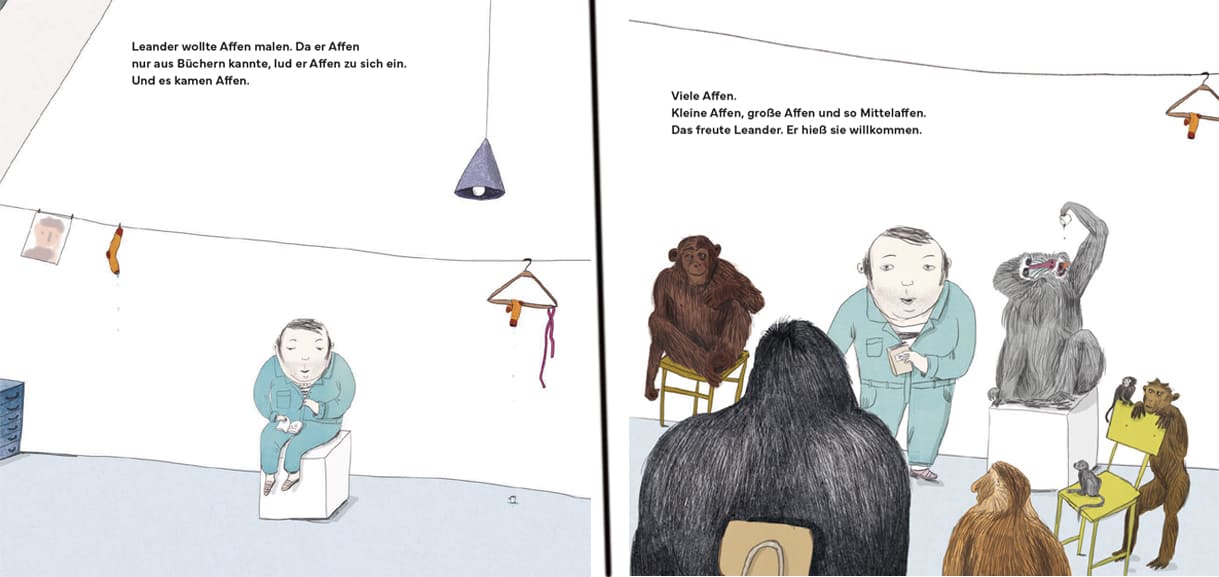
Leander kommt nicht und nicht zu dem, was er wollte: Affen zu malen. „Es ist auch ganz unwichtig, ob ihr euch ähnlich seht… innen drin seid ihr nämlich alle gleich!“, lässt der Autor den Maler belehren. Und dann fällt Christian Duda eine wunderbare Formulierung ein: „Darauf folgte ein stilles Durcheinander. Ein stilles Durcheinander ist eigentlich auch laut, man hört es nur nicht.“
Ähnlich spielt er später als das Mädchen Luzi auftaucht und unter anderem erklärt: „Wir alle sind Affen und Affen sind Tiere…“
„Eisige Stille war im Zimmer. Eisige Stille ist, wenn man friert, obwohl es nicht kalt ist.“
Und schon hat Luzi damit den Maler Leander in eine ähnliche Lage versetzt wie er zuvor die Affen: Wer will kein Tier sein. „Er verlor die Fassung, die Schuhe, die Klamotten und jetzt war allen klar: Auch Leander hatte einen Kopf, zwei Beine, zwei Arme, zehn Finger…“
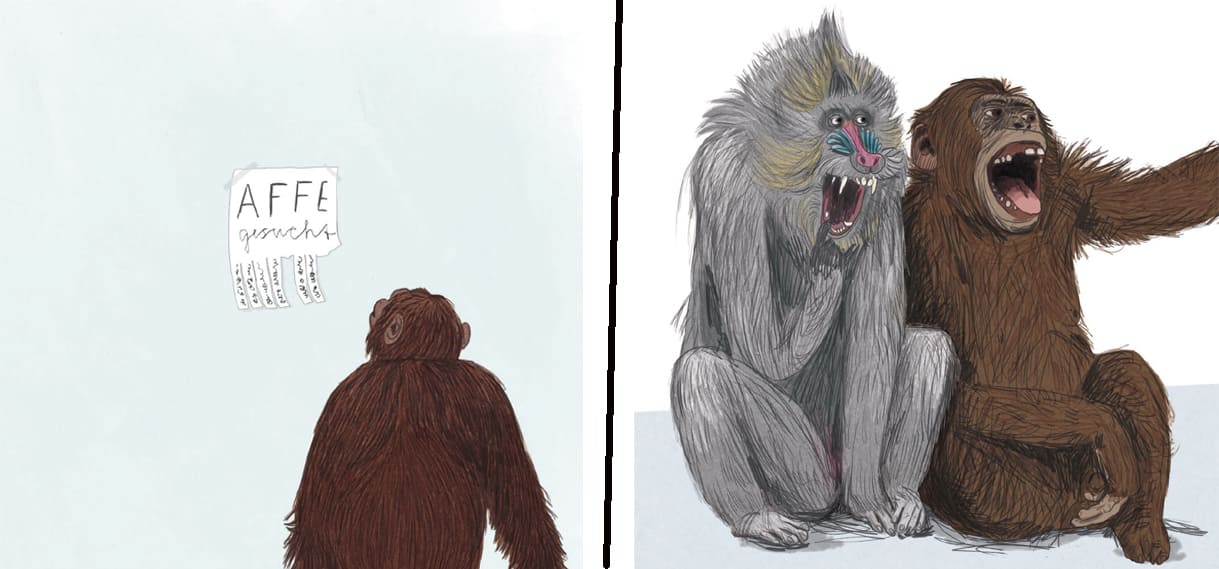
Gerade die Doppelseite zu dieser Szene verdeutlichen die Bilder noch viel stärker als schon diese Worte die vielen Gemeinsamkeiten Leanders und seiner Mal-Objekte.
Ein wunderbares Plädoyer, eben Gemeinsamkeiten statt Unterschiede in den Vordergrund zu rücken, um weniger Eiseskälte selbst bei warmen Temperaturen zu verspüren und verbreiten!
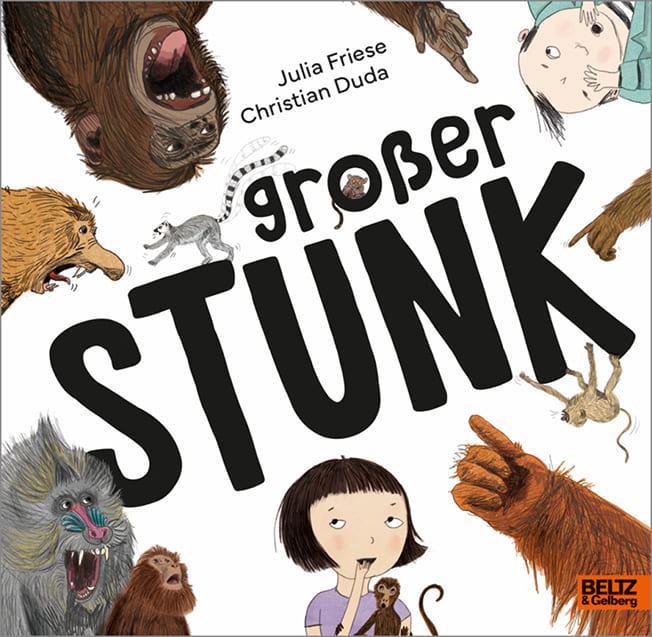
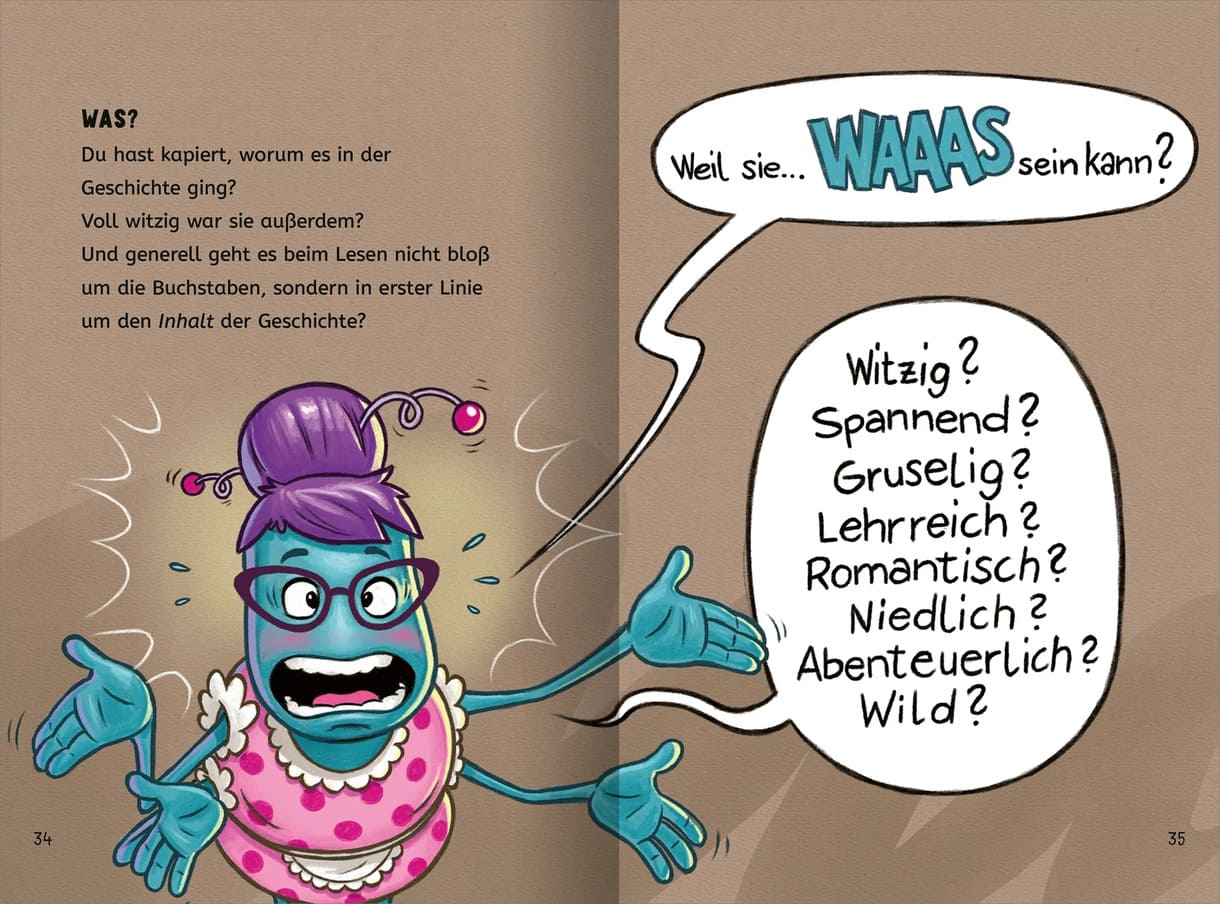
„Lesen nervt!“ Was für ein genialer Titel für ein Buch. Noch dazu mit einer gezeichneten vielbeinigen Figur, der die Sprechblase „Bücher? Nein, danke!“ aus dem Mund kommt und die auf einem Berg von Büchern thront vor einer Wand voller Bücher.
Wer gern liest, schmunzelt sicher schon und freut sich über den schrägen Zugang so als würde über einem Geschäft mit Süßwaren stehen: Nur für all jene, die Schokolade hassen… 😉
Und wer wirklich nicht und nicht und nicht lesen mag oder das sogar echt hasst, wird vielleicht doch neugierig sein. Ist es ein Buch ganz ohne Text, nur mit Bildern? Gibt es ja auch. Und kann auch Lesefreund:innen erfreuen, sich die gezeichnete oder gemalte Geschichte dazu selber zu denken.
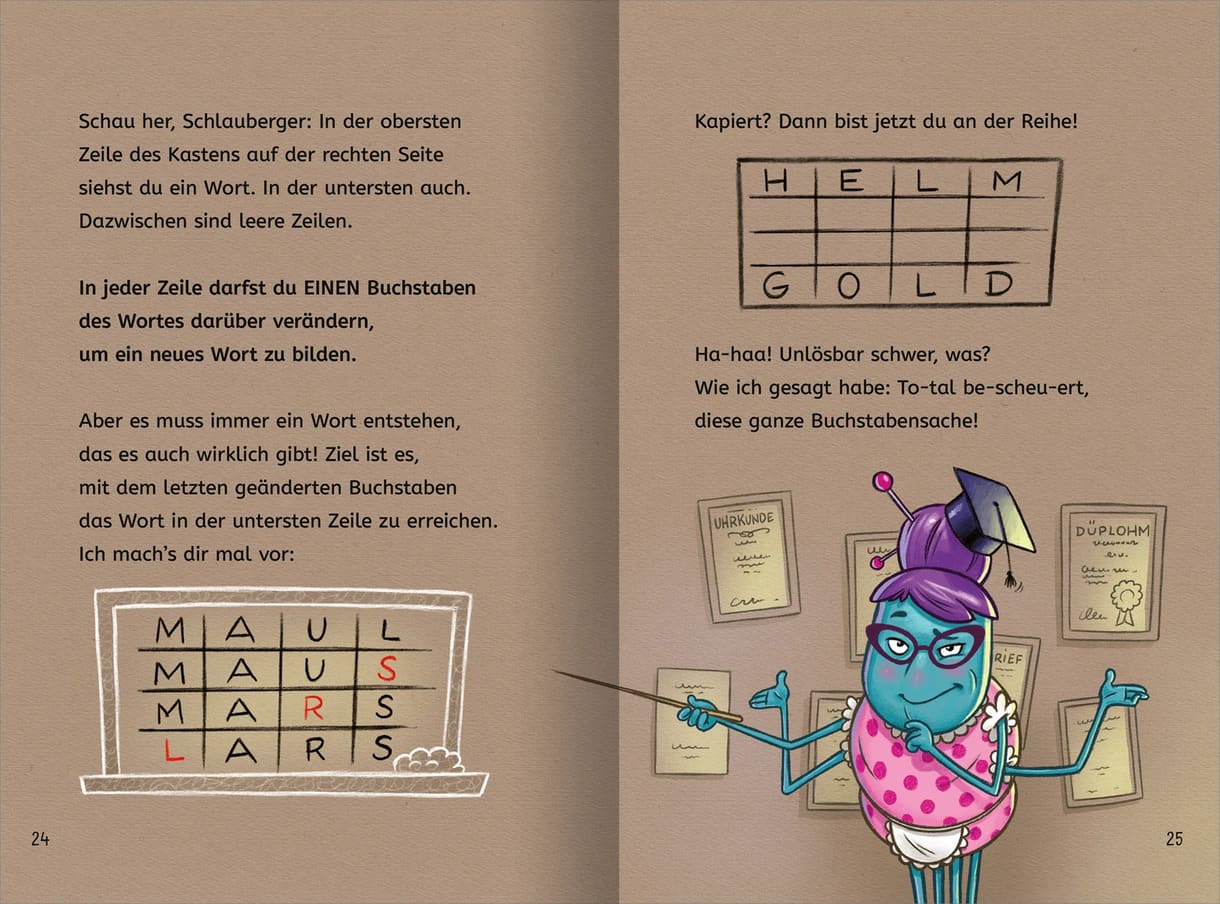
Aber nein, dieses Buch hat ganz schön Text, beginnt zunächst mit dem Spiel der gezeichneten Hauptfigur, einer Spinne namens Karoline Kneberwecht, mit dir und natürlich allen anderen Leser:innen: „Stopp“ samt gleich zwei Ausrufzeichen. „Aufhören“ und nochmals zwei von der Sorte, die den Ruf ausdrücken. „Schließ dieses Buch wieder und stell es zurück ins Regal! Sofort!!“
Du befindest dich, so ergeben die nächsten Seiten in einer Bibliothek – alle Seiten irgendwie im Karton-Design. Es gebe gar keine spannenden Büche, so die Spinne meist mit vor Ärger grünem Gesicht. Weil du sie in ihrer Ruhe, in ihren Netzen störst, pardon „nääärvst“.
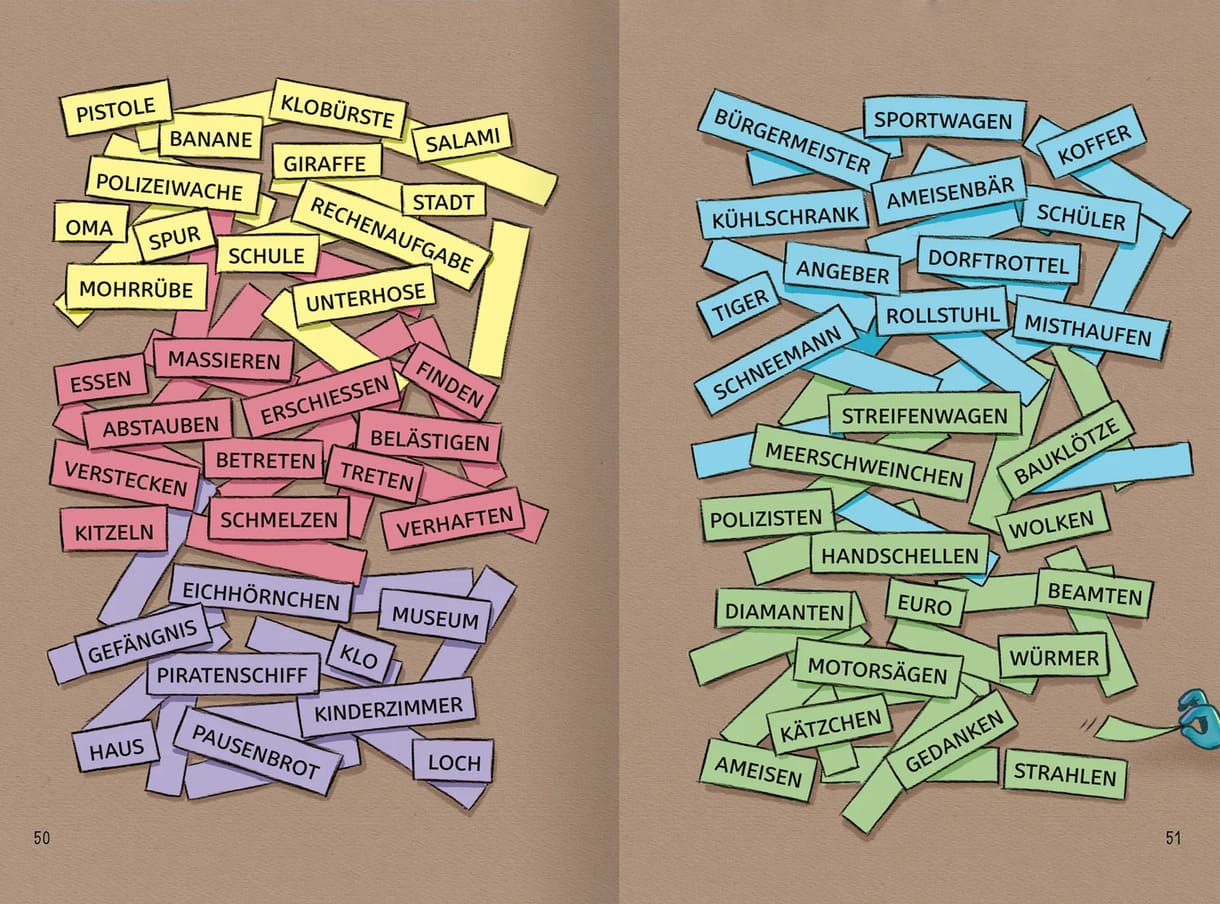
Und schon lädt sie dich zu Wortspielen und Rätseln ein, mit denen sie dir zeigen will, dass Buchstaben so ihre Tücken haben. Und im Nu schafft sie natürlich das Gegenteil des Buchtitels bzw. dessen, was sie von Anfang an vorgibt, dir zu verklickern. Schon liest du sogar Texte mit ausgelassenen Buchstaben über einen kleinen H_elden namens Knurpsi und seinen H_mster… und das sogar seitenweise 😉
Und das ist nicht das einzige der Rätsel und Lesespiele.
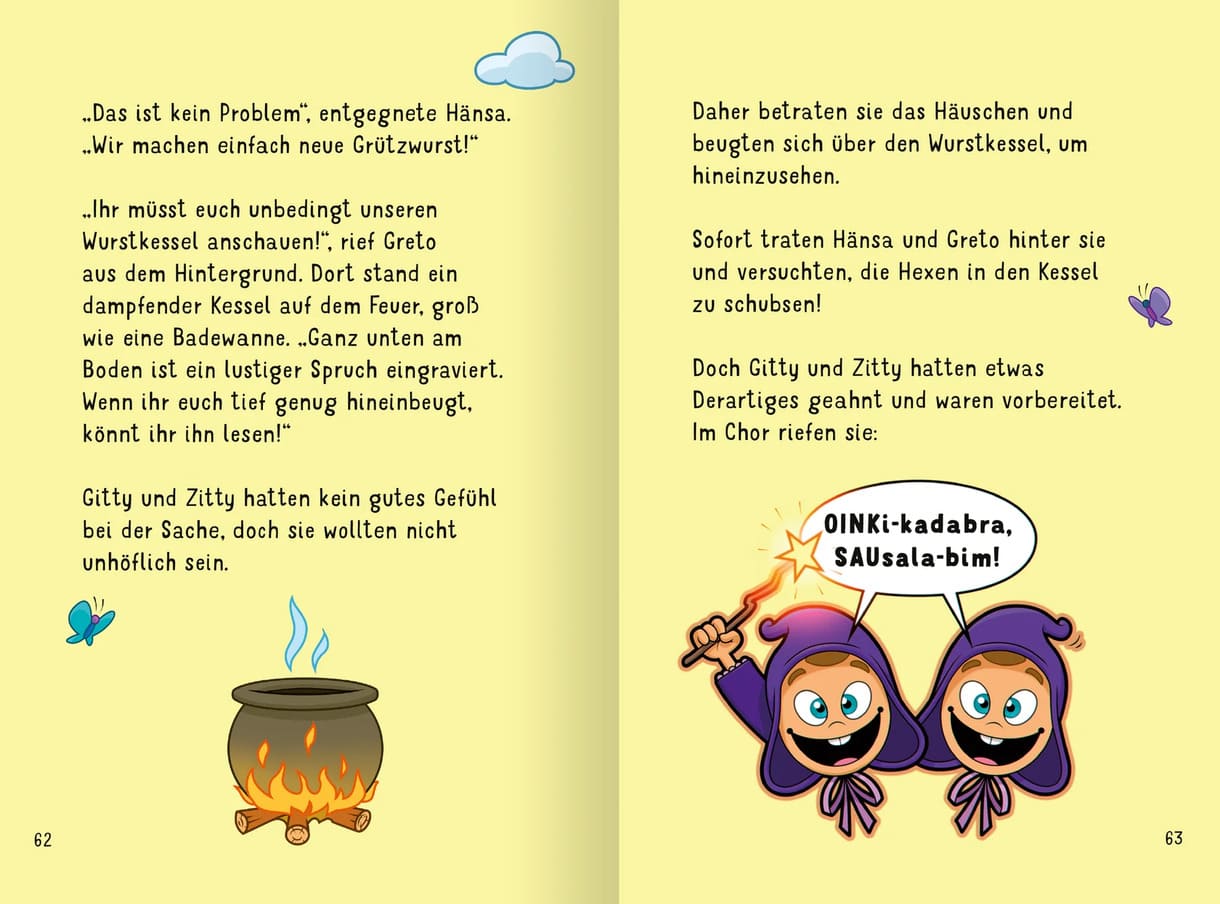
Das war schon vom Start weg so erfolgreich, dass das Autoren-Illustratoren-Duo des erst vor nicht einmal zwei Jahren erschienen ersten Bandes mittlerweile drei weitere „Lesen nervt!“-Bücher – Untertitel „Bloß keine Bücher!“, „Bücher? Voll anstrengend!“ sowie „Bücher? Weg damit“ produzieren mussten / durften.
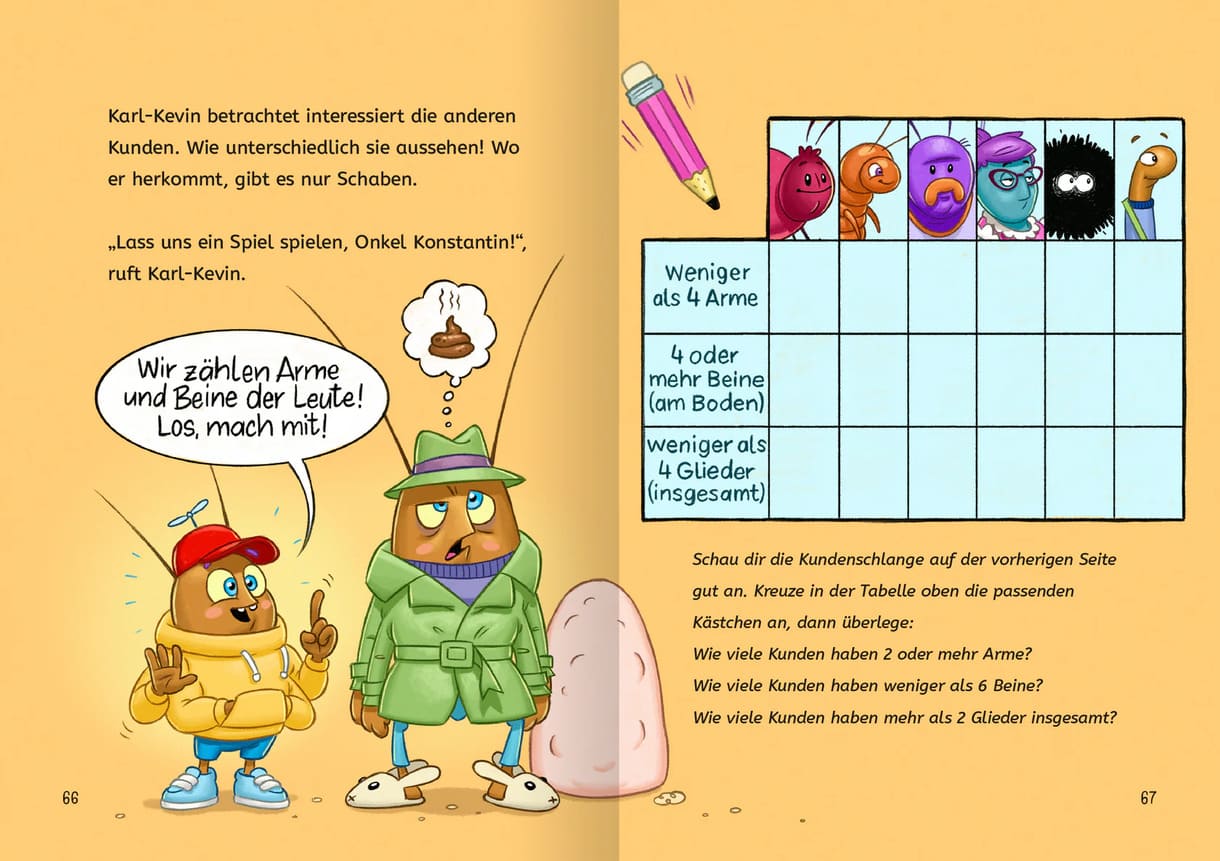
Und nach dem selben Muster folgt im Februar des neuen Jahres (2026) noch eines für Mathe: „Rechnen nervt! – Mathe? Ohne mich!“, dem auf der Verlagsseite schon Band 1 hinzugefügt wurde, also weitere Bücher in Aussicht gestellt werden. Hier tritt an die Stelle der erzählenden Lese-„Hasserin“ Karoline Kneberwecht eine Schabe (Kakerlake oder Küchenkäfer) namens Konstantin Kukerluk. Dieser wohnt in einer Schublade bei der Kassa eines kleinen „Alles Marktes“ der beiden Schwestern Emma und Edna Göpgörk. Und natürlich wirst du da auf ähnliche Weise ins spielerische Rechnen reingezogen wie von der Spinne in die Welt der Buchstaben, Wörter und Sätze.

Noch nicht so traditionsreich wie das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, aber auch nicht zum ersten Mal, strahlt Radio Arbos – Gesellschaft für Musik und Theater – am 1. Jänner 2026 das Musiktheaterstück „Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“ aus; und zwar in einer Inszenierung für Puppentheater, die vor einem Jahr im Salzburger Breloque Theater produziert worden ist – mehr dazu in einem Link zum vorjährigen Beitrag auf dieser Seite, unten am Ende des Beitrages.
Anlass ist die Wiederkehr des Geburtstages des Komponisten dieser im Konzentrationsalge Theresienstadt geschriebenen Antikriegsoper, Viktor Ullmann (1.1.1898 in Teschen).
Rund vier Wochen später, am 27. Jänner, dem 81. Jahrestag der Befreiung des Nazi-Massenvernichtungslagers Auschwitz, in dem auch Ullmann ermordet wurde (18.Oktober 1944) strahlt Arbos auf seiner Website dann einen Live-Mitschnitt jener Fassung der genannten Antikriegsoper aus, die am 23. Mai 1995 im tschechischen Terezín (Theresienstadt) 50 Jahre nach Faschismus und Krieg erstaufgeführt wurde – in der rekonstruierten Originalfassung Ullmanns von Karel Berman, Paul Kling und Herbert Thomas Mandl. Alle drei waren am Prozess der Fertigstellung von Ullmanns Anti-Kriegsoper im Rahmen der „Freizeitgestaltung“ im Konzentrationslager Theresienstadt beteiligt. Im KZ Theresienstadt wurde Ullmanns Antikriegsoper ja „nur“ geprobt, nie gespielt.
Karel Berman probte die Partie des Todes in Theresienstadt. Bermans Rollenbuch des Todes von Ullmanns „Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“ war die wichtigste Quelle zur Rekonstruktion der Originalfassung, neben den Berichten des Konzertmeisters der Theresienstädter Proben, dem Geiger Paul Kling, und den Berichten von Herbert Thomas Mandl, der bei allen in Theresienstadt statt gefundenen Proben anwesend war. Musik und Libretto zur Anti-Kriegsoper stammen von Viktor Ullmann, die auf den eigenen Kriegserfahrungen im Ersten Weltkrieg basiert.
Die Tschechische Erstaufführung fand am 24. September 1993 im Národní památník na Vítkově im Prager Bezirk Žižkov – gegenüber der Prager Burg und Symbol für den Kampf um Freiheit der Tschechoslowakei – statt durch „ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater“ und war die Opernaufführung des Jahres 1993 in der Tschechischen Republik.

„Während auf anderen Kontinenten Menschen verhungern, verbrennen in Österreich Menschen buchstäblich ihr Geld, indem sie zu Silvester Raketen in den Himmel schießen. Gerade in Zeiten, in denen Länder ihre Mittel für Entwicklungszusammenarbeit massiv kürzen, wäre es eine solidarische Alternative, das eingesparte Geld zu spenden“, appelliert Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, kurz vor dem Jahreswechsel 2025/26.
„Es gibt so viele Projekte, die dank einer Spende Kindern eine täglich warme Mahlzeit bereitstellen, Kinder von Kinderarbeit befreien, Schulbildung fördern – einfach Leben verändern und eine bessere Zukunft ermöglichen. Bitte denken Sie daran und zünden Sie zu Silvester kein Strohfeuer, sondern ermöglichen Sie ein Leben in Würde für Menschen in Risikosituationen!“

In der aktuellen Information dieser Organisation werden auch zwei konkrete Projekte – in Äthiopien und Ghana genannt, die von Jugend Eine Welt unterstützt werden und vorgeschlagen, statt Geld zu verbrennen es dafür zu spenden. So könnten mit den geschätzt zehn Millionen, die in Österreich zum Jahreswechsel ver-böllert werden in Kulmasa (Nord-Ghana) ein ganzes Jahr lang 62.500 Schulkinder täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden.

Feuerwerke und andere Knallkörper stellen außerdem eine Belastung für die Umwelt dar UND versetzen durch die Knallerei und die Lichter am Himmel auch viele Tiere in Panik. Darauf weist die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ in einer aktuellen Meldung hin. „Jedes Jahr aufs Neue leiden sowohl unsere Haustiere als auch Wildtiere wie zum Beispiel Igel, Wildvögel und Rehe enorm. Auch sogenannte Nutztiere wie Pferde oder Kühe erleben diese Nacht als Horror. In extremen Fällen kann Feuerwerk sogar zum Tod der Tiere führen.“
Übrigens hat „Vier Pfoten“, aber auch der WWF, eine eigene Petition gegen Böllerei gestartet – beide am Ende des Beitrages verlinkt.

Auch wenn diesen Argumenten so etwas wie der „Geschmack“ von „Spaßbremsen“ anhaftet, so weist die Plattform jugendarbeit.at genau unter dem Titel „Böller & Raketen – Spaß oder Gefahr?“ darauf hin, dass zu jedem Jahreswechsel vor allem viele Jugendliche bzw. junge Erwachsene Verletzungen erleiden. Samt Hinweisen auf die gesetzlichen Bestimmungen und einem Quiz zum entsprechenden Wissensstand.
feuerwerk-kinderarbeit-fuer-bunte-sterne <— damals noch im Kinder-KURIER, Vorläufer von KiJuKU
jugendeinewelt –> verbrennen-sie-nicht-ihr-geld-mit-silvester-raketen
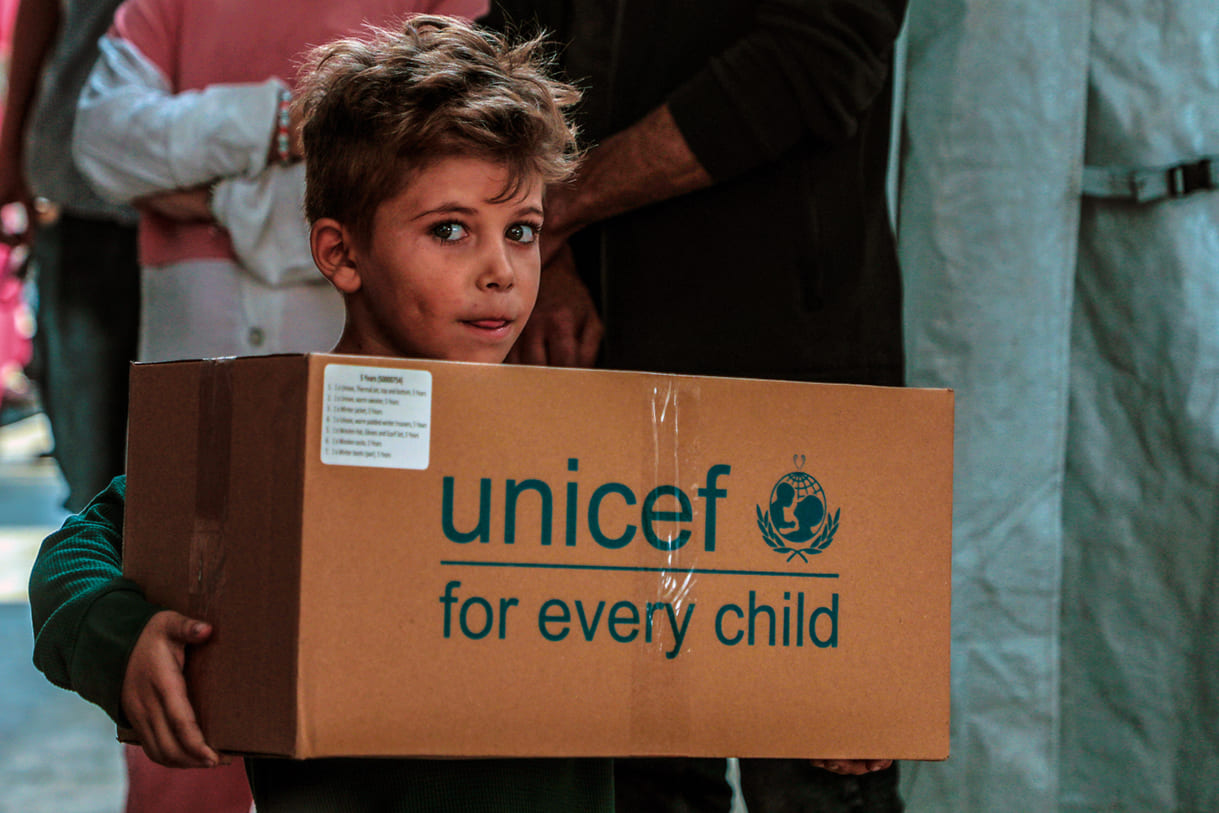
Hungersnot in Gaza, Gräueltaten im Sudan, der vierte Kriegswinter in der Ukraine, schwere Naturkatastrophen wie das Erdbeben in Myanmar und Afghanistan, dazu weltweite Kürzungen der Auslandshilfen. So fasst Unicef-Österreich in einem Blog auf seiner Website in einem der letzten Beiträge des Jahres 2025 zusammen.
Nicht ohne den Unicef-typischen Schlenker in Richtung doch-noch-Optimismus. „Es gibt auch Hoffnung! Mit der Waffenruhe zwischen Israel und Gaza konnten wir mit Ende dieses Jahres unsere Hilfe im Gazastreifen ausweiten. In Österreich engagiert sich außerdem ein neu gegründeter Jugendbeirat für die Rechte der Kinder. Und Sie an unserer Seite – als UNICEF Unterstützer und Spender – sind ein Grund zur Hoffnung. Es zeigt: Vielen Menschen ist es nicht egal, wie es den Kindern rund um die Welt geht. Diese Solidarität stimmt uns hoffnungsvoll, dass wir gemeinsam etwas bewirken können!“
Dennoch die nackten, tragischen Fakten: Die Zahl hungernder Menschen hat in den vergangenen fünf Jahren um 122 Millionen zugenommen. Hungerkrisen verschärfen sich rund um die Welt. Die Ursachen sind komplex: Von diversen Krisen bis zu Wetterextremen als Folge der Klimakrise. Weltweit sind rund 43 Millionen Kinder unter fünf Jahren akut mangelernährt und 150 Millionen chronisch mangelernährt.
Im Jahr 2025 wuchsen so viele Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten auf wie nie zuvor. Fast jedes fünfte Kind, und damit fast doppelt so viele wie Mitte der 90er Jahre, war betroffen.
Kürzungen der Hilfsgelder durch Geberländer gefährden Fortschritte für Kinder und Familien in Not. 14 Millionen mangelernährte Kinder weltweit können deswegen nicht mehr behandelt werden.
Außerdem sei die Zahl schwerer Kinderrechtsverletzungen stark gestiegen, was konkret bedeutet, dass Zehntausende Kinder, „getötet, verstümmelt, von bewaffneten Gruppen rekrutiert oder eingesetzt, entführt oder Opfer sexualisierter Gewalt wurden, denen Bildung, Schutz, medizinische Versorgung oder humanitäre Hilfe fehlen“, wird Unicef in einer ORF.at-Meldung zusätzlich zitiert.

Zwölf junge Menschen aus sieben Bundesländern setzen sich seit Februar für die Kinderrechte in Österreich ein. Der neue Jugendbeirat ist nicht nur eine starke Stimme für Kinderrechte. Er plant darüber hinaus aktiv Veranstaltungen, um Kinderrechte in Österreich zu stärken.
Unicef-Blog-Beitrag: 2025 in Bildern

Ein Kind reitet auf einem Bären mitten durch einen Wald im Schneetreiben. Grell rot golden leuchtet die Schrift „Es war einmal ein Schneetreiben“, so der Titel dieses abenteuerlichen, textlosen Bilderbuchs von Richard Johnson.
Alles beginnt zunächst im fast eingeschneiten Haus des Kindes und seines Vaters. Letzterer liest gedruckte Zeitung, ersteres liegt gemütlich auf dem Boden und zeichnet. Dann ziehen sie sich ziemlich warm an und stapfen durch das Schneegestöber.
Doppelseitige und mitunter einzelne sozusagen herangezoomte gemalte Bilder wechseln einander ab. Unter anderem riesig das Gesicht des Kindes, das glückselig von tanzenden, dicken Schneeflocken umgeben ist. Oder in einem der kleinen Bilder groß die Hand des Kindes sowie die des Vaters, die nacheinander zu greifen suchen, aber sich verlieren.

So wie die beiden. Und wir blieben – natürlich – beim Kind. Vom anfänglichen freudigen Tollen im Schnee bis zur Suche. Begleitet von einem Nachthimmel mit tierischen Sternbildern bis zu echten irdischen Tieren, die sich mit neugierigen Blicken um das suchende Kind scharen – und auf der folgenden Doppelseite Einzelporträts erhalten, ebenso wie die Hauptfigur, das Kind, das nun einigermaßen erschrocken dir entgegenblickt. Bis es – einmal umgeblättert – vom großen Bären eingeladen wird, gemeinsam mit ihm und den anderen Tieren zu spielen, essen und feiern.
Und als es dann doch so etwas wie offensichtlich Heimweh bekommt, vom Bären zum Aufsteigen eingeladen und auch das ist nicht überraschend, aber in wunderschönen Bildern festgehalten, nach Hause zum Vater gebracht wird…

Einige blau-weiß gemusterte große Fliesen an den vorwiegend grauen Wänden, gaaaanz weit oben eine überdimensionale Steckdose. Projiziert auf einen durchscheinenden Vorhang erscheinen riiiiesige menschliche Waden und Füße. Womit die Größenverhältnisse höchst wirksam abgesteckt werden, denn alles Folgende spielt sich im Reich von Mäusen ab. Ein weiteres beeindruckendes Beispiel aus diesem Bühnenbild (Ulv Jakobsen) bleibt allerdings gut einem Viertel des Publikums – auf der linken Seite der Sitzreihen mindestens bis zur Mitte derselben – leider verborgen: Ein Regal mit zwei Dosen – Bohnen und Mais sowie einem Glas eingelegter Weichseln; schaaaade. Die Mais-Dose kommt wenigstens später als Podest für die Titelfigur in „Der überaus starke Willibald“ im Renaissancetheater ins Spiel.
Sehr gut sichtbar für alle ab 6 Jahren wird dafür in dem Stück (Bühnenfassung und Regie: Sebastian von Lagiewski) nach dem gleichnamigen 120 Seiten starken, leicht lesbaren gleichnamigen Kinderroman von Willi Fährmann (Autor und Pädagoge; 1929 – 2017) ein Mechanismus, wie jemand Demokratie zerstört und sich zum Tyrannen macht.

Bisher haben die Mäuse liebend gern Fangen und anderes in der Küche gespielt und hatten ihren Spaß am Leben, wenn die Menschen schliefen. Und wenn es galt, eine Entscheidung zu fällen, haben „wir seit Mäusegedenken beraten, alle kommen zu Wort und am Ende stimmen wir ab“, bringt der gewählte Präsident Georg (Leon Lembert) das demokratische Prinzip auf den Punkt.
Das bleibt nicht so, ähnlich wie George Orwell (1903 – 1950) in der viel berühmteren „Farm der Tiere“ (Animal Farm; 1945 erschienen) schildern Buch (1983 veröffentlicht) und Stückfassung angesiedelt im Tierreich, wie Demokratie – und das leider ziemlich schnell – zerstört werden können. Die Titelfigur Willibald, der sich als „überaus stark“ aufspielt, und Josef, der schon zu Beginn die spielenden Mäuse wegen fehlender Disziplin und nur Spielen im Kopf anherrscht, basteln an der Legende einer gar wilden Katze im Garten.

Bei der großen Gefahr aber würde beraten und reden nicht funktionieren. Es brauche einen der da das Sagen hat. Die verbreitete Angst vor dem Außenfeind lässt viele der Mäuse einknicken. Die einen sind gleich für den Führer Willibald, andere wie Georg besänftigen, das wäre aber nur für diese Gefahrenzeit. Lediglich Lili (nachdenklich, hinterfragend, mutig Lara Haucke) widerspricht. Und wird – noch dazu als einzige weiße Maus mit roten Augen – zum inneren Feindbild auserwählt, gar verdächtigt, mit der Katze „unter einer Decke zu stecken“, und in die Bibliothek verbannt. Nur zum Hackeln darf, nein muss sie in die Küche kommen.

Willibald (herrlich unsympathisch herr-isch und noch dazu kunstvoll dümmlich Sebastian Pass) und vor allem aber sein Ideengeber Josef (gespielt unterwürfig gegenüber dem Boss, gnadenlos zu jeder Art von in-Frage stellen: Valentin Späth) schmieden Abwehrpläne, bei denen alle anpacken müssen. Außer die beiden selbst. Doch auch das traut sich nur Lilimaus anzumerken. Als Philipp (Sebastian von Malfèr) wagt, seiner Kollegin recht zu geben, wird er in die Schranken gewiesen.
Josef, den Autor Fährmann bewusst so genannt hat, erfindet auch zwei Propagandasprüche: „Ein Boss! Ein Haus! Ein Rudel!“ sowie „Flink wie Fledermäuse! Zäh wie Schweineschwarte! Hart wie Käserinde!“ (im Buch statt letzterem Tirolerbrot), die auch nicht zufällig an „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ bzw. „Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“ der Nazis und ihres Propagandaministers Josef Goebbels erinnern. Im Buch hat Willibald zudem noch neben Josef eine Hermannmaus in seinem Herrschaftsstab (Hermann Göring war Chef der Nazi-Luftwaffe und Reichswirtschaftsminister).

Disziplin, militärische Übungen, Verteidigungswall aus ausgestreuten Erbsen jede Nacht bauen und in der Früh, bevor die Menschen kommen, wieder einsammeln – nix ist mehr mit Spielen. Da werden auch die treu ergebenen Mäuse – neben den schon genannten noch Friederike (Shirina Granmayeh), einst enge Freundin von Lili und die stets hungrige Karin (Beate Korntner) ein wenig mürbe. Als Philipp dann noch nach langer Beobachtung aus dem Fenster im Garten gar keine Katze ausfindig macht, schleichen die Mäuse mitunter zu Lili in die Bibliothek, die dort in Bilder-Lexika blättert, lesen lernt und Geschichten erzählt. Geschichten, die Mut machen.

Zu viel sehen, zu viel denken – das finden die Machthaber gefährlich. Noch findet Karin es super, dass ihnen der Boss das Denken abnimmt. Lili wird als Gefahrenherd als „Nichtmaus“ tituliert. Sie beginnt an Flucht zu denken, es gibt doch auch andere graue Häuser und Mäusefamilien, noch dazu wo ihre einstigen Freund:innen zu „Duckmäusen“ geworden sind, „aber das alles zurücklassen…?“

Außerdem schöpft sie Kraft aus gelesenen Geschichten und will dem Tyrannen die Küche und das Haus nicht überlassen. Und so lassen Autor und Regisseur die Geschichte mit dazwischen noch einigen spannenden, gefährlichen Szenen natürlich happy enden, den Tyrannen und seinen Helfer / Einflüsterer / Propagandisten stürzen, wobei die sich selbst zu Fall bringen und zum Prinzip des gemeinsamen Beratens und Beschließens zurückkehren…

Im April kommt übrigens eine Dramatisierung des Romans von Timur Vermes „Er ist wieder da“ (Bühnenfassung und Regie: Thomas Birkmeir) ins Renaissancetheater (das große Haus des Theaters der Jugend in Wien). In diesem 2012 erschienen satirischen Buch, das bald danach verfilmt wurde, erwacht Adolf Hitler 2011 wieder, meint einen Filmriss zu haben, bis er auf das richtige Datum und nach und nach die weitere historische Entwicklung draufkommt. Wie Menschen auf ihn reagieren – von der Vermutung eines Schauspielers über Erschrecken bis zum Wittern eines möglichen Geschäftserfolges mit ihm spannt sich der Bogen, den Stefano Bernardin spielen wird.

Schon früher, 9. Jänner bis 19. Februar – zunächst im NordbahnSaal und dann bei Junge Theater Wien in Simmering und Liesing – spielt das Figuren- und Objekttheater „Die Kurbel“ ein selbst entwickeltes Stück namens „Der kleine Diktator“. In der Welt von Schachfiguren rebellieren diese gegen den Schachlehrer, der daraufhin „eine Anleitung zum Chef werden“ erteilt – inspiriert von Michela Murgias Buch „Faschist werden – eine Anleitung“ und mit Anspielungen an Charlie Chaplins „Der große Diktator“.

Natürlich kommt bei Willibald, dem „kleinen“ oder auch „großen Diktator“ und erst recht bei „er ist wieder da“ und vor allem der derzeitigen aktuellen politischen Entwicklung fast weltweit der furchtsame Gedanke auf: Lernt die Menschheit nie aus der Geschichte? Und das häufig wiedergegebene Zitat von Ingeborg Bachmann aus ihrem Roman „Malina“: „Die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler.“
Ein Gedanke, der schon mehrfach hier im Zusammenhang mit anderen Stückbesprechungen – „Astoria oder: Geh‘ ma halt ein bisserl unter“ und „Hand made Tyrant“ im Schubert Theater sowie „Das Lebewohl.Wolken.Heim Und dann nach Hause“ von Elfriede Jelinek im Theater Arche (beide Wien) – geschrieben schon Jahrzehnte früher von Antonio Gramsci (1921 in „Ordine Nuovo“) formuliert wurde: „Die Illusion ist das zäheste Unkraut des Kollektivbewusstseins; die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler.“
Der Autor des bereits vor mehr als 40 Jahren erschienen Buches „Der überaus starke Willibald“ hat übrigens einige historische Romane, manche ausgehend von echten leidvollen Erfahrungen von Flucht, Ausgrenzung, Vorurteilen verfasst; u.a. „Das Jahr der Wölfe“, „Kristina, vergiss nicht“, „Es geschah im Nachbarhaus“, „Zeit zu hassen, Zeit zu lieben“.

Australien hat es eingeführt. In der EU wird es diskutiert. In den letzten Tagen des Jahres 2025 meinten Vertreter von Regierungsparteien, wenn’s in der Europäischen Union zu langsam geht, könnte Österreich vorpreschen mit einer Social-Media-Beschränkung ab – das Alter blieb noch offen. Handyverbot in den ersten acht Schulstufen gilt schon seit einigen Monaten. Im Herbst startete eine Online-Petition unter dem Titel „Kinderrechte im digitalen Raum durchsetzen!“ in der ein generelles TikTok-Verbot in Österreich und idealerweise der EU, eine Altersbeschränkung für Social Media bis 16 Jahre verlangt wird. 876 von 1000 erforderlichen Unterschriften war der Stand am 27. Dezember Mittag.
„Diese Beschränkungen spiegeln eine echte Besorgnis wider: Kinder sind online Mobbing, Ausbeutung und schädlichen Inhalten ausgesetzt, mit negativen Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Der Status quo versagt gegenüber Kindern und überfordert Familien“, begrüßte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, erst kürzlich – zum Tag der Menschenrechte (10. Dezember) „das wachsende Engagement für die Online-Sicherheit von Kindern“, zeigt sich aber skeptisch in Sachen Verbote. Sie „könnten sich sogar als kontraproduktiv erweisen“, heißt es im Statement.

„Soziale Medien sind kein Luxus – für viele Kinder, insbesondere für jene, die isoliert oder marginalisiert sind, sind sie eine Lebensader, die Zugang zu Lernen, Verbindung, Spiel und Selbstdarstellung bietet. Darüber hinaus werden viele Kinder und Jugendliche weiterhin auf soziale Medien zugreifen, sei es durch Umgehungen, gemeinsame Geräte oder die Nutzung weniger regulierter Plattformen, was es letztendlich schwieriger macht, sie zu schützen“, wird argumentiert.
„Altersbeschränkungen müssen Teil eines umfassenderen Ansatzes sein, der Kinder vor Schaden schützt, ihre Rechte auf Privatsphäre und Beteiligung respektiert und sie nicht in unregulierte, weniger sichere Räume drängt. Regulierung sollte kein Ersatz dafür sein, dass Plattformen in die Kindersicherheit investieren. Gesetze, die Altersbeschränkungen einführen, sind keine Alternative dazu, dass Unternehmen das Plattformdesign und die Inhaltsmoderation verbessern.
Unicef fordert Regierungen, Regulierungsbehörden und Unternehmen auf, mit Kindern und Familien zusammenzuarbeiten, um digitale Umgebungen zu schaffen, die sicher, inklusiv sind und die Rechte von Kindern respektieren. Dies beinhaltet:
Unicef –> Onlinesicherheit für Kinder

Weihnachten wird oft mit Lichterglanz und Gemeinsamkeit in Verbindung gebracht. Der „leuchtendem Stern“, der den Weg zur Geburtskrippe gewiesen haben soll, steht für die vielfältigen drei „Weisen aus dem Morgenland“, zu deren Ehren der 3-Köngistag am 6. Jänner erfunden wurde. Steht aber auch für eine der größten Solidaritätsaktionen, die Sternsinger:innen.
Zehntausende Kinder ziehen Jahr für Jahr zwischen Weihnachten und dem besagten Feiertag durch Land und Städte, läuten oder klopfen an Türen und sammeln Spenden, in Österreich sind jährlich rund 85.000 Sternsinger:innen unterwegs. Im Schnitt werden rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika von der Dreikönigskation, dem Hilfswerk der Katholischen Jungschar, mit dem gesammelten Geld unterstütz. Wobei längst nicht nur katholische, auch nicht nur christliche Kinder bei den Aktionen der Sternsinger:innen mitmachen. Allen Hass fördernden Sprüchen zum Trotz beteiligen sich viele junge Menschen anderer nicht zuletzt muslimischer oder gar keiner Glaubensrichtung an dieser großen Solidaritätsaktion.
Auch wenn viele Projekte unterstützt werden, so holt die Dreikönigsaktion jedes Jahr einige Schwerpunktprojekte in den Vordergrund. Rund um den Wechsel von 2025 zu 2026 sind dies:

Viele Familien kämpfen täglich ums Überleben. Dürren, Armut und fehlende Bildungsmöglichkeiten treffen besonders die Kinder. Mit den Spenden wird nachhaltige Landwirtschaft unterstützt, damit Felder wieder genügend Nahrung liefern. Gefördert werden Gemüsegärten und gesunde Mahlzeiten für eine bessere Entwicklung der Kinder.

Supertaifun „Fung-Wong“, vor Ort „Uwan“ genannt traf Anfang November mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h auf die Küste von Luzon. Die dabei zerstörte Schule wurde bereits mit Dreikönigs-Aktion-Spendengelder wieder aufgebaut – ökologisch und stärker gesichert.
Aber viele Familien auf den Philippinen stehen buchstäblich vor Trümmern: Häuser, Felder und wichtige Infrastruktur sind zerstört. Um die größte Not zu lindern, erhalten die Familien einfache Haushaltswaren, Werkzeug und Fischernetze, damit sie ihre Häuser aufbauen, und die Fischerboote wieder instandsetzen können.

Bei der jüngsten Weltklimakonferenz im brasilianischen Belem war das Amazonasgebiet und sein Regenwald (Rand-)Thema. Ist aber entscheidend für die Menschen vor Ort UND das Weltklima.
Die Dreikönigsaktion unterstützt Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche und hilft den Regenwald zu bewahren. Denn, wenn der Regenwald verschwindet, verlieren Menschen ihre Heimat – und wir alle einen wichtigen Schutzschild gegen die globale Klimakrise.
Gemeinsam für eine gerechte(re) Welt, gemeinsam Gutes tun – sind Botschaften unter denen nun Zehntausende Kinder und Jugendliche als Sternsinger:innen Spenden schwerpunktmäßig für die genannten drei Projekte sammeln.

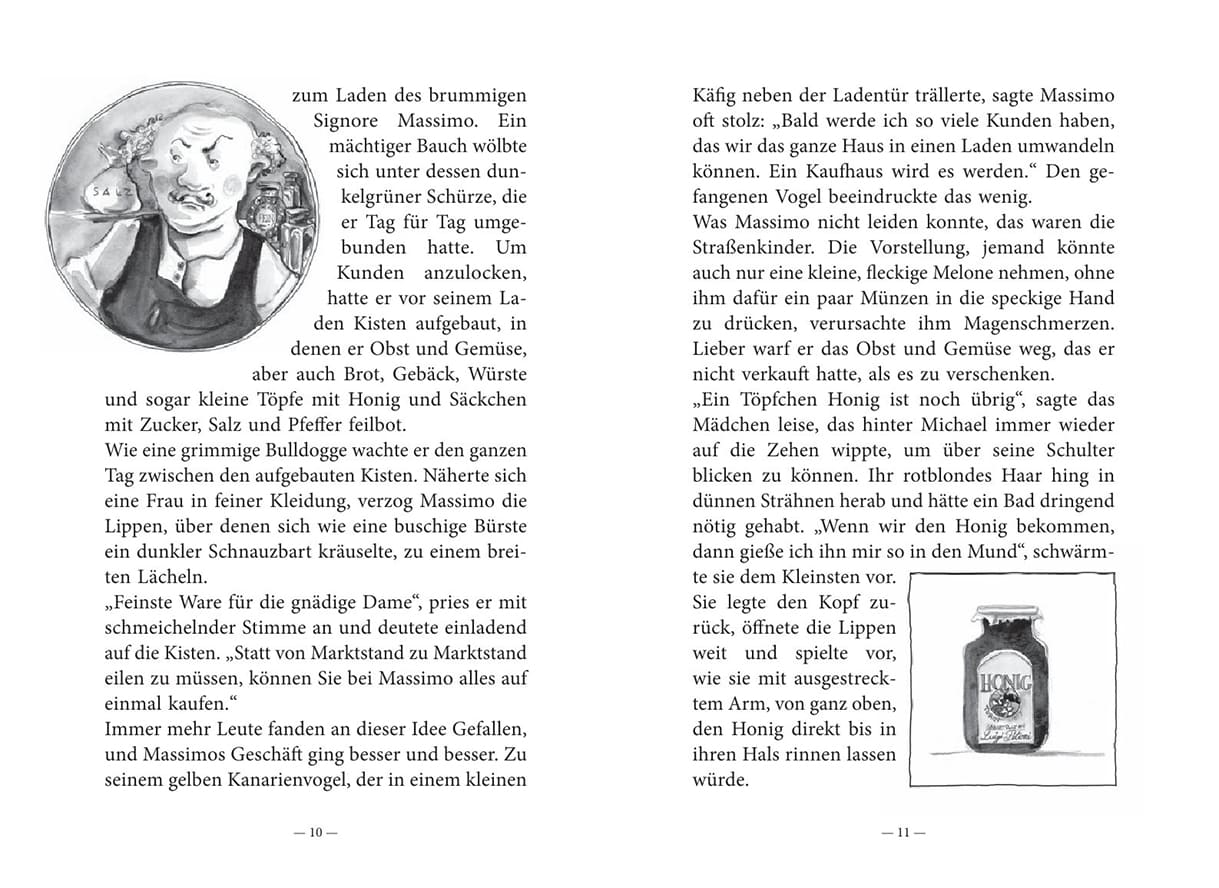
Ausgehend von der spannenden – echten – Geschichte des italienischen Straßenkindes Michele Magone (1845–1859) hat Thomas Brezina dessen Leben mit vielen erfundenen Ausschmückungen zu 200 leicht lesbaren Seiten verarbeitet. Zum ersten Mal von 20 Jahren erschienen, ist es nun 2025 knapp vor Jahresende in einer neuen Version „Michael Magone und er wirkliche Mut“ veröffentlicht worden.
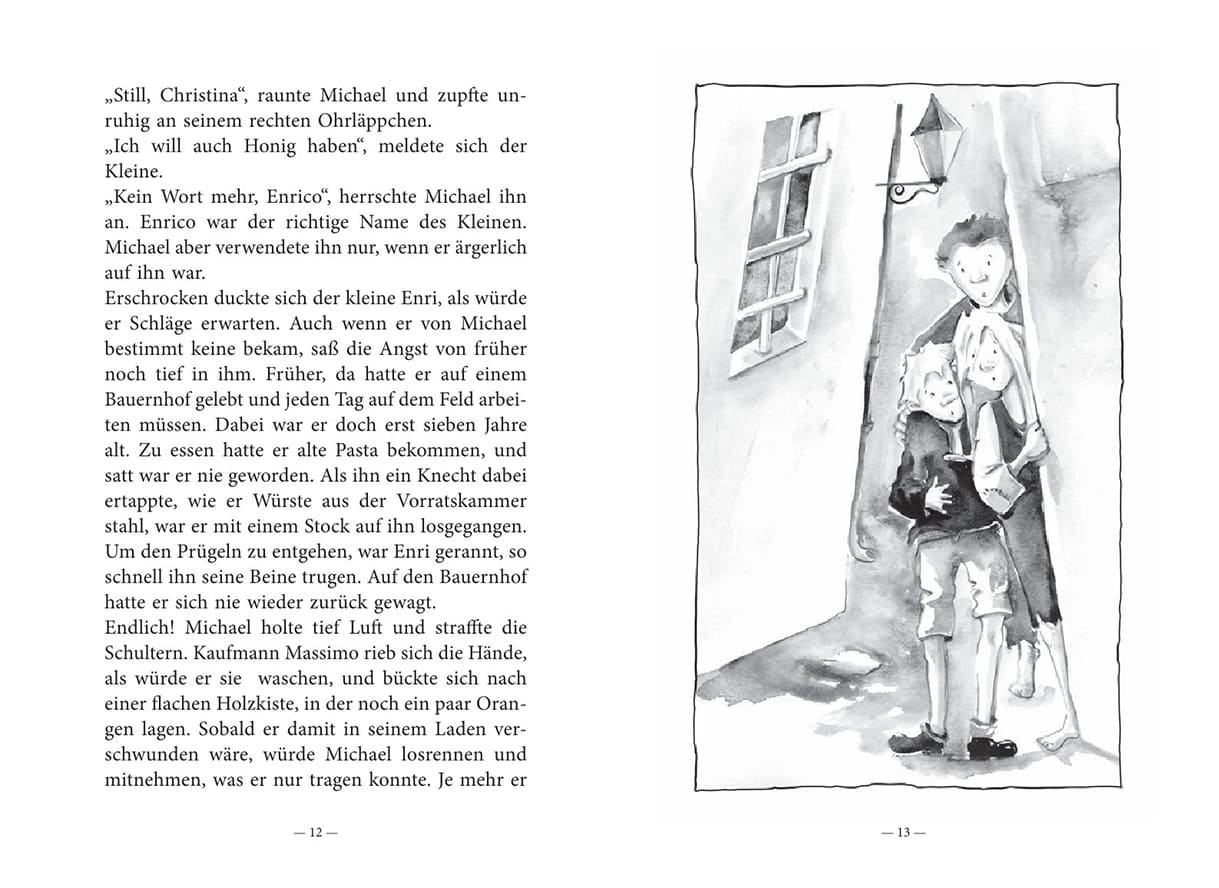
Der Großteil der Kapitel umfasst den abenteuerlichen Überlebenskampf Magones und einiger weniger ihm in seiner Bande verbliebener Straßenkinder. Viele seiner früheren Mitstreiter:innen haben sich zum Gegenspieler Alessandro vertschüsst. Bei einem großen Einbruch verletzt sich der jüngste aus Magones Gruppe sehr. Da sieht der Banden-Chef keinen anderen Ausweg als ihn zur Kirche zum aufgeschlossenen Priester Don Bosco (Giovanni Melchiorre Bosco 1815 – 1888) zu bringen. Die freundliche, offene Begegnung auf Augenhöhe lässt Magone aber dennoch recht misstrauisch bleiben. Schlechte Erfahrungen, vor allem im Kinderheim des Ehepaares Peporelli, haben sein Grundvertrauen mehr als erschüttert.
Dennoch scheinen die Angebote, Essen, lesen und anderes zu lernen und nicht zuletzt Fußball spielen zu dürfen verlockend. Aber echt? Und wie würden / werden andere reagieren? Showdown eines Kampfes der Banden-bosse Magone und Alessandro und … Steckt der wirkliche Mut im Kampf oder?…
Und was meint Don Bosco mit der Haselnuss, die er Michael für einige Tage borgt – in dir steckt so viel wie in dieser Nuss?…
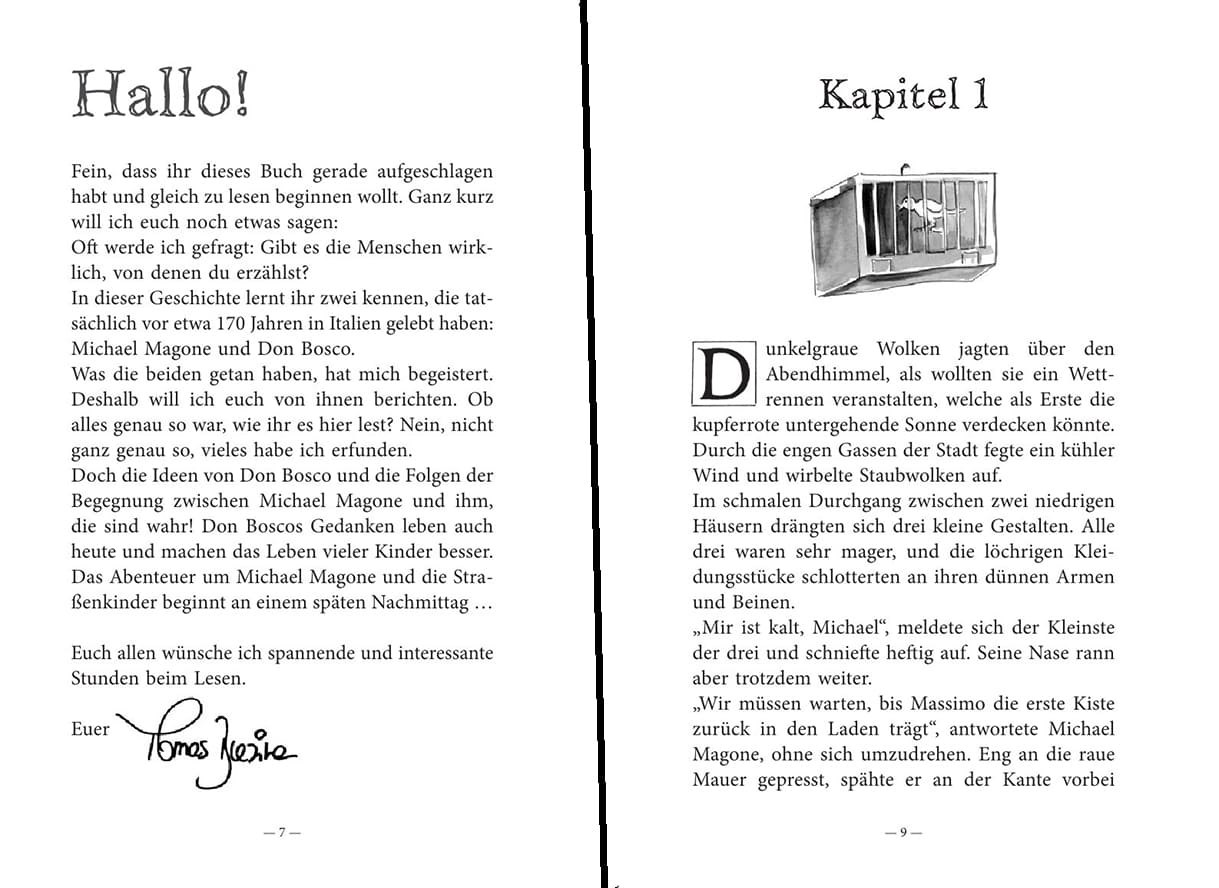
Brezinas Buch über den Wandel vom kriminellen Straßenkind zum lernbegierigen Schüler des reformpädagogischen Priesters Don Boscos – mit vielen Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Petra Lefin – hat natürlich ein Happy End.
Der echte Magone allerdings starb schon recht früh als Jugendlicher. Er war „einer von drei Schülern, die der Heilige Johannes Bosco für heilig hielt“; die anderen beiden: der Heilige Dominikus Savio und Franziskus Besucco. „Ein Gemälde der drei Schüler befindet sich in der Kirche San Francesco de Sales in Valdocco, Turin.“ (Wikipedia).
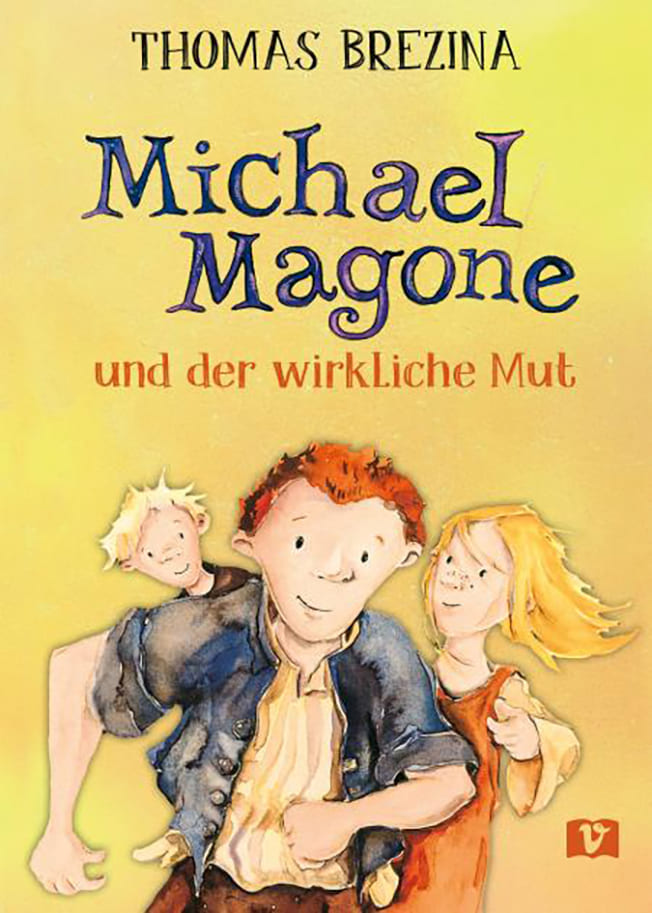
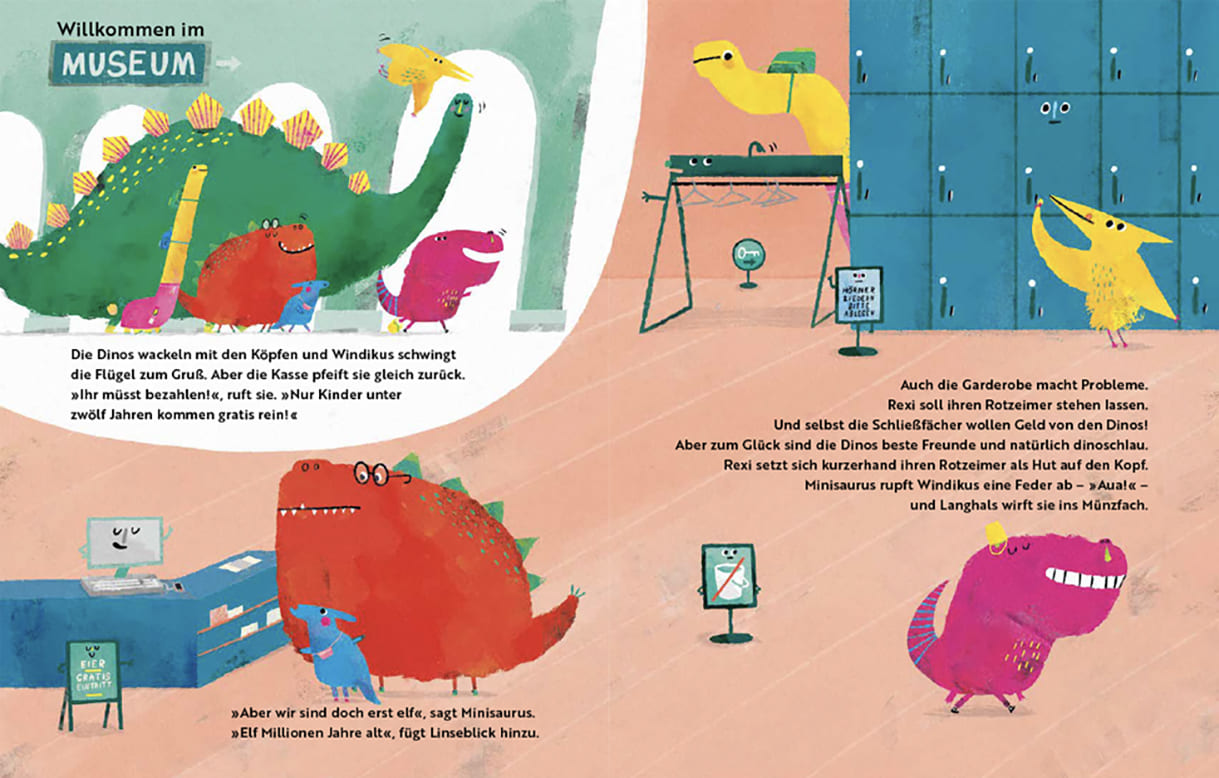
(Weihnachts-)Ferien ist auch eine Zeit, in der du möglicherweise mit Verwandten ein Museum besuchst. Solltest du Dino-Fan sein, ist das Naturhistorische Museum in Wien ein lohnenswertes Ziel – mit einem eigenen Sauriersaal, großen Skeletten von Diploducus, Allosaurus, Iguanodon und dem Flugsaurier Pteranodon samt so manche Computeranimation.
Und vielleicht magst du deiner Fantasie freien Lauf lassen und dir vorstellen, was wäre, wenn nun echte Dinosaurier auch das Museum besuchen würden, um ihre Verwandten, oder das was von ihnen übrig geblieben ist, besuchen wollen?
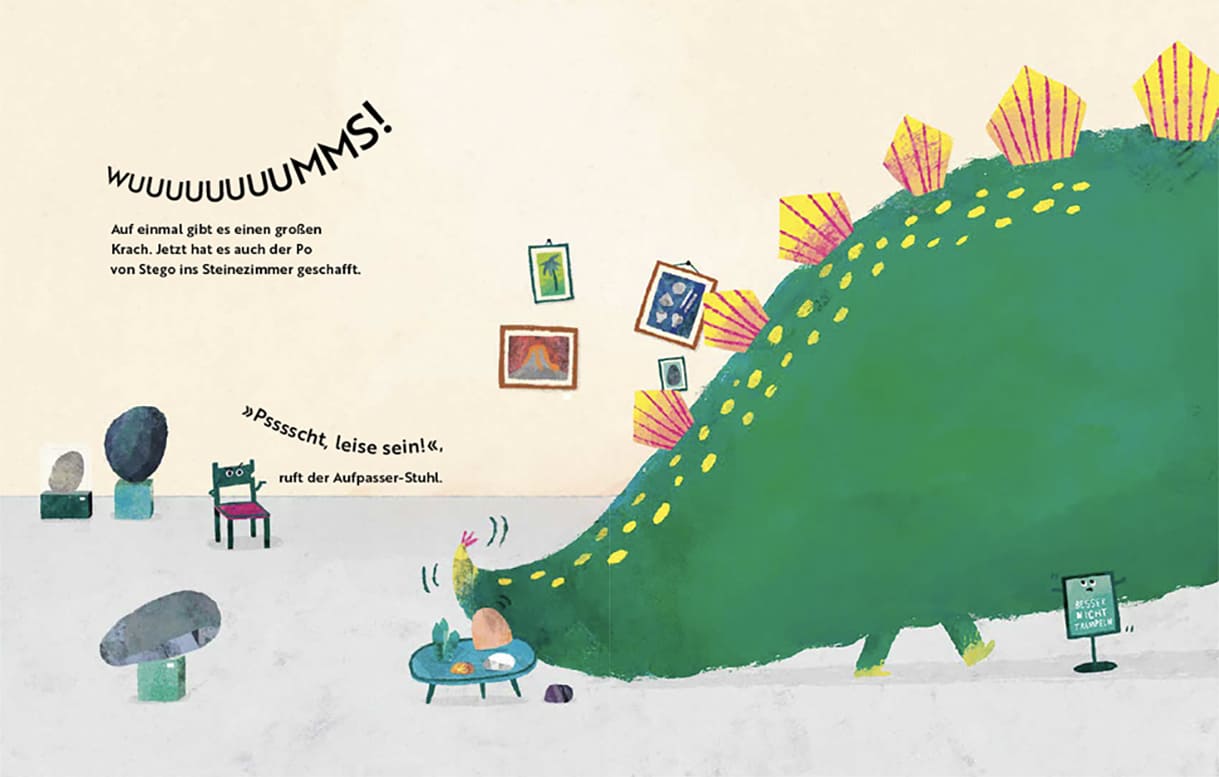
Das könnte der Ausgangspunkt für die Autorin Marie Gamillscheg und die Illustratorin Anna Süßbauer gewesen sein für ihr Bilderbuch „Was mach ein Dino im Museum?“ Wobei sich Geschichte und Bilder nicht nur um einen, sondern eine ganze Schar unterschiedlicher Saurier drehen. Gemeinsam fahren sie mit einem Bus, der schon ausschaut wie ein Stegosaurier, ins Museum. Dort ist die erste Hürde das Eintrittsgeld. Wobei die Info, dass ab 12 Jahren zu bezahlen sei, offenbar ignoriert, dass in österreichischen Bundesmuseen Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre freien Eintritt haben.
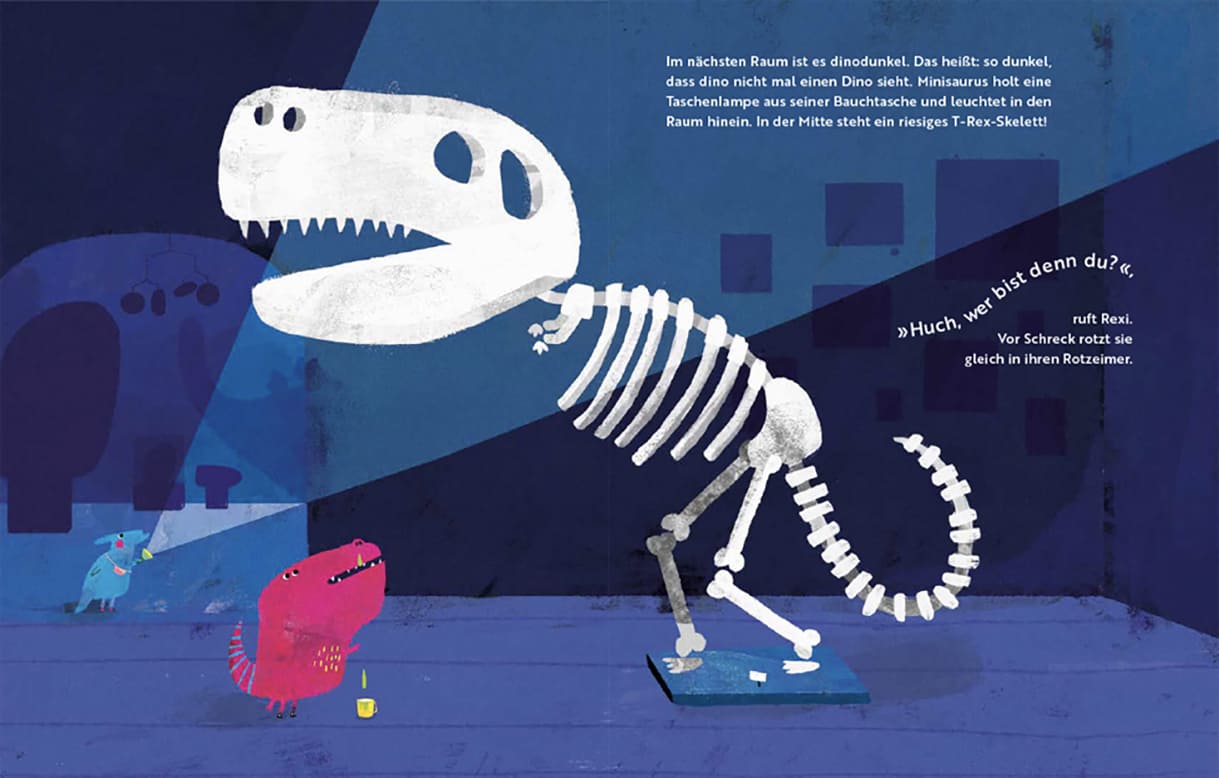
Natürlich sorgen die versammelten Dinos für so manches Chaos, am meisten aber stört es sie, dass die Ausstellung – egal in welchem Museum – nicht die Vielfalt der Saurier abbildet, fast immer sind die Größten die Stars. Das ärgert vor allem Minisaurus. „Uns gibt es in allen möglichen Formen… mit verschiedensten Frisuren … und mit den verrücktesten Outfits!“
Womit dieses Bilderbuch auch zwischen Zeilen und Bildern für viel mehr als Dinosaurier und Museen steht 😉
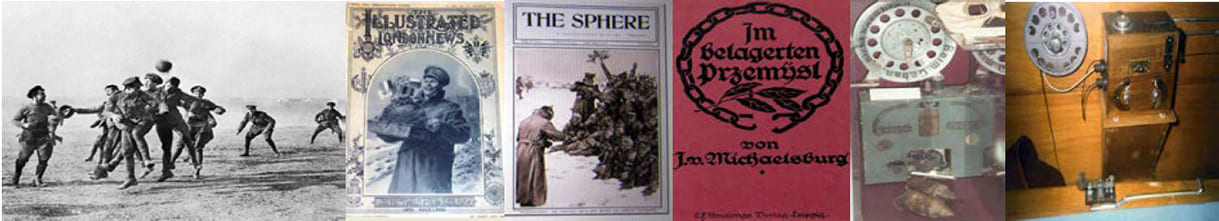
Auch heuer scheint es -nicht einmal zu Weihnachten – einen kurzen Waffenstillstand in den Kriegen in der Ukraine, im Sudan und auch nicht in dem darauf zusteuernden von Donald Trumps USA gegen Venezuela geführten zu geben.
Vor mehr als 90 Jahren gab es einen solchen im ersten Winter des ersten Weltkrieges. Im Ersten Weltkrieg gab es an der Front zu Weihnachten 1914 am Heiligen Abend und am Ersten Weihnachtsfeiertag einen Weihnachtsfrieden. Und am Heiligen Abend, am 24. Dezember 1914 gab es die Weihnachtsbotschaft von Kaiser Franz Joseph I, dem Herrscher der Donaumonarchie an die Eingeschlossen der von russischen Truppen belagerten Stadt Przemyśl. Anstatt Krieg zu führen, wurde ein Friedensfest gefeiert, am Heiligen Abend und am Ersten Weihnachtsfeiertag.
Dies ist auch in diesem Jahr wieder Anlass für „Arbos – Gesellschaft für Musik und Theater“ online „Musik aus dem Großen Krieg zu übertragen (Link am Ende des Beitrages) – u.a. mit Johann-Strauss-Melodien, aber vor allem von Kompositionen Viktor Ullmanns: „Präzision, meine Herren, ist die Hauptsache“, dadaistische Komposition aus dem Ersten Weltkrieg arrangiert für Klavier, Sopran und Bassbariton, „Marsch“ nach dem gleichnamigen Gedicht von Theodor Kramer arrangiert für Violine, Cello, Klarinette, Saxophon, Horn, Klavier und Schlagwerk, Gebärdensprache und Stimme „Wendla im Garten“ nach dem Gedicht von Frank Wedekind, jeweils arrangiert von Herbert Gantschacher vom genannten Verein Arbos.
Weiters zu hören sein werden ebenfalls Ullmanns „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ nach dem gleichnamigen Gedicht von Rainer Maria Rilke, Nr. 2 aus Teil I in der Originalfassung des Komponisten für großes Orchester rekonstruiert von Elmo Cosentini und Herbert Gantschacher, „und nicht zuletzt Viktor Ullmanns „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“ (Musik und Libretto in der Originalfassung des Komponisten rekonstruiert in Zusammenarbeit mit Karel Berman, Herbert Thomas Mandl, Paul Kling, Ingo Schultz, Alexander Drčar und Herbert Gantschacher im Auftrag von „Gesellschaft für Musik und Theater)
Eine Produktion aus dem Projekt „krieg=daDa“ von ARBOS gesungen und gespielt vom Kronthaler Saxophonquartett, Markus Rupert, Christoph Traxler, Rupert Bergmann, Katrin Koch, „ensemble kreativ“, Werner Mössler, Projekt-Chor, „arbos ensemble“ Stephen Swanson, Stefani Kahl, Ingrid Niedermair und Johannes Strasser Sendung auf ARBOS-Radio
Über den Weihnachtsfrieden im ersten Weltkrieg berichteten „The Daily Mirror“, „The Sphere“ und die „London Illustrated News“ auch mit Bildern. Die Soldaten kamen aus den Schützengräben heraus und feierten gemeinsam an der Frontlinie, spielten Fußball, es war ein Friedensfest von kurzer Dauer, denn danach wurden sie von ihren Kommandeuren bei Todesstrafe gezwungen, den Kampf fortzusetzen. Dieser Weihnachtsfrieden war lange Zeit nur von der Westfront im Ersten Weltkrieg zwischen britischen, französischen, belgischen und deutschen Soldaten bekannt. Einen Weihnachtsfrieden gab es aber auch im Osten zwischen den Truppen des Russischen Reiches und der Habsburgermonarchie im belagerten Przemyśl. Darüber berichtete die Krankenschwester Ilka Michaelsburg, deren Buch „Im belagerten Przemyśl“ 1915 erschien, dies geschah am Heiligen Abend 1914. Ebenso am Heiligen Abend, dem 24. Dezember 1914, übermittelte Kaiser Franz Joseph I., der Herrscher der Donaumonarchie aus dem Erzhaus Habsburg die Weihnachtsbotschaft via einer Radiostation, die in Wien aufgebaut war, und an die Radiostation im belagerten Przemyśl übermittelt wurde. In dieser Botschaft wünschte er den Eingeschlossenen zum Weihnachtsfest alles Gute und bat die Bevölkerung und Soldaten auszuharren. Am Neujahrstag 1915 und zum russischen Weihnachtsfest Anfang Jänner 1915: „Im Vorfeld schwenkte der Feind die weiße Fahne und schickte eine Deputation von zwei russischen Offizieren zur Weihnachtsbeglückwünschung in unser Lager herüber. Sie brachten russischen Tabak und Zigaretten als Weihnachtsgabe … daß am russischen Weihnachtsabend österreichische Offiziere die russische Beglückwünschung erwidert haben, indem sie gleichzeitig als Gegenleistung für die Zigaretten der Belagerungsarmee – Sardinen und Salami überreichten.“
arbos-radio –> Musik aus dem Großen Krieg zum Weihnachtsfrieden
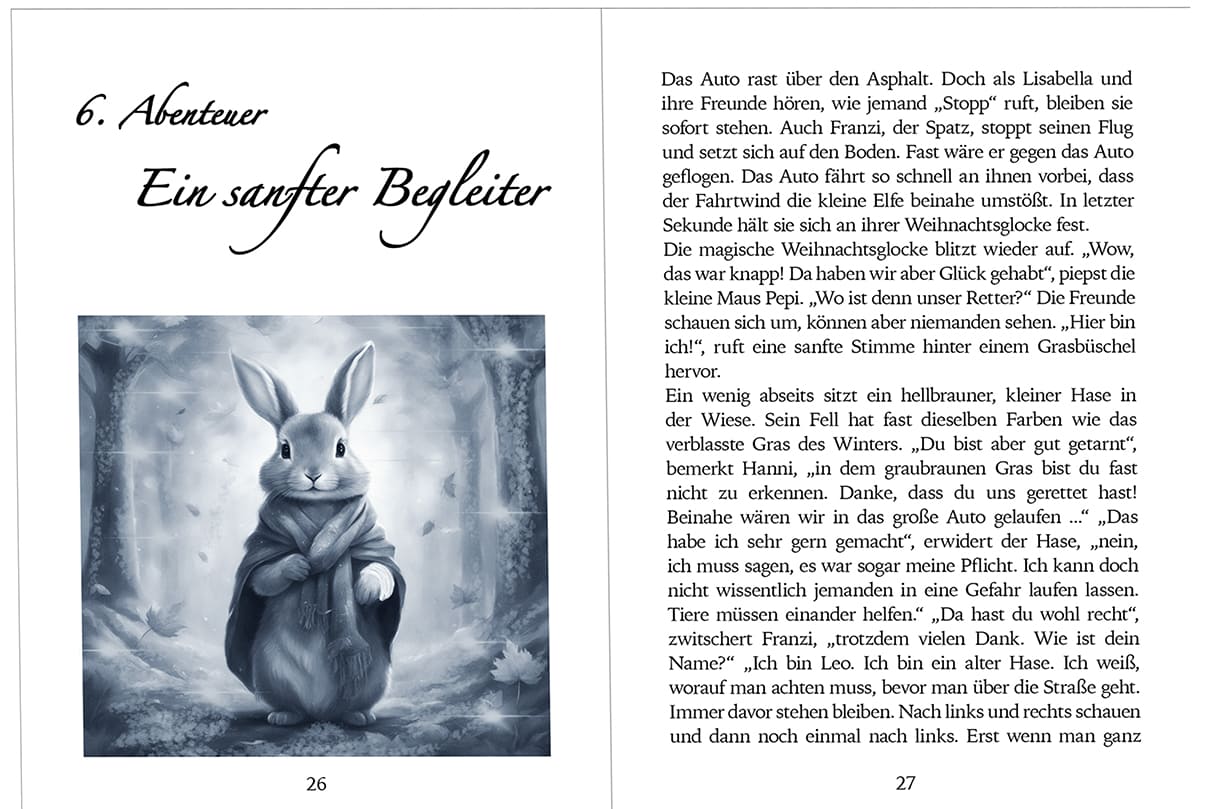
24 Kapitel lang dreht sich alles um die titelgebende „magische Weihnachtsglocke“. Sie gehört zu den in einem Hollerbusch lebenden Elfen. Zum Fest leuchtet und erklingt sie und alle dürfen sich dann was wünschen.
Eine der vielen Elfen ist Lisabella, die noch dazu zu Weihnachten Geburtstag hat. Und ausgerechnet sie, die mit der Weihnachtsglocke Anfang Dezember fliegt, wird von einem Menschen entdeckt, gepackt und weit weg verfrachtet. Ihr rechter Flügel wird dabei verletzt, also nix mit Heimflug.
Soweit die Ausgangslage rund vier Wochen vor dem Fest. Mühsam und beschwerlich wird der Rückweg, der noch dazu nicht so einfach ist. Wo befindet sie sich? Wo ist der Hollerbusch. Nach und nach kommen verschiedene Tiere zu Hilfe und gesellen sich zur Wandergruppe: Maus Pepi, Maulwürfin Hanni, krähe Karli, Spatz Franz, Hase Leo. Irgendwann dazwischen hilft auch noch eine namenlose Kuh. Eine Igelin namens Ida, die Elster Josi und das Eichhörnchen Fanny, die rote Katze Blumi sowie Silver, ein altes Pferd, Fischlein und zwei Schwäne kommen auch noch in der abenteuerlichen Geschichte vor.
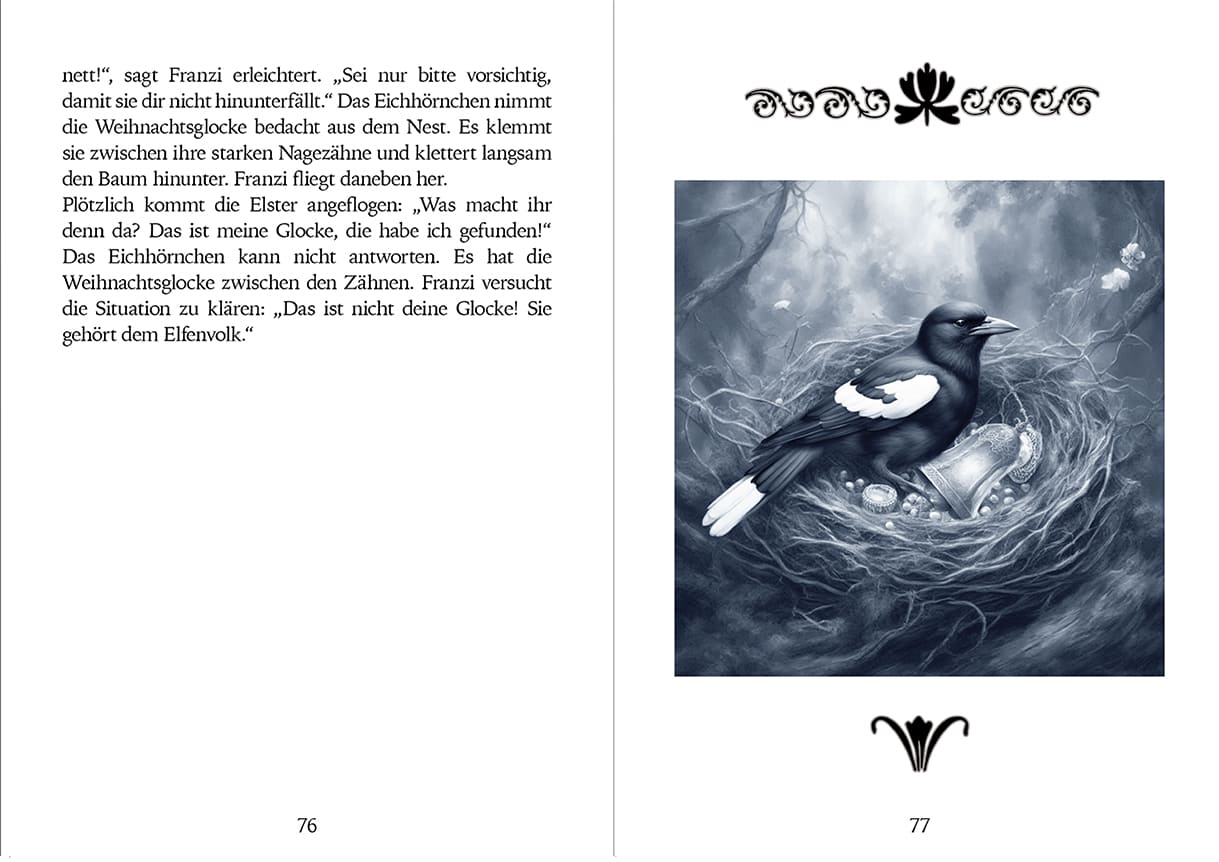
Klar geht aber auch gemeinsam nicht immer alles glatt. Soll auch nicht, die Geschichte, die sich Brit Blumilon ausgedacht und am Beginn jedes der meist knapp mehr als dreiseitigen Texte mit einer magisch wirkenden Schwarz-Weiß-Zeichnung versehen hat, soll ja bis zum Schluss spannend bleiben. Auch wenn natürlich von Anfang an klar mitschwingt, dass Lisabella – und einige ihrer tierischen Begleiter:innen – es sicher rechtzeitig zum Hollerbusch schaffen werden.
Wo du dann – per QR-Code nach der letzten Seite – zu einem nicht ganz alltäglichen Weihnachtslied kommst, in dem das Christkind unter anderem pupst (Lied: Urban Elves)
Das Buch hat übrigens die Gruppe „Töchter der Kunst“ zu ihrem musikalischen Theaterstück „Wirrum Warrum Wundeglocke“ inspiriert – Stückbesprechung unten verlinkt.

„Ich beginne meinen Arbeitstag, wie es das Protokoll besagt: Optimieren Sie Ihre Atmung. Beschleunigen Sie Ihr Denken… Ich arbeite im Ministerium für Informationsfluss, in der Abteilung für Textverdichtung. Unsere Mission ist es, jegliches entschleunigte Denken aus den Netzwerken zu entfernen. Wir sortieren Wörter, die zu lange brauchen, aus. Intern nennen wir das Entschleunigungsterrorismus, die größte Gefahr aller Zeiten, dicht gefolgt von der Mittagspause. Der Begriff wurde übrigens in Rekordzeit erfunden: 0,8 Sekunden.
Mein Kollege kaut zu langsam, sein Kiefer unterschreitet die vorgeschriebene Bissrate. Kein Wunder, dass zwei Wächter schon auf ihn zustürmen. Letzte Woche wurde jemand abgeführt, weil er beim Niesen eine halbe Sekunde zu spät Gesundheit gesagt hat. …
Mein Pacer piept leise. Warnstufe Gelb. Ich habe zu lange nachgedacht, wie gefährlich!…“

Diese Sätze stammen aus einem der 23 Finaltexte Jugendlicher bzw. junger Erwachsener des Literaturbewerbs Texte Wien. Zum zehnten Mal waren junge kreative Schreiber:innen – und das trotz des Namens nicht nur aus Wien – eingeladen, ihre Gedanken zu einem Jahresthema zu verfassen; rund 4000 junge Leute haben in diesem Jahrzehnt Texte für den Bewerb eingereicht. „Tempo“ war das Motto für den Jubiläumsbewerb. „Schneller atmen“ titelte Julia Bohrer aus dem Gymnasium Neusiedl am See ihren Beitrag, aus dem die Eingangspassage zitiert ist.
Zum zweiten Mal fand die Preisverleihung – immer mit genau zweiminütigen Textauszügen – gelesen von vier Profi-Schauspieler:innen (Zeynep Buyraç, Kaspar Locher, Markus Meyer und Maximilian Thienen) im Schauspielhaus Wien (davor viele Jahre – mit Ausnahme der Pandemie-Ära im Burgtheaterspielort Kasino am Schwarzenbergplatz) statt; jeweils untermalt von einer jugendlichen Band, heuer Leeta – mehr dazu in einem eigenen Beitrag.
Übrigens: Alle Texte, mit denen die jungen Autor:innen ins Finale gekommen sind, können auf der Homepage des Bewerbs – am Ende des Beitrages verlinkt – (nach-)gelesen werden, und zwar aus allen Bewerbsjahren bis 2016 zurück.
Der Text des aktuellen Siegers ist in einem eigenen Beitrag auch hier auf dieser Website – ebenfalls unten verlinkt – vollständig veröffentlicht: „Elfzwanzig“ von Philip Pecoraro, eine Hommage an den 12. Bezirk von Wien, übrigens ist Meidling einer von nur drei der 23 Bezirke, die den Bewerb – bisher – nicht unterstützen.
Auszüge aus dem zweit- und dritt-platzierten Text – „Sonne über dein Haupt“ von Theresa Schmerold sowie „Ein Haufen Kindheit“ von Bruna Karolyi – sind ebenfalls in eigenen Beiträgen unten verlinkt – die Top 3 jeweils auch mit den Begründungen der Jury (Judith Fischer, Erwin Greiner, Andrej Haring, Eva Holzmann, Julia Jost, Vanja König, Hanno Millesi, Lene Moormann und Jana Podbelsek).
Tempo, obwohl sich dies – wie im eingangs zitierten Beitrag – mit Rasanz in den meisten Köpfen fast automatisch verknüpft, kann aber auch das glatte Gegenteil sein. Und so kreisen so manche der jugendlichen Texte durchaus um Innehalten, ja sogar Stillstand.
„Ich lebte ein temporeiches Leben, das vom schnellen und dreckigen Geld finanziert wurde. Am Anfang tat ich es für die bunten Scheine, dann für die unantastbare Macht und letztendlich, um die Welt zu erobern. Ich hatte mich schon damit abgefunden, entweder Gefängnis oder Millionen. Doch das ewige Streben nach mehr zog mich in die Strömung eines Teufelskreises, in dem ich, ohne es zu bemerken, ertrank“, beginnt er Text von Arda Aksoy aus dem Schulzentrum Ungargasse (Wien-Landstraße).
„Mir kam es so vor, als ob die Sanduhr meines Lebens durch die Risse im Glas unkontrollierbar Körner verlor. Mein Leben verging wie im Zeitraffer, Klamotten von Designern, deren Namen ich nicht aussprechen konnte, Freundlichkeiten von Menschen, die mich verachteten, die Sättigung meiner Gelüste, alles lief perfekt, bis der Traum platzte. Als die Tür aufknallte und die engen Handschellen sich schmerzhaft in mein Fleisch bohrten, überrumpelte mich ein Gefühl der Reue, ein Drang, die Welt anzuzünden und mit ihr zu verbrennen.
Die restliche Zeit meiner Existenz soll ich hier verbringen? An einem Ort, an dem keine Blumen aufblühen, die Vögel nicht zwitschern, die Sterne nicht leuchten und die Tage nicht vergehen. Ist es leicht, immer die gleiche Wand zu sehen und mit Kreide jeden Tag zu zählen? Der kalte Luftzug, der unter der Stahltür durchzieht, die verrosteten Gitter oder das steinharte Bett, alles ist hier verflucht, oder bin ich derjenige, der seine Umgebung mit einem Fluch belegt?
Der Tag, an dem ich einen Fuß auf diesen kalten Beton setzte, änderte alles. Die Zeit verlangsamte sich und die Sühne meiner Sünden fing an…“
Er schreibe eigentlich erst seit rund 1½ Jahren, vertraut der Autor des Textes „Gefallene Sterne“, aus dem die vorigen Absätze zitiert sind, dem Reporter an, sei ein Fan von Romanen russischer Dichter wie Dostojewski, lese aber auch auf Türkisch und Deutsch. „Ich sammle im Alltag Ideen, verknüpfe sie dann wie bei diesem Text viel mit Szenen aus Filmen, die mich inspirieren. Zu „Tempo“ wollte ich den krassen Wechsel von der Hektik zum Stillstand, wie ich ihn mir in einem Gefängnis vorstelle, zumindest von dem, was ich in Filmen gesehen habe.“

So wie Jury-Entscheidungen durchaus subjektiv sein können, so ist es auch die Auswahl an Zitaten hier in diesem Beitrag, der eben nicht nur die Top3-präsentieren will. Alle 23 jungen Autor:innen, die es mit ihren Texten ins Finale geschafft haben, sind schon Sieger:innen. Dieser Beitrag und die vielen Zitate aus Texten wollen Lust darauf machen, selber in den einen oder anderen, vielleicht auch mehrere der eingereichten Texte reinzulesen.
„Der Bühnenraum eines Theaters war schon immer ein Zufluchtsort der Randständigen, dort galten die gesellschaftlichen Regeln weniger streng“, schreibt Yuliia Obukhivska von der Grazer HTBLVA (Höhere Technische Bundeslehr und Versuchsanstalt) Ortweinschule mit einem künstlerischen Zweig in „Niko, oder Vom Kolonialismus erzählt“. In einem Beitrag, der nur unwesentlich kürzer ist als alle anderen 22 zusammen, baut sie eine Jahrhunderte umfassende Geschichte der Ukraine ebenso ein wie Vampirismus, Neu-ankommen in einer Schulklasse und eben Außenseitertum sowie intensive Gefühle.
„… jede Sekunde Stillstand hinterlässt eine Verbrennung, und er wird bewundert, ja man bewundert ihn hinter vorgehaltener Hand, denn Bewunderung ist nur eine höfliche Reform des Ekels… weil Zersetzung Bewegung ist, ein Prozess. Kein Stillstand…“
„Ich werde mich nicht mehr biegen und nicht mehr versuchen, mich in mich selbst zu verleben, stattdessen über meine einsamen Dämonen siegen und, Freiheit. Ich atme Sie ein und nie wieder aus, halte sie fest, wie ein Kind seinen Traum.“
„Mein Schleichen wird zu einem sicheren Gang, mein Gehen zu einem gehetzten Lauf – ich laufe nach vorne, in die unendliche Weite, ohne Ziel, ohne Richtung, ohne klar ersichtbaren Sinn. Nach einiger Zeit komme ich erschöpft zum Stehen. Ich keuche atemlos vor mich hin und setze mich langsam auf den Boden. Wie anstrengend es doch ist, so lange zu laufen, ohne dabei vorwärtszukommen.“
„Ich habe doch alles, was das Herz begehrt. Mir kann es nicht schlecht gehen. Trotzdem ertrinke ich nun neben all diesen Dingen. Sie könnten mein Anker sein, mein Fels in der Brandung. Doch ein Fels sinkt schneller als ein menschlicher Körper. Drückt nach unten… Es ist viel einfacher, dem Sog zu folgen, als gegen ihn anzukämpfen…“
„Ich wünschte, ich wäre ein Schwamm. Ich wünschte, ich könnte jeden Moment wie ein Schwamm aufsaugen. Ich versuche krampfhaft, alles festzuhalten. Alle Erinnerungen so lebhaft zu behalten, als wären sie nie zu Ende gegangen. Ich trauere Momenten nach noch während sie passieren…“

„Er war eine Bimgeburt. Im 62er, Ecke Dörfelstraße, Meidling. Die Jungen hat’s gefreut, weil Kinder doch so lieb sind, und die Alten gestört, weil allweil so ein Lärm is‘. Nur der Fahrer hat wieder nur ans Dienstrecht gedacht und ob er an allem schuld ist oder nicht. Dabei war Er nur eine Störung im Betriebsablauf.
Eingeschult, ausgeschult, früh angestellt, schnell entlassen worden. Lang studiert – also die Speisekarte beim Wirten. Gegen Akademiker keine Abneigung, aber auch keine Sympathie. Die haben immerhin noch nie richtig gearbeitet. Eh, Er auch nicht, ja klar, sowieso. Aber bei Ihm ist das doch was anderes.
Und so steigt Er montags in seinen Toyota Corolla und fährt Richtung Niederhofstraße. Da ist in der Ruckergasse – etwa da, wo die Ratschkygasse kreuzt – ein Riesen-Bahö. Er fährt langsam, das will Er sich anschauen. Wann ist in Elfzwanzig immerhin sonst was los? Die ultrarechten Linksliberalen werfen den linksextremen Rechtsradikalen Hühnereier ans Parteilokal. Die Linken hassen nämlich die Rechten und die Rechten hassen die Linken, nur den Hausbesorger Rypacek interessiert das alles nicht. Der will nur wissen, welche Güteklasse die Eier haben, weil Güteklasse A sich so schwer wieder entfernen lässt.
Er hält sich da aber raus aus dem Bahö, immerhin ist es nicht seines, und mit Politik hat Er nichts am Hut. Entscheiden, das tun sowieso die da oben – das denkt nicht nur Er, das denken viele, betont Er gern. Deshalb gibt man in Österreich vermutlich alle 30 Jahren dem Extremen eine Chance. Aber damit kann man Ihm gestohlen bleiben.
Nein, Er muss weiter. Gang rein, auf’s Gas, Ruckergasse runter. Nicht geschaut, nicht gebremst. Mit 50 Sachen in einen Mistkübler rein. Von hinten. Toyota hin. Er auch.
Am Folgetag erwacht Er müde, in kater-ähnlichem Zustand in einer Einliegerwohnung am Schöpfwerk, Meidling. Eine Wiedergeburt ist anstrengend. Am Tisch zwei leere Bier und ein Bescheid des Himmlischen Comebackfragenzentrums. HiCofraZ. Hunger hat Er, und keine passende Hose. Dafür in der Garage einen Tiguan.
Er fährt einkaufen und trifft am Eingang, da wo die Hunde draußen bleiben müssen, die Grüß-Gotts mit ihren Zeitungskalendern und die Zum-Wohls mit ihrem Großgebinde Rotwein. Er hat keine Angst. Nur der hat Angst, dass die Zum-Wohls einem was tun, dem sie noch nie was getan haben, sagt Er. Ihn hat am Bahnhof mal einer beleidigt, in einer Fremdsprache. Doch sowas kann Er verkraften.
Nur an der Kassa hört der Spaß auf. Riesenschlange – eine alte Dame hat’s genau. Zweite Kassa! Er ruft sowas nicht, das schickt sich nicht, findet Er. Die neue Hose gleich einem Schal lässig umgeschwungen, weil Er keine Hand frei hat, geht Er in die Tiefgarage. Da fällt der Alten von der Kassa das 6er-Tragerl Bier hinunter und drei Flaschen gehen zu Bruch.
Er hilft und bückt sich. Kniebeuge, Armstrecken, Bierheben. Wird dabei völlig übersehen. Im Rückwärtsgang, beim Ausparken. Kastenwagen. Installateur Atesli, bei Rohrgebrechen aller Art. Firmenauto ein Totalschaden. Er auch.
Am Folgetag liegt Er benebelt auf einem Kuhfellteppich in der Zöppelgasse, Meidling. Ein Hund zerreißt seinen Bescheid des HiCofraZ. Guten Morgen! Eine alte Dame gießt Hortensien. Sie hat einen Hund namens Katze, eine Katze namens Erwin und einen Erwin namens Holecek. Der liegt bei ihr am Sofa.
Er verlässt die Wohnung und belädt seinen Twingo. Da blickt Er in die Ferne und sieht schwarze Punkte. Die Zugvögel, seufzt Er, aber in Wahrheit sind es nur Mistelbacher im Stau gen Italien. Er träumt, träumt vom Meer, von Amore, von Espresso und von Jesolo. Dabei sind eigentlich nur Mistelbacher dort. Wenn Er unten ist, trinkt Er immer Birra Moretti und Montepulciano und benimmt sich auch sonst wie zuhause, nur dass man da ins Meer schiffen kann. Nicht wie daheim ins Bankett.
Die alte Holecek ruft Ihn, Erwin ist gestürzt. Er denkt zunächst an die Katze, sieht aber bald ihren Alten im Stiegenhaus liegen. Schnell hilft Er, bei Stürzen zählt jede Sekunde, das weiß Er. Da geht die 3er-Tür auf und die Czapka ruft, was allweil so ein Radau ist, man könne sich nicht aufs Fernsehen konzentrieren. Als sie den Holecek sieht, eilt sie zur Hilfe und verwendet zwei Freiminuten für einen gebührenfreien Notruf.
Zwei Zivildiener verladen den Holecek. Bahre, festzurren, Abfahrt. Sie sind in Eile. Da beißt ihn Katze. Er stolpert, vor die Rettung. Die Zivis erschrecken. Ihre Nerven hinüber. Er auch.
Am Folgetag sitzt Er zugedröhnt an einem Esstisch in Hetzendorf, Meidling. Er weiß schon, was Sache ist, und zündet sich mit dem Wisch vom HiCofraZ eine Zigarette an. Er will unter die Leute kommen und fährt mit seinem Fiat Punto zum Wirten.
Drinnen wird geschimpft, über Preise, echte Wiener, solche die es werden wollen und über solche, die es nicht sind, obwohl sie so tun. Wer Wien hasst, der kann sich schleichen gehen!, ruft einer. No na, denkt Er, was sonst. Wer Wien hasst, liebt es in Wahrheit, das sagt Er immer. Und wer Ihn nicht liebt, ist sowieso selbst schuld. Da fängt einer, der Vucevic heißt, mit den Ausländern an. Daraufhin meint ein anderer, der Novak heißt, dass der Vucevic ja selber einer ist.
Das will der Vucevic nicht auf sich sitzen lassen und nennt den Novak einen Tschechen, was der Novak bestreitet, immerhin wären seine Ahnen schon in der Kaiserzeit gekommen. Da hat er Recht, denkt Er, das kann der Vucevic nicht von sich behaupten. Aber der winkt nur ab und beschwichtigt in ein Krügerl hinein. Er steht auf der Gasse, da fällt Ihm noch was ein. Am Ende sind wir alle Elfzwanziger!, ruft Er hinein und erntet Zustimmung. Klar, sowieso, no na.
Dem 8A versagen da die Bremsen. Rutscht, rollt, schlittert. Direkt auf den Wirten zu. Er weicht nicht aus. Er weiß, was jetzt kommt. Eilmeldung. Kronen Zeitung. Bus rast in Wirtshaus. Eingangstür zerstört, Mann überfahren. Das war Er. Schon ein Scheißpech, denkt man im HiCofraZ. Arme Sau. Aber Er, Er sieht die Sache gelassen. Den Kater morgen wird Er verkraften. Solange Er nur wieder in Elfzwanzig landet.“

„Der Text überzeugt durch seinen rasanten, pointierten Erzählfluss, der das Wettbewerbsthema Tempo meisterhaft umsetzt. In schnellen Schnitten und mit wienerischem Schmäh jagt die Geschichte ihren Protagonisten durch ein Leben voller absurder Zufälle, alltägliche Katastrophen und grotesker Wiedergeburten. Die temporeiche Abfolge von Szene – jedes Mal abrupt endend, jedes Mal nahtlos neu beginnend – erzeugt eine komische wie tragische Dynamik, die den Leser atemlos mitreißt.
Sprachlich präzise, rhythmisch, humorvoll und mit scharfem Blick für gesellschaftliche Eigenheiten verbindet der Text das Wettbewerbsthema mit Charaktertiefe und Milieugespür. Die Geschwindigkeit mit der Leben, Tod und Wiedergeburt ineinander krachen, macht den Text formal wie inhaltlich zu einem herausragenden Siegerbeitrag.“

„Da steht er, zwischen den anderen, eine grün-weiße Raupe mit Zyklopenauge, schief am Stammplatz, du hast es eilig gehabt. Dein Bus ist mutterseelenallein, schwach beleuchtet. Ich habe ihn an den Post-its erkannt, sie kleben an der Windschutzscheibe und am Armaturenbrett. Ich gehe langsam auf ihn zu, hole die Stange aus dem schwarzen Rucksack, leger auf einer Schulter, lege das Eisen ans Gummi der Tür, es gibt leicht nach, ganz einfach, ich stemme die Tür auf, wie du es mir gezeigt hast und steige ein, dein Platz ist frei, aber ich sehe dich noch sitzen, verschmolzen mit dem bedruckten Stoffsitz. Direkt über dem Fahrersitz ist eine Sonne gezeichnet, dein eigener Stern…
Ich habe erst nach zwei Wochen meines neuen Schulwegs erkannt, dass immer du da vorne sitzt und fährst, immer im selben Bus, wie hast du das geschafft, habe ich dich gefragt, wenn du lange genug dabei bist, bist du frei irgendwann. Die Leute bemerken dich nicht mehr, so bist du mit dem Bus verwachsen und er mit dir, hast beobachtet und mitgeschrieben. Notierst die Geschichte, sie klebt gelb um dich rum. Du hast mir ab der vierten Woche eine Bedeutung zugewiesen, ich bin der, der sein Geld nie dabei hat, Schwarzfahrer, der trotzdem bezahlt, mit Kastanien, mit Nimm2, mit Spickzetteln oder einem Wort, ich habe dir nie eine Münze gegeben, du hast gesagt, ich nicht, ich muss mehr zahlen, den höheren Preis, du hast dir das ausgedacht in der vierten Woche, beim achten Mal Geld vergessen.
Unsere Freundschaft, Bekanntschaft, die lief so: Ich steige ein, ich bezahle (ich mache eine Pirouette, gebe dir ein Herbstblatt, sage meine Lieblingseissorten alphabetisch auf, du bestimmst den Preis), du schüttelst mir ernst die Hand, grüßt, ich gehe die Reihen entlang, der Rucksack schief auf den Schultern. Immer derselbe Platz, du links vorne, ich rechts hinten, in Fahrtrichtung. Auf dem Sitz vor mir steht: Lebn ist hart ohne S-Budget Juneberry, und, ich war das nicht, habe ich dir gesagt, als wir Plätze getauscht haben.“

„Sonne über dein Haupt“ ist die Geschichte eines Schülers, der im Chauffeur des Busses, mit dem er in seine neue Schule fährt, einer alternativen Form von Lehrer begegnet. Von ihm lernt er unter anderem, dass es auch andere Formen der Bezahlung gibt, dass es gilt, Freiheit auszusitzen, und erst dann davon gesprochen werden kann, wenn man für die anderen unsichtbar geworden ist.
Sukzessive verwandelt sich das Innere des Busses in eine sonderbare Form von Klassenzimmer, in dem rund um den Fahrersitz auf zahlreichen Post-its Die Geschichte geschrieben steht. Als der Chauffeur eines Tages tatsächlich nicht mehr ist, nimmt der Protagonist dieses Zettelwerk an sich. Zurück lässt er hingegen die Zeichnung einer Sonne, dort, wo sich, knapp darunter, tagtäglich die Halbglatze des Fahrers befunden hat.
Was diesen Text auszeichnet, ist der Mut, erzählerisch alternative Wege zu gehen, das Erblühen einer Beziehung zwischen einem Heranwachsenden und einem Rädchen im Alltagsbetrieb zu schildern und dabei, anstatt auf altbekannte Bilder zurückzugreifen, selbst welche zu erfinden. Auch scheut der Text nicht davor zurück, jene Akteure ins Zentrum zu rücken, die dazu tendieren, Teil des Hintergrundrauschens unseres Lebens zu sein und anzuerkennen, dass gerade ihre Menschlichkeit und die Eigenheit das Gewöhnliche zu etwas Besonderem werden lassen können. Wir tauchen in die Vorstellungswelt eines sich entwickelnden kreativen Geistes ein, der bereit ist mit seinen eigenen Einfällen vorlieb zu nehmen.“

„Schließlich tat ich das, was ich immer getan hatte, ich floh in mein Kinderzimmer. Wie erstarrt in der Zeit, so unberührt, dass es mir Angst machte. Mit einem seltsam fremden Gefühl ging ich im Raum auf und ab. Ich riss das Fenster auf, um den abgestandenen Geruch loszuwerden. Auf dem Bett unter der Dachschräge saß Rudi, mein Kuschelbär, mit dem von Oma bestickten Blümchenpullover. An den Wänden, glänzend poliert, hingen Medaillen, Pokale und Bilder von einem strahlenden Mädchen mit Dutt und Tutu neben einer noch strahlenderen Mutter. Die Spitzenschuhe, am Haken daneben, ließ ich unberührt in ihrem grazilen Stolz.
Dann begann ich nacheinander die Schubladen meines Schranks zu öffnen. Betrachtete alles mit Sorgfalt, als wäre es fremdes Eigentum. Vorsichtig strich ich über die aus Holz geschnitzten Tiere, mit denen ich mich stundenlang beschäftigt hatte. Die verblasste Spieldose, mit der sich drehenden Tänzerin, hielt ich besonders lange und summte die Melodie. Gemeinsam mit meiner Herzchen-Kette, die ich von meiner besten Freundin bekommen hatte, bildeten Rudi, die Holztiere und die Spieldose einen kleinen Haufen am Parkettboden vor mir. Die anderen Spielsachen schlichtete ich mit gründlicher Genauigkeit an ihren Platz zurück. In der untersten Lade meiner hellrosa Kommode fand ich meine alte Barbiepuppe Annelies. Ihre blonden Haare waren in einen großen Knoten zusammengefilzt, ihre Plastikhaut hatte längst den frischen Glanz verloren und ihr fehlte der rechte Stöckelschuh. Ich hielt sie und weinte. Endlich weinte ich. Die tiefgekühlten Gefühle schmolzen und tropften auf meine Hose. Ich weinte um das kleine Mädchen, ein Werkzeug der verpassten Träume ihrer Mutter und die Schuld, immer wieder daran zu scheitern, diese einzuholen…“

„Ein Haufen Kindheit entfaltet seine Dramatik in ruhigen, präzisen Bildern, die jedoch emotional mit großer Wucht voranschreiten. Durch die Gegenüberstellung des erstarrten Elternhauses und der sich immer schneller verdichtenden inneren Aufarbeitung erzeugt der Text ein stilles, aber stetig zunehmendes Tempo der Erkenntnis.
Die Autorin zeigt, wie kraftvoll langsames Erzählen sein kann: Die Rückkehr in das Kinderzimmer, das Öffnen der Schubladen und das Wiederentdecken der Objekte der Kindheit werden zu einer sukzessiven Beschleunigung des inneren Wandels. Der Moment des Weinenkönnens markiert einen emotionalen Durchbruc, der den Text – ohne äußere Hast – in ein starkes finales Tempo führt. Das scheint vor allem dem Publikum besonders gefallen zu haben. Denn ausschlaggebend für den dritten Platz war hier das Public Voting.“
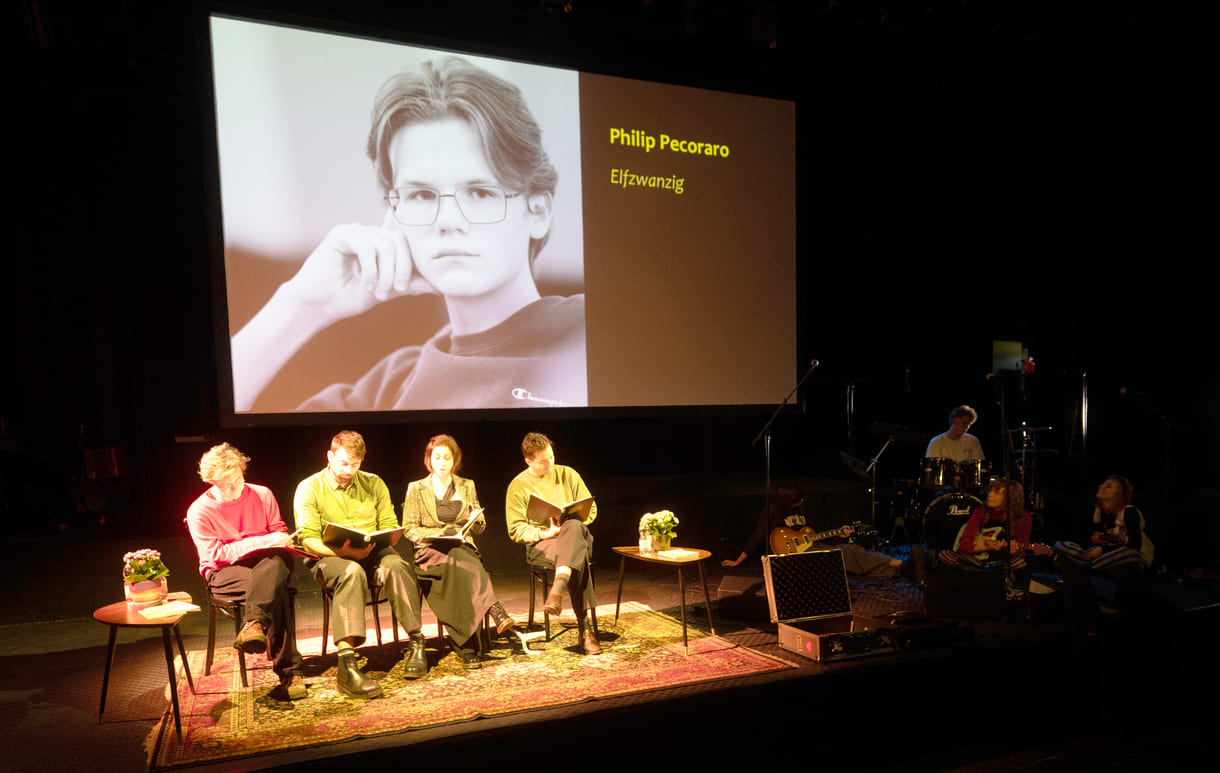
Zeitreisen spielten in manchen Texten zum Thema Tempo der jugendlichen Autor:innen eine Rolle. Neben vordergründigen Wiedergeburten baute der Autor des dieses Jahr siegreichen Textes „Elfzwanzig“ – der Ort seiner Handlungen, gleichzeitig sein Heimatbezirk, ist Meidling, der 12. Wiener Bezirk mit der Postleitzahl 1120 – auch gleichsam zeitreisende Altwiener Begriffe ein. So verwendet er „Mistelbacher“ für Polizisten, was einen rund 100 Jahre zurückliegenden historischen Grund hat (Link weiter unten).
„Ich mag so alte Wiener Bezeichnungen und sammle sprachliche Kuriositäten“, beantwortet er die Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… woher er diesen – seit vielen Jahrzehnten gar nicht mehr üblichen Begriff – kenne. Texte, die nicht für die Schule sein müssen, schreibe er ungefähr seit der Zeit, als er im Gymnasium begonnen habe. „Zeitweise wenn mir sehr fad ist, beginne ich Texte zu schreiben oder zumindest Gedanken zu sammeln. Das meiste auf papiernen Zetteln. Mein Laptop ist so langsam, da mach ich nur das Nötigste. Manches Mal schreibe ich auch in Hefte. Einmal hab ich leider ein solches mit vielen Notizen in einem Lokal verloren. Vielleicht finde ich ja einmal irgendeinen Text von jemandem, der das Heft gefunden und meine Aufzeichnungen verwendet hat“, meint Philip Pecoraro augenzwinkernd.

Eine der vielleichtheftigsten Passagen der rund 100 A4-Seiten der 23 Finaltexte des Jubiläums-Jugendliteraturbewerbs „texte.Wien“ stammt aus „Ein Haufen Kindheit“ von Bruna Karolyi (Gymnasium Neusiedl am See), die damit den dritten Platz belegte: „Die einzige Wärme im Raum ging von der Tasse Tee aus. Geredet wurde nur wenig. Die Stille war mir so vertraut, dass es beinahe komisch war, wie sehr sie mich erdrückte. Nur die Uhr tickte. Immer lauter…“ Bleibt zu wünschen, dass möglichst wenige solche Gefühle an den bevorstehenden Feiertagen erleben (müssen).

Wobei die Autorin im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… betont, dass „Dies aber nichts Autobiographisches ist, sondern alles ausgedacht. Ich versuche beim Schreiben immer wieder, mich in andere Personen hineinzuversetzen.“ Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erzählt sie: „Ich hab schon in der Volksschule begonnen mehr zu schreiben als für die Schule gefragt war. Und im Gymnasium in Neusiedl hatte ich das Glück, dass wir da eine kreative Schreibwerkstatt haben. Trotzdem schreib ich das meiste dann in der Freizeit. Für diesen Text hatte ich ziemlichen Zeitdruck. Genau deshalb wollte ich mit Verlangsamung, ja fast Stillstand experimentieren.“

Alljährlich begleitet eine neue, junge Band die feierliche Preisverleihung mit professioneller Lesung aus den Finaltexten durch Schauspieler:innen, zunächst „nur“ des Bugtheaters, seit der neuen Location auch aus dem Schauspielhaus Wien. In diesem Jahr spielte „Leeta“ auf. Noah Sarich (eGitarre und Gesang), Leona Sperrer (ebenfalls eGitarre und Gesang), Lea-Carlotta Walenta (Bass) und Paul Peschke (Schlagzeug) spielten und sangen selbst geschriebene Songs – in auch selbst gemalten und geschneiderten T-Shirts mit den Symbolen von Spielkarten.

„Wenn wir uns treffen, um neue Songs zu schreiben, reden wir über das Thema, das wir bringen wollen, und entweder schreiben wir gemeinsam oder die eine oder der andere schreibt dann. Und das mit den Spielkarten haben wir einmal ausprobiert und uns gedacht, das ist ganz cool und hat einen Wiedererkennungswert. Vorerst bleiben wir sicher dabei.“
Die jungen Musiker:innen verraten Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auch den Hintergrund für den Bandnamen. Die beiden Frauen haben in einer WG beim Karmelitermarkt in Wien-Leopoldstadt gewohnt. „Das hat uns gefallen und wir wollten von dem Namen ausgehend, was Verfremdetes und so sind wir von Karme-liter auf Leeta gekommen!“

Festliche Krippen gibt es in unterschiedlichsten Formen, einer der wohl ungewöhnlichsten steht derzeit in einer Auslage eines Geschäftslokals in der Wiener Burggasse (Hausnummer 24): Das beim krippenverein Wien gestaltete Modell der Baustellenruine des geplanten Kaufhauses Lamarr, eines einst Prestigeobjekts von René Benkos Signa.
„Spenden statt spekulieren!“ ist die Erklärung der Marketing-Agentur HFA zu dieser Beton-Krippe übertitelt. Der QR-Code führt zum Winterpaket“ der Obdachlosen-Zufluchtsstätte Gruft der Caritas. „Die handgemachte Krippe zeigt die Ruine an der Mariahilfer Straße als Symbol für Größenwahn, Macht und den Verlust an sozialem Bewusstsein. Und soll daran erinnern, dass Weihnachten von Mitgefühl, Gemeinschaft und Menschlichkeit handelt – und nicht von Profit.“
Passend zum Thema Gier vs. Menschlichkeit läuft übrigens das teatro-Musical nach Charles Dickens’ berühmter „Weihnachtsgeschichte“ von bis 23. Dezember in der Stadtgalerie Mödling; Stückbesprechung und Detailinfos unten am Ende des Beitrages verlinkt.
Tourte „Die Werkstatt – Baumanstraßen-Verschönerungsverein“ im Vorjahr vor Weihnachten mit einem Fahrradanhänger als mobilem Punschstand an einige Orte des dritten Bezirks, Landstraße, so spielte sich 2025 am letzten Adventsonntag ein einmaliger Tee- und Punschstand in der Grätzel-Oase dieser kleinen Gasse ab. Diese von den Werkstattleuten eigenhändig gebaute gemütlich gestaltete Insel ist Teil des Projekts, die Gasse menschenfreundlicher und lebenswerter zu gestalten. Dazu gehören auch die gegen Ende der Sommerferien seit zwei Jahren organisierten Straßenfeste – siehe unten verlinkte Berichte.

„Ein Mann chillt mit einem Hammerhai“ – zwei Mal gaben unterschiedliche Jugendliche in einem KI-Workshop diesen Prompt (Ein- oder Aufgabe für das Programm) ein. Beide Male „spuckte“ die mit „künstlicher Intelligenz“ arbeitende Fotobearbeitungs- und -erstellungs-Software Canva Bilder mit einem Hai und einem Mann aus – und jedes Mal mit einem Hammer. In einem Fall hält der Mann – bärtig wie der zweite – das Werkzeug in Händen; beim anderen Bild schwebt der Hammer über den Wellen, dafür neben definitiv einem Hammerhai 😉
Es sind dies zwei von Dutzenden Fotos, die Jugendliche im KI-Medienlabor seit Beginn des Schuljahres in Workshops erstellt haben – teil einzeln, immer wieder aber auch in Gruppen. Ein Teil dieser Jugendlichen befindet sich in einer AusbildungsFit-Maßnahme der ÖJAB (Österreichische JungArbeiterBewegung), andere verbringen Lern- und Freizeit mit der Vienna Hobby Lobby, die mit ÖJAB zusammenarbeitet. Manche hatten sich schon selbstständig (Vor-)Wissen in Sachen KI beigebracht, für andere boten die Workshops die ersten Einstiege in diesen relativ neuen Zweig der digitalen Welt. Der aber sicher unerlässlich sein wird in der gegenwärtigen und noch viel mehr zukünftigen Arbeits- und Berufswelt und darüber hinaus im (Alltags-)Leben.
In der Woche vor Weihnachten lud die ÖJAB-Zentrale in Wien zu einer Veranstaltung, in der Ergebnisse dieses KI-Medienlabors präsentiert wurden und viele der Bilder – leider nur für einen Nachmittag – in einer Ausstellung zu sehen waren, „AI × Youth Gallery – Jugend gestaltet Zukunft“.
Das was als „Katzenvideos“ seit vielen Jahren sprichwörtliche Attraktionen an Bewegtbildern auf Social Media Plattformen sind, fand auch in so manchen der mit Artificial Intelligence, der englischen Version von KI, produzierten Bilder in den Workshops seinen Niederschlag: Von der gekrönten Stubentigerin und ihrer fast identen Gefolgschaft, die Canva zum Prompt „Katzen übernehmen die Weltherrschaft 2“ kreiierte bis zur Golf-spielenden Katze vor einer im Hintergrund explodierenden Sonne.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… präsentiert hier nicht nur viele dieser Bilder der Ausstellung, drei Jugendliche erklärten sich bereit für kurze Interviews. Die 18-jährige Ellen Wollmann nutzte vor den Workshops „vor allem Chat GPT für Alltagsfragen, zum Beispiel wollte ich einmal wissen, wie lange Milch in einem schon geöffneten Packerl haltbar ist; aber auch für schulische Sachen wie Referate und Präsentationen. In den Workshops, die vier Mal fünf Stunden dauerten, haben wir mit Fotos und Videos gearbeitet, was für mich neu war. Zuerst haben wir mit Vorgaben für Bilder gelernt mit diesem Werkzeug umzugehen und dann konnten wir frei arbeiten“, freut sie sich über etliche der Ergebnisse, die sie mit Kolleg:innen erstellt hat und präsentiert sich zwischen solchen Fotos.
Raphael (19) gesteht, dass der erste Versuch eigentlich ein Flop war. „Ich hab als Prompt geschrieben: Mann, der mit einer Ameise am Strand chillt. Aber die Ameise ist nicht und nicht zu finden, sie ist einfach zu klein.“ Dafür freut er sich umso mehr über den sehr gelungenen Erdbeer-Elefanten, der gleich drunter hängt.

Ein Teil der Workshops fand in Wien-Brigittenau in Räumen der Hobby Lobby, der andere in Mödling im ÖJAB-Haus statt. „Zukunft Mödling“ mit diesem kurzen Begriffspaar fütterten verschiedene Jugendliche die KI – und beide Mal waren seeeehr düstere Bilder das Ergebnis. Womit das Internet zu Mödling und der Zukunft dieser Stadt gefüllt ist?
Eine der Jugendlichen, die anonym bleiben will, zeigt dem Journalisten das Bild, das auf ihre Zwei-Wort-Angabe hin von der KI angefertigt worden ist. „Trotzdem hat die Arbeit mit diesen KI-Werkzeugen Spaß gemacht, es war überraschend, was da oft mit der Eingabe von einem Satz oder nur höchstens drei Wörtern an Bildern rauskommt“, resümiert sie bei der Präsentation der Ergebnisse der Workshops.
„Die KI wird die Zukunft sein und wir werden sehr abhängig von ihr sein! Deswegen sollten wir uns jetzt schon mit der KI beschäftigen, um herauszufinden wie sie funktioniert, was sie gut machen, was sie nicht gut machen kann, damit wir sie positiv einsetzen können!“, wurde bei den Präsentationen Emanuel zitiert. Er ist jugendlicher Leiter bei Hobby Lobby und Co-Workshop-Leiter des Medienlabors.
„Es waren sehr coole und spannende Workshops! Die Jugendlichen zeigten Interesse und hatten viel Spaß mit den KI-Gestaltungsmöglichkeiten. Sie setzten sich auch sehr reflektiert und kritisch mit KI auseinander“, meinte der erwachsene Workshop-Leiter Markus Toth.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr Frauen das Leben klaut!“ Diesen Spruch riefen Freitag um die Mittagszeit Dutzende Jugendliche der AHS-Oberstufe Geringergasse in Wien-Simmering zwischen den großen metallenen Buchstaben die gemeinsam „Information“ ergeben und der Glasfassade dieser Schule, die neben der eigenen noch eine Handelsakademie beherbergt.
Die allermeisten Gymnasiast:innen der 6. bis 8. Klasse strömten in der Pause vor der vierten Schulstunde vor ihr Gebäude, viele hielten handgeschriebene Plakate auf Karton oder weißem Papier hoch. Mit vielfach bekannten, aber auch neuen, kreativen Variationen von Sprüchen gegen Gewalt an Frauen und deren Spitze des Eisbergs, Femizide. Die Bandbreite reiche von „Gewalt hat viele Gesichter, oft ist es ein bekanntes“, „Man(n) tötet nicht aus Liebe“, „Girls just wanna have fun(damental human rights)“ bis „Femizide sind die Probleme von allen“.
„Wir sind heute laut, weil Schweigen tötet, weil Wegschauen tötet und weil Ignoranz tötet. Dieser Protest ist für Gerechtigkeit, für Schutz, für ein Leben ohne Angst. Und wir hören nicht auf, bis Gewalt gegen Frauen beendet ist!“, rief Schulsprecherin Lea Schraufek, verstärkt durch ein Megaphon aus der Schuldirektion, die die Aktion ebenso unterstützt wie so manche Lehrer:innen – mit Plakaten oder mit Bodenmalkreiden. Und so wurden sogar auf dem regennassen Boden sichtbar manche der Plakat- und Sprech-Chor-Losungen von Jugendlichen aufgemalt.
„Die Aktion war spontan innerhalb von wenigen Tagen von Schüler:innen der Peer-Mediations- bzw. Projektmanagement-Teams ausgegangen“, berichtet die schon genannte Schulsprecherin Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… „Wir haben die Aktion nur für Schülerinnen und Schüler der sechsten bis achten Klassen zugänglich gemacht, weil die ja nicht mehr schulpflichtig sind und selber entscheiden können, ob sie mitmachen oder nicht. Am Mittwoch hatten wir dann noch einen gemeinsamen kreativen Plakatmal-Termin angeboten.“
Die Schulsprecherin machte in einer kurzen Rede auf einige der erschreckenden Fakten aufmerksam, dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen ist. Dass dies sich vor allem aber nur dann ändern wird, wenn es nicht ein „Frauenthema“ bleibt, sondern Männer sich gegen gewalttätige Handlungen ihrer Geschlechtsgenossen engagieren, stellten teilnehmende Burschen mit unterschiedlichsten Plakaten klar. Vom bekannten „Man(n) tötet nicht aus Liebe“ bis zu einer schnell hingekritzelten Penis-Zeichnung mit der Frage „Rechtfertigt das Deine Gewalt?“
Schon die Tage vor dieser Aktion gab es dann in den Oberstufenklassen so manche Diskussionen zum Thema, die Plakate sollen im Schulhaus angebracht werden, um es nicht bei dem einstündigen Streik zu belassen, sondern noch länger und intensiver darüber zu diskutieren.
Gesprächsrunde mit einigen Schüler:innen in einem weiteren Beitrag.
Eine andere Schule, die Marketing-Handelsakademie im steirischen Fürstenfeld, beteiligte sich schon vor zwei Wochen an der internationalen Aktion „16 Tage Gegen Gewalt an Frauen“ (25. November bis 10. Dezember) mit Plakaten, einem Banner an der Schulfassade „Stoppt Gewalt gegen Frauen“ und einem beeindruckenden rund 1½-minütigen YouTube-Video – unten verlinkt.
Nach den ersten 20 Sekunden, in denen eine Jugendliche über diese Gewalt als großes, fast unsichtbares Problem spricht, kommt’s im ersten Moment zu einer Art irritierendem Mansplaining: Ein Bursch grätscht ins Bild: „Stopp! …“
Doch es kommt tatsächlich ganz anders. „Das ist kein Frauenthema, das ist jetzt reine Männersache!“, bringt er ins Spiel. „Wir Männer sind das Problem und deshalb auch Teil der Lösung…“ Später meint ein Kollege: „Wenn wir nicht eingreifen und nicht widersprechen und einfach nur wegschauen, dann werden wir Teil des Problems…“

Nach der Streikstunde traf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… noch einige Jugendliche, vor allem der 6A, aber auch einige aus der achten Klasse zu einer Interviewrunde. „Vor allem die jüngste Geschichte, wo ein Mädchen das SOS-Notzeichen gemacht hat und der Stiefvater dann doch freigesprochen worden ist, aber auch die Aktion der Wiener Linien (Aufkleber auf Sitzen in U-Bahnstationen: „Kein Platz für Gewalt“) hat uns dazu gebracht, dass wir auch in der Schule ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen wollten“, eröffnet Laura den Gesprächsreigen. „Die Initiative ist von der Schulsprecherin ausgegangen“ – siehe Reportage über die Aktion, unten verlinkt.
Die 6A begann mit der Diskussion darüber in einer unverbindlichen Übung, rasch kam’s zu vielen Ideen und einer gemeinsamen Plakatmal-Aktion Mitte der Woche aller interessierten Oberstufen-Schüler:innen. In den Gesprächen sei vor allem auch „Cat-Calling“ (sexuell aufgeladene Anmachsprüche) immer präsent gewesen, „weil viele von uns das immer wieder erleben“, tönt es aus der Runde. Sara zählt eigene und andere Beispiele auf – von penetranter Anmache älterer Männer im Fastfood-Restaurant über körperbetonte Sprüche in der Physiotherapie bis zu handgreiflichen Übergriffen dabei. Andere berichten von sexuellen Übergriffen eines jugendlichen Cousins auf die damals Siebenjährige.

Als Bursch schäme er sich sehr oft für das Verhalten seiner Geschlechtsgenossen meinte der 8-Kläss’ler Raphi. „Solches Verhalten und die Ängste der Mädchen sind die Schuld von Männern, aber eben dieser Männer und nicht von allen.“
Wie er reagiere, wenn er solches wahrnehme, wollte KiJuKU wissen. „Es kommt darauf an, je näher dir so einer ist, desto leichter fällt es zu sagen: Das geht so gar nicht!“
Der Reporter will von der Runde noch wissen, ob die Jugendlichen nun das Gefühl haben, doch ein bisschen was bewirkt zu haben, dass gerade die angesprochenen Belästigungen auch breit thematisiert worden sind.
„Das war schon gut so vor der Schule, aber ich fände es besser so eine Aktion zum Beispiel auf der Simmeringer Hauptstraße zu machen, wo es doch viel mehr Leute sehen und hören“, resümiert Sara abschließend.
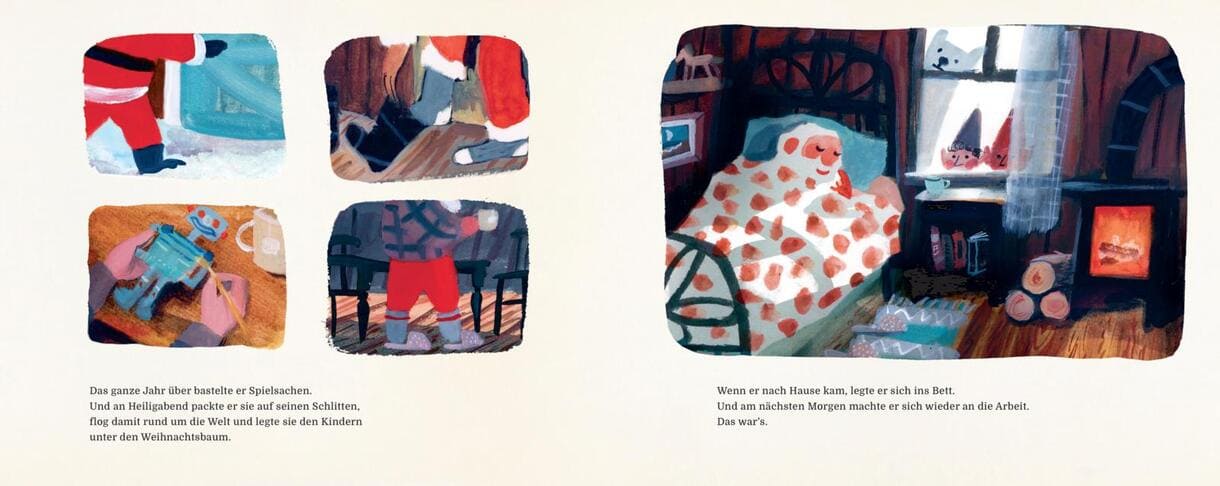
Ob Christkind oder Weihnachtsmann ist eine Art Glaubensfrage. Jedenfalls existieren einigermaßen mehr (Bilder-)Bücher über die männliche Version der 8angeblichen) Gabenbringer:innen. Mann mit weißem Bart, rotem Mantel und ebensolcher Mütze, Schlitten, gezogen von Rentieren. Flug um die Welt…
Dieser eine 24-Stunden-Tag erfordert aber viel Vorarbeit – von ihm, Mitarbeiter:innen wie Wichtel, Elfen und so manchen Tieren. „Der Weihnachtsmann feiert kein Weihnachten?“, fragt Mac Barnett (Übersetzung aus dem Englischen: Bernadette Ott) im Bilderbuch „Ein Fest für den Weihnachtsmann“.
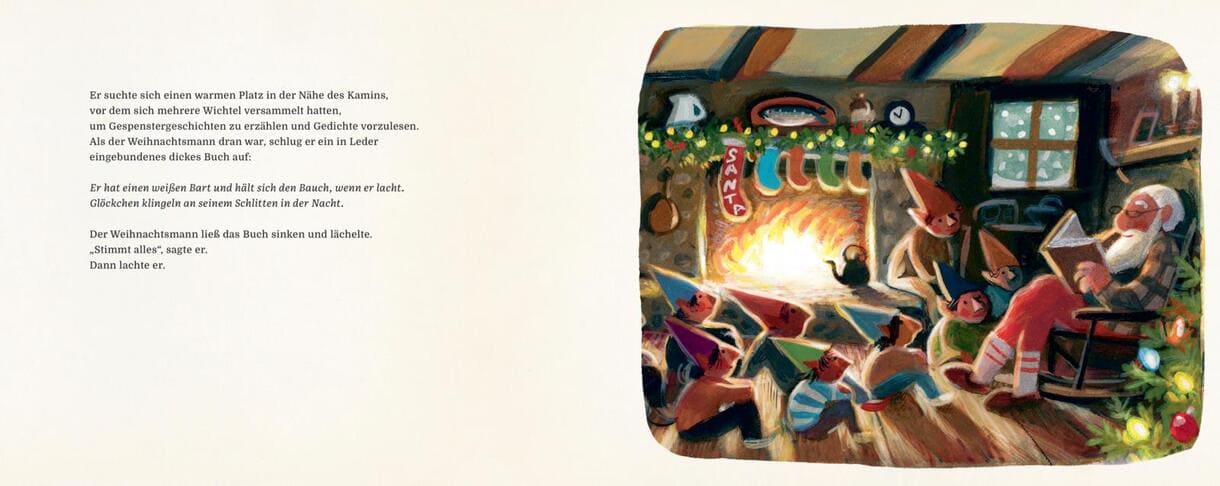
„Er schläft aus“, sagten die Wichtel über den Tag nach Weihnachten. „Eine halbe Stunde länger als sonst.“ Das scheint dem Eisbären nicht genug und so bringen die Wichtel an diesem Tag dem Weihnachtsmann Frühstück ans Bett. Dann wollte er sein Tagwerk beginnen – Vorbereitungen fürs nächste Weihnachtsfest.
Nix da, meinten die Helfer:innen…
… und so begannen sie mit ihrem Chef ein Weihnachtsfest für den Weihnachtsmann vorzubereiten – mit einem überraschenden Gabenbringer – ähnlich gekleidet, nur doch größer. Im Text wird nicht verraten, um wen es sich handelt. Aber in den gemalten Bildern des kanadischen Illustrators Sydney Smith sehr wohl – womit du’s dann auch weißt. Die Bilder, die mehr als einen Hauch von Kinderzeichnungen aufweisen, bringen viel zauberhafte winterweihnachtliche Stimmung auf die Doppelseiten.
Übrigens Smith hat im Vorjahr – gemeinsam mit dem österreichischen Autor Heinz Janisch -den wichtigen, berühmten nach dem dänischen Märchendichter Hans Christian Andersen benannten Preis bekommen.

Auch wenn es „Die Weihnachtsgeschichte“ heißt und sich diese Erzählung von Charles Dickens rund um dieses – demnächst bevorstehende – Fest dreht, ist sie doch viel mehr: Gier, die zu Hart- und Kaltherzigkeit führt; und sich doch sogar im fortgeschrittenen Alter noch ändern lässt.
Im mittlerweile zehnten Jahr spielt, singt und tanzt ein teatro-Ensemble eine Musicalversion dieser Geschichte, die der bekannte britische sozialkritische Autor 1843 unter dem Originaltitel „A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost-Story of Christmas“ (Ein Weihnachtslied in Prosa, oder Eine Geistergeschichte zum Christfest) erstmals veröffentlichte. Noch bis 23. Dezember ist dieses rund 2½-stündige immer wieder mitreißende schwungvolle Plädoyer für Empathie zu erleben.
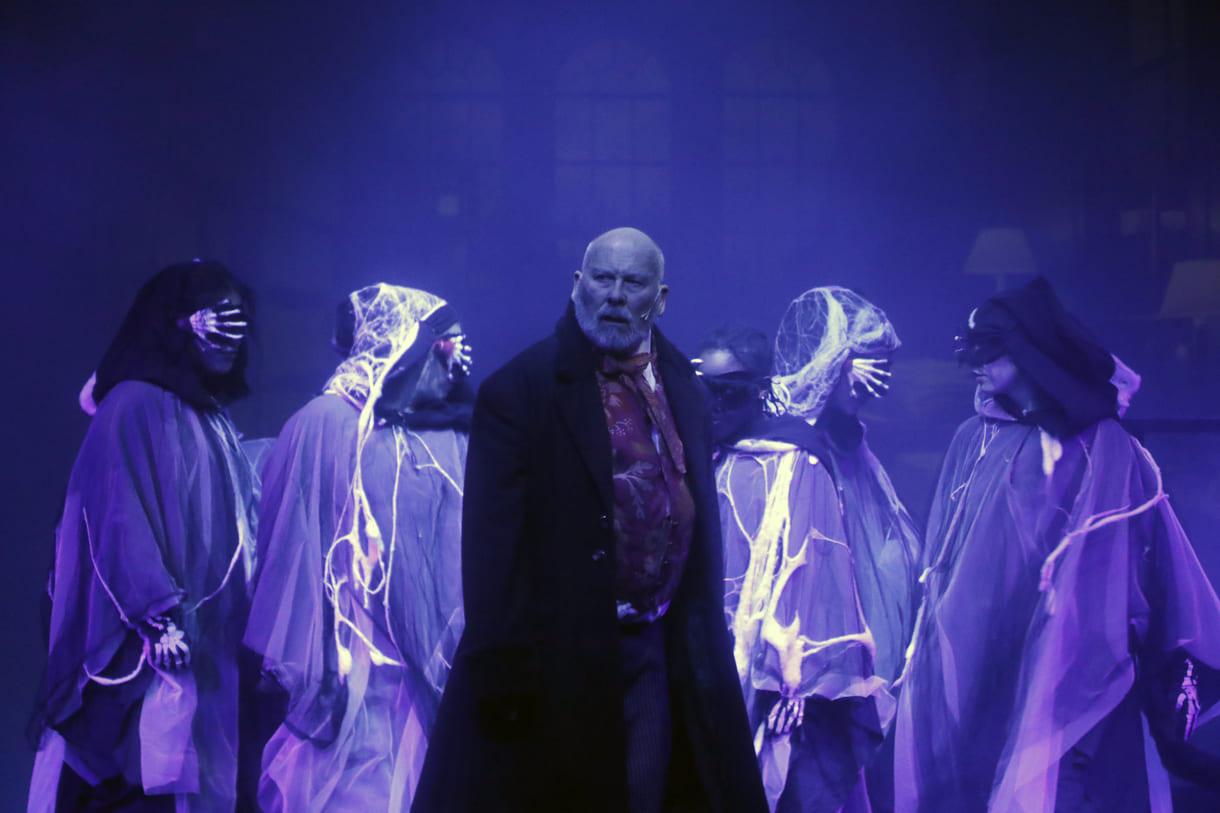
Knapp für jene, die Dickens‘ Geschichte nicht kennen die Handlung: Ebenezer Scrooge schaut nur auf das Geld seiner Firma, will keine Zeit für Freundlichkeiten „verschwenden“. Verwandtenbesuche zu Weihnachten hasst er ebenso wie das Festüberhaupt. Seiner Untergebenen, den so behandelt er seine Mitarbeiterin, gibt er zum Fest nur frei, weil er ihr enttäuschtes Gesicht nicht sehen will. Und dann erscheinen ihm der Reihe nach drei Geister – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Die Vergangenheit lässt ihn in seine Kindheit reisen. Der junge Schüler Ebenezer hat einen Aufsatz voller Empathie geschrieben! Doch der Jugendliche bzw. junge Erwachsene schon lässt seine Freundin zu Weihnachten sitzen, weil er sich um seine Geschäfte kümmern muss. Die Zukunft? Er wird sterben wie alle, aber niemand wird um ihn trauern, ja eher froh sein, dass der Geizkragen nicht mehr lebt.
Und so… – eben Happy End, nachdem er erkennt „was bin ich nur für ein Mensch geworden?!“ Der Erkenntnis folgen Handlungen – mit anderen feiern, die notwendigen teuren Medikamente für ein schwer krankes Kind zu finanzieren…

Im großen Globe-Wien-Theater in der Marx-Halle applaudierte das Publikum praktisch nach jedem Song. Gesang und Tanz rissen die Zuschauer:innen mit, Schauspiel zog es in seinen Bann. Aber alles andere als nur happy, denn in vielen Momenten jener Phase in denen Scrooge so grausam zu anderen – und spürbar auch zu sich selbst – handelt, berührt das Spiel auch sehr, schnürt fast – auch wenn klar ist, dies ist „nur“ Bühne – die Kehle zu. Das schafft Peter Faerber, die diese Rolle von Anfang an verkörpert(e). Damals hätte Niklas Petzer noch gar nicht Eby, den Ebenezer Scrooge als Schulkind, spielen können. Denn er ist heuer erst 14, steht aber nun im zweiten Jahr in dieser Rolle, in der Professionalität in nichts seinem viel älteren, jahrzehntelangen Kollegen um nichts nach.

So manche der Kinder und Jugendlichen, die bei – oder nicht selten erst durch – teatro zu spielen, singen und tanzen beginnen, machen dies später auch zu ihrem Beruf. So ist Lili Beetz nun schon im zweiten Jahr ihres Bachelor-Studiums Musikalisches Unterhaltungstheater an der MuK (Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien). Heuer gibt sie Belle – und das entsprechend wandlungsfähig. Sie ist – bei der Reise in die Vergangenheit die Freundin des jugendlichen Ebenezer (Im Globe Wien: David Mannhart für den erkrankten Timo Petz) und in der Gegenwart eine eben ungefähr gleich alte Frau wie Scrooge. Während Ebenezer in den drei Altersstufen von drei Darsteller:innen verkörpert wird, schlüpft Lili Beetz sowohl in die Rolle der sehr jungen als auch der alten Frau.

In den ersten vier Jahren der teatro-Version der „Weihnachtsgeschichte“ (Buch: Norbert Holoubek) spielte sie Timmy – den Tiny Tim bei Charles Dickens, das kranke Kind der von Scrooge schlecht behandelten Mitarbeiterin Mrs. Cratchit (Lena Mausser, die auch die Lehrerin gibt und heuer Regie führte).
Auch wenn hier im Text nicht alle Mitwirkenden genannt werden, so seien dennoch einige noch unbedingt erwähnt: Für die Choreografie sorgte Rita Sereinig, als Dance Captain agiert Emily Fisher, die von der Nichte Laureen in Cathleen Fezziwig und einen Tanzgeist wechselt. Für die passenden, üppigen Kostüme zeichnet – wie immer – Brigitte Huber und für die Maske Renate Harter verantwortlich.

Was die teatro-Aufführungen auch auszeichnet: Live spielt auf der Bühne ein kleines Orchester: Klavier: Walter Lochmann, der auch die Arrangements zu dem Kompositionen von Norberto Bertassi (auch Intendanz, Bühnenbild sowie Scrooges Vater und einen Arzt spielt) schrieb; Gitarre: Wilfried Modlik; Bass: Stephan Först; Violoncello: Elisabeth Zeisner; Querflöte: Katrin Weninger; Percussion: Wolfgang Wehner.

Zum zweiten Mal gastierte teatro damit im gut gefüllten Wiener Globe Theater. Die Gruppe verbindet seit mehr als einem ¼ Jahrhundert Kinder, Jugendliche und erwachsene Profis zu einem harmonischen Ensemble, in dem die Jungen und Jüngsten gleichwertig agieren; so manche aus diesem Kreis schlagen dann auch eine professionelle Karriere ein, wie nicht zuletzt Moritz Mausser. Der Falco-Darsteller im Wiener Ronacher und nun in der Rolle von Maria Theresias Gegenspieler Friedrich II hatte bis vor drei Jahren

„In Zeiten, in denen Menschen weltweit mehr auf ihre Differenzen als auf ihre Gemeinsamkeiten achten, in denen Krieg und Armut herrscht, in denen gespaltet statt geeint wird, wäre es schön, wenn die drei Geister der Weihnacht unserer Geschichte vielleicht nicht nur den grantigen, geizigen Scrooge heimsuchen, sondern auch mal wieder durch die Welt fliegen und einigen anderen Menschen einen Besuch abstatten. Vieles könnten Sie doch lernen, von Nächstenliebe bis hin zu der Freude an den kleinen Dingen im Leben, und sich vielleicht wie Scrooge doch noch ändern“, schreibt Lena Mausser, Regisseurin – und wie schon erwähnt in den Rollen der Lehrerin sowie der von Scrooge unterirdisch behandelten Mitarbeiterin Mrs. Crachtit – der Jubiläums-Aufführungsserie im – wie immer – umfangreichen, lesenswerten Programmheft.
familien-musicals-scrooge-mal-2 <— damals noch im Kinder-KURIER
geht-s-dem-geizkragen-an-den-kragen <— auch noch im KiKu
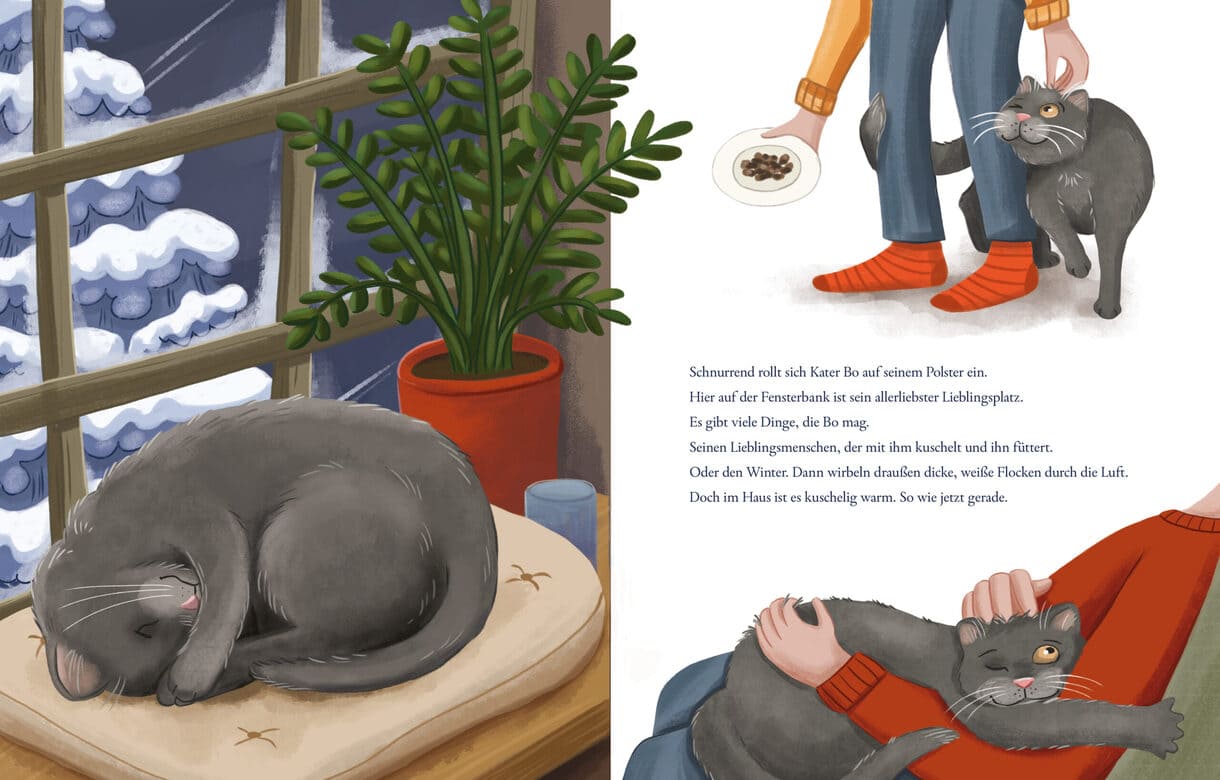
„Schnurrige Weihnachten“ zeigt von Lieblingsmenschen nur Füße und Hände und rückt die Sicht des wohnungsbesitzenden Katers und einem neuen Kätzchen ins Zentrum von Text und Bildern.
Und hier noch eine Besprechung eines (vor-)weihnachtliches Buches mit vielen Bildern. Schon der Titel „Schnurrige Weihnachten – Bo und Flöckchen warten aufs Christkind“ und natürlich das Cover verraten, dass zwei Katzen im Mittelpunkt der Geschichte von Christine Auer (Text) und Kristin Pfannkuchen (Illustration) stehen.
Hin und wieder kommt der Lieblingsmensch von Kater Bo vor – aber nur auf drei der zwölf Doppelseiten sind ein Teil der Arme und Beine von diesem zu sehen. Ansonsten spielt sich alles unter den Katzen ab. Und das ist anfangs gar nicht so einfach. Bo ist alles andere als erfreut, als eines Tages ein Korb mit einem kleinen weißen Kätzchen steht – samt vielen Umzugskartons und einem zweiten Menschen, der bisher öfter schon zu Besuch war. Da aber ohne Vierbeiner.

Und dann will dieses quietschvergnügte, ausgelassen herumspringende und -laufende Kätzchen namens Flöckchen noch mit lauter Glitzerzeugs das ganze Haus weihnachtlich schmücken. Das passt Bo, dem Hausherren, so gar nicht. Als eines Tages Flöckchen mit ihrem Lieblingsmenschen außer Haus ist, verräumt Bo alles in seinem Versteck.
Doch statt nun froh zu sein, plagt den Kater schlechtes Gewissen, als er die heimkommende Katze ur-traurig sieht – und erlebt.
Und so kommt wie’s kommen muss ein Happy End. Bo rückt den Weihnachtsschmuck wieder raus. „Als Bo sieht, wie sich Flöckchen freut, wird ihm ganz warm vor Glück…“


(Vor-)Weihnachten heißt in vielen Theatern: Ein Stück für Kinder muss ins Programm. Schon lange nicht mehr immer eines, das mit dem bevorstehenden Fest und seiner Geschichte zu tun hat. Aber sehr oft jedenfalls ein Klassiker – entweder Märchen oder bekannte (Kinderbuch-)Figuren. Das Theater Forum Schwechat (übrigens mit der S-Bahn wirklich schnell von Wien aus erreichbar) baut sich seit einigen Jahren jeweils einen eigenen witzigen Märchen-Mix, aufgepeppt mit Musical-Einlagen.
Heuer (2025) ist es „König Drosselbart leicht verhext!“. Die Grundgeschichte dieses Märchens bleibt: Eine hochnäsige, eitle, überhebliche, alle anderen Menschen abwertende Prinzessin. Ein König, der sich in sie verliebt, den sie genauso erniedrigend abweist. Und ein Fluch, der sie dazu verurteilt, den nächstbesten Bettler zu heiraten und unter ärmlichen Verhältnissen leben zu müssen. Und natürlich, wie sich’s für ein Grimm’sches Märchen gehört: Happy End. Die verstoßene Prinzessin lernt Mitgefühl und der „Bettler“ entpuppt sich als – eben König Drosselbart…

Hier spielt sich’s in 1¼ Stunden, gewürzt mit eigenen Songtexten zu Melodien bekannter Hits, unter anderem zwei von ABBA (Details, siehe Info-Box) natürlich ein bissl anders ab. Abgesehen davon, dass die Prinzessin wenigstens einen Namen kriegt – Glinda (gespielt von Nadine Schimetta) – ist sie eine Internet-Celebrity. Aber sogar das bewerkstelligt sie nicht selber. Dafür hält sie sich eine Untergebene: Influencer-Schlumpfine. In deren Rolle springt die künstlerische Leiterin des Theaters, die sich auch – wie immer – die Geschichte ausgedacht und Regie geführt hat, ein (der vorgesehene Schauspieler, David Kieber, ist länger erkrankt). Die Influencerin filmt aber nicht nur ihre Chefin, sehr häufig dreht sie die Kamera-Ansicht und setzt sich selbst zentral und groß ins Bild.
Und dies geht technisch ausgetüftelt über die Bühne. Schlumpfine spielt nicht nur, als würde sie filmen, sie tut es mit einem Smartphone tatsächlich live. Die Bewegtbilder werden auf zwei senkrechte große Monitore überspielt – Zwischenstation einer von zwei Laptops, von dem aus dies gesteuert wird. Vom zweiten aus landen – teils KI-generierte – Bilder und Animationen als „Kulisse“, beispielsweise viele getöpferten Vasen und Töpfe, in einem Regal (Bühnenbild und diese Video-„Zauberei“: Thomas Fischer-Seidl sowie Werner Ramschak, Daniel Truttmann, Jakobus van Ederen, Manuela Seidl, Amy Parteli).

Zurück zum Schauspiel: Neu – im Gegensatz zum Original – ist eine grüne Hexe namens Elphaba (Amy Parteli), gleichzeitig die beste Freundin von Drosselbart (Mirkan Öncel). Sie ist es, die Glinda, nachdem sie Drosselbart als 10.000 Heirats-Bewerber gedemütigt hat, dazu verzaubert, sich dem besagten Bettler anzuschließen. Obendrein verhext sie die eigentlich selber Möchte-gern-Influencerin Schlumpfine zum Handy-Entzug.

Hier ist es übrigens nicht der Vater der Prinzessin, sondern ihre Mutter, auch die bekommt einen Namen, Marlene (gespielt von Sandra Högl), die an ihrer Tochter verzweifelt, auch wenn sie gleich in der Eingangs-Szene ein nicht unähnliches Verhalten vor dem großen Spiegel vorlebt. Drosselbart hat hier ebenfalls eine in Erscheinung tretende Mutter, Königin Nathalie (Sabrina Zettl).
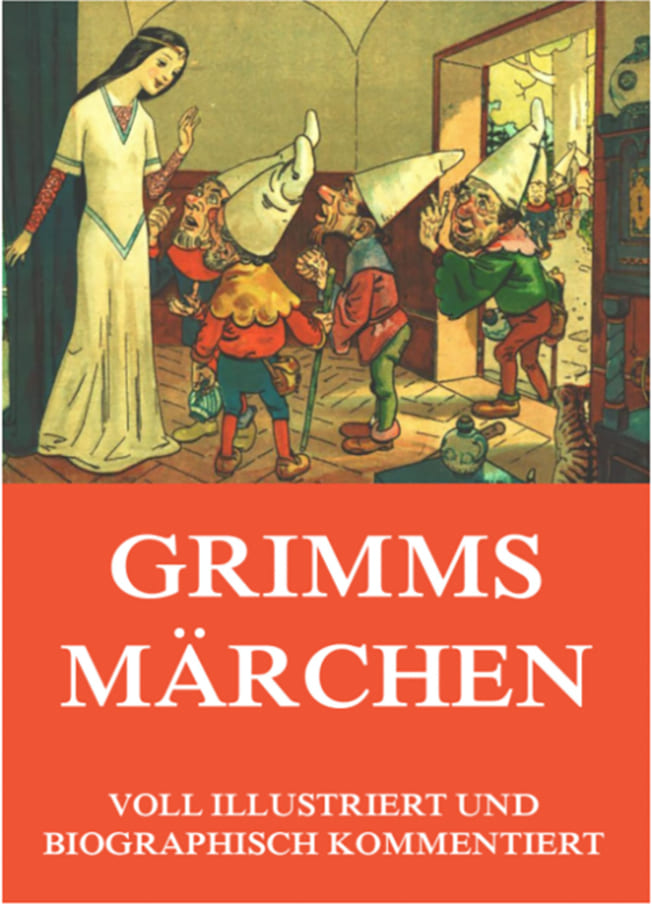

Seit 30 Jahren und damit fast sein halbes Leben schlüpft der bekannte Autor Thomas Brezina im Advent in die Rolle eines Art Weihnachtsmanns, bringt Kindern in der Klinik Ottakring (vormals Wilhelminenspital) Bücher – Und Zeit für das eine oder andere Gespräch mit jungen und jüngsten Patient:innen. Aber auch der Gabenbringer fühlt sich selber beschenkt – durch die Freude der Kinder.
Die Aktion gemeinsam mit den Kinderfreunden war heuer zum runden Jubiläum noch ein bisschen größer – von der Begleitgruppe von Funktionär:innen und mit einem aufblasbaren 3er und 0er für Fotos neben und unter einem geschmückten Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Krankenhauses. Die Dutzenden Bücher wurden von den Verlagen G & G, Joppy und edition a zur Verfügung gestellt.
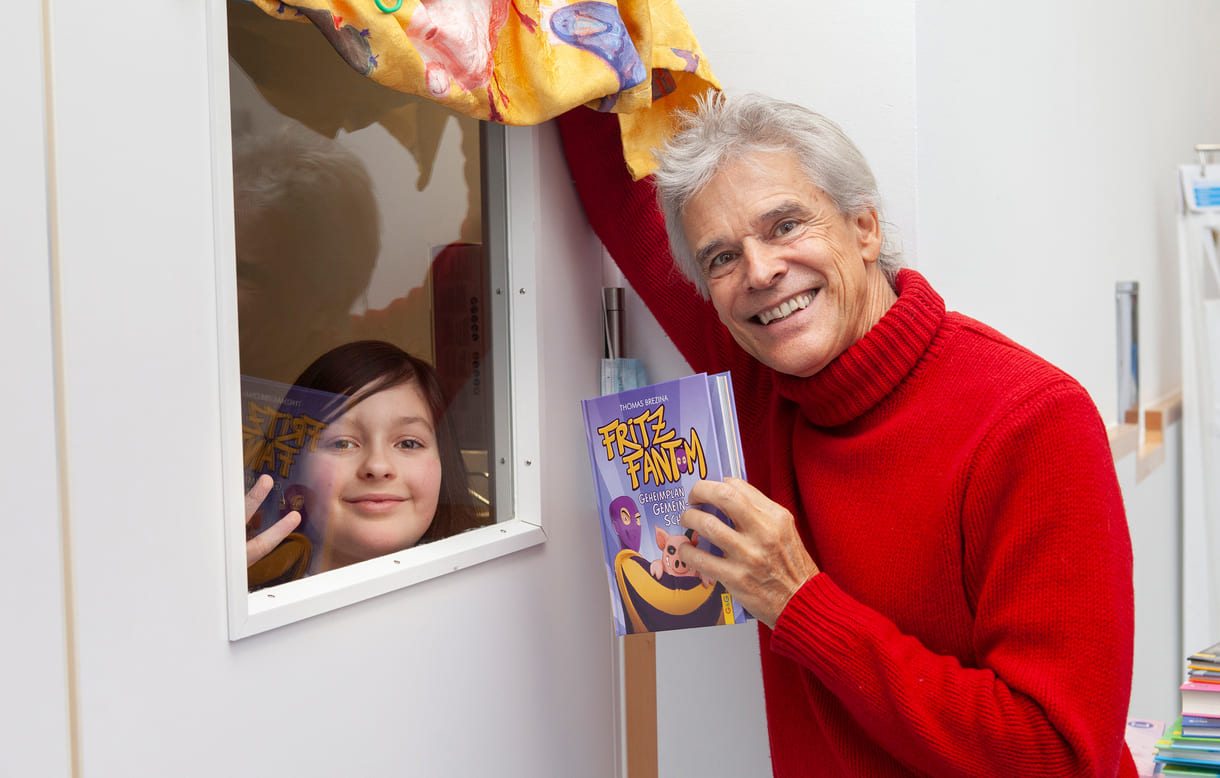
„Dass wir nun schon seit drei Jahrzehnten Kinder in der Klinik Ottakring besuchen dürfen, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Die Freude der Kinder ist jedes Jahr aufs Neue ein riesiges Geschenk. Besonders berührt mich, dass mich heute Erwachsene ansprechen, die damals als Kinder hier lagen und sich noch an meinen Besuch erinnern. Mein größter Respekt gilt allen Mitarbeiter:innen der Kinder- und Jugendabteilung, die so viel dafür tun, dass sich Kinder und Eltern im Krankenhaus wohlfühlen. Es ist wunderbar, dass wir mit dieser Aktion seit so vielen Jahren Freude bereiten können“, erklärt Thomas Brezina in einer Medien-Aussendung der Wiener Kinderfreunde.
Margarethe Maurer, Bereichsleiterin Pflege der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Ottakring, betont die besondere Bedeutung des Jubiläums: „Die Kinder freuen sich jedes Jahr sehr. Wenn Thomas an ihr Krankenbett kommt und sich mit ihnen unterhält, gibt es immer leuchtende Augen. Wir bedanken uns herzlich für diese jahrzehntelange Treue und die unvergesslichen Momente für unsere Kinder und ihre Eltern.“

„Diese schöne gemeinsame Aktion mit Thomas Brezina ist das Highlight unserer alljährlichen Weihnachtsbuchaktion. Seit den frühen 50er Jahren schenken die Kinderfreunde Bücher an Tausende Kinder und ermöglichen ihnen in Wien den Besuch eines Kinder(freunde)Musicals im Raimund Theater“, erklärt Nationalratsabgeordneter Christian Oxonitsch, Vorsitzender der Wiener Kinderfreunde. Apropos: Mehr zum diesjährigen Musical-Geschenk für rund 6000 Kinder in mehreren Vorstellungen in einem KiJuKU-Bericht am Ende des Beitrages verlinkt.
Vor elf Jahren, 2014, begleitete der Kinder-KURIER, Vorläufer von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Brezina bei seinen Krankenbesuchen in der Kinderabteilung des Krankenhauses im 16. Bezirk in Wien. Auf die Reporter-Frage, warum er bei dieser Aktion mitmache, meinte Brezina: „Ich komm jedes Jahr echt sehr gerne her, weil dieses Krankenhaus eine Atmosphäre ausstrahlt, dass es den Kindern und Jugendlichen hier gut geht und die Kinder sich über meinen Besuch, die Bücher und die Gespräche freuen. Und an dieser Freude teilhaben zu können, freut natürlich auch mich.“ (kiku.at – 2014; gesamter Beitrag unten ebenfalls verlinkt).
brezina-als-weihnachtsmann-im-wiener-wilhelminenspital <– damals im Kinder-KURIER

Der samtrote Vorhang wird zur Seite geschoben und auf der Bühne: Nichts als Wäscheleinen, behängt mit Socken, Geschirrtüchern, Kleinstkindergewand und einem riesigen Leintuch und Teebeutel (?). Rätselnde Blicke zu Beginn eines nicht ganz einstündigen Programms dreier Duos im „erstbesten Theaterhaus für Clownerie, dem Theater Olé in Wien-Landstraße.
Doch das erste Duo versteckt sich nicht zwischen oder hinter den Wäschestücken und den doch irritierend hier hängenden Teebeuteln. Aber clowneske Schauspieler:innen machen so manch scheinbar verrückte Dinge 😉

Christoph Singewald und Odilia Hochstetter als Kuno und Gloria tauchen dann von hinter dem Publikum auf – das darf gespoilert werden, noch sind keine weiteren Termine bekannt. Mit einem Wäschekorb. Und natürlich kommt’s beim Abhängen zu ziemlichem Chaos. Kleidungsstücke wie zwei Hosen werden von dem beiden zu eigenem Leben erweckt, die durch die Welt wandern. Und nachdem sie einmal erwähnen, sie müssten da jetzt eigentlich schnell die Wäsche im Korb verstauen, um die Bühne für das Theater frei zu machen, ruft mindestens eines der Kinder immer wieder „nicht stressen!“. Hin und wieder aber ergänzt von einem „ihr müsst noch aufräumen!“ Womit jene Kinder, die spontan reinrufen mindestens so viel Lacher kriegen wie die Bühnen-Clown:innen. Immerhin haben sie so ge-checkt, dass Clownerie nicht selten von Widersprüchlichkeiten lebt.
Das Prinzip von Gegensätzen, die – entsprechend gespielt – für viel Lachen sorgen, setzen die folgenden beiden Duos als scheinbare Gegner:innen. Zunächst schlüpfen Emanuelle Bidaud und Brigitte Cwickl als Dores und Bridget in die Rollen von Polizei und Verbrechen. Die Verbrecherin sorgt – trotz Bemühungen – nicht und nicht dafür, dass sich das Publikum fürchtet. Bitte, eher sogar bettelnd: „könnt’s euch ned a bissl fürchten!“
Erst als die Polizistin die insbesondere jungen und jüngsten Zuschauer:innen bitte, wenigstens so zu spielen, dass ihr euch fürchtet. Das gelingt, auch wenn insbesondere die Kinder mehr als nur durchblitzen lassen, dass sie ihre Angst mehr als übertreiben spielen…
Widersprüchlich auch die Ausgangsbasis für Duo Nummer 3 – alle sechs Clown:innen haben den zweisemestrigen Workshop des Theaters Olé absolviert: Alexander Czernin und Roman Seidl geben sich als Chef und Bauhackler, der auf die herrischen Anweisungen per Hand-zeigen da und dort was ausmessen muss. Bis das Maßband zum Blechsalat und gar zur Fessel für den Boss wird. Bis sie – wie auch das Duo zuvor einfach die Kopfbedeckungen tauschen – Bauhelm für den Chef und Polizeikapperl für die Verbrecherin…
Als gemeinsamen Titel für ihre dreiteiligen lustigen Duette verwenden sie den fast schon in Vergessenheit geratenen Begriff „Dreikäsehoch“ und fügen dem ein „in kariert und gestreift“ hinzu.
Wobei – wie Wikipedia weiß – dieser nicht nur „2007 zum drittschönsten bedrohten Wort der deutschen Sprache gewählt“ wurde, sondern vielleicht gar nix mit drei übereinander gestapelten Käselaiben als Größenangabe für Kinder zu tun haben könnte. „Andererseits wird vermutet, dass das Wort … vom französischen Wort caisse (deutsch: Kiste, Kasten) abstammt.“
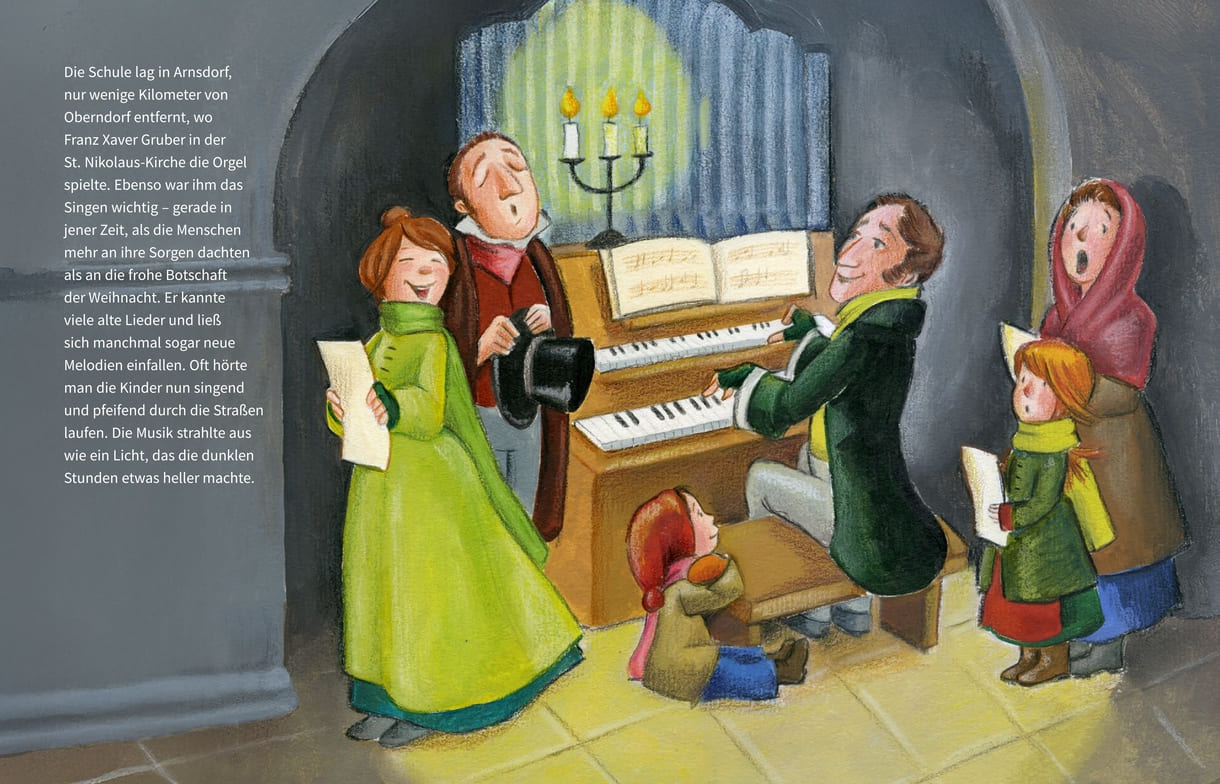
Demnächst wird – wie jedes Jahr – in vielen Wohnzimmern vor dem Nadelbaum mit Glas- Kunststoff- oder auch selbst gebasteltem Schmuck ausechten Strohhalmen eines der wohl berühmtesten Lieder der Welt gesungen. Zu Weihnachten gehört „Stille Nacht! Heilige Nacht!“
In mehr als 300 Sprachen bzw. Dialekte ist jener Text, den Joseph Mohr 1818 gedichtet hat – zur Melodie, komponiert von Franz Xaver Gruber -, übersetzt worden. Übrigens hat Mohr sechs Strophen geschrieben, meistens werden nur die ersten beiden und die letzte gesungen.
Aber alle sechs Strophen sind – und das gleich zwei Mal – Teil des Bilderbuchs. In wenigen, knappen Sätzen und großen bunten Bildern, im Stile alter künstlerisch angefertigter Kinderzeichnungen – wird die (mögliche) Entstehungsgeschichte von Text und Musik dieses Liedes geschildert. Armut und schwere Lebensbedingungen schienen – dem Buch zufolge – am 24. Dezember 1818 durch, mit und nach dem Singen dieses Liedes in der römisch-katholischen Kirche St. Nikola in Oberdorf bei Salzburg fast wie weggeblasen. Wenigstens für einig Stunden. So die Legende.
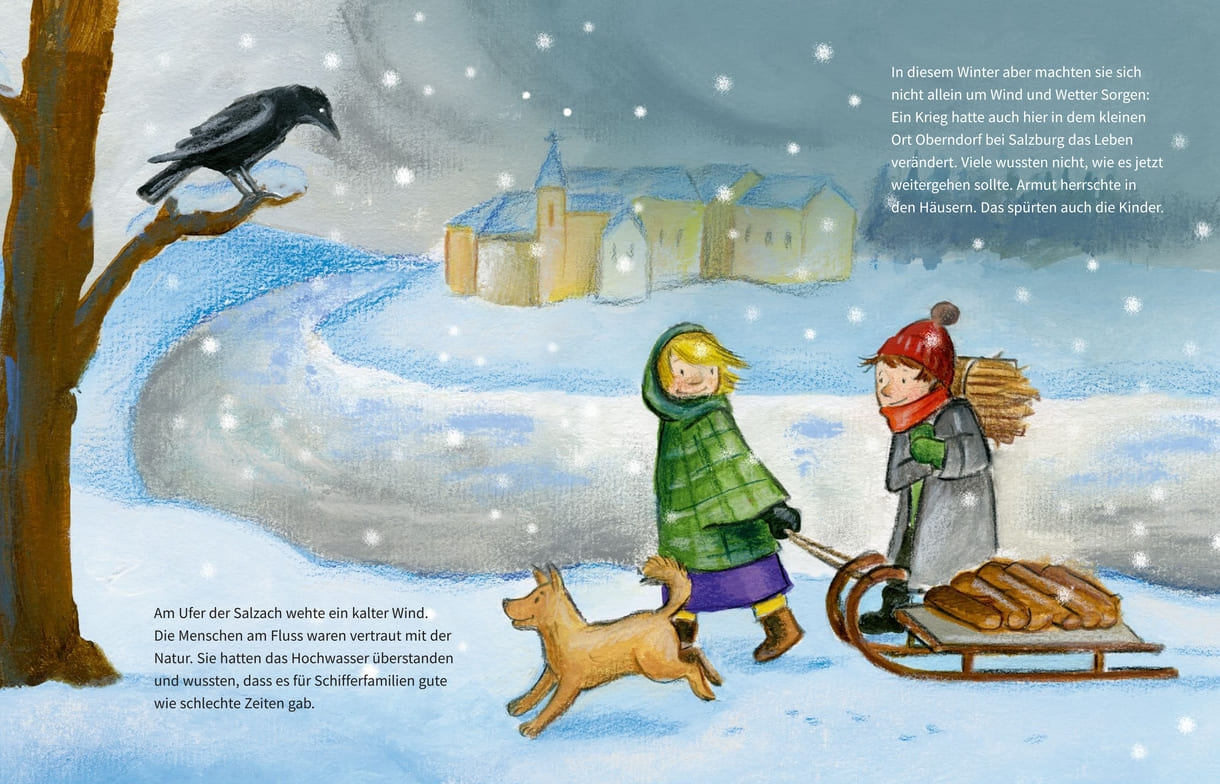
Übrigens erfahren wir aus diesem Bilderbuch, das heuer, zehn Jahre nach dem ersten Erscheinen, neu aufgelegt wurde, warum die Melodie sozusagen zu einem Ohrwurm geworden ist. „Die Orgel in St. Nikolaus war alt und beschädigt. Franz Xaver Gruber versuchte also, für das Gedicht eine einfache Melodie zu finden, die sich leicht mit der Gitarre begleiten ließ.“
Nachdem das Duo aus Textdichter und Komponist das neue Lied anstimmten, und alle in der Kirche zunächst andachtsvoll gelauscht hatten, „verwandelte sich die Stille in einen großen Gesang…“
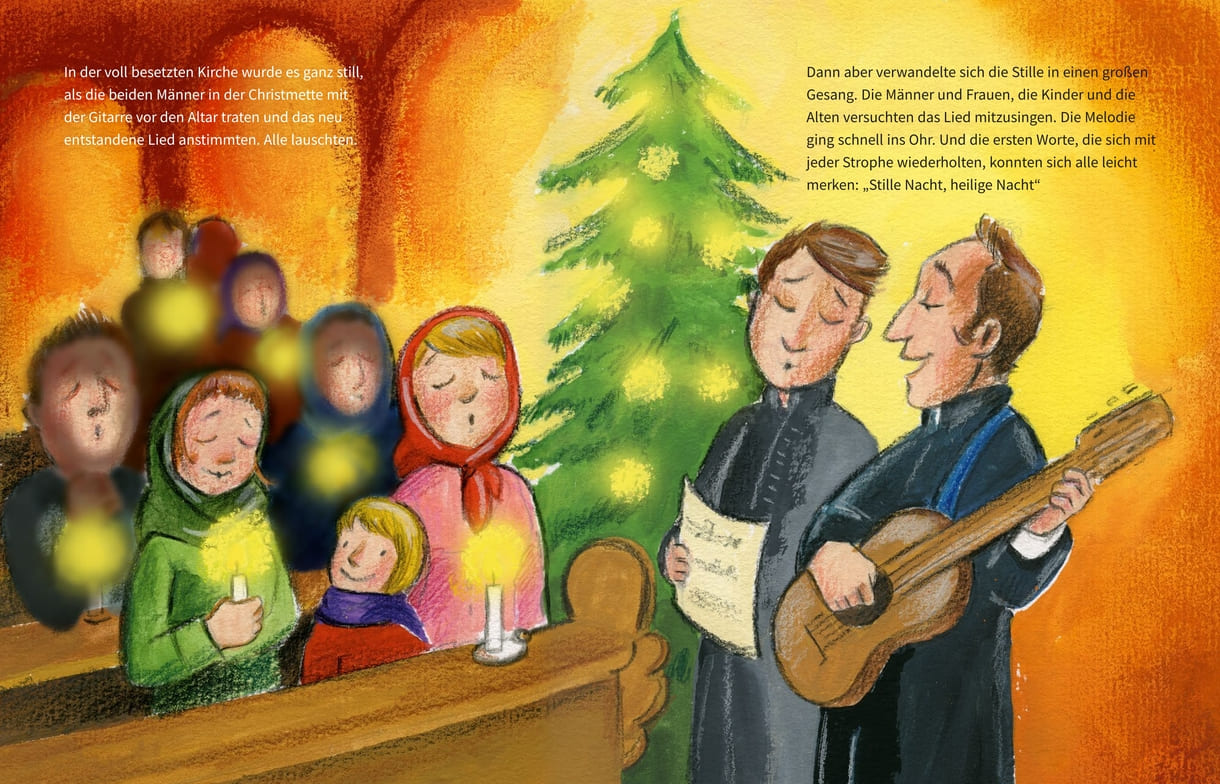
Die (ur-)alte Kirche wurde knapp mehr als 100 Jahre danach – nach dem ersten Weltkrieg (1914 – 1918) in langer Bauzeit (1924 – 1936) durch eine neu errichtete „Stille-Nacht-Gedächtniskapelle“ ersetzt. Vor fast 15 Jahren (2011) wurde das Lied von der für Bildung und Kultur zuständigen Organisation der Vereinten Nationen, UNESCO, zum immateriellen Kulturerbe in Österreich erklärt (Quelle: wikipedia, nicht das hier besprochene Bilderbuch)
Übrigens ist das Lied mit seinem Text so stark unter viiiielen Menschen in Hirn und Herz verankert, dass es den Nazis nicht gelungen ist, ihre Umdichtung, in der es unter anderem hieß, dass Adolf Hitler über alle wacht…, breit durchzusetzen!

Irgendwie trist die Bühnen-Szenerie, wenn das Publikum den Theaterort betritt: eine von einer hölzernen Bande U-förmig umgebene Bühne mit 15 leeren Sesseln. Nicht ganz leer – über den Lehnen hängen rote Uniformjacken. Hinter der Bande im vorderen rechten (vom Publikum aus) Eck dann doch drei Menschen in ebensolchen Blazern (Bühne und Kostüm: Rosa Wallbrecher; die uniformen Jacken sind eine Spende der Blasmusikkapelle „Harmonie“ aus dem Schweizer Wettingen-Kloster).
Das Schauspiel beginnt mit der Begrüßung zur Versammlung des Vereins, Feststellung der Beschlussfähigkeit und dem Hinweis, dass eigentlich 15 Minuten gewartet werden müsste, um verspäteten Vereinsmitgliedern die Möglichkeit zur Teilnahme zu gewähren.
Nein, das Publikum muss nicht warten, in Übereinstimmung mit diesem wird auf diese ¼ Stunde verzichtet und die erste Abstimmung – samt Publikum – kann starten. Es geht um die – wie der Stücktitel dieser österreichisch-schweizerischen Koproduktion schon verspricht – „Rettung der Blasmusik“.

Von manchen noch immer mit dem Vorurteil behaftet, überholt, von gestern, sehr konservativ, hat sie sich schon lange aus dieser Ecke gespielt. Das musste auch die ÖVP im Frühjahr 2024 beinahe leidvoll erfahren. In ihre selber vom Zaun gebrochene Kampagne zur „Leitkultur“ baute sie etliche Fotos von Blasmusik-Kapellen ein. Die damalige Jugendstaatssekretärin, in der jetzigen Regierung Kanzleramts-Ministerin für Familie, Integration, Europa, spielt selber seit ihrem 10. Lebensjahr Zugposaune in einer solchen in ihrem Heimatort Walding (Oberösterreich).

Doch der Präsident des Österreichischen sowie Landesobmann des steirischen Blasmusikverbands Erich Riegler wehrte sich öffentlich gegen die Vereinnahmung. „Als ich zu musizieren begann, glichen etliche Blasmusikkapellen noch Altherren-Clubs“, zitierte ihn die Wochenzeitung Falter. „Doch im Laufe der Jahrzehnte seien immer mehr junge Menschen – vor allem Frauen – aktiv geworden. Bei den unter 30-Jährigen stellen sie mittlerweile die Mehrheit, nämlich 55 Prozent der Mitglieder. Heute findet sich im Repertoire der Blasmusikkapellen auch viel zeitgenössische Musik.“ (Falter) „Wir schöpfen aus unserer Tradition und entwickeln uns weiter…Wir sind für alle offen.“ (Erich Riegler).
In der Blasmusik spielten „Menschen aller Geschlechteridentitäten, aller Altersgruppen und aller sozialen Schichten“; auch „Menschen mit Beeinträchtigungen“ seien willkommen, zitierte der Standard den Blasmusikpräsidenten. Und: In einer Musikkapelle „ist es egal, woher ein Mensch stammt, welchen Glauben er hat und mit welcher politischen Richtung er liebäugelt“, alle seien gleich viel wert.“

So zurück zum Schauspiel – das Publikum stimmt wohl immer für die Fortsetzung der Rettungskampagne. Wenn nicht, fällt dem Schauspiel- und Musiktrio sicher auch etwas ein.
Vereinsprozeduren werden abgewickelt mit allen bewussten auf unfreiwillig gespielten laienhaften Reden. Und immer wieder wird natürlich wirklich geblasen – Christian Spitzenstätter, Nora Winkler und Max Gnant spielen Klarinette, Zugposaune, Horn und dazu hin und wieder eine große Trommel (Regie: Simon Windisch).
Das Klischee vielen Biertrinkens wird bedient, aber auch die Aufstellung eines Art Maibaums in einer Bierkiste (Mastkonzeption/-bau und Rigging: Nik Huber). Diese erklettert Max Gnant, um beim dosierten, urlaaangsamen Runterrutschen gleichzeitig ein Horn zu blasen und dies noch gekonnt musikalisch im Zusammenspiel (Komposition: Robert Lepenik) mit seinen beiden Kolleg:innen zu ebener Erd.

Und nicht zuletzt wird das Publikum gegen Ende nochmals und dann musikalisch eingebunden, wie, das sei aber hier nicht gespoilert. Nach Wien und Graz (Kristallwerk) dann wieder Wien (jeweils Theater am Werk / Petersplatz), im Jänner tourt die Koproduktion von „bum bum pieces“ (Österreich) und vanderbolten.production (Schweiz) dann in der Schweiz – Baden, Bern, Zug.
Übrigens: Spätestens seit dem Festival „Woodstock der Blasmusik“ in Ort im Innkreis (Oberösterreich) ab 2011 in Österreich und international nicht zuletzt beim jährlichen Guča-Trompetenfestival (Dragačevski sabor u Guči, eine halbe Million Besucher:innen, was 2009Rekord war) wissen viele auch über die Bläser:innen hinaus, dass die altbackene Ecke längst überholt ist. Auch wenn parteipolitisch versucht wird – siehe oben sowie die Aufsplittung zwischen Volks- und anderer Kultur durch die blau-schwarze Landesregierung in der Steiermark – das Rad zurückdrehen zu wollen.
Und das Stück „Zur Rettung der Blasmusik“ selber thematisiert in verschiedenen Szenen immer wieder auch die Wichtigkeit des Vereinslebens rund um die örtliche Blasmusik für insbesondere kleinere Gemeinden.


Teuflisch böse blickt dir eine urwütende dunkelrote mehr als unsympathische Figur von der Titelseite dieses Bilderbuchs entgegen. In großen schwarzen hingemalten Buchstaben prangt daneben „NUR ICH“ als erster Teil des Buchtitels, in lieblicherer roter Schrift darunter die Fortsetzung „allein will Omas Farbe sein!“
Und es bleibt nicht beim Rot, das diesen Anspruch stellt. Die Story: sehr unzufrieden lümmelt Pippa auf der Couch – mit zehn „o“ versieht die Illustratorin Angela Holzmann das „so“ vor dem langweilig, wie das Mädchen den eigenen Gemütszustand beschreibt. Da schlägt auf der nächsten Doppelseite offenbar die Mutter vor: „Mal Oma doch ein buntes Bild, / das von Farben überquillt!“
Als Antwort reimt Autor Michael Schwankhart: „Und welche Farben nehm ich da, / für das Bild der Omama?“
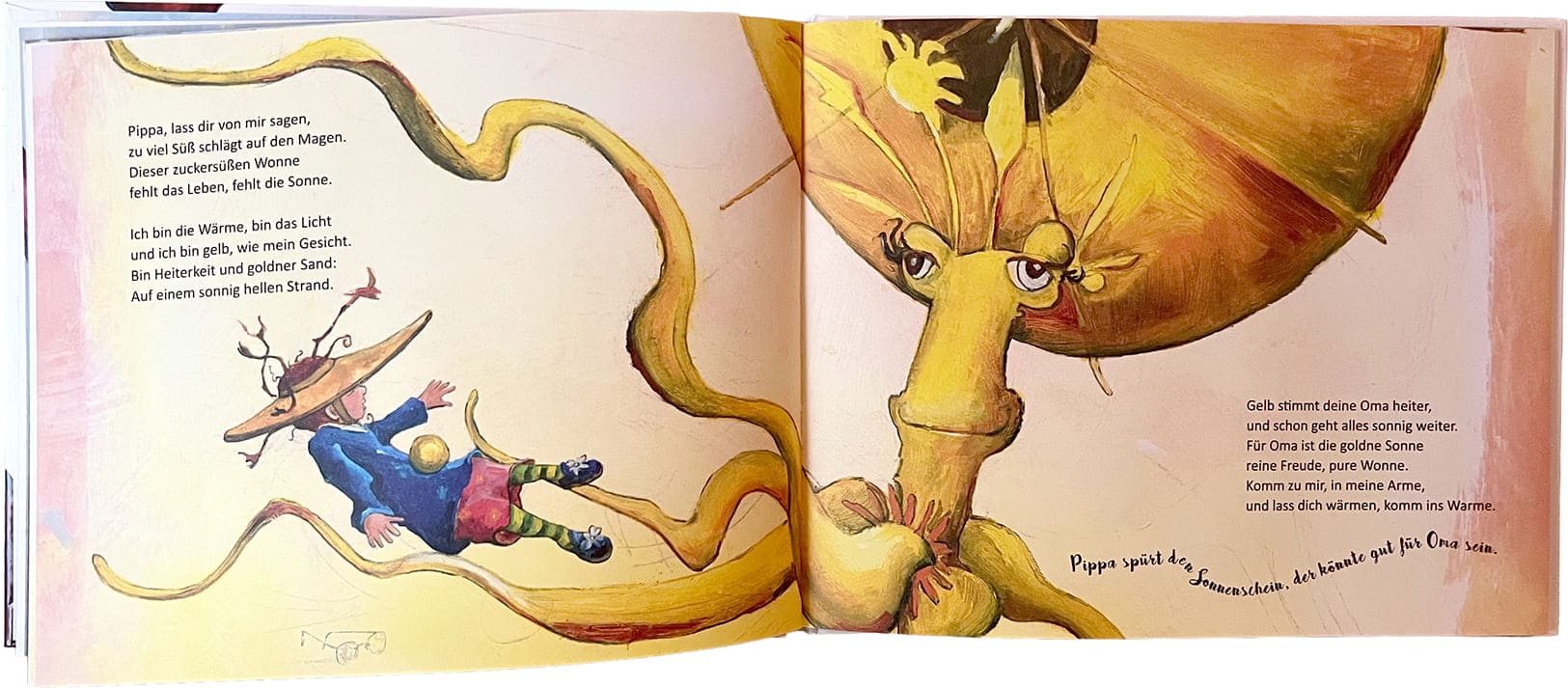
Und damit beginnt die Geschichte, die sich um den Vor-Kampf der Farben dreht und so symbolisch für vieles in Konkurrenzdenken steht: „NUR ICH“ – wie schon am Beginn das Rot auf der Titelseite entgegenbrüllt, so spielen sich der Reihe nach ganz ähnlich auch blau, rosa, gelb, violett, grün, orange… auf. Bevor Pippa auch nur einen Pinselstrich malen kann, dominiert jeweils eine der Farben das Geschehen, will die junge Malerin davon überzeugen dies und nur diese zu verwenden. Nur sie sie schließlich die schönste, größte, beste Farbe…
Zu den entsprechenden Reimen der sich als die einzig Wahre aufspielenden Farben, hat die Illustratorin ganz schön wilde Bilder eben (fast) nur in dieser Farbe auf der jeweiligen Seite gemalt.
Wie die Geschichte ausgeht?
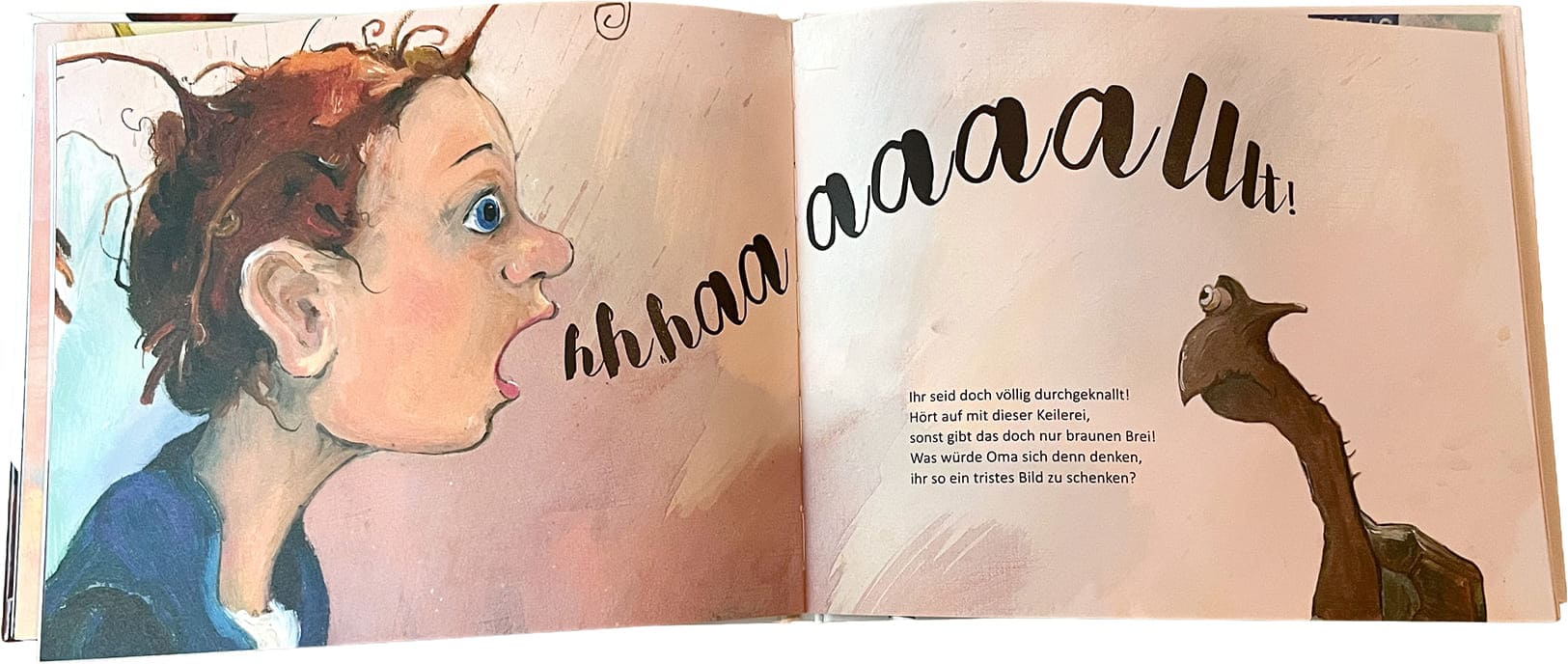
Das sei hier nicht verraten, aber vielleicht fällt dir ja eine eigene Lösung ein – und wirst möglicherweise staunen, wenn du dann dieses Buch liest und anschaust. Wahrscheinlich kommst du auf ein Bild, das zwar ganz anders aussehen könnte als das Schlussbild in diesem Buch, aber im Prinzip wird dein Bild oder die Vorstellung eines solchen nicht viel abweichen von dem, was sich das Duo Autor und Illustratorin einfallen haben lassen.
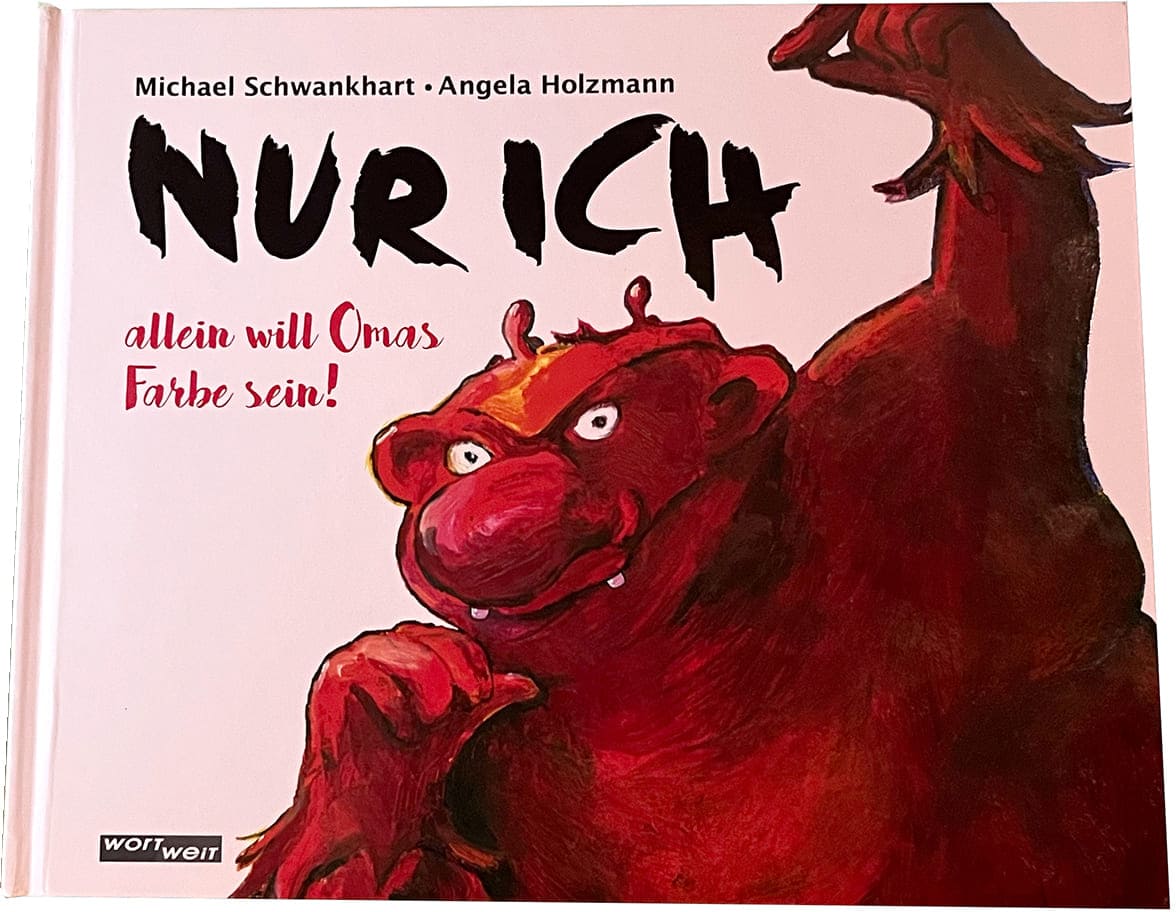

Ein alter, geöffneter, Koffer, aber so hingelegt, dass das Publikum nicht reinschauen kann. Nur, wer ein bisschen seitlich sitzt, sieht, dass es da aus dem Koffer leuchtet. Ein zweiter, offenbar ebenso alter Koffer, der aber lange zu bleibt und aufgestellt bei einer elektronischen Musikanlage steht. Und dann steht da auf der Bühne, vor der viele Kinder auf Matten Platz nehmen, eine uralte Stehlampe, an deren Stange zwei Regenschirm hängen, einer mit Rüschen-Rand. Ach ja, „da ist eine Schatztruhe“, entdecken noch Kinder, die beim Warten genau schauen.
Bevor das Schauspiel „Wirrum Warrum Wunderglocke“ aber anfängt, mischt sich die Regisseurin Nico Wind unters Publikum, stellt sich vor und lädt alle ein, sich an einem Wünsche-Ritual zu beteiligen: Hände reiben, öffnen, Wunsch reinsagen und ihn in die Lüfte blasen. Jetzt einmal wünschen sich – mit ihr – alle, dass das Theaterstück (endlich) losgeht.

Veronika Vitovec und Theresa Seits betreten in bunten Latzhosen und farbenfrohen Socken und Schuhen die Bühne, erstere legt sich in den geöffneten Koffer, Zweitere versteckt sich hinter dem Turm mit Musikgeräten. Sie wird immer wieder auch live Töne und Klänge in die Szenerie schicken. Aber sich auch – wie die Erstgenannte, die zuerst eine Hand, dann einen Fuß und schließlich ihr Gesicht aus dem Koffer schauen lässt – in eine Fee verwandeln.
Plötzlich rollt ein kugelrunder Wollknäuel zur nun aus dem Koffer gestiegenen Veronika Vitovec. „Was hast du da?“, fragt Kollegin Theresa Seits. „Eine Wunderglocke, die kann Wünsche erfüllen!“ Die eine wünscht sich die andere her und die eine gemeinsame abenteuerliche Reise.

Auf eine solche nehmen die beiden sich und das Publikum rund eine Stunde lang mit. Dabei „verzaubern“ sie einen weiteren Regenschirm in eine Maus namens Warrum, aus dem ersten und später aus dem zweiten Koffer Stoffbahnen (Ausstattung: Myriel Meißner), die fast nie zu enden scheinen und diese in schlangenlinienförmige Wege und so manche Tiere, zum Beispiel einen Igel. Die Musikerin selbst wird zum Maulwurf, der sich als Rapper versucht.
Und rund um diese beiden Tiere, vor allem aber den Igel, ein flauschig-weiches Stoffbündel, das sich von Kindern streicheln lässt, erzählen die beiden, dass die Menschen ihm und seinesgleichen kaum Laub liegen lassen, das sie aber brauchen für ihren Bau. Eigentlich würden sie ja Winterschlaf halten, aber sie finden dafür häufig nicht genug Nahrung, um sich darauf vorzubereiten.

Dies geht, wie die ganze Geschichte des Theaterstücks, aus von dem Buch „Die magische Weihnachtsglocke“ von Brit Blumilon. In 24 Kapiteln – wie so manch andere „Adventkalender“ in Buchform – erlebt Elfe, die im Buch Lisabella heißt, mit tierischen Freundinnen und Freunden Abenteuer. Die Regisseurin hat gemeinsam mit den beiden Schauspielerinnen, ausgehend von diesem Buch das Stück recht frei entwickelt. Unter anderem trifft sie auf Igelin Ida, die ihre Familie verloren hat. (Buchbesprechung folgt in ein paar Tagen).
Das Igel-Kapitel hat das Theaterteam stark berührt, weshalb sie dieser Geschichte auch viel Zeit einräumten, im Foyer liegen auch Materialien einer Igel-Initiative auf. „Vielleicht auch, weil ich selber in meinem Garten, den ich jetzt so richtig verwildern lasse, eine Igel-Rettungsstation habe“, ergänzt die Regisseurin. Igel fressen vor allem Käfer und die finden sie oft in Totholz. Bei Schnecken und Würmern können sie sogar so krank werden, dass sie ihre Stacheln verlieren…“, sprudelt Nico Wind begeistert im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nach der Vorstellung drauf los.
Nun, die beiden Schauspielerinnen wollen die Wunderglocke ins Elfendorf zurückbringen und kommen dabei auch zwischen den auf den Matten sitzenden Kindern vorbei. Hin und wieder im Laufe dieser Stunde – für die Kindergartenkinder irgendwann zwischendurch ein wenig zu lang – dürfen sie mit den Händen auf den Boden trommeln, auch sonst sind sie – oder einig von ihnen – manchmal gefragt. Was schwierig ist, wieder einzufangen.
„Töchter der Kunst“, so die Theatergruppe, tourt nach Donaustadt, Floridsdorf, Simmering (Bears in the Park, in der Nähe der Gasometer), mit und für Junge Theater Wien noch Favoriten und Liesing – Termine in der Info-Box am Ende.
In Simmering stand der Reporter vor der Hausnummer 12 in der Eyzinggasse ein wenig verloren, sah aber eine Kindergartengruppe den Gehsteig entlang kommen. Also Frage: Geht ihr zum Theaterstück? Ja, wir gehen auch zum Theater, der Eingang zum Veranstaltungsort „Bears in the Park“ ist um die Ecke in der Otto-Herschmanngasse.
Nach dem Stück plaudern die Vorschulkinder aus dem Kindergarten Rinnböckstraße zum einen darüber, was ihnen am besten im Stück gefallen hat. Sehr häufig nannten die jungen Theaterbesucher:innen den Igel, einer ergänzte, „weil er nicht echt war“, andere hatten auch eine Giraffe gesehen. „Alles“ meinte eines der Kinder und sofort schlossen sich andere an.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte aber, nachdem es ja viel ums Wünschen gegangen war, wissen, was sich die Kinder wünschen. Da reichte die Palette von „eine Uhr, aber eine richtige“ über einen Roller, einen Hund, ein Auto, eine Krone bis zu einem Fahrrad. Als schon fast alle Kinder abgerauscht waren, um Schuhe und Jacken anzuziehen, meinte ein Mädchen noch schüchtern: „Ich wünsche mir Malen“, auf Nachfrage, „ja selber malen will ich“. Vielleicht erfüllt sie ja mit gemalten Bildern den einen oder anderen der Wünsche ihrer Kindergartenkolleg:innen.

Ein bunter „Fallschirm“ wie er vor allem von Kinderfesten bekannt ist, wird von einigen, auch meist farbenfroh gekleideten, Menschen vor dem Seitentrakt des Burgtheaters aufgespannt. Kinder laufen drunter hin und her. Ein bemalter Regenschirm tanzt auf dem abwechselnd rauf und runter gezogenen bunten Tuch auf und ab. Viele Touris fotografieren und filmen die kleine Gruppe, nicht selten von anderer perspektive mit Blick auf den erleuchteten Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus.
Hin und wieder, leider zu selten, rufen einige aus der Gruppe den Grund ihrer fröhlichen Aktion – mit ernstem Hintergrund: „Amerlinghaus muss bleiben!
Es geht um dieses unabhängige Kulturzentrum im nahegelegenen siebenten Bezirk, Wien-Neubau, für das die Stadt Wien die Subvention so stark kürzen will, dass es im Frühjahr 2026 mehr oder minder den Betreib einstellen müsste.
Wenige Tage zuvor, in der ersten Dezemberwoche, gab es eine Demo mit mehr als 500 Teilnehmer:innen für den Erhalt des Amerlinghauses als Kulturzentrum. „Mei Deitschkurs is net deppat!“, war wohl das kreativste der Protestplakate bei der Demonstration gegen die massive Subventionskürzung für das unabhängige Kulturzentrum Amerlinghaus in Wien-Neubau. Vor 50 Jahren durch die Besetzung des damals eher baufälligen Hauses überhaupt erst – so wie die anderen alten Häuser am „Spittelberg – heute längst als mustergültige Sanierung eines Viertels gefeiert.
Budgetnot ist überall. Daher sparen, sparen, sparen! Kürzen, kürzen, kürzen! Aber wo?
Nun, selbst in der Stadt Wien, die immer Wert darauflegt, sozial und kulturell zu sein, wird bei Beschäftigungsprojekten in der Suchthilfe, Deutschkursen, der Unterstützung für Menschen die aus Ländern flüchten mussten, in denen sie Gefahren ausgesetzt sind, aber dennoch kein Asyl bekommen haben, und vielem mehr der sprichwörtliche Rotstift zur Hand genommen.
Eines dieser Projekte, das bedroht ist: Das Amerlinghaus. Es bietet physisch und geistig Raum für Dutzende kulturelle, politische, soziale Initiativen und Vereine, viel Diskussionen, Deutschkurse, eine selbstverwaltete reformpädagogisch Kindergruppe und, und, und…
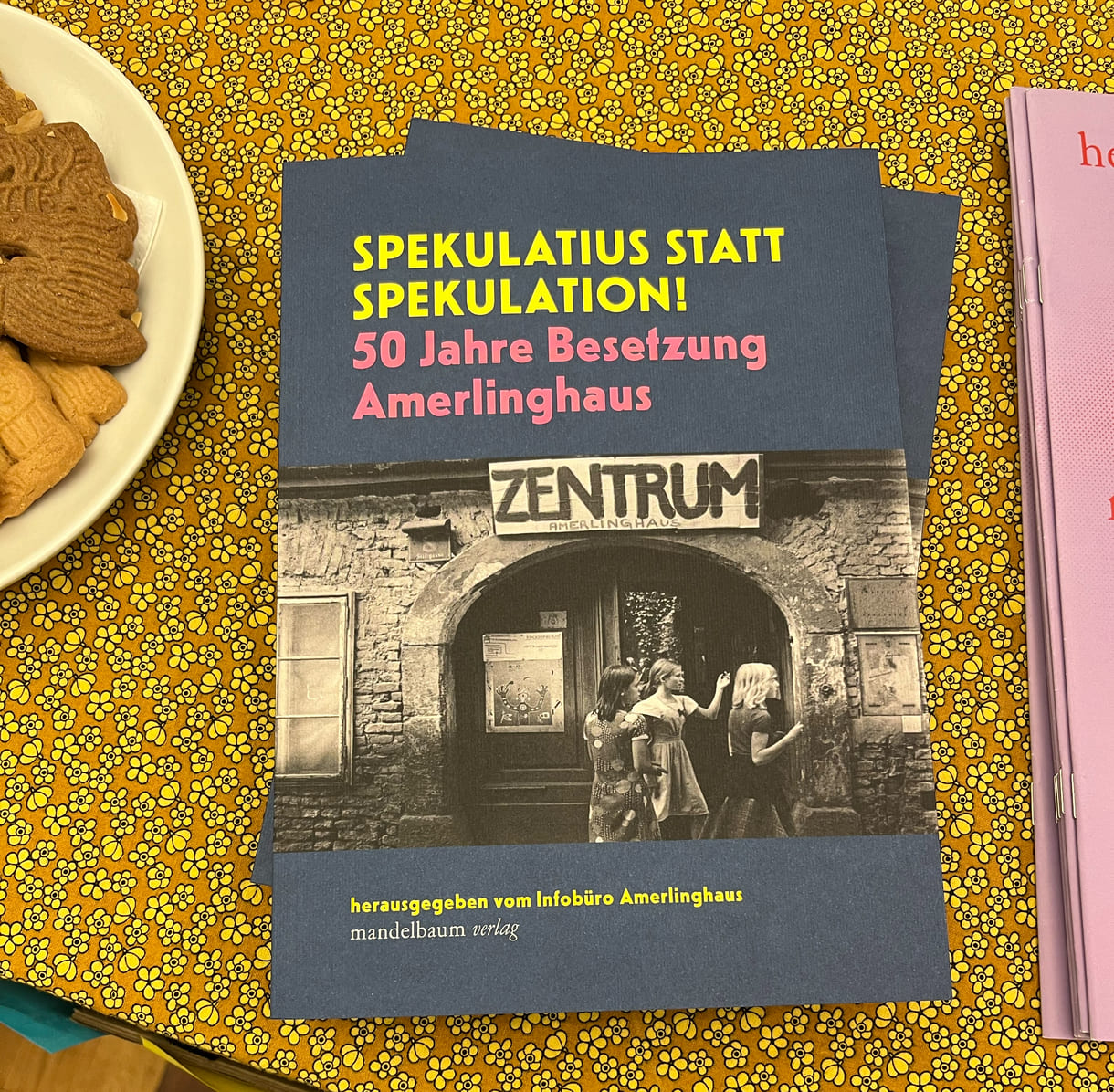
Erst Anfang Oktober wurde ein fast 300 Seiten starkes Buch mit 50 Kapiteln zur Geschichte, Philosophie, einzelnen Initiativen und Bewegungen, u.a. Frauenbewegung, Kampf um demokratische Mitbestimmung, Kinderrechte, zivilgesellschaftliches Engagement, solidarisches Zusammenleben, Diversität und vieles andere präsentiert – nicht zuletzt mit vorweihnachtlichen Keksen, entsprechend dem Buchtitel: „Spekulatius statt Spekulation!“ Einem der Sprüche, die irgendwann bei einer Aktion in den Anfangsjahren – wo es ja um die Rettung des gesamten Spittelbergs und seiner – heute längst geschätzten – renovierten alten Häuser ging, die vor einem halben Jahrhundert bedroht waren aus Spekulationsgründen alle abgerissen und durch – höhere – Neubauten ersetzt zu werden.
Bei dieser Buchpräsentation waren natürlich Finanzen auch ein Thema, weil das Kulturzentrum in den 50 Jahren seines Bestehens immer wieder darum kämpfen musste. Doch, so hieß es Anfang Oktober noch hoffnungsfroh, das Jahr 2026 wäre gesichert. Nun will die Stadt Wien die Unterstützung auf unter 150.000 Euro und damit rund die Hälfte der erforderlichen Mittel wie Energie, knappe Personalressourcen kürzen. Was übrigens wahrscheinlich sogar weniger ist als der zweite – ohne Ausschreibung – bestellte Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, der ehemalige ÖVP-Wien-Chef Manfred Juraczka – kosten wird.
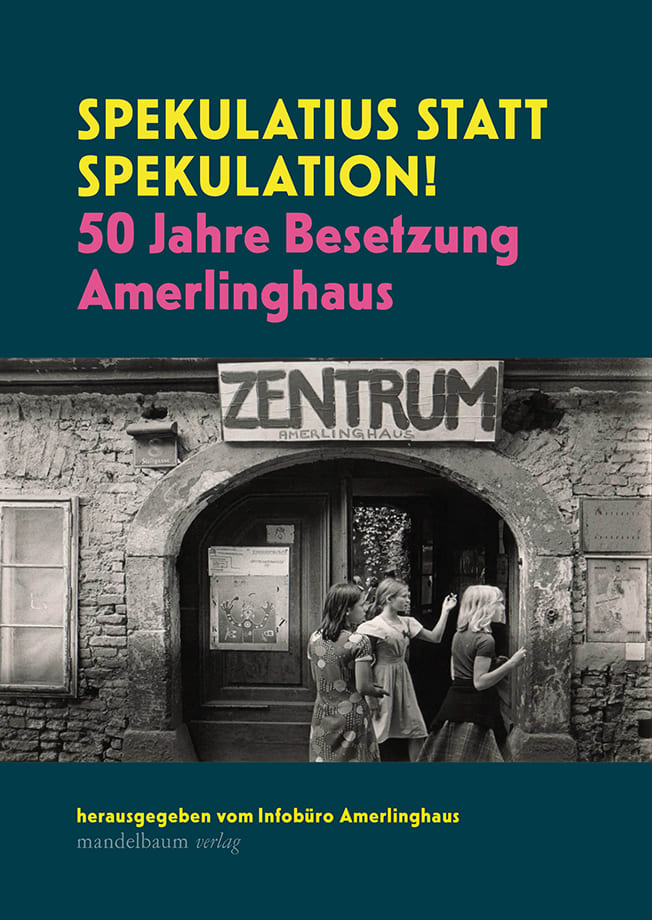

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Michael Ludwig,
sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling,
sehr geehrte Frau Stadträtin Veronica Kaup-Hasler,
sehr geehrte Frau Stadträtin Barbara Novak,
Die geplanten Kürzungen bei der Förderung von Kunst und Kultur – besonders die Halbierung der Arbeitsstipendien – haben schwere Folgen. Sie gefährden:
Gerade in Krisenzeiten sind Kunst und Kultur wichtig. Sie schaffen Orte, an denen Menschen sich treffen, nachdenken und neue Ideen finden können. Auch die Regierung hat in ihrer Erklärung „Aufschwungskoalition für Wien“ erkannt, dass Kultur für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt zentral ist.
Kürzungen treffen vor allem die freie Kulturszene. Viele Projekte könnten nicht mehr stattfinden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden ihre Arbeit verlieren, und Kulturstätten müssten schließen. Wenn engagierte Menschen ihre Arbeit verlieren, geht wichtiges Wissen verloren – und sie stehen für die Kulturarbeit nicht mehr zur Verfügung.
Die Ziele der Stadtregierung – faire Löhne und sichere Arbeitsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler – können dann nicht mehr erreicht werden. Gleichzeitig fordert auch die EU in ihrem neuen Papier „Culture Compass“, dass Kunst und Kultur für Demokratie unverzichtbar sind und faire Bedingungen brauchen.
Wien ist weltweit bekannt für Kunst und Kultur. Wenn hier gespart wird, verliert die Stadt an Anziehungskraft – auch für Tourismus und Wirtschaft. Eine erhöhte Tourismusabgabe ab 2026 könnte helfen, aber das Geld käme zu spät, wenn 2026 bereits viele Einrichtungen schließen müssen. Dieses Geld sollte gezielt der freien Szene zugutekommen, weil diese keine festen Förderzusagen oder sicheren Arbeitsverträge hat.
Außerdem wurde in den letzten Jahren zu wenig in die freie Szene investiert. Es fehlen bezahlbare Arbeitsräume, Ateliers und Bühnen. Viele Fördermittel müssen für Miete ausgegeben werden, statt für die eigentliche künstlerische Arbeit. Die Stadt braucht mehr kostenlose oder günstige Räume, damit sich Kunst und Kultur frei entwickeln können.
Auch Kulturprojekte, die von der Bildungsabteilung (MA 13) statt aus der Kulturabteilung (MA 7) gefördert werden, sind von Kürzungen bedroht – mit denselben Folgen: weniger Vielfalt, Projekte werden gestrichen, Menschen verlieren ihre Jobs.
Sparen darf nicht auf Kosten der Kunst, Kultur und sozialen Sicherheit gehen.
Wir fordern deshalb:
Außerdem bleiben alle Forderungen aus dem „4-Themen-Programm der Interessengemeinschaften für Kunst und Kultur“ vom April 2025 bestehen.
Dieser Brief wurde am 24.11.2025 verschickt.
Unterzeichnet haben:
Berufsvereinigungen der bildenden Künstler Österreichs, Zentralverband
Forum Literaturübersetzen Österreich
Forum Österreichischer Filmfestivals
IG Autorinnen Autoren
IG Bildende Kunst
IG Freie Theaterarbeit
IG Kultur Wien
Kulturrat Österreich
Österreichischer Musikrat
Hier klicken, um die Originalfassung des offenen Briefs zu lesen
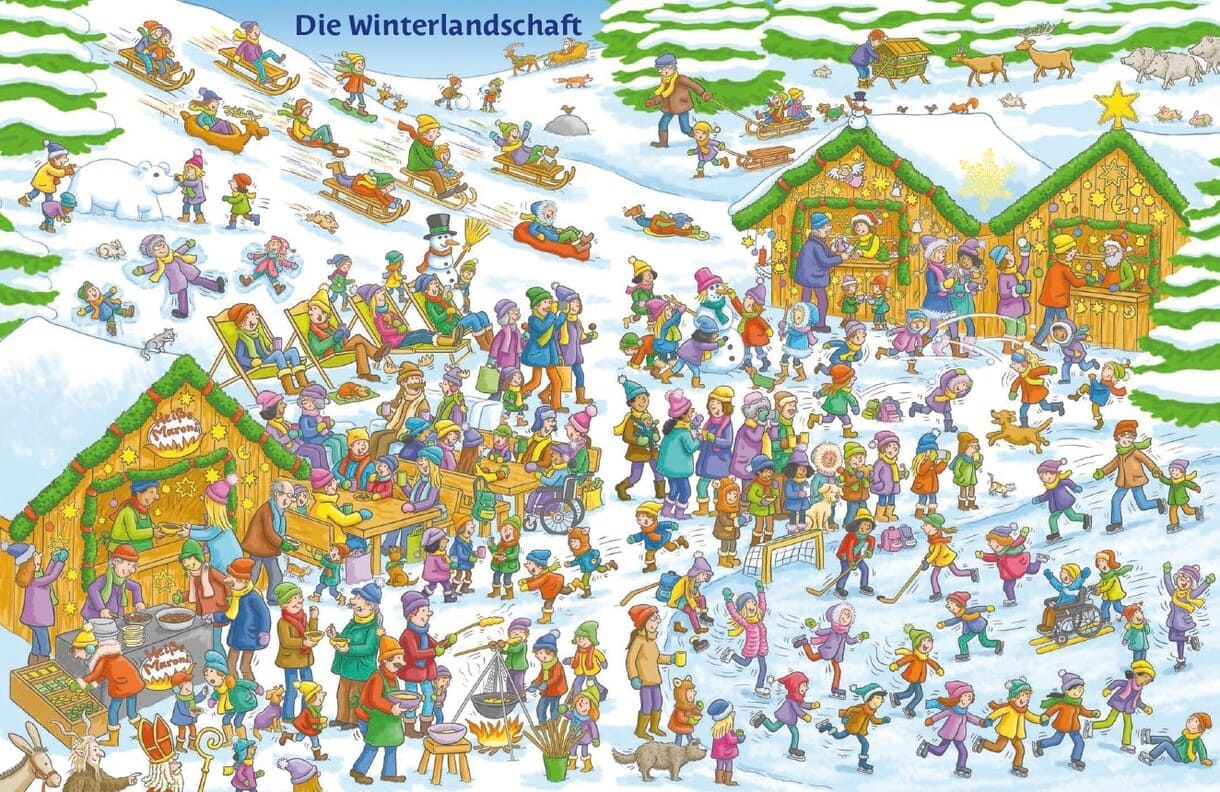
Wimmelbücher kennst du sicherlich, dieses kreist um Weihnachten. Auf der Titelseite mit zusätzlichem Gold-Glitzerdruck kannst du vielleicht schon stundenlang hängenbleiben, suchen und finden und wieder was Neues entdecken.
Noch mehr zum Schauen – auch ohne Glitzer – findest du natürlich im Inneren auf den großen Doppelseiten von „Mein Christkind-Wimmelbuch“ von Matthias Kahl. Sicher weit mehr als 100 Kinder im ersten Kapitel „Spiel und Spaß im Schnee“, folgen Szenen aus einer Weihnachtsbackstube, Wichtelwerkstatt, Advent in der Stadt, Christkindlmarkt, aber auch Weihnachtszauber im Wald.
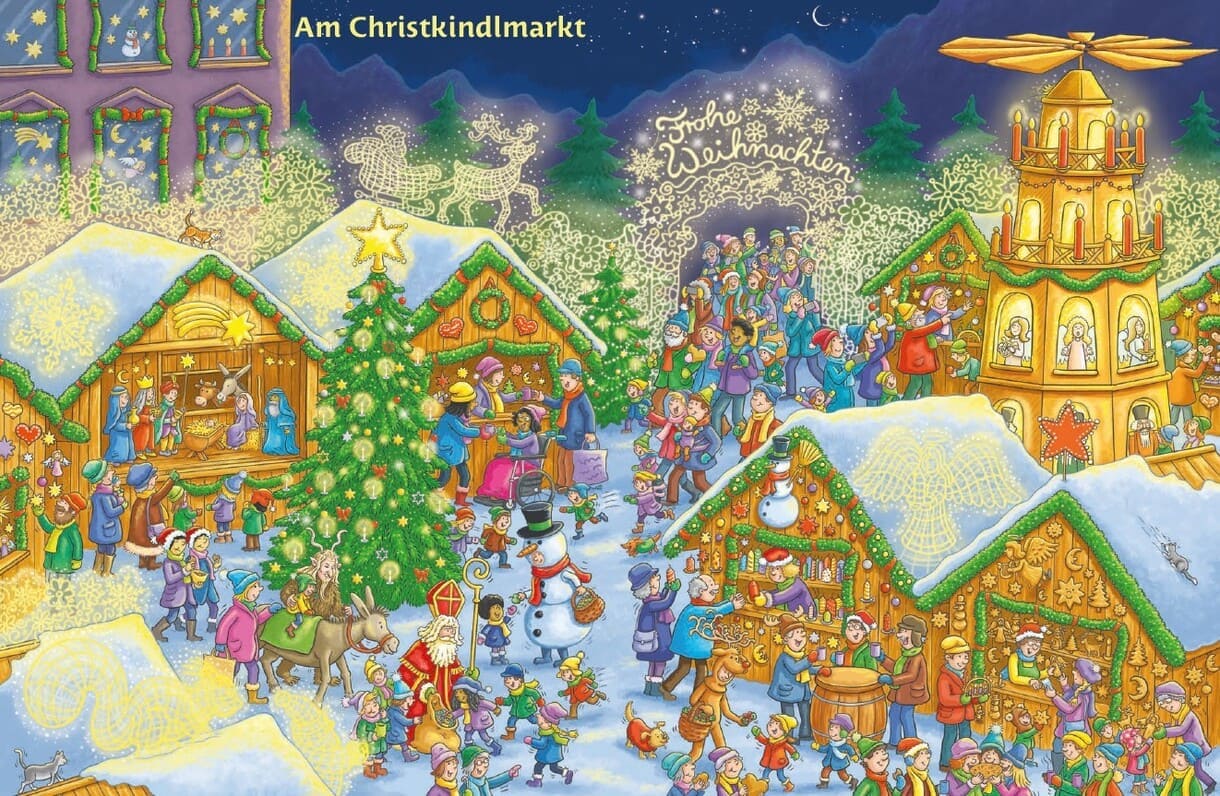
Wie bei Wimmelbüchern üblich, wird dir auch beim x-ten Mal anschauen noch immer das eine oder andere Detail auffallen, das du bis dahin übersehen hast. Und sollte dir fad werden, versuch vielleicht die auf der Rückseite des Buches abgedruckten drei kleinen Bilder bzw. sechs weiteren Bildausschnitte auf den vorangegangenen Seiten zu suchen und – nicht ganz so leicht – zu finden; fast ein österlicher Brauch, nach Verstecktem zu suchen 😉
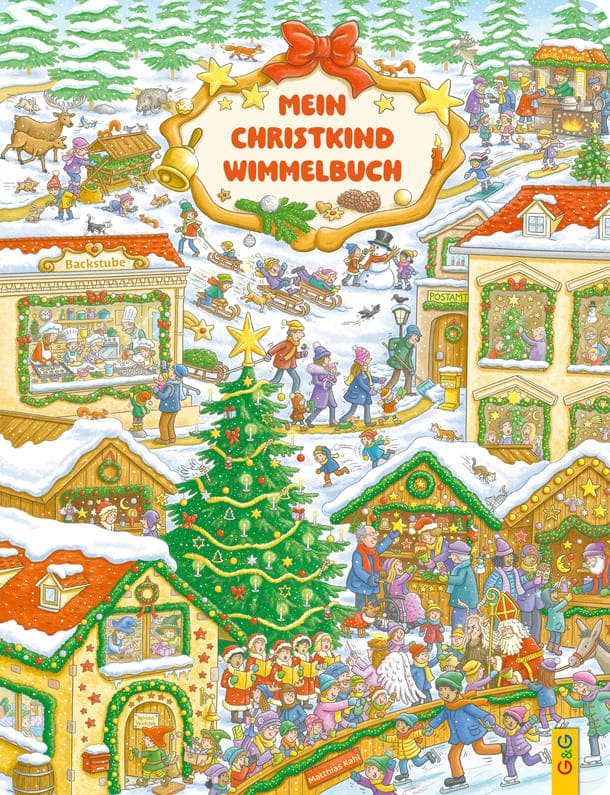

Er spielt und singt im seit dem Feiertag (8. Dezember 2025) im Wiener Raimund Theater nicht nur den „kleinen Stanislaus“ im Musical „Die drei Stanisläuse“, das die Kinderfreunde heuer – wie jedes Jahr ein anderes – rund 6000 Kindern schenken. Simon Malleczek hat auch zwei Auftritt mit verschiedenen Saxofonen. Und er ist erst 17, also nur wenige Jahre älter als sein Publikum. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… führte kurz nach der umjubelten Premiere und vor einer zweiten Vorstellung am Nachmittag ein kurzes Interview mit dem Newcomer.
KiJuKU: Seit wann machen Sie Musik und Schauspiel?
Simon Malleczek: Eigentlich schon immer.
KiJuKU: Was heißt immer?
Simon Malleczek: Ich hab mit drei angefangen mit Geige, ich hab Fagott gespielt, ich spiel Saxofon, was ich heute auch spielen durfte. Ich hab im Kindergarten zu singen angefangen.
KiJuKU: Wie kommt man mit drei auf die Idee, Geige zu spielen?
Simon Malleczek: Das ist eine sehr gute Frage. Angeblich – ich hab keine Erinnerung daran, aber so wurde es mir immer wieder erzählt – sobald ich stehen konnte, stand ich vor der Übertragung des Neujahrskonzerts, hab mich auf Bücher gestellt und versucht das zu dirigieren. Das heißt die Begeisterung für Musik war irgendwie schon immer da.
KiJuKU: Ist nicht Geige gerade zum Beginnen schwierig?
Simon Malleczek: Es gibt auch schon kleine Geigen.
KiJuKU: Aber bei einer Flöte oder einem Tasteninstrument ist es schon leichter, bald einmal Töne zu spielen, was bei Geigen ja nicht so einfach ist?
Simon Malleczek: Ich war auch nicht besonders gut, aber die Schwierigkeit hat das gefördert, ich wollt einfach Töne rauskriegen.
KiJuKU: Und dann haben sie Musikschulen besucht?
Simon Malleczek: Ja, zuerst mit Fagott und dann mit Saxofon.
KiJuKU: Jetzt gehen Sie noch in die Schule, oder?
Simon Malleczek: Nein, ich bin nicht mehr in der Schule, ich hab in der 7. Klasse abgebrochen, ich hab schon so viele Projekte gespielt, dass ich gesagt hab, ich hör mit der Schule auf.
KiJuKU: Sie wechseln in eine Schauspiel-, Musik oder kombinierte Ausbildung?
Simon Malleczek: Genau, das Ziel ist eine professionelle Ausbildung, vorerst Schauspiel.

KiJuKU: Wie sind Sie zum Kinderfreund-Musical gekommen?
Simon Malleczek: Das war ganz witzig, ich kenn die Stella Kranner, die die jüngste Veronika spielt, schon ganz lang. Die hat mich angerufen: Ich hab ein Casting für dich! Dann war ich auf einer Konzertreise in Vorarlberg und hab ein WhatsApp-Nachricht bekommen: Heute 12.30 Uhr eCasting, geht klar? Dann bin ich von der prob weg ins Hotel gegangen, hab das eCasting gemacht und wurde genommen.
KiJuKU: Was haben Sie im eCasting gemacht – schon Texte aus den Stanisläusen?
Simon Malleczek: Nein, zwei Lieder gesungen, einen Monolog aus meinem Repertoire, ich glaub es war auch was aus dem Phantom der Oper dabei, aber ich weiß es nicht mehr.
KiJuKU: Kannten Sie die Stanisläuse-Geschichten?
Simon Malleczek: Ich bin voll mit diesen Büchern aufgewachsen, zuerst vorgelesen, dann selber gelesen. Und ich war jedes Jahr beim Kinderfreunde-Weihnachts-Musical. Ich hab im Dezember Geburtstag, war jedes Jahr – meistens genau an meinem Geburtstag mit meinen Freunden in der Vorstellung, nachher sind wir zum Christkindlmarkt gegangen. Das ist jetzt so ein kleiner Kreis, der sich gerade schließt, dass ich da mitspielen darf. Heuer ist leider an meinem Geburtstag keine Vorstellung.
Gespielt wird bis 20. Dezember – Infos im unten verlinkten Beitrag, in dem das Musical besprochen wird.

„… und natürlich den drei Veronikas!“ – schon in der mehrfach wiederholten Ansage im sich füllenden Raimund Theater ertönt eine Ergänzung zum Titel des Musicals „Die drei Stanisläuse“, das am Feiertagsvormittag seine umjubelte Uraufführung erlebte (Details in der Info-Box ganz am Ende des Beitrages). Einige der sechs Bilderbücher – geschrieben von Vera Ferra-Mikura und illustriert von Romulus Candea zwischen 1962 und 1995 – werden immer und immer wieder neu aufgelegt – Buchbesprechungen auf KiJuKU.at am Ende des Beitrages verlinkt.
Wie die Protagonist:innen aus drei Generationen greifen offenbar heutige Großeltern zu den Büchern aus ihrer Kindheit, um sie ihren Enkelkindern vorzulesen oder zu schenken. Schon die Einleitung oben deutet den wesentlichen Unterschied zwischen den Büchern und dem Musical an – nicht nur die schwungvolle, ins Ohr gehende Musik: Geschrieben und in Bildern sind Bub, Vater und Großvater die aktiven, die abenteuerlustigen, die Entdecker, die drei Generationen Veronikas sind eher die Randfiguren und treten in althergebrachten Rollen mit überholten Aufgaben in Erscheinung.

Auf der Bühne singen und spielen sie gleichberechtigt, lassen sich nicht alles gefallen. Stella Kranner als die Jüngste, das Kind Veronika, gibt ihrem Bruder, dem jüngsten Stanislaus (Simon Malleczek) schon recht früh zu verstehen, das mit der „kleinen Schwester“ könne er sich abschminken, sei sie doch größer als er. Und wenn Georg Hasenzagl als mittlerer Stanislau neben dem Wäschekorb auf unschuldig singt „ich hab ja nichts gemacht“, kontert ihm Anna Knott (die auch gemeinsam mit Janine Hickl für die Choreo zuständig ist) als Ehefrau und damit mittlere Veronika: „ja eben, das ist ja das Problem“, denn im Haushalt mit anpacken wäre ja wohl angesagt.

Was noch in einem der Songs mit teilweise Ohrwurm-Potenzial verstärkt und unterstrichen wird, wenn es heißt, dass die Welt nur ändern kann, der sich selber ändern kann. Andere Texte besingen vor allem das, was auch die Autorin der Bücher so toll in Szenen verpackt hat: Fantasie schafft Abenteuer. „Es braucht nicht viel, nur Fantasie und jedes Spiel wird schön wie nie: Wir stellen’s uns vor!“ kommt in mehreren Liedern vor – mit dem Versuch das Publikum gerade in den letzten Satz miteinstimmen zu lassen.

Die schon genannten vier Darsteller:innen – und dazu noch Elena Schreiber und Martin Petraschka als das älteste eh klar Veronika und Stanislaus-Paar – schlüpfen aber auch noch in andere Rollen. So geben die drei Frauen auch Feen, die die Stanisläuse – und das auch schon im sechsten Buch, in dem die Veronikas es auf den Titel geschafft haben – dazu bringen, Küche zu putzen und Kekse zu backen. Die drei Männer treten als diebische Mäusefänger auf.
Die Bühnenfassung hat – wie schon im Vorjahr bei „Die Omama im Apfelbaum“ nach Mira Lobe und Susi Weigel – Stephan Lack geschrieben, für Regie und künstlerische Leitung zeichnet wieder Caroline Richards verantwortlich. Die Songs komponiert und die Live-Musik geleitet hat erneut Michael Hecht, der auch Bass spielt; an den Keyboards Ed Reardon und Benjamin Alan Kubaczek und das Schlagzeug bedient wieder Lukas Schlintl. Wobei zusätzlich zu den vier Musikern der Jüngste auf der Bühne Simon Malleczek (17 – Interview in einem eigenen Beitrag) neben Schauspiel und Gesang in zwei Szenen Saxofon bzw. Sopransaxofon spielt.

Das vor allem dank – teils überraschender (Malereien!) Videoeinspielungen – wandelbare Bühnenbild stammt von Alois Ellmauer bzw. Videoproduktion: Alexander Trinkl, Lisa Punz. Da die Schauspieler:innen, die gleichzeitig auch Sänger:innen sind – eben Musical – natürlich nicht Kinder / Eltern bzw. Großeltern sind, hilft auch die generationenmäßig unterschiedliche Kleidung mit, niemanden durcheinander zu bringen (Kostüme: Natalie Pedetti Prack).
Die Kinderfreunde schenken seit fast 40 Jahren in der Vorweihnachtszeit Tausenden Kindern ein Musical, seit langem im Raimund Theater. Bis vor zwei Jahren war es fast immer ein eigens dafür geschriebenes Stück Musiktheater. Im Vorjahr wurden Konzept und Leading-Team – Bühnenfassung, Regie, Musik – verändert, seither werden Bilderbücher aus dem zu den Kinderfreunden zählenden Verlag Jungbrunnen dramatisiert. War es im Vorjahr „Die Omama im Apfelbaum“ vom Duo Mira Lobe und Susi Weigel, so bildeten heuer die sechs Bücher über die drei Generationen Stanisläuse – und in der Musicalversion viel stärker als in den Büchern die drei Veronikas, ebenfalls Großmutter – Mutter -Kind – die Grundlage für das vorweihnachtliche für Kinder kostenlose Musiktheater.

Übrigens: Dem Verlag wurde erst in der Vorwoche der Bruno-Kreisky-Preis (nach dem Bundeskanzler von 1970 bis 1983) des Karl-Renner-Instituts überreicht. In der Begründung heißt es unter anderem: „Jungbrunnen überzeugt durch seinen Mut, auch schwierige und kontroverse Themen wie Inklusion, Diversität und Nachhaltigkeit in seinen Publikationen aufzugreifen, ohne dabei die Magie kindlicher und jugendlicher Erzählwelten zu verlieren. Der Verlag setzt konsequent auf hochwertige Illustrationen, innovative Ansätze und literarische Qualität und erreicht so Generationen von Jugendlichen, die durch die Bücher nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken angeregt werden… Die Jury würdigt den Verlag Jungbrunnen für sein nachhaltiges Engagement, kulturelle und politische Bildung zu fördern. Er ermöglicht durch seine unermüdliche Arbeit Kinder- und Jugendliteratur auf höchstem Niveau. Der Verlag ist ein Leuchtturm für die Bedeutung von Literatur als Werkzeug politischer Bildung, demokratischen Bewusstseins und gesellschaftlichen Zusammenhalts.“
Warum dann ausgerechnet Bücher für das aktuelle Musical ausgesucht wurden, die zwar Fantasie fördern, aber ein überholtes Frauenbild – auch schon in den Entstehungszeiten; 5. Buch 1974, 6. Buch 1995 – verbreiten? Na gut, immerhin hat die Musicalversion den einen oder anderen kleineren Ansatz neuerer Sichtweisen aus diesen Büchern vergrößert bzw. hinzugefügt – siehe oben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen