
Mittlerweile schon fast zur Tradition geworden sind diesen besonderen Salzburger Festspiele – nicht in der gleichnamigen Landeshauptstadt, sondern im kleinen Hüttschlag (rund 900 Einwohner:innen) im Bezirk St. Johann im Pongau: Bilingual in Österreichischer Gebärden- sowie deutscher Lautsprache findet nun zum fünften Mal ein visueller Musiktheaterabend im Turnsaal der örtlichen Volksschule statt.
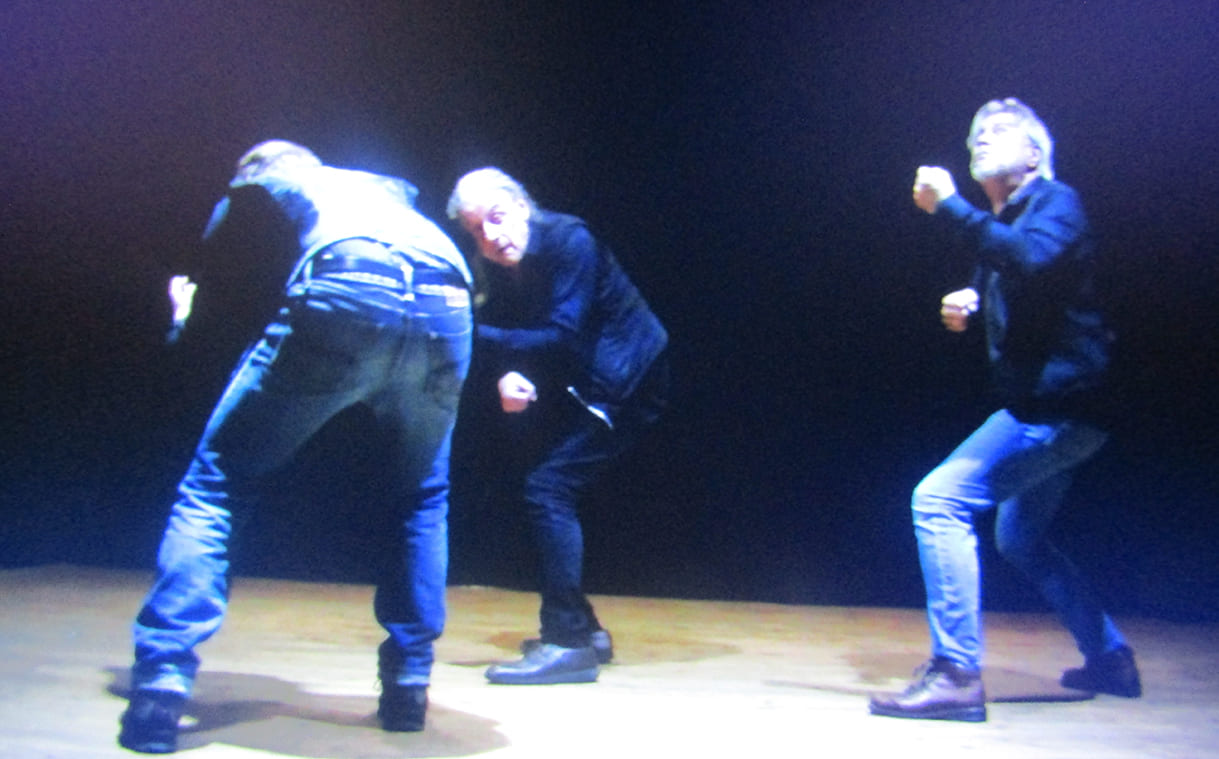
Schauspieler:innen und Musiker:innen gestalten ein vielschichtiges, inhaltsreiches Programm, das sich vor allem gegen Krieg(slust) richtet. In diesem Jahr wird unter anderem „Kriegsschweine“ mit Szenen und Gedichten von August Stramm (Patrouille, Sturmangriff, Kriegsgrab), „Schwarzer Sabbath“ mit Szenen und Gedichten von Giuseppe Ungaretti (Veglia / Nachtwache); Musik von Ozzy Osbourne, Terence Michael Butler, Willaim T. Ward, F. Frank Iommi, „Sabbath blutiger Sabbath“ mit Szenen und Gedichten von Paul Scheerbart (Kriegstheater) und den schon Genannten inszeniert.
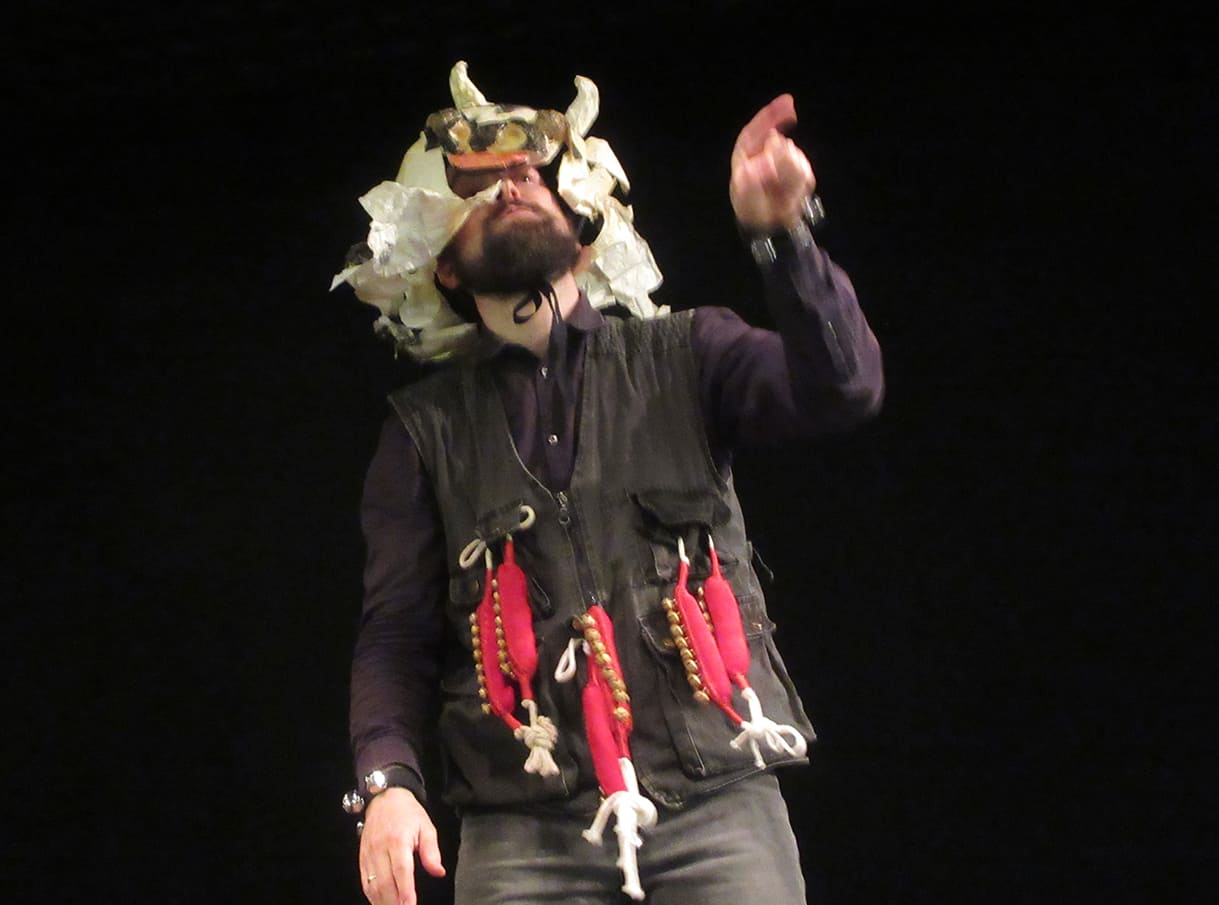
Ferner wird unter dem Titel „Wir genießen die himmlischen Freuden“ visuelles Theater und Musik in Bewegung nach Gustav Mahlers vierter Symphonie bearbeitet für Stimme, Kammerensemble und Gebärdensprach-Chor komponiert von Werner Raditschnig gegeben – mit Werner Mössler, Markus Rupert, Markus Pol und Rita Luksch; für die Musik sorgt das arbos-ensemble: Thomas Trsek (Violine), Nicola Vitale (Klarinette, Saxophon und Bass-Klarinette), Bojana Foinidis (Akkordeon) und Adi Schober (Schlagwerk); Kostüme und Objekte: Burgis Paier; Regie: Herbert Gantschacher.

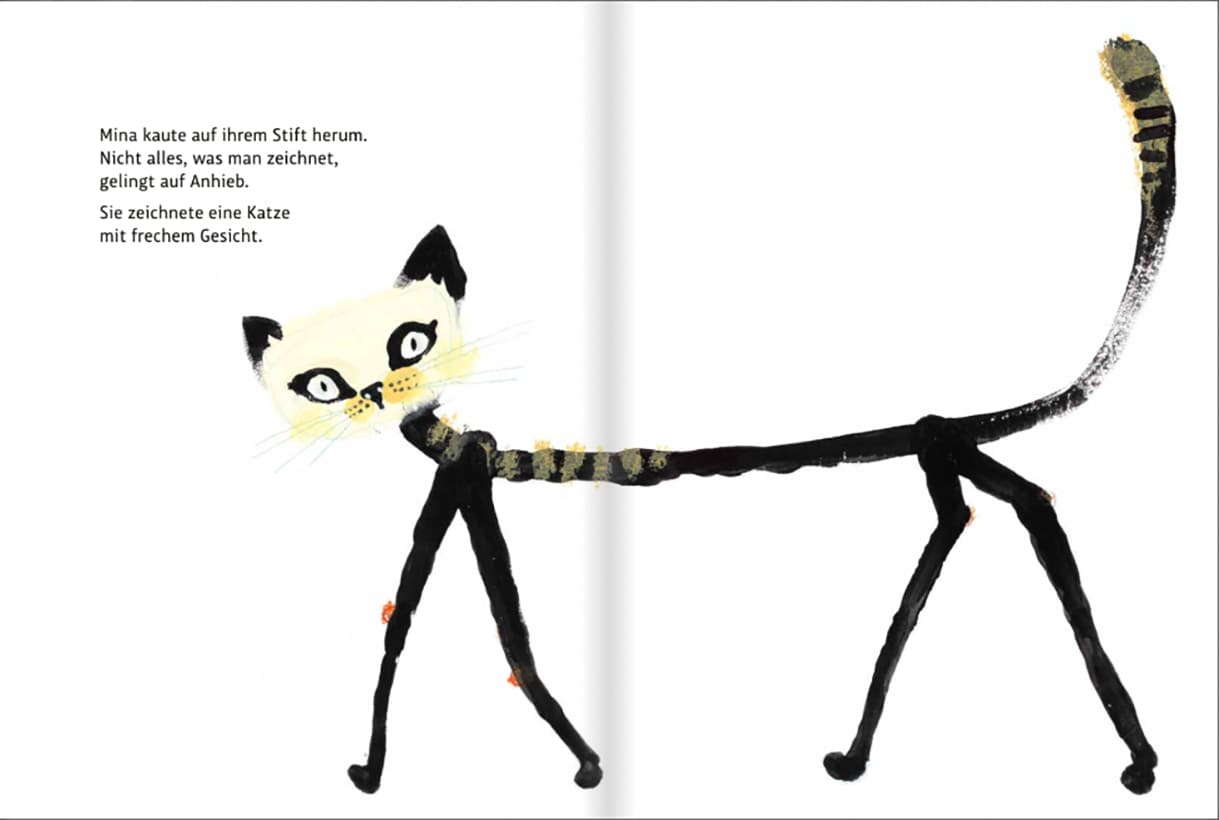
Als wär’s tatsächlich ein erster Versuch einer gezeichneten Katze, erstreckt sich diese ausgewachsene Strichfigur über die zweite Doppelseite (siehe Bild oben) dieser kunstvollen Einladung zur eigenen Kreativität.
Die Geschichte, geschrieben von Claudia Gürtler, beginnt damit, dass Mina, ein Kind, zu Weihnachten als ihr letztes Geschenk ein „dickes Buch mit leeren, weißen Seiten“ und „dazu eine Schachtel mit Stiften, Farben und Pinseln“ auspackte. Und große Freude daran zu haben schien.
„Nicht alles, was man zeichnet, gelingt auf Anhieb. Sie zeichnete eine Katze mit frechem Gesicht“, steht dann neben der eingangs beschriebenen Zeichnung. Renate Habinger verknüpft die zwölf Doppelseiten von „Farbe, Eule, Stift und Katze“ hinweg elaborierte künstlerische Zeichnungen mit kunstvoll gestalteten Elementen, als wären diese erste Malversuche.
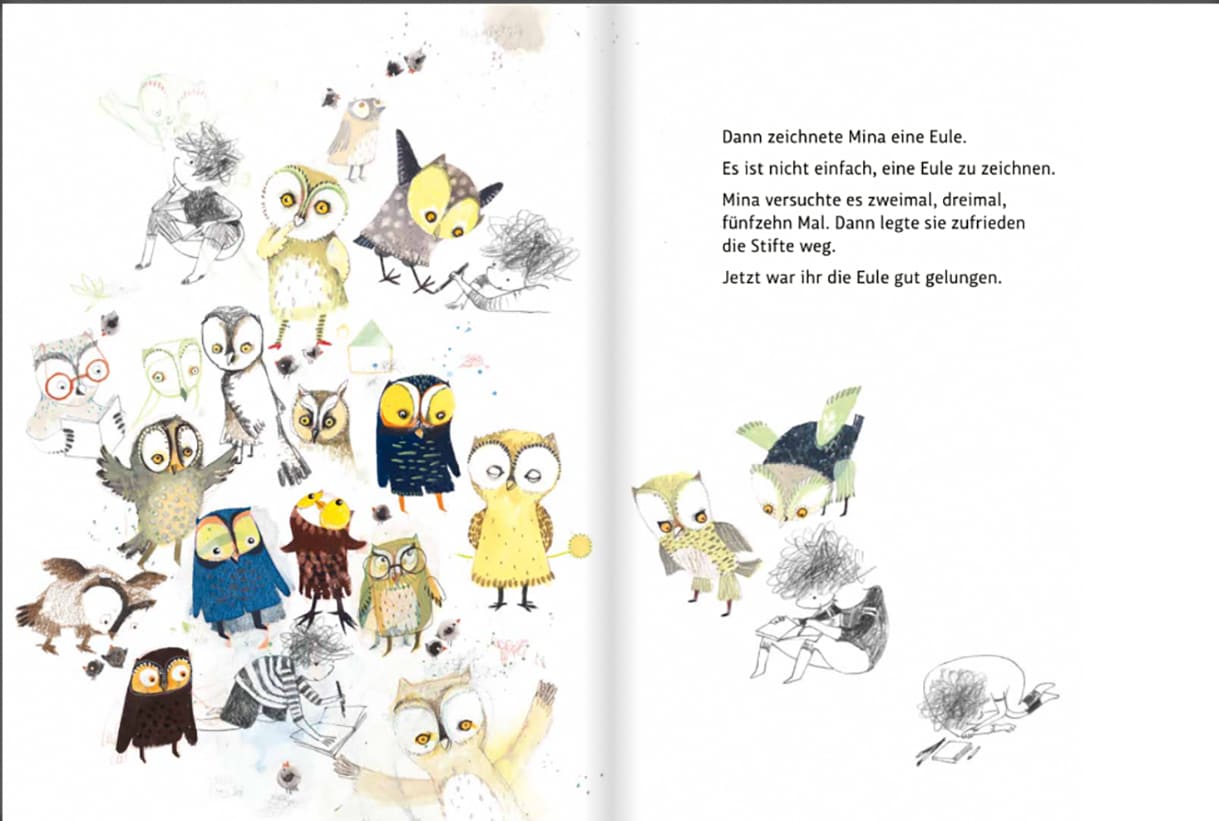
Damit nimmt das Buch von vornherein all jenen Angst, selber zu malen oder zeichnen, denen eingeredet wird: „Das kannst du nicht“ oder die sich das selber vorsagen. Und dieses Bilderbuch animiert durch die Geschichte des offenbar sehr jungen Kindes Mina alle, die es lesen oder vorgelesen bekommen, sich mit Stift und Pinsel eigene fantasievolle Bild-Geschichten auszudenken.
In diesem Buch spielen neben Katzen natürlich – wie der Titel besagt – Eulen eine große Rolle – und die scheinen von Mina erschaffen, dann doch auf den Seiten die sie gestaltet ein Eigenleben zu entwickeln. Wie das recht oft auch bei Schriftsteller:innen und Illustrator:innen vorkommt, wenn diese ihren Figuren Freiraum für ihre Entwicklung geben.
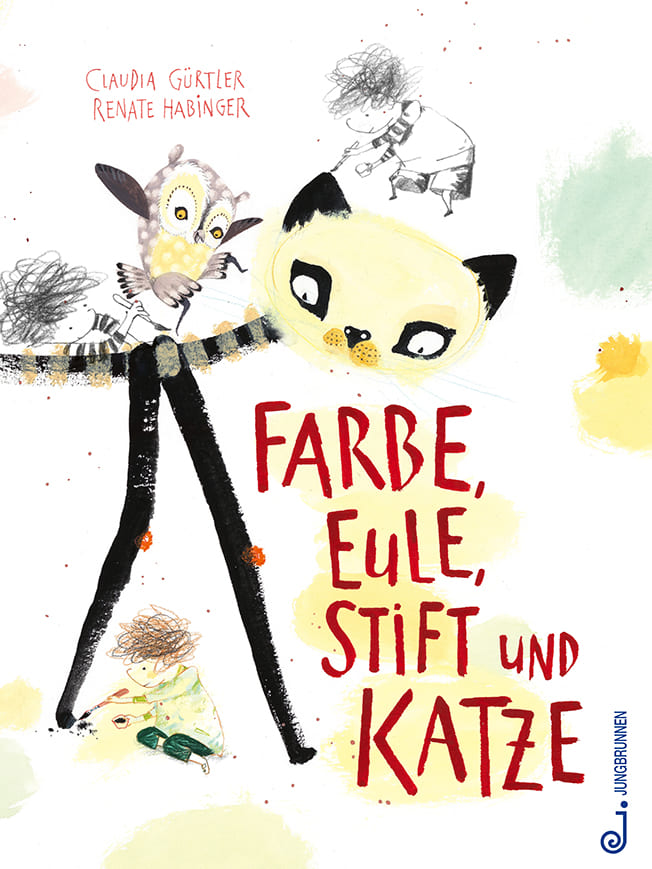

Zirkus im Doppelpack. Als Clown mit buntem Hemd und orangefarbenen Crocs stets auf der Jagd nach Beifall aus dem Publikum, das er dazu immer wieder, teils massiv, animiert zeigt Philippe Ducasse in „Ah Bah Bravo!“ Kunststücke wie Jonglieren mit bis zu fünf Bällen, balanciert einen langen dünnen Stock, den einige Kinder im Publikum zunächst für einen Riesen-Zauberstab halten, sogar im Handstand mit seinen Füßen und einen Hulla Hoop-Reifen rund um seinen weit nach hinten gestreckten Po.
Was bei der Kultursommer-Wien-Bühne am Nordwestbahnhof (warum vom Mortarapark in den beiden vergangenen Jahren, den die lokale Bevölkerung ohnehin gut besuchte, abgegangen wurde, war nicht wirklich in Erfahrung zu bringen) nicht beim ersten, und nicht einmal beim zweiten Versuch, sondern erst im dritten Anlauf klappte.
Aber so ist live nun einmal – oder war’s sogar geplant. In so manche Zirkusarena dieser Welt gehen hin und wieder Tricks zunächst bewusst schief, um die Schwierigkeit erst recht zu unterstreichen.
Im Hintergrund auf der Bühne selbst hängt schon ein – ganz unüblich – schwarzer Vorhang und die – noch nicht leuchtende – Schrift „Pupa Circi“ (Zirkuspuppe oder Puppen-Zirkus). Ein solcher löst den eben beschriebenen akrobatischen Clown-Auftritt – oder clownesken Akrobatik-Act ab.
Michael Pöllmann, Leiter des Marionetten Theaters Schwandorf (Deutschland) führt den frech dreinschauenden Igel Riccio Ricci an Fäden an einem Holzkreuz in die „Manege auf der Bühne“. Der – nicht der Puppenspieler, sondern der Igel – bleibt nicht der einzige, wenngleich alle kommenden Figuren auch ihre Solo-Auftritte haben. Riesen-Stoffschlang Agatha Magnolia erobert praktisch die gesamte Bühne, Stinkwanze Stepolino wandert an den Fäden gar durch die Publikumsreihen, während Adelheid, die rosa spinnenbeinige Königin der Lüfte geschickt als Seiltänzerin balanciert.
Die ungewöhnlichste der Figuren – alle erdacht, entworfen und geschickt und bespielbar gebaut von Scarlett Köfner – ist eine Geige namens Ann-Sophie. Die Musik dazu spielt allerdings eine solche aus Fleisch und Blut: Johanna Kugler live in einer Ecke der Bühne sitzend – und nicht nur während des Auftritts der Marionetten-Geige, die übrigens noch eine kleine Baby-Geige aus ihrem Umhang hervor„zaubert“.
Die Live-Musik erfolgt im Duo – neben der Geigerin sitzt Bläser Daniel Moser, der abwechselnd Saxofon, Bass-Klarinette und Holz-Querflöte spielt.

Schmale geschwungene Papierstreifen meist in Pastellfarben liegen bereit. Der Reihe nach holen sich Kinder in einem der vielen Kurse der Kinderuni Kunst, in denen mit Papier gearbeitet wird, solche. Bella, Sebastian und Linna lassen sich gleich zu Beginn von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nicht nur auf die Finger schauen, wie sie geschickt mit Hilfe einer Art Stift mit gespaltener metallspitze einen Streifen nach dem anderen dort einzwicken und kleine Röllchen drehen. Diese kleben sie auf ihre Zeichnungen. Ganz unterschiedliche. Sebastian und Linna haben beide jeweils einen Dinosaurier gezeichnet, Bella eine Figur mit gelber Krone auf dem Kopf. „Nein, Prinzessin oder Königin will ich nicht sein“, stellt sie aber gleich einmal klar.
Welche Bilder auch immer mit Bleistift gezeichnet wurden, sie werden nun nach und nach mit den Röllchen vollgeklebt womit sich ein 3D-Bild ergibt. „Quilling“ heißt diese Technik, die offenbar vom englischen Wort unter anderem für Feder kommt – wie die eingedrehten Metallband-Federn in einem Uhrwerk.
Anregungen finden sich in einem bunten Buch mit hochkomplizierten Kunstwerken in dieser Technik neben den vielen bunten Streifen, die sich die Jung- und Jüngst-Studierenden holen. Sarah lässt sich von der Rückseite des Buches, einem ausgefeilten Mandala inspirieren – und erhält von Claudia-Eva, der Leiterin dieses Workshops, den Tipp, dass die Streiferln nicht unbedingt nur kreisrund aufgewickelt werden müssen, sondern durchaus auch in Form von Blütenblättern – was für einige der inneren Elemente des Mandalas sogar besser passen wird…

Vielfältig sind die Techniken und Kunstsparten, in denen sich Kinder von 6 bis 14 Jahren – und das nicht nur im Haupthaus, der Universität für Angewandte Kunst, sondern in zahlreichen anderen Kunst-Einrichtungen „austoben“ können. „Viel spannender als in der Schule“, fällt in einem der Kurse die Bemerkung mehrerer Kinder, weshalb sie gern in den Sommerferien solche Workshops besuchen.
Beim Lokalaugenschein beschränkte sich KiJuKU in diesem Jahr dennoch nur auf „die Angewandte“. In einem anderen Gebäudeteil im ersten Stock haben Teilnehmer:innen unterschiedlichste „Tiefseemonster“ gezeichnet, die einen ließen sich von echten Tieren – Riesenquallen, Anglerfischen, Aalen und weiteren inspirieren, andere schufen Fantasiewesen unter Wasser. Und die Zeichnungen, so zeigen James, Megan, Valentino, Luise, Victoria und noch weitere Student:innen, „werden dann von uns gebaut. Holz-Kreuz um die herum Draht gebogen ist, stehen schon auf den Tischen. Stunden später werden die Kinder Gipsbandagen darum herum wickeln, um aus den zweidimensionalen Zeichnungen dreidimensionalen Skulpturen zu schaffen.
Ganz anders geht’s in einem der Dachgeschoßräume zu. Gruppenweis schlüpfen Kinder in die Rollen von Spinnen, Schnecken, Schildkröten. Inspirationsquelle für das hier entstehende Theaterstück in Kooperation mit der Schauspielakademie Stanislavski ist „Tranquilla Trampeltreu“. Der berühmte Autor Michael Ende (u.a. Momo, Die unendliche Geschichte…) hat vor mehr als 50 Jahren die Geschichte über eine Schildkröte dieses Namens geschrieben, die zum Hochzeitsfest von Sultan Leo, dem 28., aufbricht und unterwegs von anderen Tieren belächelt wird, weil sie ja so langsam dahinschreitet. Sie kommt dennoch rechtzeitig zum Fest an, allerdings bereits von Leo, dem XXIX (29.) 😉
Das – ursprünglich von Marie-Luise Pricken und später von anderen Künstler:innen – Michael Bayer / Julia Nüsch / Manfred Schlüter illustrierte Bilderbuch gab es schon in unterschiedlichen Bühnenversionen, unter anderem einer Kinderoper (Komponist Wilfried Hiller) – in der Leo der König der Tiere, also ein Löwe ist. In der kinderunikunst-Version ist es Königin Leonie, die zum Fest einlädt. Und da ist die Schildkröte auch nicht die Langsamste, Schnecken wundern sich sogar über das rasend schnelle Tempo der Schildkröte.
Ebenfalls im Dachgeschoß darf KiJuKU begeisterten Maler:innen ein wenig zuschauen – und zuhören über verschiedene höchst kreative Titelvorschläge für schon fertige Bilder im Ersatzkurs für eine erkrankte Workshopleiterin. „Plantschen mit Farben“ nannte sich das, was offenbar weit mehr als ein Ersatz wurde und viel Spaß bereitete. „Frittiertes, mutiertes, genmanipuliertes Kaninchen mit lackierten Gelnägeln“ war dann das Ergebnis für eines der Bilder, das noch den Namen Jeffrey bekam.
In einem geräumigen Gangabteil werken die einen an großen Kartonteilen, andere an Stoffstreifen, dritte positionieren sich auf großen Würfeln, proben Auf- und Abgänge. Plötzlich taucht einer der KinderuniKunst-Studierenden mit burgzinnen-artiger Gesichtsmaske auf. „Das ist aber nur Teil von… wart ich zeig’s dir“, und schon stemmt er eine große Kartonburg in die Höhe und wandert mit dieser den Gang entlang. Viele der anderen Teile wirken robotermäßig. Und genau das sind sie – nach und nach entstehen in „Robot Rock“ ein Roboter und verwandte Figuren und Objekte – die letztlich alle für die Gestaltung eines Musik-Videos …
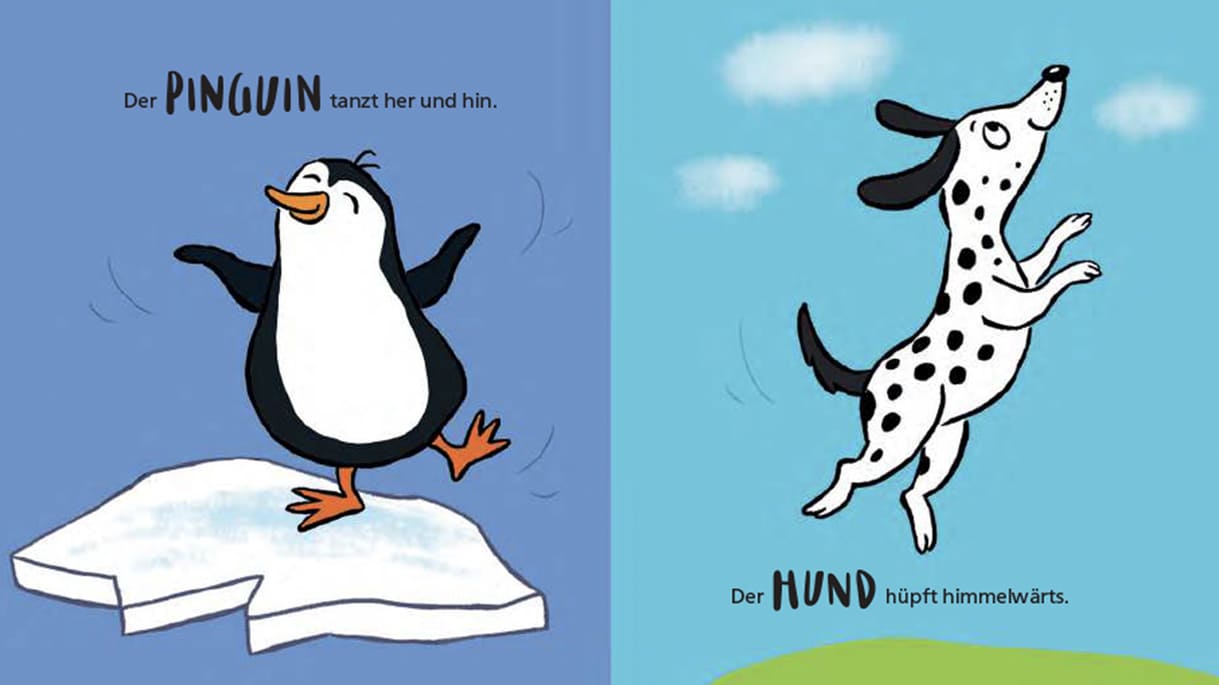
Vom Pandabären über einen Orca, Zebra, Katze, Pinguin, Hase und noch so manche Tiere tanzen, springen, schwimmen fröhlich über die bunten Seiten. Sogar „das Stinktier riecht nach Blütenduft“.
Ein lustig sich bewegendes Tier (Illustration: Birgit Antoni), ein passender kurzer Satz (Text: Lena Raubaum) dazu lassen die jeweilige Freude aus dem quadratischen hand- und reißfesten Buch auf seine Betrachter:innen und (Vor-)Leser:innen überspringen. Warum die alle so gut drauf sind?
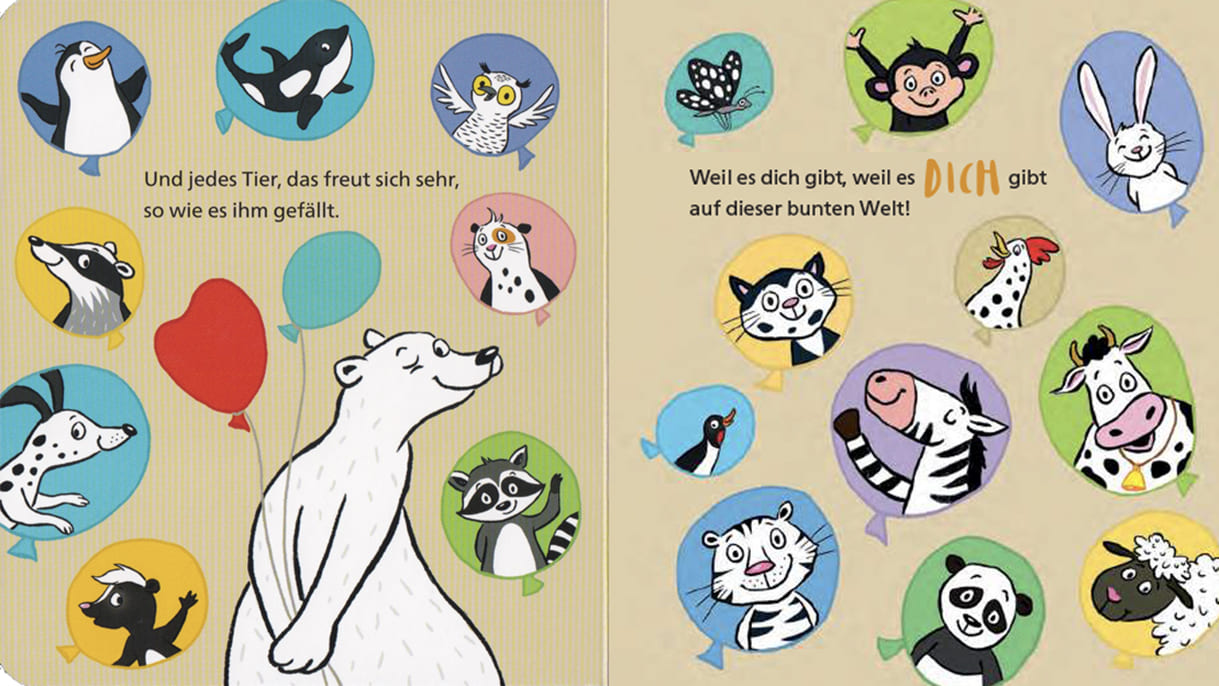
Das steht im Titel – und geballt noch einmal auf der letzten Doppelseite – ausnahmsweise wird hier einmal der Schluss gespoilert – weil es eigentlich ohnehin um jede einzelne Seite – und noch viel mehr, die vielleicht in deinem Kopf entstehen werden geht: „Weil es dich gibt“… „auf dieser bunten Welt!“
Wenn der große, kleine Schmerz kommt oder schon da ist, kann dieses Papp-Bilderbuch Trost spenden. Aber auch ganz einfach so schafft es das kleine und doch so große Buch vielleicht sogar Älteren ein stilles oder auch lautes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und auch in nicht gerade zu Optimismus Anlass gebenden Zeiten ein positives „ach ja“ in Hirn, Herz und Bauch zu rufen.
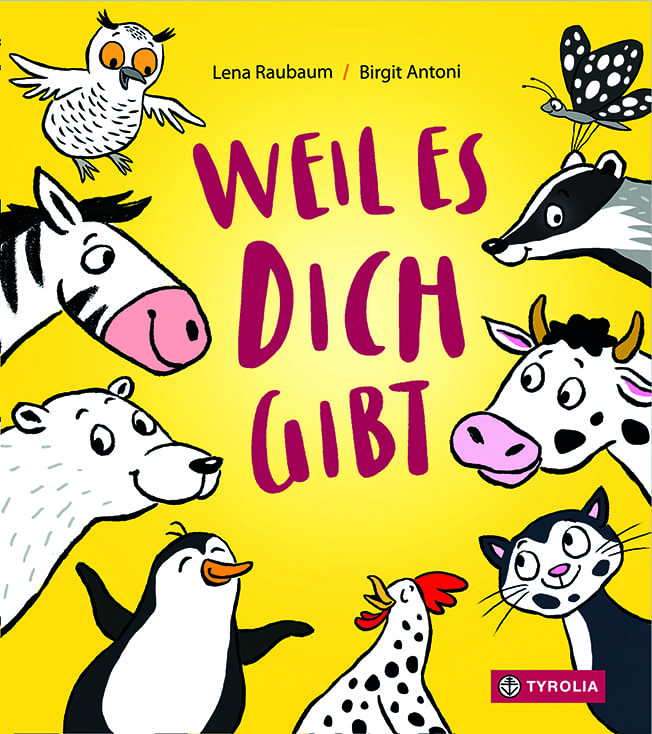

Doch bevor es zur ersten Vorlesung in den C2 im Hörsaal-Zentrum am Campus der Universität Wien – für jahr(zehnt)elange Wiener:innen im Alten AKH – ging, brauchte es „natürlich“ eine offizielle Eröffnung.
Zum ersten Mal seit fast einem ¼-Jahrhundert musste diese – aufgrund des Regens – aus dem Hof nach innen ausweichen. Dort ging es auf Stiegen und Gängen dicht gedrängt zu wie vielleicht in einem Ameisenhaufen. Könnte sein, dass diese Tiere in der einen oder anderen der fast 400 Lehrveranstaltungen für die rund 4000 jungen und jüngsten Studierenden (7 bis 12 Jahre) an praktisch allen Wiener „hohen Schulen“ (samt Fachhochschul-Campus) – an den Kunst-Universitäten läuft diese Woche auch noch die kinderunkunst – eine Rolle spielen werden 😉
Und noch eine Premiere gab’s im 23. Jahr der ältesten Kinderuni Österreichs: Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ist so jung (32), dass sie als Kind, wäre die Oberösterreicherin damals in Wien gewesen, Studierende an der Kinderuni sein hätte können. Sie durchschnitt gemeinsam unter anderem mit dem Rektor der Wiener Universität, Sebastian Schütze, sowie dem Vertreter des Sponsors (auch eine Neuheit: Bawag), Enver Siručić (Präsidenten des Bankenverbandes und stellvertretenden CEO – Chief Executive Officer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied – der BAWAG Group) das rote Band. Erstmals übrigens kein Kind mit Schere mit dabei ;(
Deutete der Titel der ersten Lehrveranstaltung in diesem Sommer – zwei Wochen lang warten Lehrende aus allen Fachbereichen darauf ihr Spezialwissen mit Kindern zu teilen – darauf hin, dass Quantenphysik ein doch recht kompliziertes Fachgebiet ist, so verblüfften viele der Jung- und Jüngststudierenden nicht nur mit Fragen, sondern schon mit Vorwissen. Kaum stellt der Lehrende, Markus Aspelmeyer (Fakultät für Physik) eine Frage, schon schossen Dutzende Arme in die Höhe. Eine Studierende bekam ihren fast nie herunter, auch wenn sie (zu) selten drangenommen wurde. Die eine oder der andere war hingegen sichtbar überfordert und freute sich mehr über das Ende der Vorlesung.
Bevor direkt ins Thema eingestiegen wurde, gab’s einige Minuten zum Grundsätzlichen von Wissenschaft und Forschung und der Herangehensweise, zu schauen ob eigene Theorien mit der Wirklichkeit, mit der Natur in diesem Fall übereinstimmen. Und der im speziellen Fall recht jungen Erkenntnis, dass sich Licht einigermaßen wie Wellen verhält und doch aus Teilchen besteht. Apselmeyer brachte auch einen Photonenzähler, den der „Papst der Quantenphysik“, Anton Zeilinger, erfunden hatte. Er bekam übrigens vor nicht ganz drei Jahren den Physik-Nobelpreis. Klick, klick, klick – wenn der Unilehrer die Hand von der Abdeckung weggab und Licht drauf stieß – und bei besonders viel Licht gingen die einzelnen Laute in ein Dauergeräusch über.
Und doch lässt sich vieles noch gar nicht erklären, eröffnete der Wissenschafter den Kindern – mit der Perspektive, dass möglicherweise die eine oder der andere später sich auf dieses Fachgebiet spezialisiere und Forschung weitertreiben könnte 😉
Ach ja, zurück zum Titel dieses Beitrages: Aspelmeyer projizierte eine Zeichnung, in der viele Menschen einen Hasen und noch mehr eine Ente zu erkennen glauben, um zu erklären: Wir haben noch nicht einmal eine Sprache dafür, dass Licht beide Eigenschaften, die von Welle und Teilchen, besitzen, als müsste ein Wort für diesen Entenhasen oder diese Hasenente gefunden werden.
Im Erdgeschoss des Hörsaal-Zentrums steht neben dem Info-Point ein Bücherregal. Daneben sitzen Kinderuni-Studierende gemütlich auf dem Boden. Buchstaben auf einer Schnur zeigen, was zu sehen ist: Bibliothek. Seit einigen Jahren gibt es einen Kinderuni-Beirat aus – genau! – Kindern. Im Vorjahr wurden Kinder speziell um ihre Meinungen gefragt – und neben viel positivem Feedback wurde auf einen Mangel hingewiesen: Jede Uni hat eine Bibliothek, die Kinderuni hatte da noch keine.
Und weil aller Anfang schwer ist, steht schräg gegenüber ein Tisch mit einigen Büchern und einem Hinweisschild: Tauschregal – samt der Bitte um Bücherspenden für die Erweiterung dieser Bibliothek.
Zwar gibt es – neben den Wegen zu den Lehrveranstaltungen samt so mancher Stiegen – und Spiel und Bewegungsangeboten von wienXtra im Hof oder dem Spielplatz einen Hof weiter am Uni-Campus – den kritischen Kindern aus dem Vorjahr zufolge zu wenig Bewegung. Mehr wichtige Themen war ein weiterer Wunsch.
Beides wird in diesem 23. Jahr kombiniert: Kommenden Montag „landet“ in Wien eine Rad-Tour der Kinderuni Wismar (Deutschland), die eine Friedensfahrt von der Ostsee weg organisiert. Die fährt entlang des einstigen „Eisernen Vorhangs“ unter dem Motto „bike the line“ nun bis Wien. Vom DOCK an der Spittelauer Lände am Donaukanal, einem Ganzjahresangebot der Kinderuni Wien, wir dann, begleitet von Wiener Kinderuni-Studierenden bis zum Campus geradelt – bis zur Lehrveranstaltung „Für Frieden und Zusammenarbeit: 80 Jahre UNO“, gehalten von der Juristin Irmgard Marboe.
Übrigens: Auch wenn die meisten Lehrveranstaltungen längst ausgebucht sind, es gibt immer wieder noch den einen oder anderen Restplatz – auf der Website – Link am Ende des Beitrages.
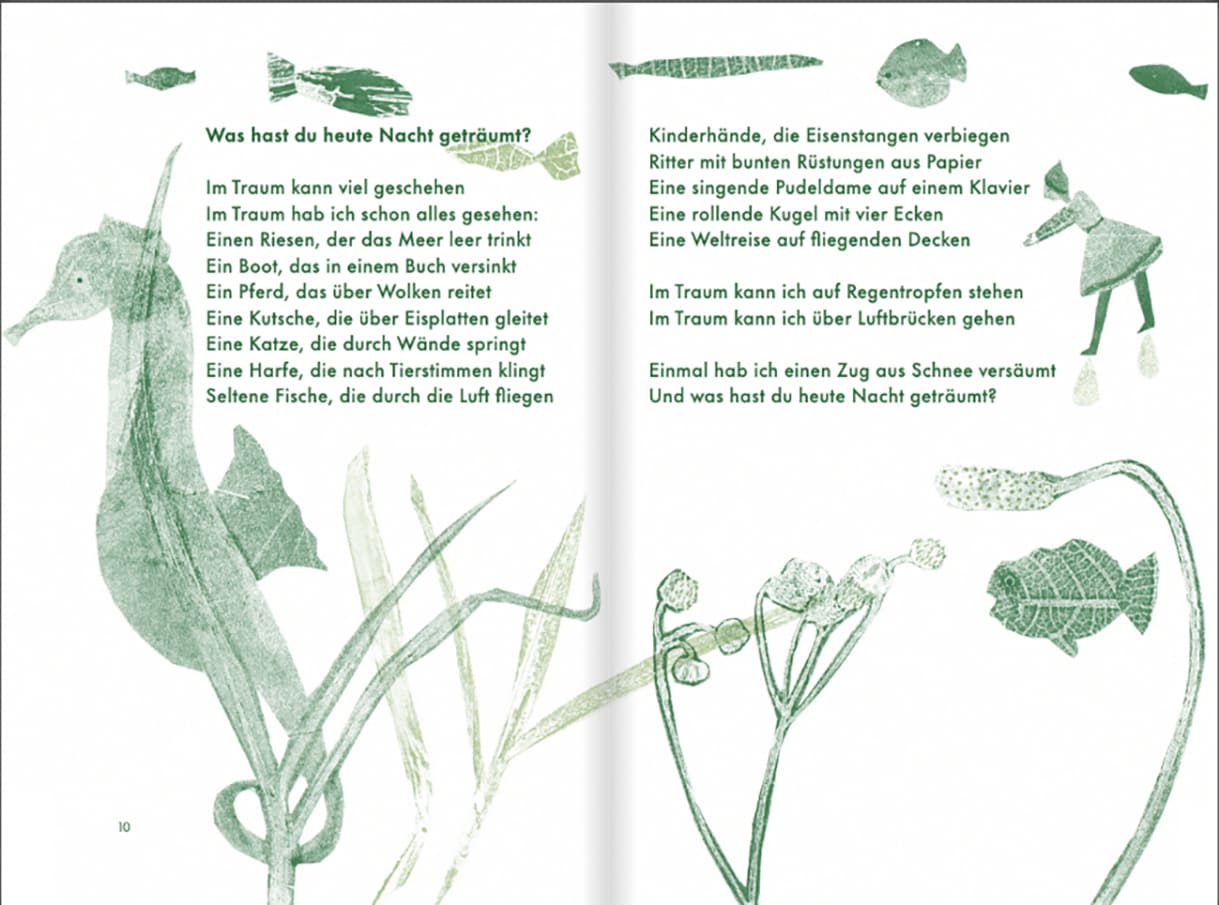
Der Zauberer
steckt
seine schlechte Laune
in die linke Hosentasche
Und zaubert
aus der rechten
ein fröhliches Lachen hervor
Dieses siebenzeilige Gedicht auf Seite 54 bringt vielleicht am besten die Grundidee dieses wunderbaren Bandes der beiden preisgekrönten Kinderbuch-Künstler:innen Heinz Janisch (Text) und Linda Wolfsgruber (Illustration) auf den Punkt. „Ich freue mich furchtbar sehr“ versammelt auf fast 90 Seiten meist in sehr wenigen Zeilen große Geschichten, die allen Widernissen der Welt zum Trotz positive Momente ins Zentrum rücken. Und so riesig machen, dass sie – nein, nicht das Schlimme der Welt vergessen, aber Hoffnung vermitteln. Und dies weder zwanghaft, noch aufgesetzt oder gar pathetisch.
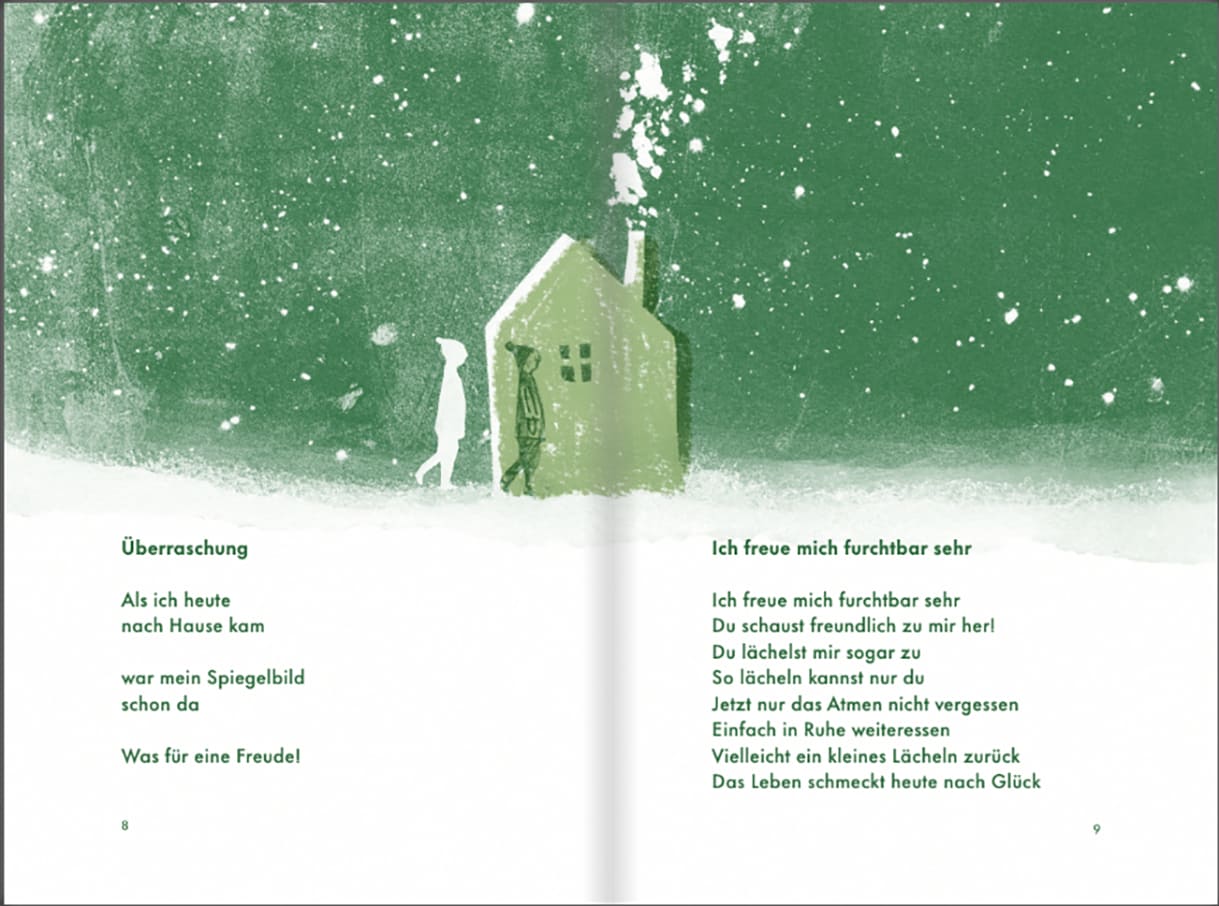
So manches ergibt sich auch aus dem Humor, der beim Denken um die Ecke immer wieder mitschwingt. In etlichen Gedichten spielen Fragen eine große Rolle, nicht zuletzt in „Was kann man in Hosentaschen tragen? – Eine ganze Welt – und viele Fragen!“ Das passt wunderbar zu den ersten Ferienwochen, in der so manche Kinderunis stattfinden, in denen Kinder Hörsäle und Labors stürmen, um am Ende (beispielsweise der Kinderuni Wien bei der Sponsion) zu geloben, „nie aufzuhören, Fragen zu stellen – und Antworten darauf zu suchen“.
Das eine oder andere der Gedichte stößt auch riesige (kinder-)philosophische Themen auf, wenn der Autor etwa „Nichts“ zehn Zeilen widmet. Die beginnen mit einem Gefühl, das sicher jede und jeder kennt: „Heute will mir nichts gelingen / Nicht einmal / ein richtiges Gedicht /“ und damit endet, das dies gar nicht stimmt, weil nun ja doch was da steht 😉
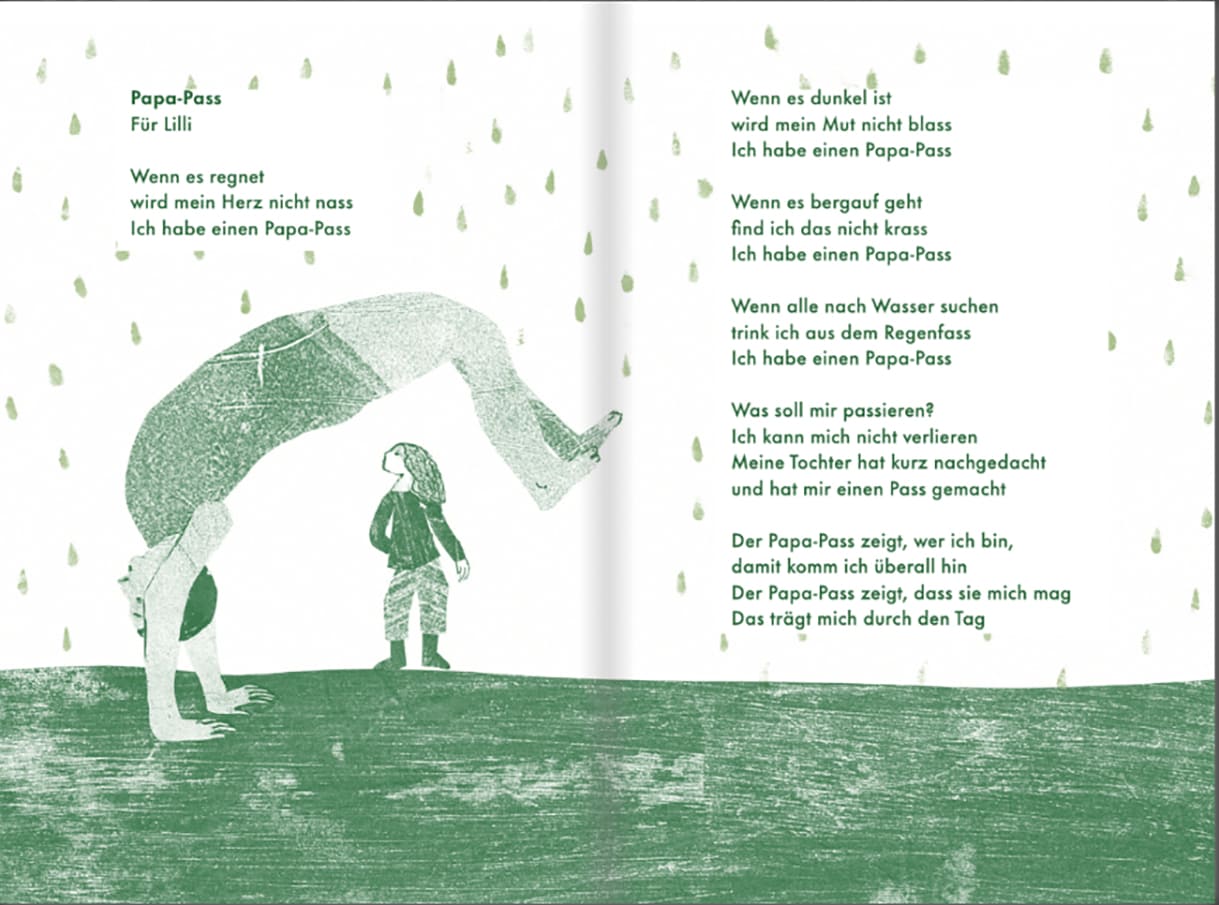
Wie bei guten Illustrationen üblich, aber von Linda Wolfsgruber besonders meisterinnenhaft ausgeführt, eröffnen ihre Zeichnungen mehr als nur die Bebilderung des Textes. Eigene – durchgehend in grün gehaltene, sehr oft naturnahe, häufig zerbrechlich wirkende und doch kräftige menschliche, tierische und pflanzliche Figuren setzen zwischen, neben und unter die Textzeilen Bilder, die ähnlich wie der Text oft Anregungen zum Weiterspinnen der Gedanken einladen.
Ach ja, Heinz Janisch stellt dem Buch die Bemerkung voran: „In unfreundlichen Zeiten braucht es freundliche Gedichte.“
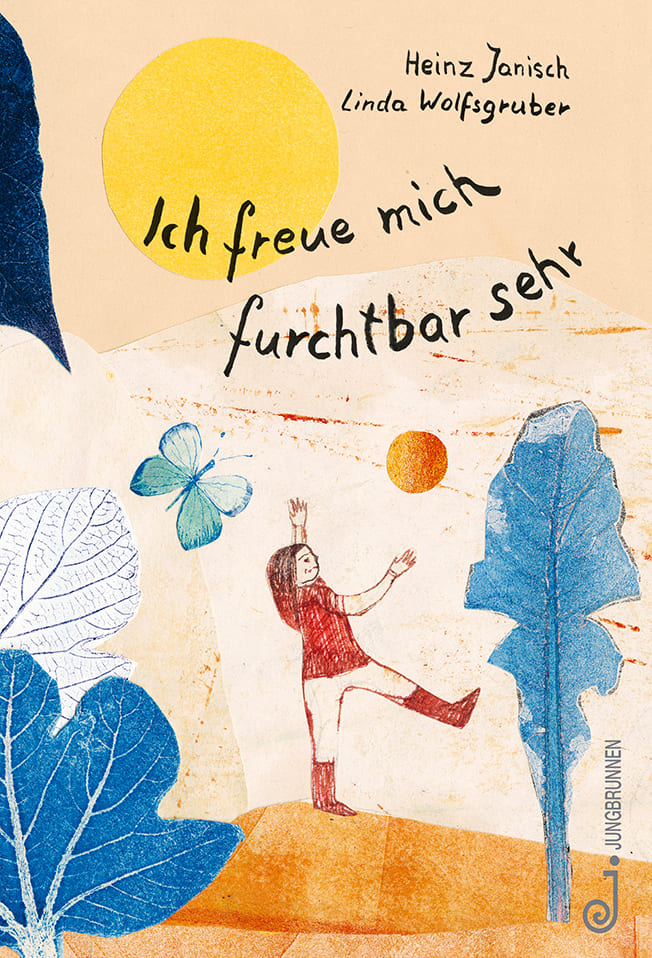

Wo sie begonnen hat, da endet die Jubiläums Kinderuni in Waidhofen an der Ybbs – im Kristallsaal von Schloss Rothschild. Vor zehn Jahren wurde aus der Nicht-Universitätsstadt auf dem Umweg über Kinder und Kurse für sie doch eine. Nicht zuletzt aufgrund dieser Besonderheit heißt die Kinderuni hier KinderUNIversum.
Apropos Universum – ein Kurs drehte sich um unser Sonnensystem, die Heimat der Erde im unendlichen Weltall – und das mit Planeten zum An- und damit leichteren Be-greifen. Vieles, das Kinder in diesen drei Tagen im Schloss sowie an anderen Orten der Stadt bzw. noch weiter weg bei Exkursionen erleben konnten, findet sich auch in Form von Berichten und Fotos auf einer sechs-seitigen Campus-Zeitung, die unter anderem mit Unterstützung von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr im Foyer vor dem besagten schon genannten Kristallsaal aufgebaut war.
Zurück zum Abschluss. Einer der – zeitlich – letzten Kurse am Nachmittag war eine „Zauberschule“, auch wenn dieses Schloss nicht zu Hogwarts wurde, erlernten die teilnehmenden Kinder einige Tricks vom Magier Illusian, alias Julian Grafenhofer. Und so verblüffte nicht nur er alle Gäst:innen der Sponsion, sondern auch Kinder „zauberten“, unter anderem mit riesigen Spielkarten.
Übrigens Zauberschule: Eine der eifrigsten Jungredaktuer:innen, die zehnjährige Anna-Lena Gschnaidtner verfasste neben etlichen Berichten auch einige Witze für die Campus-Zeitung. Einer hat’s auf Seite 1 geschafft – und der sei hier schon verraten, auch wenn die sechs Seiten Teil der nächsten Ausgabe der acht bis zehn Mal jährlich erscheinenden Waidhofener Stadtnachrichten sind und diese erste in der kommenden Woche an alle Haushalte dieser niederösterreichischen Stadt gehen:
„Lasst euch von euren Eltern nicht reinlegen, ich habe Harry Potter schon oft gesehen. „Bitte“ ist gar kein Zauberwort!“, schrieb die fast stets lächelnde und besonders eifrige junge Redakteurin.
Sie führte übrigens ein kurzes, knackiges mit einem Schuss Humor durchzogenes Video-Interview mit dem Bürgermeister der Stadt, Werner Krammer. Gefilmt hat Stefanie Grasberger, die in diesem Jahr die Zeitungsredaktion mit betreute – und, wie schon in einem vorigen Bericht erwähnt, beim ersten KinderUNIversum als Elfjährige selber Beiträge geschrieben hat – damals noch im festlichen Sitzungssaal des Rathauses. Sie hat das Video auch geschnitten und auf Instagram veröffentlicht – Link am Ende dieses Beitrages.
Beim Betreten des Saales fand sich übrigens eine große Kartonkiste mit der Aufschrift „Nachhaltigkeitskiste“. Diese ist eines der sichtbarsten Errungenschaften des neuen Kinderbeirates für das KinderUNIversum. Von Nachhaltigkeit soll nicht nur geredet werden. Brauchbare Gegenstände, die manche Kinder nicht mehr benötigen, konnten / können in dieser deponiert werden. So können andere sie verwenden, statt Ressourcen zu verschwenden 😉
Zum Jubiläum gab’s eine Torte mit dem Logo des KinderUNIversums – die allerdings bei Weitem zu klein war für die Absolvent:innen ;(

„Freiheit für alle politischen Gefangenen in der Türkei!“. „Hoch die internationale Solidarität“, „Solidarität heißt Widerstand – Kampf dem Faschismus in jedem Land!“ Hin und wieder rief ein halbes Dutzend Aktivist:innen vor der Mall in Wien-Mitte diese Solgans. Dazwischen erzählten Rednerinnen und Redner den Grund für die Aktion mit Zelt, Transparenten, Flugblättern und den genannten Sprech-Chören.
In der Türkei lässt der autokratisch herrschende Präsident Recep Tayyip Erdoğan immer wieder politische Widersacher einsperren, darunter auch Journalist:innen. Eine davon ist Sevda Perihan Erkılınç, die knapp vor dem 1. Mai eingesperrt wurde, im Frauengefängnis B-6 in Bakırköy. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen unter dem „Codenamen“ Sevda verbotenen Aktionen zu initiieren. Dabei ist dies ihr zweiter Vorname, für dessen Eintragung in amtliche Dokumente sie schon lange kämpfte, wäre als nicht besonders konspirativ. Sie ist Reporterin der linken Zeitung Özgür Gelecek (freie Zukunft). Anklageschrift gibt es auch nach zwei Monaten noch nicht.

„Es ist weder ein Verbrechen noch kann man damit terrorisieren, Nachrichten für eine Zeitung zu berichten, die die Stimme der Unterdrückten, Arbeiter, Frauen und LGBTI+-Personen ist.“ Schreiben der Wahrheit sei ein legitimes Recht, journalistische Tätigkeit dürfe nicht bestraft werden, wird ein Schreiben von ihr an die Öffentlichkeit zitiert.
„Die inhaftierte Journalistin erinnerte daran, dass viele Journalisten im Land aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im Gefängnis sitzen, und erklärte, dass selbst grundlegende Rechte in der Türkei unter Druck stünden.

Erkılınç hingegen sagte, dass die Täter von Femiziden oft freigelassen würden und argumentierte, dass Femizide durch Straflosigkeit gefördert würden. Sie nannte das Beispiel von Bahar, die von ihrem Ex-Mann in Şişli getötet wurde“, schreibt das unabhängige Kommunikationsnetzwerk (bağımsız iletişim ağı)
Obendrein wird im Gefängnis nicht auf ihre Erkrankungen – Asthma und Zöliakie – eingegangen, und somit ihre Gesundheit massiv gefährdet.
Drei der Aktivist:innen haben gelbe Warnwesten an – mit der Aufschrift Hungerstreik. Aus Solidarität mit eingesperrten Journalist:innen läuft in der Türkei ein Hungerstreik, in Österreich verweigern die drei für drei Tage die Nahrungs-Aufnahme.
Übrigens sitzt seit mehr als drei Monaten auch der gewählte Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, seit mehr als drei Monaten im Gefängnis. Er, dessen Wahl 2019 von der türkischen Regierungspartei AKP angefochten worden war und der in der Wiederholung eine noch größere Mehrheit der Stimmen (Vorsprung rund 800.000) von den Wähler:innen bekam, gilt als aussichtsreicher Gegenkandidat bei künftigen Präsidentschaftswahlen.
bianet.org -> gazeteci-perihan-erkilinc
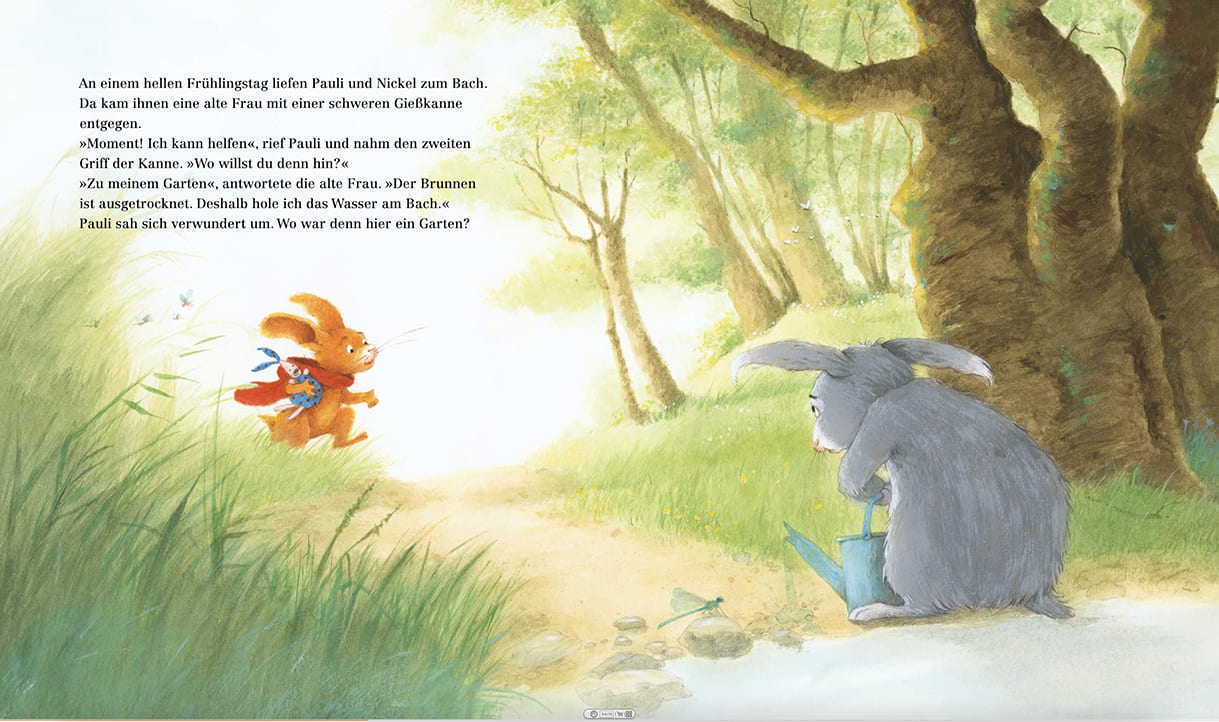
Pauli, ein mittlerweile dank seiner Erfinderin, der Autorin Brigitte Weninger, schon ganz schön berühmtes Kaninchen, ist im jüngsten Abenteuer zu Beginn rasend schnell mit seinem Kuschel-Nickel unterwegs in Richtung Wald. Illustratorin Eve Tharlet lässt ihn fast über den Boden fliegen.
Plötzlich stoppt Pauli, denn er sieht, wie eine alte graue Häsin eine schwere Gießkanne schleppt. Sofort bietet er seine Hilfe an, um den Wasserbehälter gemeinsam zu tragen. Wundert sich aber als Elise sagt, dass sie den Garten gießen will. Weit und breit sieht der Titelheld keinen solchen.
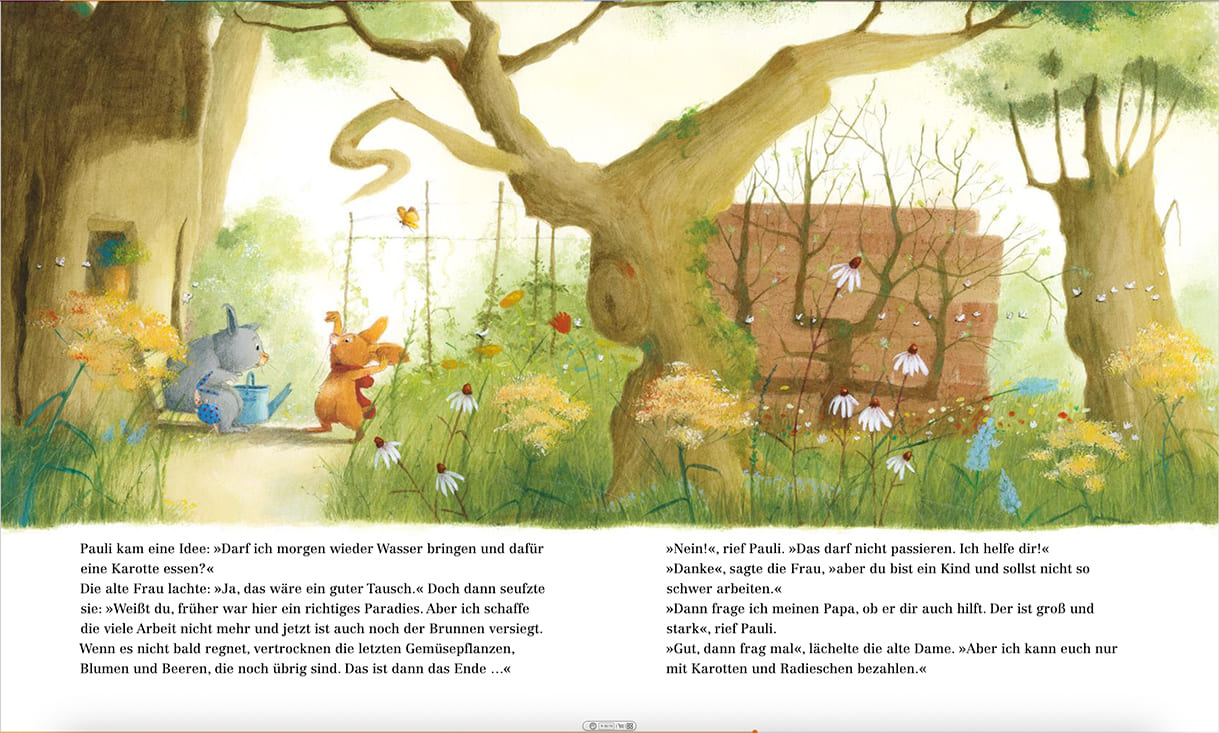
Hinter einem verwitterten Holztor liegt der alten Häsin verwilderter Garten. Da packt nicht nur Pauli mit an, sondern nach und nach organisiert er auch den „Rest“ seiner großen Familie. Im Team richten sie den Garten her. Als Belohnung gibt’s Karotten und Radieschen.
Nein, es gibt keine Wendung, keinen Streit, nur noch später die Herausforderung eines Hochwassers. Aber auch diese lässt die Autorin, vormals zwei Jahrzehnte lang Elementarpädagogin, die Kaninchen gemeinsam meistern. Weshalb das Buch folgerichtig nach dem ersten Teil des Titels (mit dem Namen der zentralen Figur, der Weninger schon viele Geschichten gewidmet hat), „Ein Garten für alle“ heißt.
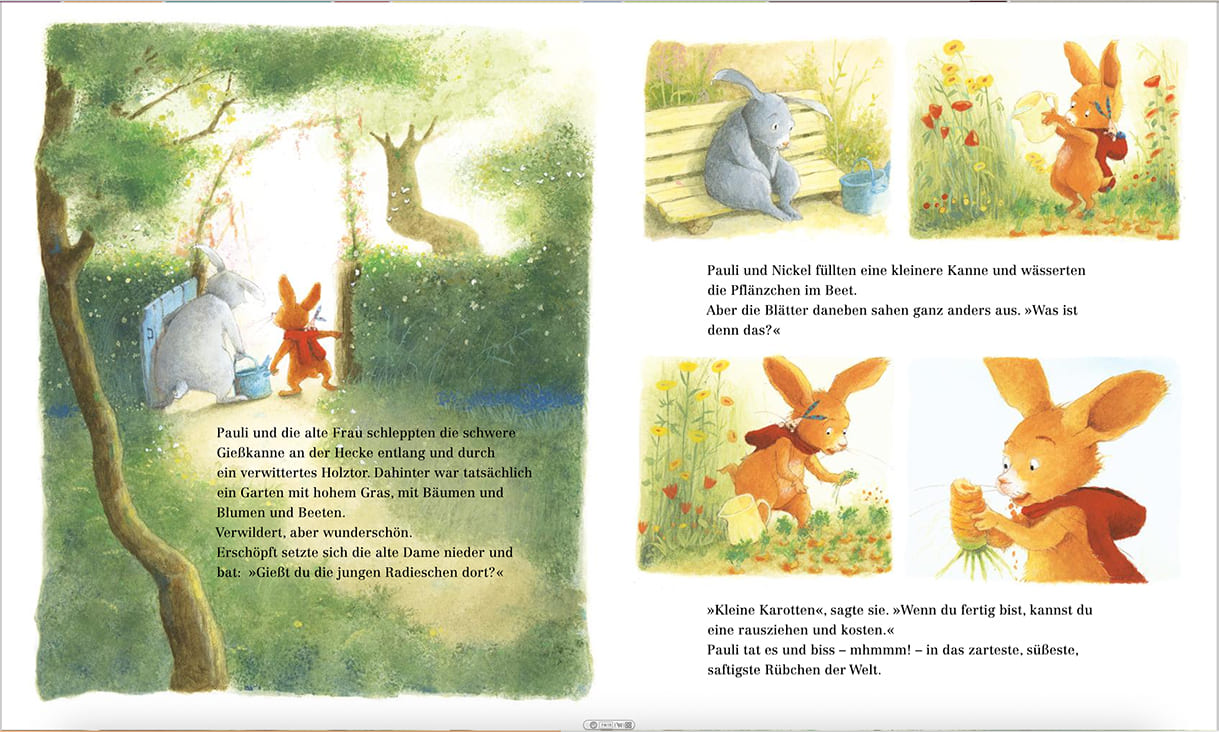
Auch wenn hier jetzt schon sehr viel gespoilert wurde – dieses Bilderbuch – übrigens auch als Hör-Datei von der Verlagsseite runterzuladen – lebt weit darüber hinaus von vielen kleinen Einzelheiten in der Erzählung ebenso wie den detailverliebten Zeichnungen.
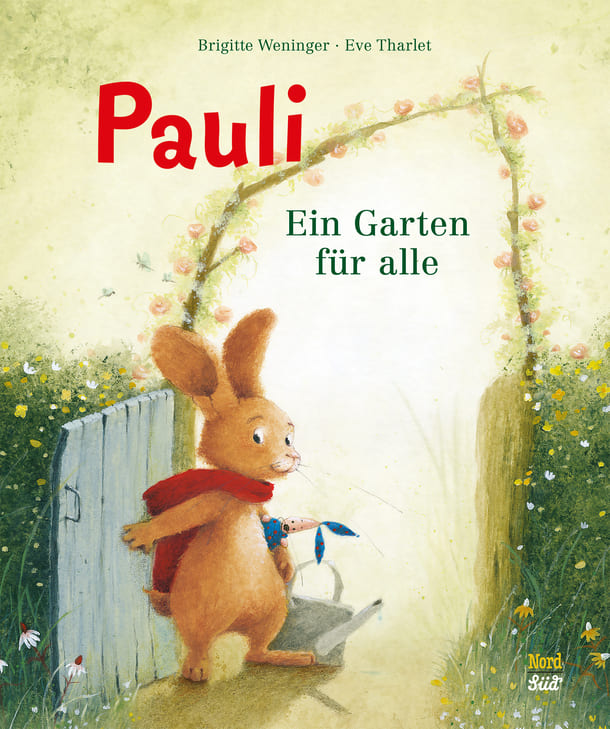

Fröhliche Laute im Chor klingen durchs Stiegenhaus von Schloss Rothschild mit seiner altehrwürdigen, knarrenden hölzernen Treppe auf der einen und den marmorierten Steinstufen, die hinauf zum Kristall-Saal führen andererseits. Dies ist eine der zentrale Locations des KinderUNIversums im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs. Diese Kinderuni begeht in diesem Jahr den zehnten Geburtstag.
Und die Klänge, von denen anfangs die Rede war, sind Zungenbrecher in verschiedensten Sprachen – Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch und jedenfalls noch Japanisch. Das machte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ziemlich neugierig. KiJuKU darf hier – wie in den Anfangsjahren der Vorläufer Kinder-KURIER die junge Redaktion der Campus-Zeitung mit betreuen und die Jung- und Jüngst-Journalist:innen bei der Arbeit begleiten, sowie sechs Seiten der kommenden Stadtnachrichten zusammenfügen.
Also zunächst auf ins Erdgeschoß und ein paar Schnappschüsse so wie ein Video – solche Zungenbrecher wirken nur, wenn sie auch vernommen werden; daher unten am Ende des Beitrages ein Video verlinkt;)
Vermittelt hat diese Zungenbrecher Fatma Efendioğlu als Lehrende beim KinderUNIversum, die beim Verein „Startklar“ als Sprachförderin arbeitet und Kinder beim spielerischen Erlernen der deutschen Sprache unterstützt, selbst mehrsprachig ist und unter anderem Zungenbrecher in weiteren Sprachen mitgebracht hat.
Da passt ein KiJuKU-Buchtipp aus dem März gut hierher: „A wie Biene“. Klingt aufs Erste verwirrend? Nun, „Arı ist etwa das türkische Wort für Bienen. Auf dieser ersten der Bilderbuchseiten von Ellen Heck (Illustration und Text im englischen Original, Übersetzung: Regina Jooß) gibt’s noch drei weitere Bienen-Bezeichnungen: Abelha (Portugiesisch), Aamoo (Ojimbwe – so steht’s im Buch, dürfte aber eher korrekt Ojibwe heißen, und dies ist laut Wikipedia eine der größten indigenen Bevölkerungen in Nordamerika – Kanada und USA). Schließlich beginnt Biene noch in Igbo, einer der mehr als 500 Sprachen im westafrikanischen Nigeria, mit A – Aṅụ“, stand hier damals – unten, am Ende des Beitrages Link zu dieser Buchbesprechung; weitere Links zum mehrsprachigen Redebewerb „Sag’s Multi!“
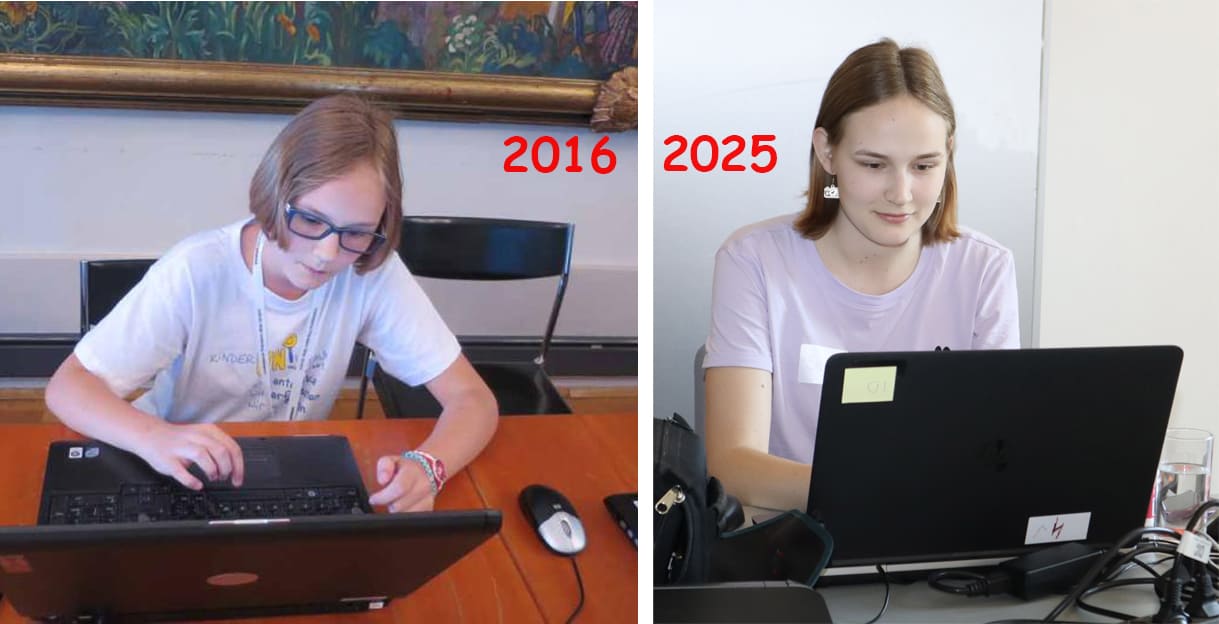
Übrigens: Die Campus-Jung- und Jüngst-Redaktion wurde in diesem Jahr unter anderem von Stefanie Grasberger mitbetreut. In den ersten Jahren von KinderUNIversum hat sie als Kind in verschiedenen Kursen studiert und wurde mittlerweile Journalistin mit schon einigen Praktika in verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen 😉
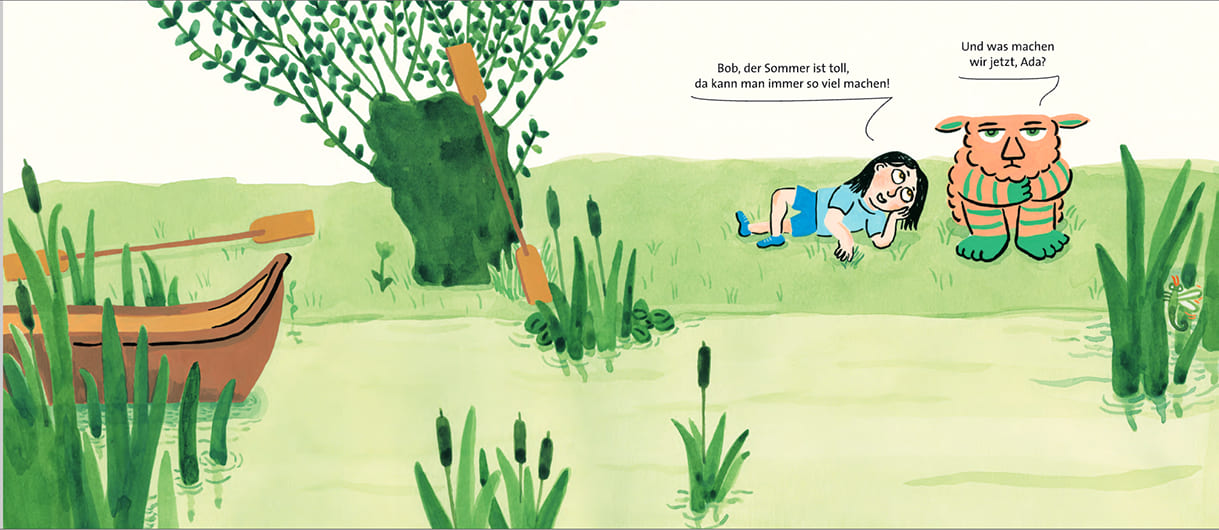
Fast alles in diesem Bilderbuch spielt sich in einem Kajak ab. Ein Boot, gezeichnet von Magali Bardos, das vorne und hinten glich ausschaut. Mit diesem machen sich Ada und Bob, ein Mensch und ein Tier, die beide zu Beginn auf einer Wiese am Ufer eines Flusses liegen, auf die Reise.
Ganz so einfach ist das Paddeln aber nicht, aber dann gleiten sie übers Wasser, freuen sich am Vorwärtskommen und der Landschaft. Klar, so einfach kann’s nicht bleiben, jedes Buch braucht Abwechslung und Spannung. Dafür sorgt Ada. Nicht immer zur Freude von Bob. Die Last des Paddelns ist auch – nicht nur aus der Sicht von Bob – offenbar nicht fair verteilt. Ada spielt sich als Chefin auf und so kommt’s zu durchaus heftigen Streitereien. Und damit – so viel darf schon verraten werden, bist du auf der letzten Seite.

Da ließ sich Autorin Clémence Sabbagh (aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel) was Besonderes einfallen: „Lies die Geschichte noch einmal – jetzt aber rückwärts“, lautet der allerletzte Satz. Sozusagen wie die Form des Bootes, weshalb das Buch auch „Kajak – Eine Geschichte in zwei Richtungen“ heißt.
Eine witzige Idee, funktioniert nur nicht ganz – denn erstens musst du auf manchen Seiten dann doch zuerst den Text auf der rechten statt in umgekehrter Reihenfolge auf der linken lesen. Und zweitens, kennst du ja sowohl den Anfang als auch das Ende.
Andererseits: Es könnte auch sein, dass du den beiden – wieder am Beginn – eine zweite Chance schenkst und dir selber ausdenkst, wie die zweite Kanu-Reise verlaufen könnte.


Schon in der letzten Schulwoche (im Osten Österreichs, Ende Juni) meinten einige Volksschüler:innen am Rande eines Besuchs im „Curiosity Cube“ (Neugier-Würfel), der zwei Tage in Wien Station gemacht hat, dass sie durchaus auch lieber weiter lernen statt Ferien haben würden. Seit mehr als 20 Jahren stürmen Tausende Kinder in Wien in den Sommerferien zwei Wochen lang so ziemlich alle Universitäten und Hochschulen für die Kinderuni. Sie wollen in jenen Fachgebieten, die sie besonders interessieren mehr wissen, Experimente machen, Neues lernen.
Derzeit läuft in Wien auch schon die Kinderuni Kunst und aktuell drei Tage lang auch das KinderUNIversum im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs, das auch „nichts anderes“ als eine Kinderuni ist, nur dass die Stadt selber über keine Universität verfügt. Zeitgleich mit Wien startet die Kinderuni in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz, jene in Steyr im selben Bundesland gegen Ende der Sommerferien, in Krems (NÖ) steigt sie auch diese Woche, jene in der steirischen Landeshauptstadt Graz in der dortigen ersten Ferienwoche, jene in Salzburg hat schon während der Schulzeit begonnen, läuft aber auch noch in der ersten Ferienwoche, Innsbruck startet kommende Woche.
Diese Kinderuni mit Jahr für Jahr rund 200 neugierigen, wissbegierigen Jung- und Jüngst-Studierenden – Kurse in verschiedenen Altersgruppen von 5 bis 15 Jahre – feiert heuer den 10. Geburtstag. Zum Jubiläum kam die erste Garde der Kinderuni Wien, die in zwei Jahren ihr erstes ¼ Jahrhundert begehen wird.
Nach einem Vortrage über Stahl von Axel Michels vom Hauptsponsor voestalpine mit Anleihe beim TV-Kinder-Klassiker 1 – 2 oder 3 mit babyleichten Fragen, spannte Karoline Iber von der Kinderuni Wien einen großen Bogen von kindlicher Neugier bis zu forschenden Wissenschafter:innen. In einem kleinen, handlichen Experiment ließ sie einen Tischtennisball schweben. Der „Zaubertrick“ – ein Föhn. Heiße Luft, kann aber auch kalte sein, hält den Ball in der Höhe.
Die eine oder andere (Quiz-)Frage lief hier nicht mit Feldern, auf die es galt, sich zu stellen samt „wenn das Licht angeht“ ab, sondern mit bunten Karten – rot, grün, lila. Ihre Fragen waren nicht immer einfach. Und wahrscheinlich war auch für die wenigen Erwachsenen im Raum die Auflösung, welches die älteste Universität der Welt ist, verblüffend. Wien – gegründet 1365 – ist „nur“ die älteste deutschsprachige hohe Schule, Bologna – fast 300 Jahre früher, 1088 – ist „nur“ die älteste in Europa. Aber schon noch einmal mehr als 200 Jahre früher öffnete die Universität al-Qarawīyīn im marokkanischen Fès ihre Tore für Studierende, und natürlich Lehrende. Übrigens wurde diese Uni von einer Frau gegründet Fāṭima al-Fihrīya. Letzteres wurde leider gar nicht dazu gesagt.
Handwerk und Technik, Wissenschaft unterschiedlichster Sparten, aber auch viel Kunst und Kultur spielt sich in Kursen des Waidhofener KinderUNIversums ab. Umwelt und Nachhaltigkeit sind ebenfalls Themen. Über so manches davon berichten auch junge Reporterinnen und Reporter in der Campus-Zeitung, die von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… mit betreut wird – wie in den Anfangsjahren vom KiJuKU-Vorläufer Kinder-KURIER. Mit im Betreuer:innen-Team ist übrigens mit Stefanie Grasberger eine Frau, die in den Anfangsjahren als Kind selber auch in der Campus-Zeitung als Kinder-Reporterin geschrieben hat 😉
Erstmals wird die Campus-Zeitung aber Teil der offiziellen Stadtnachrichten von Waidhofen an der Ybbs, die dann in der kommenden Woche an alle Haushalte der Stadt gehen werden.
Übrigens: Im ersten Jahr von KinderUNIversum und der Campus-Zeitung hat ein junger Reporter in einem Beitrag erklärt, dass Ybbs nicht wie es die meisten Menschen außerhalb dieser Gegend als Übs, sondern als Ibs ausgesprochen wird 😉

Wie schon im ersten Teil – Link dazu weiter unten – verraten, steht in diesem Sommer „Rotkäppchen – neu verirrt“ auf dem Spielplan des alljährlichen „Märchensommers“ im Schloss Poysbrunn (Weinviertel, Niederösterreich). Viele Theater- und Musical-Versionen haben gerade dieses Märchen auch schon neu und ziemlich anders erzählt – zuletzt im heurigen Frühjahr der Wiener Rabenhof in Kooperation mit dem Theater der Jugend – mit einem vegetarischen Wolf – Link zu dieser und weiteren Stück- sowie Buch-Besprechungen weiter unten.
Zurück nach Poysbrunn. Obwohl im Weinviertel gelegen, hat Rotkäppchen (Patrizia Leitsoni) – wie auch in vielen neueren Versionen – in ihrem Korb für den Besuch der Großmutter im Wald natürlich keinen Alkohol mehr mit, sondern Hollersaft. Der wächst, so wie der Kuchen, hier ein Kürbis(kern)-Gugelhupf, aus dem Korb heraus – zu personifizierten Schauspieler:innen: Christian Kohlhofer als wandelnde Flasche mit Stoppelhut und grünen Stiefeln sowie Gudrun Nikodem-Eichenhardt mit jedenfalls an diese Kuchenform erinnerndem breitem Rock samt rosa Zuckerguss und ebensolch farbigen Sneakers. Da blieb die Verkleidung ab der Körpermitte nach oben noch ein Geheimnis, das bei der Probe nicht gelüftet wurde (Kostüme: Agnes Hamvas).
Die beiden begleiten nun Rotkäppchen auf der Suche nach Omas Waldhaus. Die Oma, die hier mit Helga sogar einen Namen hat – im Gegensatz zu den meisten Versionen -, ist eine kreuzfidele, lebenslustige und reise- und tanzfreudige (wie auch die anderen Figuren und Darsteller:innen, schließlich gibt es immer wieder Lieder im Verlauf der Vorstellung) Dame mit altem, kleinen Handy (Johannes Kemetter). Sie verfügt übrigens – auch wenn nicht alles, so sei doch ein bisschen schon verraten – über ein magisches Kochbuch und beheimatet bei sich eine Hausmaus. Diese wird von Kindern abwechselnd gespielt, unter anderem Linus Nikodem-Eichenhardt (Interview siehe im ersten untern verlinkten Teil); fast vier Dutzend Kinder (genau 45) schlüpfen in bunte Stastist:innen-Rollen die einige Szenen bereichern – als Glimmerleins und Zauberblumen – neben den Hausmäusen.
Wie immer im wahrhaft märchenhaft wirkenden Schloss spielt sich die Story als Stationen-Theater ab – Beginn und Schluss für alle gemeinsam in einem großen Zelt neben dem Schloss und dann in drei großen Gruppen – in verschiedenen Räumen in Schloss und dessen Garten, was abwechslungsreich, dafür leider nicht barrierefrei ist.
Dazwischen wandern die Zuschauer:innen – unter anderem zu Omas Haus, zu einer Fee (Viktoria Hillisch), zum Großen Glimmer (Barbara Kramer) und den Glimmerleins (etliche der Kinder, die sich in verschiedenen Rollen wochenend-weise abwechseln) oder dem Steinbeißer (Johannes Kemetter, ja, genau, der der auch die Oma spielt). Von allen drei Stationen muss das Publikum – mit ein bisschen Mitmachen – Dinge mitbringen, um die Story aufzulösen. Von der Fee zum Beispiel Glitzerstaub.
Diese „residiert“ in einem der hintersten Zimmer im zweiten Stock, der sich in eine Art Himmelsbogen samt wolkiger Hollywoodschaukel verwandelt hat (Bühnenbild: Marcus Ganser). Beim Probenbesuch durfte diese Station und damit die eher grantige, weil singesuntaugliche Fee miterlebt werden. Klar, dass sich das im Verlauf der Szene auflöst, der Guglhupf – mit Hilfe der Kinder und anderer im Publikum – bringt sie so weit, dass sie sogar fröhlich jodeln lernt.

Ach ja, da wäre doch noch der Wolf (Daniel Ogris)!? Dass er Oma und Rotkäppchen nicht frisst, wurde hier schon im ersten Teil gespoilert. Trotzdem geht die große Angst vor ihm um. Tier- und gar Wolf-Liebenden könnte das recht lange auf die Nerven gehen und wirken, als würde dies den Jagdwütigen, die derzeit viel um leichtere Abschüsse lobbyieren, in die Hände spielen. Aber natürlich wendet sich auch da die Story zum Guten; doch wie? Das soll doch beim Besuch eine Überraschung bleiben.
Interviews mit 2 der 45 Kinder, die – abwechselnd – mitspielen hier unten

Viele Märchen spielen in oder rund um Schlösser. Dieses zählt nicht dazu: Rotkäppchen. Zum „Glück“ gibt es auf dem Areal des Schlossgartens vom Poysbrunn (Niederösterreich), der natürlich über etliche Bäume, die an Wald erinnern, verfügt, auch eine Art große hölzerne Hütte. Die ist einer der Spielorte – auf der Veranda davor als Großmutters Waldhäuschen.
Wie schon in den vergangenen Jahren wird nicht einfach die Story aus der Sammlung der Gebrüder Grimm oder eine andere Geschichte (es gab schon Alice im Wunderland, die Lewis Carroll erfunden hatte) inszeniert, sondern die Geschichte neu und ziemlich verändert erzählt, gespielt, gesungen und getanzt. Gerade für Rotkäppchen gibt es übrigens zahlreiche veränderte Versionen – in Büchern und auf Bühnen – Links zu einigen Besprechungen am Ende dieses Beitrages.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte knapp eine Woche vor der Premiere von „Rotkäppchen – neu verirrt“ einer der Proben, bei der alles durchgespielt wurde, zuschauen. Rund um wurde noch gebohrt, geschraubt, gehämmert, Holzplatten für Kulissenteile gemalt…
Und während die sieben erwachsenen Darsteller:innen alle spielten, waren nur zwei der Kinder im Einsatz. Junge und jüngste Mitwirkenden übernehmen bei den Inszenierungen im Märchensommer immer nur die Rolle von Zauberblumen, Trolle, Glimmer und andere, also eher Statist:innen. Im Gegensatz etwa zu den Aufführungen von teatro im Stadttheater Mödling wo Kinder und Jugendliche gemeinsam mit erwachsenen Profis die Musicals prägen.
… dafür kommen hier ausschließlich die beiden Kinder des Proben-Sonntagmittags zu Wort: Louis (10) und Linus (8), ersterer spielt einen Glimmer, Zweiterer die Hausmaus bei Oma. Und als solche kommt er auch mehr zum Einsatz und darf sogar den Wolf vertreiben, der hier übrigens – so viel sei hier schon verraten, weder Oma noch Rotkäppchen frisst.
Beide sind „heuer schon zum dritten Mal dabei“, erzählen sie im Journalist:innen-Gespräch (eine Kollegin war auch dabei), und erinnern sich an frühere Rollen als Teil der Crazy Chickens bzw. als Gnom bei Rapunzel.
Sehr schwierig seien die Proben nicht gewesen, aber schon ein bisschen, lassen sie durchklingen, „aber ich freu mich, wenn ich’s dann kann“, meint Linus, der sich freut, „dass ich zum ersten Mal auch eine kleine Sprechrolle habe“, wobei er „hofft, mich nicht zu verhaspeln, das wäre nicht so cool.“
Übrigens haben die beiden wie fast alle ihre Alterskolleg:innen zwei verschiedene Rollen, die sie abwechselnd übernehmen; „jedes Wochenende spielen andere Kinder“, so Louis. „Das Wechseln ist aber nicht so schwer“, versichern sie beide in dem Interview, das sie beide gemeinsam vor dem Eingang zum Efeu-verhangenen Schloss vor der Probe führen.
Beide sind aus Wien – im Gegensatz zu einigen anderen der mitwirkenden Kinder, die in der Gegend wohnen, „aber wenn wir spielen, bleiben wir hier“.
Auf die Frage wie der Wechsel von der Großstadt in den kleinen Ort ist, schätzen beide die viele Natur und das Grün hier. „Ich wollt immer schon einmal in der Wildnis wohnen“, meint etwa Linus.
KiJuKU will auch wissen, ob Theater, Schauspiel ein möglicher Berufswunsch sein könnte?
Louis, schon ziemlich überzeugend: „Ich will Kellner werden!“ Und sein Kollege Linus träumt eher vom Fliegen als Pilot, schaut später zum Himmel und berichtet ganz aufgeregt, dass in dem kleinen Flugzeug das zu sehen und zu hören ist, „mein Vater fliegt, der macht gerade den Pilotenschein“.
Mehr zur Story und der Inszenierung „Rotkäppchen – neu verirrt“ (3. Juli – 24. August 2025; an den Wochenenden) in einem weiteren, eigenen Beitrag – dann auch mit allen Detail-Infos -, der noch folgt.
neu-ertraeumte-alice-mal-3-im-wunderland <- damals noch im Kinder-KURIER

„Ich schenke euch ein Wort“, begann Lena Raubaum ihre Festrede bei der diesjährigen Preisverleihung der Jury der jungen Leser*innen. Ein Schuljahr lang lesen Kinder bzw. Jugendliche gut ein Dutzend Bücher, diskutieren darüber, bewerten die Lektüre und wählen gegen Ende der Saison ein Lieblingsbuch aus. Dieses stellen sie öffentlich, teils performativ, vor, begründen ihre Entscheidungen und zeichnen die Autor:innen aus. Manche reisen an, andere erfahren von ihrer Wahl – mittlerweile längst auf elektronischem Weg und die meisten aus der Ferne antworten auch – schriftlich oder hin und wieder per Video-Botschaft.
Seit vier Jahren gibt es – nach der Pause aufgrund des Todes der Gründerin der ersten Jury vor mehr als 30 Jahren, Mirjam Morad – sozusagen die Jury der jungen Leser*innen 2.0. Als Verein Literaturbagage organisieren Greta Egle, Anna und Kathi Pech sowie Sara Schausberger, die in Morads Zeit selber als Kinder bzw. dann Jugendliche Teil dieser Jury waren, die wieder auferstandenen regelmäßigen Zusammenkünfte junger Menschen, die gern lesen und über Bücher diskutieren. Das genannte Quartett holt jedes Jahr zur Preisverleihung auch eine Person, die schon etliche Bücher (auch) für junge Leser:innen geschrieben hat; so war es im Vorjahr Renate Welsh und heuer Lena Raubaum, die über Bedeutung und Wichtigkeit von Lesen erzählten.
Lena Raubaum betrat das Redepult mit einem Rucksack, aus dem sie nach und nach sozusagen Requisiten hervor holte. Aber zunächst zurück zum Beginn dieses Beitrages: Das Wort das sie – nicht nur den jungen Juror:innen, sondern natürlcih dem gesamten Auditorium und über diesen Artikel (hoffentlich) noch viel mehr Menschen „schenkte“: Litera-Tür, ausgesprochen wie im Französischen, aber eben mit der bewussten Bedeutung Tür bzw. Türen. Solche können Bücher öffnen – zu verschiedensten Welten;)
Zu den spannenden Objekten, die sie aus dem Rucksack holte zählte ein eher ungewöhnliches Symbol für Zeit – die mit Büchern verwendet, nie verschwendet werde: Das fast kreisrunde Ding war keine Uhr – die wäre ja gewöhnlich -, sondern die Scheibe eines Baumstammes!
Apropos Zeit: Die 41-jährie Autorin zahlreicher, auch preisgekrönter, Bücher, zählt zu den wenigen, die neben Prosa-Geschichten auch Gedichte verfasst. Ein solches aus dem Band „Mit Worten will ich dich umarmen. Gedichte und Gedanken“, illustriert von Katja Seifert, teilte sie zum Abschluss mit dem Publikum, indem sie es nicht nur hörbar vortrug, sondern auch in Gebärdensprache, die sie derzeit erlernt, sichtbar machte – und alle dazu einlud, bei der nachfolgenden Wiederholung mit zu gebärden. Ein Gedicht übrigens, das derzeit fast jeden Tag bei Betrachtung der Weltlage vielleicht eine Spur von Trost vermitteln könnte:
Tage gibt’s, da spinnt die Welt
da dreht sich alles um
da geht was schief
da rennt was schräg
da frag dich nicht warum
denn Tage gibt’s, da spinnt die Welt
das Tröstliche dabei:All diese schrägen Tage
die gehen auch vorbei
Aus Lena Raubaum / Katja Seifert: Mit Worten will ich dich umarmen. Gedichte und Gedanken

Apropos „spinnen“ und vorbeigehen – vielleicht unterstützt das Kulturamt der Stadt Wien ja im kommenden Jahr die Aktivitäten dieser wunderbaren Initiative wieder. Heuer hat sie – im Gegensatz zu all den vergangenen Jahr(zehnt)en die Subvention dafür gestrichen, noch dazu kurz vor der Preisverleihung.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wandte sich mit der Frage nach einem warum an die Wiener Kulturstadträtin und wurde von dort direkt an die zuständige MA (MagistratsAbteilung) 7 verwiesen. Von dort hieß es in der eMail-Antwort mit Verweis auf die Förderung zahlreicher anderer Kinderliteratur-Initiativen unter anderem: „Die Absage in dieser Runde erfolgte aus budgetären Erwägungen, die in jeder neue Einreichrunde gefasst werden. Da es in dieser Einreichrunde eine große Zahl von Einreichungen von hoher Qualität bei einem begrenzten Budget gab, und da die Veranstaltung laut Antrag auch auf andere Fördermittel aus Bund und Stadt (Bezirk) zurückgreifen und daher stattfinden konnte, wurde in dieser Runde eine Förderung nicht empfohlen. Der durchaus sichtbare Wert der Veranstaltung ist in dieser Empfehlung aber nicht widergespiegelt und wir laden die Literaturbagage ein für 2026 in der nächsten Einreichrunde Ende des Jahres anzusuchen…“
Also Nachfrage bei der Literaturbagage, wie das mit den anderen Fördermitteln ist. Antwort: „Es stimmt, dass wir Förderung von Bezirk und Kulturministerium. Aber der Bund (Ministerium) finanziert den laufenden Betrieb, jene von Bezirk und Stadt Wien wären direkt für die Veranstaltung der Preisverleihung. Also nach der MA-7-Logik könnte dann der laufende Betrieb funktionieren, aber die Preisverleihung geht sich eigentlich nicht aus. Außer wir machen alles gratis, wobei wir das Ganze ohnehin schon quasi für kein Geld machen.“

Die längsten (Warte-)Schlangen im Wiener Donaupark am Samstagnachmittag, dem ersten Tag des Ferienspiel-Startfestes, beim Zorbing (in einem großen luftgefüllten Ball über die Wiese rollen), dem Autobus-Fahr-Simulator und bei der legendären Schrei-Box – kein Schreibfehler. In dem Zelt des Medienzentrums dürfen Kinder nach Herzenslust schreien – und werden dabei fotografiert. Die ausdrucksstarken, fröhlichen Bilder können nach ganz kurzer Zeit mitgenommen werden. „Noch einmal! Noch einmal!“, vernahm Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… beim Lokalaugenschein nicht nur einmal. Aus Rücksicht auf die wartenden Kolleg:innen gaben sich die meisten dann doch mit dem jeweiligen Schnappschuss zufrieden.
In einer eigenen, kleinen Sportwelt warteten eine Fußball-Torwand, Basketballkörbe in unterschiedlichen Höhen, an andere Stelle konnte anstelle eines runden Balls, das berühmte „Eierlaberl“ wie der Football in Wien auch liebevoll genannt wird, geworfen werden.
Statt einer Hüpfburg gibt’s traditionell riesige aufgepumpte Rutschen – auch eine sehr beliebte Station. Bauerngolf, Schminken lassen, selber auf großen Papierbögen an Staffeleien malen, wissenschaftliche Experimente an mehreren Stellen, Infos und Tipps für Notfälle von den Helfer:innen Wiens, spielerisch über Mülltrennung bzw. Klimaschutz lernen.
Eine der ersten Stationen – beim Zugang von der U1, andernfalls eine der letzten: Wiener Wasser – entweder im Becher oder die eigene Falsche wieder auffüllen lassen. Was angesichts der Hitze sehr notwendig war; wobei es auch ständig hier verortete Hydranten gibt. Wasser versprühten auch die Künstler:innen, die alle anderen überrag(t)en, weil sie auf Stelzen gingen /gehen.
Der Scooter-Parcours eignete sich besonders für beeindruckende Fotos – direkte Sicht auf den Donauturm im Hintergrund. Ausprobiert werden kann aber auch, wie es sich in einem Rollstuhl fährt und dass es da so manche Hindernisse gibt. Apropos Inklusion: Das Programm auf der Bühne wurde abwechselnd von zwei Dolmetscherinnen in Österreichische Gebärdensprache übersetzt. Ein bisschen davon kann auch am Stand der „Kinderhände“ erlernt werden, unter anderem durch Zusammenfügen von Legosteinen mit den an der Seite aufgedruckten Zeichen für die Buchstaben – so kommst du zu einem Turm mit deinem Namen.
Übrigens, auf der Bühne gibt es abwechslungsreiches Programm – von unterschiedlichsten Tanzstilen über ebenso verschiedene Musik – Musical, Beatboxen, Hip*Hop, Rap bis zu Punk, dazu Clownerie, Geschichten UND natürlich dem leibhaftigen Holli – als Mensch im Kostüm des Ferienspiel-Maskottchens wandert der Sonnenkopf auch übers Festgelände. Sein aufblasbares riesiges Gegenstück hingegen bleibt gleich neben der Bühne stehen.
Mehr als vier Dutzend Stationen haben ihre Zelte mit Aktivitäten und Infos für Kinder aufgestellt. Letzteres natürlich auch für Eltern, Pädagog:innen und andere Erwachsene, die nun für die kommenden neuen Wochen Programm suchen, wobei es im Rahmen des Ferienspiels rund drei Mal so viele unterschiedliche Aktions-Angebote gibt; viele davon übrigens gratis oder wenigstens kostengünstig.
Das Startfest – im Laufe der Jahrzehnte immer wieder an verschiedenen Orten – ist dieses Jahr wieder im Donaupark, einem grünen Gelände, das vor knapp mehr als 60 Jahren auf dem Areal einer ehemaligen Müllhalde für die internationale Gartenausstellung errichtet worden ist. Alle Stationen sind aber gar nicht über den ganzen Park verteilt, sondern entlang einer – natürlich autofreien – Straße – auf der einen Seite wenige Gehminuten von der U1 Station Alte Donau, auf der anderen Seite U6, Station Neue Donau; dass die S-Bahn ausgerechnet schon ab Samstag zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt war, hätte sich vielleicht doch um zwei Tage nach hinten verlegen lassen.

Amelie Herold, Mia Mende, Emma Wille und Talitha Worster lasen bei der diesjährigen Preisverleihung der Jury der jungen Leser*innen im Literaturhaus Wien wenige Tage vor Schulschluss Passagen aus „Alle Farben von Licht“, das die Jugendlichen als Ältere der Jury der jungen Leser*innen zum Preisbuch 2025 – nach Lektüre von elf Büchern und intensiven Diskussionen darüber -gewählt hatten. Da sie und Lara Menner, Sara Subotić, Delia Frassine und Mara Vecchiotti sich nicht auf ein einziges einigen konnten, stellten die vier zuletzt Genannten einen Sonderpreis der jugendlichen Jury vor: Nachtschatten – Rosenheim-Trilogie (#3) von Gry Kappel Jensen.
Die vier Erstgenannten begründeten ihre Entscheidung für das Buch von Annika Scheffel so: „Es hat uns auf so vielen Ebenen berührt und überzeugt. Die Sprache ist einfühlsam und authentisch, die Figuren sind lebendig. Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene handeln glaubwürdig, ihre Gedanken und Gefühle sind nachvollziehbar. Das Buch berührt – still aber tiefgehend ohne jeglichen Kitsch. Gerade diese Kraft der Erzählweise der Autorin hat uns beeindruckt und auch nach dem Lesen noch nachdenklich gestimmt.
Gleichzeitig spricht das Buch wichtige und ernste Themen an: Verlust, Identität, Familie und auch psychische Belastung. Diese Themen werden mit viel Feingefühl und Respekt einverwoben. Die Verbindung aus berührender Sprache und inhaltlicher Tiefe machen „Alle Farben von Licht“ für uns preiswürdig. Und aus diesem Grund möchten wir nun auch den Blick auf die ernsteren Themen der Geschichte richten, die oft leiser, aber umso eindringlicher erzählt werden.
„Alle Farben von Licht“ zeigt, wie wichtig es ist, offen und ehrlich über psychische Gesundheit zu reden. Rio leidet, doch Schritt für Schritt und Wort für Wort findet er zurück ins Leben. Seine Geschichte schenkt Hoffnung. Rios Probleme verschwinden nicht einfach, doch er lernt mit seiner Trauer zu leben. Seine Geschichte zeigt, dass es okay ist, nicht o.k. zu sein. Das Leben hat viele Schattierungen – aus diesem Grund war es uns wichtig, dieses Buch hervorzuheben, denn am wichtigsten ist es, dass man nicht alleine kämpfen und den Weg zum Licht nicht alleine gehen muss.“

… ihr euch ran und tief reingewagt habt in dieses Buch, das für mich tatsächlich das persönlichste und wichtigste ist, das ich bisher geschrieben habe; ein Buch, das es nicht leicht hat auf dem Buchmarkt, vielleicht auch wegen der Themen, weil es neben Freundschaft und Lieben eben auch vom Tod, Trauer, Verlust und Einsamkeit handelt…“ las Anna Pech aus dem Antwortbrief der Autorin. Anna ist eine der vier Gründerinnen und Betreiberinnen der „Literaturbagage“, die die Jury der jungen Leser*innen nach dem Tod der Erfinderin dieser Buchdiskussionen vor mehr als 30 Jahren, Mirjam Morad, wieder belebt hat.
Ein bisschen erinnert der Plot an Harry Potter und Hogwarts. Kamille, Kirstine, Malou und Victoria besuchen ein Internat, in dem unter anderem Magie, Hellseherei, aber auch Mythologie, nicht zuletzt aus dem Nordischen Kulturkreis. Rosenholm heißt diese Zauber-Schule – und die Trilogie von Gry Kappel Jensen.
Lara Menner, Sara Subotić, Delia Frassine und Mara Vecchiotti aus der älteren Gruppe der Jury der jungen Leser*innen (12 bis 16 Jahre) lasen Auszüge aus „Nachtschatten“, dem dritten „Rosenheim“-Band. Die Jugendlichen – zu denen noch Amelie Herold, Mia Mende, Emma Willer und Talitha Worster gehören – hatten sich bei den Buchdiskussionen nicht auf ein Preisbuch einigen können bzw. wollen und vergaben für die magische Trilogie samt Kriminalfall um einen lang zurückliegenden Mord einen Sonderpreis.

In ihrer Begründung für die Entscheidung sagten sie bei der Vorstellung auf der Bühne des Wiener Literaturhauses unter anderem: „Unserer Meinung nach gab es in der Reihe einen sehr gelungenen Perspektivenwechsel. Wann aus der Sicht welcher der Protagonistinnen geschildert wurde, war für uns während des Lesens klar ersichtlich. Auch der Schreibstil der Autorin hat uns gut gefallen, er ist klar und verständlich. Dass einige Elemente der nordischen Mythologie in die Geschichte eingearbeitet wurden, hat den Spannungsfaktor noch einmal erhöht. Die Probleme der Hauptfigur waren nachvollziehbar und spannend erzählt und auch die Liebesgeschichte kam trotz des Genres Fantasy nicht zu kurz. Die gesamte Rosenheim-Trilogie beinhaltet fesselnde Abenteuer, die uns dazu gebracht haben, die Bücher in einem durchzulesen und sie nicht so schnell wieder aus der Hand zu legen.“
Kathi Pech, eine aus dem Quartett der Literaturbagage und wie ihre Kolleginnen eins selbst Kind in der Jury der jungen LeserInnen vor mehr als 20 Jahren, verlas die englische Antwort der Autorin Gry Kappel Jensen, die sich über diese Auszeichnung sehr freute und nun Österreich noch mehr schätze… (siehe Video).
Wird mit einem dritten Teil fortgesetzt.

Als Carla Steiner, Emma Gruber, Zeynep-Sara Türk, Alma Hammerer und Suren Leo Paydar an den Tischen auf der Bühne des Wiener Literaturhauses Platz genommen hatten, wurden ihnen Schalen mit Gemüse und Obst gebracht. Suren griff zu einem aus grünen Krepp-Papieren kunstvoll gebastelten „Brokkoli“. Da war selbst jenen, die den Folder beim Büchertisch noch nicht gesehen oder gelesen hatten, aber mindestens dieses eine Buch kannten, klar: Die Wahl dieser jungen Leser:innen und ihrer beiden Kolleginnen Mia Hildebrandt, Marie Kozojed, die mit ihren Klassen auf Projekttagen waren, ist aus jenen 13 Büchern, die sie alle gelesen hatten – wie auch schon im Titel hier angekündigt – auf „Drei Wasserschweine brennen durch“ (Idee und Text: Matthäus Bär; Illustration: Anika Voigt) gefallen. Denn die Requisiten deuten auf das Futter zumindest einiger der im Buch vorkommenden Tiere im Zoo Schönbrunn hin.
Nicht zufällig war der Autor, dessen zweiter Band „Wasserschweine wollen’s wissen“ auch schon erschienen ist, ein dritter folgt, im Literaturhaus anwesend. Und lauschte aufmerksam, welche Stellen die fünf jungen Juror:innen ausgewählt hatten. Noch mehr war er neugierig auf die Begründungen der, wie er schon bei einem früheren Treffen festgestellt hatte, sehr kritischen Viel-Leser:innen.
Mehrfache sagten die genannten Kinder, dass sie es spannend gefunden haben; dazu kam noch, dass es leicht zu lesen war, dass es im Zoo Schönbrunn spielt, viel davon in der Nacht „und weil Wasserschweine drin vorkommen“. Außerdem wurde hervorgehoben, „dass das Buch aus der Sicht der Tiere geschrieben ist“ und verschiedene Altersgruppen anspricht, es auch lustig ist und „man sich so richtig in die Geschichte hineinversetzen konnte“ (siehe dazu auch das Video von den Begründungen der jungen Juror:innen).
Im Zuge der Preisverleihung interviewten die Kinder auch den Autor, der lange vor allem als Liedermacher und Sänger bekannt war. Die 3:50 für einen Song seien ihm zu kurz geworden, er wollte länger und mehr erzählen, weshalb er die künstlerische Disziplin gewechselt habe. Matthäus Bär gestand auch, dass er durch die Zusammenarbeit mit der Illustratorin Anika Voigt erst draufgekommen sei, dass Wasserschweine keine Hufe haben, weshalb er diese Passagen ändern musste. Diese Tiere faszinierten ihn, weil sie vor allem mit schwimmen, schlafen und fressen auskommen. Und Brokkoli habe er so einen wichtigen Stellenwert eingeräumt, weil da die Meinungen so ganz verschieden wären – die einen lieben, die anderen mögen ihn so gar nicht. Was für das Publikum im vollbesetzten Veranstaltungssaal des Literaturhauses, das er gleich einmal fragt, ganz und gar nicht stimmte – da gingen beim „mögen“ fast alle Arme hoch. „na gut, dann hab ich’s geschrieben, weil alle Brokkoli lieben!“, schwenkte er verschmitzt um.
Wird fortgesetzt mit den Ergebnissen der „älteren“ (12-bis 16 Jahre) sowie der Festrednerin, einer bekannten jungen Kinderbuchautorin.
In den Links unten u.a. eine schon vor Längerem erschienene Besprechung des ausgewählten Buches, das übrigens auch einen der österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise bekommen hat; sowie von anderen der Bücher auf der Lese-Liste dieser jungen Jury.
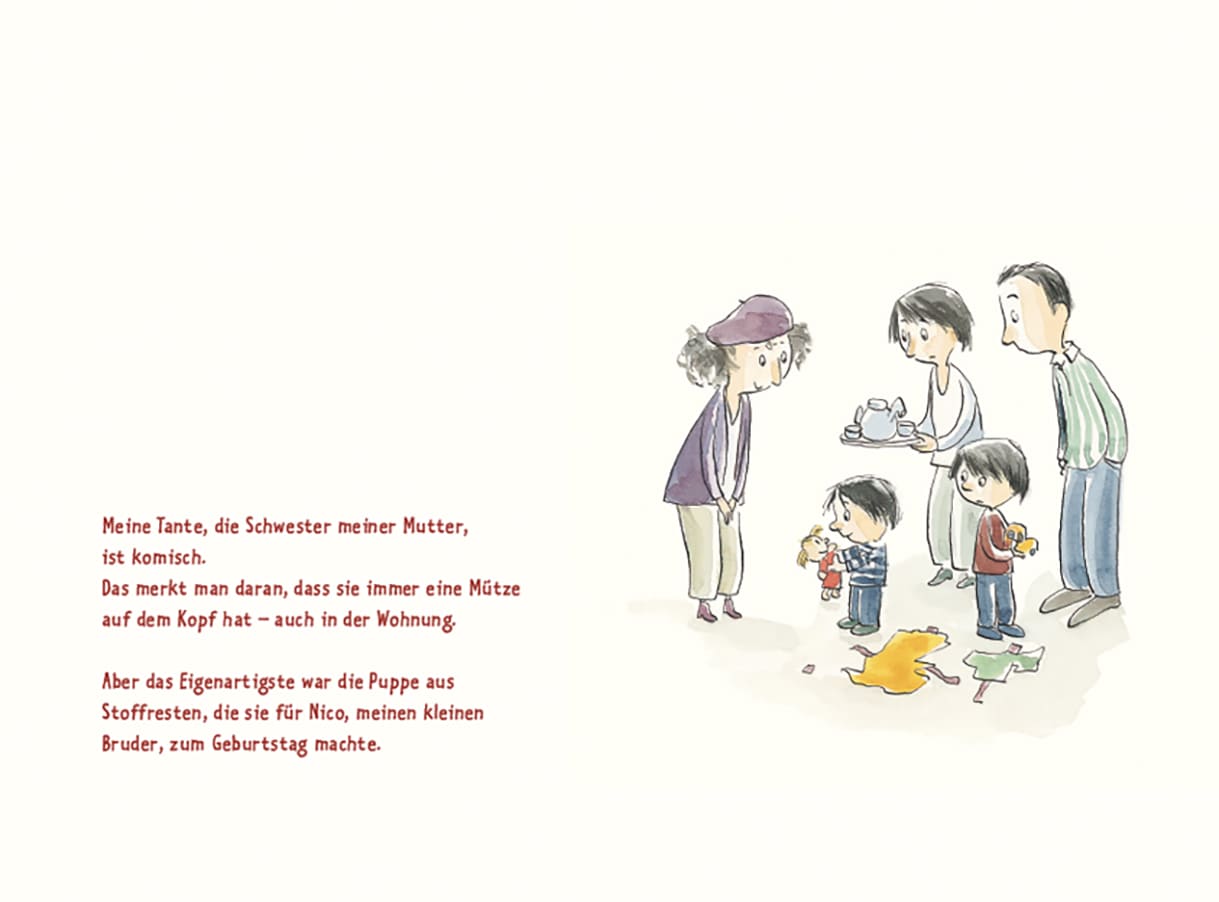
Nico, der jüngere Bruder des ich-erzählenden, namenlos bleibenden, Kindes, kriegt von seiner Tante eine Puppe geschenkt, freut sich und nennt sie Mimi. Das freut den Papa gar nicht, „heute Abend gehen wir dir ein super Spielzeug kaufen. Ein echtes Jungenspielzeug“, kündigt er an. Doch weder Schwert noch Feuerwehrhelm oder Rennauto, das der Vater ihm vorschlägt, taugt Nico, sondern „einen Puppenwagen für Mimi“.
Da zuckt der Vater aus, kauft eine große Werkzeugkiste, was seinen jüngeren Sohn zum Weinen bringt und Mama an der Kassa zur Frage veranlasst, „wozu ein Geschenk gut sein soll, das … zum Heulen bringt.“
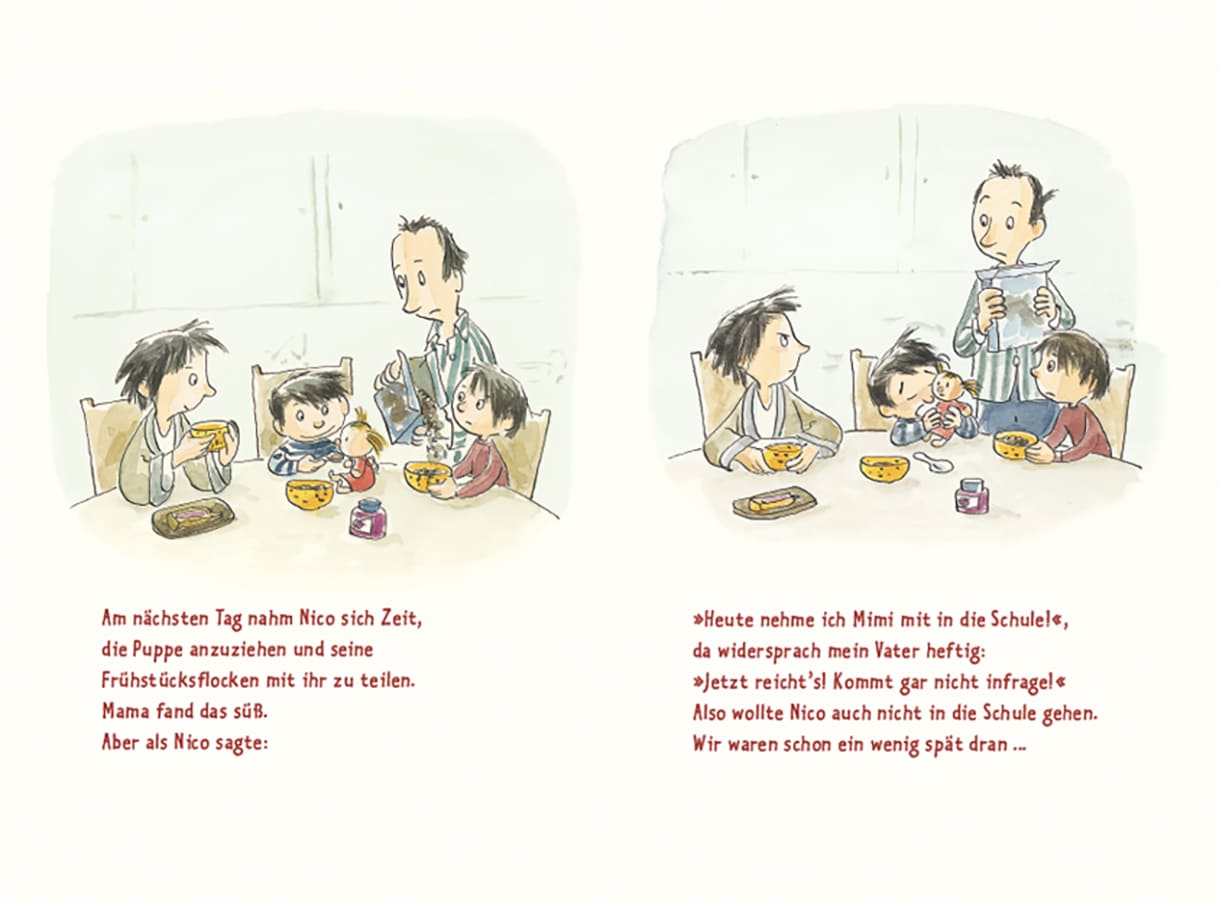
Klar, so kann’s nicht bleiben und so hat dieses reich bebilderte Buch Puppen sind doch nichts für Jungen! (Text: Ludovic Flamant; Übersetzung aus dem Französischen: Alexander Potyka; Illustration: Kean-Luc Englebert) letztlich eine große Wendung – die sei natürlich hier nicht verraten.
Während Mädchen – trotz aller Versuche, Errungenschaften in Sachen Gleichberechtigung zurückzudrängen einerseits, und der in vielen Ländern, darunter auch Österreich noch immer nicht gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit andererseits – doch so ziemlich alle Wege offenstehen, werden Buben, die mit Puppen spielen oder andere, die gern tanzen, viel zu oft belächelt, ausgelacht, runtergemacht oder sehen sich Erwachsenen gegenüber, die ihnen Fürsorglichkeit und Sanftheit austreiben wollen. Sich dann aber über männliche Gewaltbereitschaft wundern ;(
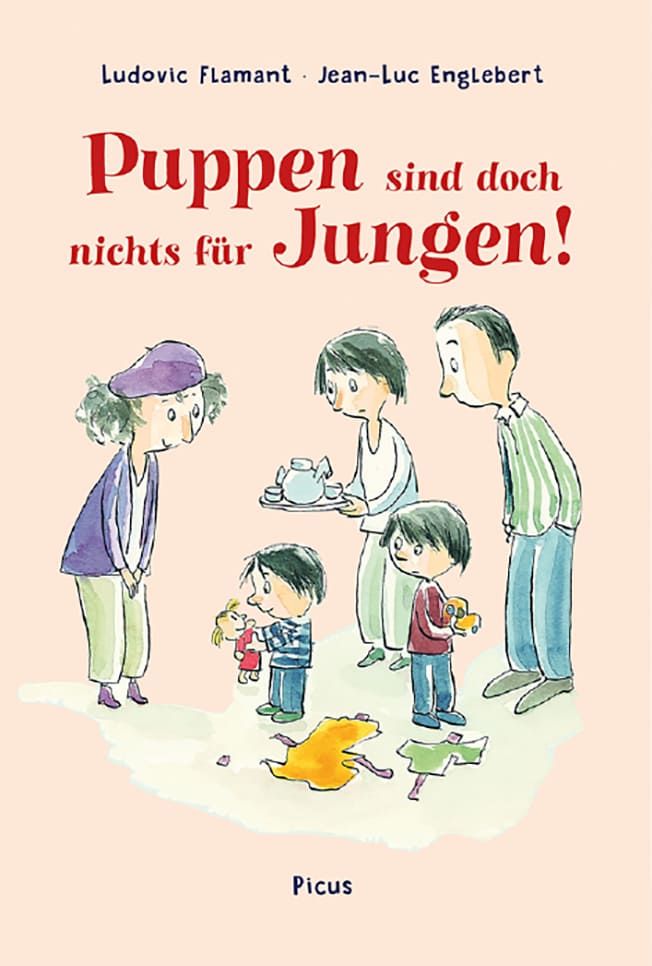

Welches der Bilder ist von einem Menschen fotografiert und welches hat eine Künstliche Intelligenz (KI) erstellt? Sofort schnellen einige Hände der vor den Fotos befragten Kinder in die Höhe. „Das rechts, die Frau im Labor hat nur einen blauen Schutzhandschuh an und die Pipette schwebt in der Luft“, sagt eines der Mädchen aus der Mehrstufenklasse der Volksschule Brüßlgasse in Wien-Ottakring.
Menschen- oder KI-gemachte Fotos war eine von drei Stationen des durch Europa tourenden „Curiosity-Cubes“ (Neugier-Würfel), der zwei Tage lang Halt im MuseumsQuartier Wien – knapp vor der fast schwarzen Wand des MuMoK (Museums Moderner Kunst“ in jenem Hof, an dessen anderer Seite das AZW (ArchitekturZentrum Wien liegt). Wobei „Würfel“ stimmt, selbst halbwegs genau genommen, nicht wirklich. Die „Heimat“ des mobilen Experimentier„kastens“ ist ein umgebauter Schiffs-Container; solche sind ein bissl größer als jene Metallkisten, die auf LKW genau drauf passen; und selbst die sind länger als breit bzw. hoch. Aber gut, das englische Cube umfasst auch Räume, deren Seiten nicht gleich lang sind 😉
KI ist das diesjährige Thema der Tour – bei den beiden anderen Stationen – jede Klasse teilt(e) sich in drei Gruppen, die reihum alle Experimente und Spiele machen konnten. Eine Station, die von vielen Kindern der Klasse von KiJuKU danach befragt, sehr geschätzt wurde, war das Bauen eines Weges von zu Hause in die Schule. Kärtchen mit schwarzen dicken Linien, gerade oder mit einer Kurve – wie sie auch aus manchen Brettspielen bekannt sind – mussten einen geschlossenen Weg ergeben. Auf solche setzten die Kinder dann winzige, kreisrunde Roboter. Die simulierten sozusagen fahrerlose Autos, blieben auf der Straße, stoppten bei roten Ampeln, verringerten beim Verkehrszeichen für Baustellen das Tempo und so weiter. „Cool, dass wir da selber die Straßen für die Roboter bauen konnten“, kam es von einem der Kinder danach und gleich stimmten viele andere ein, „das hat mir auch am besten gefallen“.
Andere meinten hingegen, „wir haben eh schon in der Schule in Freiarbeit mit größeren Bee-Bots gearbeitet“.
Ein bisschen tricky fanden nicht wenige die dritte Station – das meinten auch einige der Betreuer:innen für sich selber. Auf einem Spielfeld mit 100 kleinen Knöpfen, die bei Berührung zu leuchten beginnen, taucht immer auf der linken Hälfte ein Muster auf – das gilt es auf der rechten Spielhälfte zu „spiegeln“. Herausfordernd war nicht zuletzt, dass sich zwei verschiedene Rot-Töne sehr ähnlich sind, und die strahlende Sonne machte dies noch schwieriger. Manche Kinder setzten sich daraufhin so auf den Boden, dass sie mit ihren Oberkörpern Schatten auf das Spielfeld warfen 😉
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte natürlich von den Volksschüler:innen auch wissen, ob sie einerseits selber schon mit KI-Tools experimentiert haben und / oder andererseits bei Bildern oder Informationen im Internet nicht ganz sicher waren, von Menschen oder sozusagen Robotern gemacht?
So manche haben bei etlichen Fotos, unter anderem wurden Hundewelpen genannt, schon überlegt und genauer geschaut, ob Merkmale von KI-generiert zu erkennen gewesen wären. „Hausübung gemacht hab ich nicht mit einer KI, aber einmal hab ich meine HÜ kopiert und von ChatGPT überprüfen lassen, ob sie auch wirklich richtig ist“, erzählt ein Schüler.
Der Curiosity Cube wird vom internationalen Pharma- und chemischen Unternehmen Merck (60.000 Mitarbeiter:innen weltweit; Gründung 1668 in Darmstadt, Deutschland, mit einer Apotheke) betreiben und auf Reisen geschickt. In den USA und Kanada begann diese Förderung von Wissenschaft an Kinder bringen 2017, in Europa tourt der Container seit 2022, in Österreich war er nun erstmals; übrigens auch in Afrika in einigen Ländern im Süden (Südafrika, Botswana, Lesotho, Namibia und im kleinen Eswatini (bis 2018 Swasiland), aber auch kaNgwane genannt, einem Königreich zwischen Südafrika und Mosambik).
Der „Neugier-Würfel“ bezieht einen Teil des benötigten Stromes aus der Kraft der Sonne (solarbetrieben). Betreut werden die Stationen von Mitarbeiter:innen der Firma, den meisten im Rahmen ihrer Freistellung für freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeiten (16 Stunden oder zwei Arbeitstage pro Jahr) – die sie aber auch woanders ausüben können.
Seit mehr als 20 Jahren vermitteln in den Sommerferien, mittlerweile an den meisten Hochschulen Kinderunis Lust an Wissenschaft, Forschung, vor allem am Neugierig-Sein und Fragen-Stellen. Nach zwei Wochen Kinderuni in Wien werden die Kinder, die zur Sponsion kommen wollen, gefragt / gebeten, wer von ihnen gelobt, nie aufzuhören, Fragen zu stellen und Antworten darauf zu suchen, werde mit dem Titel Magistra oder Magister universitatis iuvenum belohnt.
Die Kinderuni Wien betreibt seit ein paar Jahren auch ganzjährig DOCK an einem Donaukanalufer (1090, Spittelauer Lände). Der Science Pool bietet ganzjährig Workshops an. Beide in praktisch allen Wissenschaftsdisziplinen. Und im „Zirkus des Wissens“ an der Linzer JKU (Johannes Kepler Universität) werden manche wissenschaftliche Themen in theatralen Geschichten auf die Bühne gebracht.
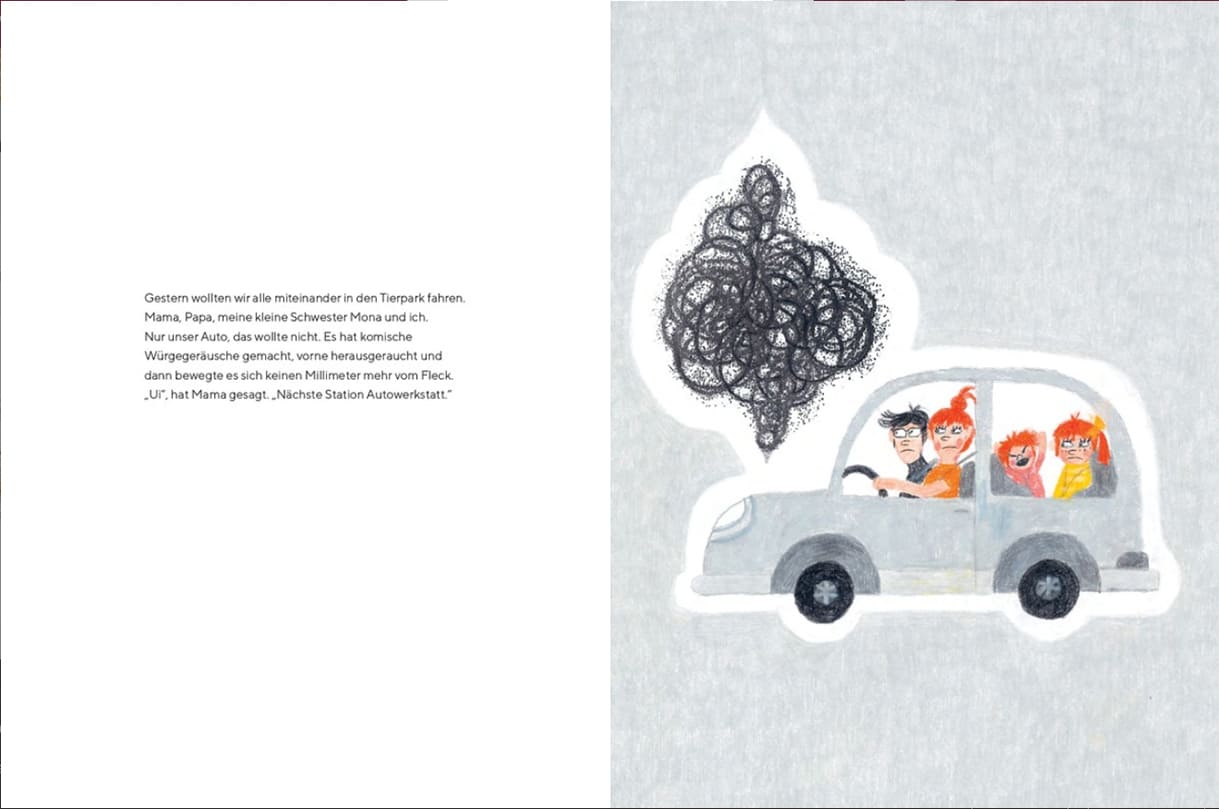
Ach wie gut, dass das elterliche Auto einmal „streikt“, wenngleich diese sehr dunklen Rauchwolken eher auf ein Uralt-Vehikel hindeutet. Aber, diese Szene ist für die mehrfach preisgekrönte Autorin und Illustratorin Leonora Leitl ohnehin „nur“ eine Art Schuhlöffel für ein Loblied auf die Fantasie von Kindern, wenn sie zu Fuß einen Weg zurücklegen. Da entdecken sie viel, das Erwachsene übersehen (würden), bleiben da und dort stehen, oder finden etwas, auf das sie klettern können oder darüber springen, staunen, versinken in Geschichten… nicht selten stören Erwachsene dabei mit „komm, geh schon weiter!“
Das erspart die Gestalterin von „Wir sind ja nicht aus Zucker!“ ihrer Titelheldin Sanna. Grantig, unausgegoren und genervt lässt Leitl Mama, Papa und die jüngere Schwester Mona rund um den Frühstückstisch dreinschauen, während Sanna fröhlich meint, wenn das Auto nicht fährt, könne sie ja zu Fuß in die Schule gehen. Wenn sie sich beeilt, erwischt sie sogar noch ihre Freund:innen – Action-Alma und Käpt’n Kurti, die schon länger auf diese Art und Weise ihren Schulweg – und den nach Hause zurücklegen.

Skeptische Mutter, erhellter Blick des Vaters, der gleich von seinen Schulweg-Abenteuern zu schildern anfängt – und sich dabei seines Spruches von damals erinnert, der dem Buch auch den Titel gegeben hat.
Gesagt, pardon geschrieben, und getan. Sogleich lässt die Autorin und Illustratorin, die hier vor allem mit Buntstiften und Wachsmalkreiden gearbeitet hat und stilistisch von Kinderzeichnungen ausgegangen ist, das Trio in fantasievolle Abenteuer eintauchen: Durch Schluchten, vorbei an wilden Tieren samt einem Säbelzahntiger, einem Imbisstand-Hexer und einer – im Text zahnlosen, im Bild ein-zahnigen – Hexe in einer Höhle. Weitere Stationen sind Sumpf, Moor, Vulkan und manches mehr – das du vielleicht in deiner Fantasie nochmals ausschmücken, ergänzen oder anreichern möchtest.

Natürlich kommen die drei Kinder – gerade noch – rechtzeitig in der Schule an, um sich auf dem Heimweg neue Abenteuer auszudenken. Vielen Kindern müsste das zu Fuß in die Schule gehen – noch dazu mit Freund:innen oder Kolleg:innen ja vielleicht weniger schmackhaft gemacht werden als Eltern. Da gibt’s eine ganze Reihe, die aus falsch verstandenem Sicherheitsgefühl ihre Kinder mit dem Auto am liebsten direkt bis vor die Schultüre bringen würden. Dieser starke Autoverkehr vor Schultoren ist allerdings eine Gefährdung weswegen viele Schulen am liebsten die Schulvorplätze autofrei machen (würden).
Und „nebenbei“ legen viele Kinder mehr Wert auf umweltfreundliches Verhalten – daraus hat sich sogar schon seit Jahren die Aktion von „Pedibus“ entwickelt, sozusagen Schulbus zu Fuß – mit gemeinsamer Geh-Strecke und Haltestellen zum „Ein-“ bzw. „Aussteigen“.


Aus tragischem aktuellen Anlass muss das aktionstheater ensemble, das ab Donnerstag „Ragazzi del Mondo“ im Bregenzer Kosmos Theater (Details siehe Info-Box) spielt, jeweils eine Vorbemerkung – auf kleinen Plakaten im Foyer anbringen und damit’s niemand übersieht, auch vortragen, und die sei auch hier auszugsweise veröffentlicht: „Sämtliche Textpassagen, wie etwa die Tatsache, wie leicht es ist, in Österreich an Waffen zu gelangen, sind im Laufe des Probenprozesses entstanden und somit keine direkte Reaktion auf die jüngste Tragödie des Amoklaufs in Graz. Es handelt sich im Stück also um Reflexionen auf das allgemeine Zeitgeschehen.“ Samt dem Verständnis dafür, dass angesichts dieser Ankündigung, manche Besucher:innen das Stück unter diesen Voraussetzungen nicht anschauen können oder wollen.
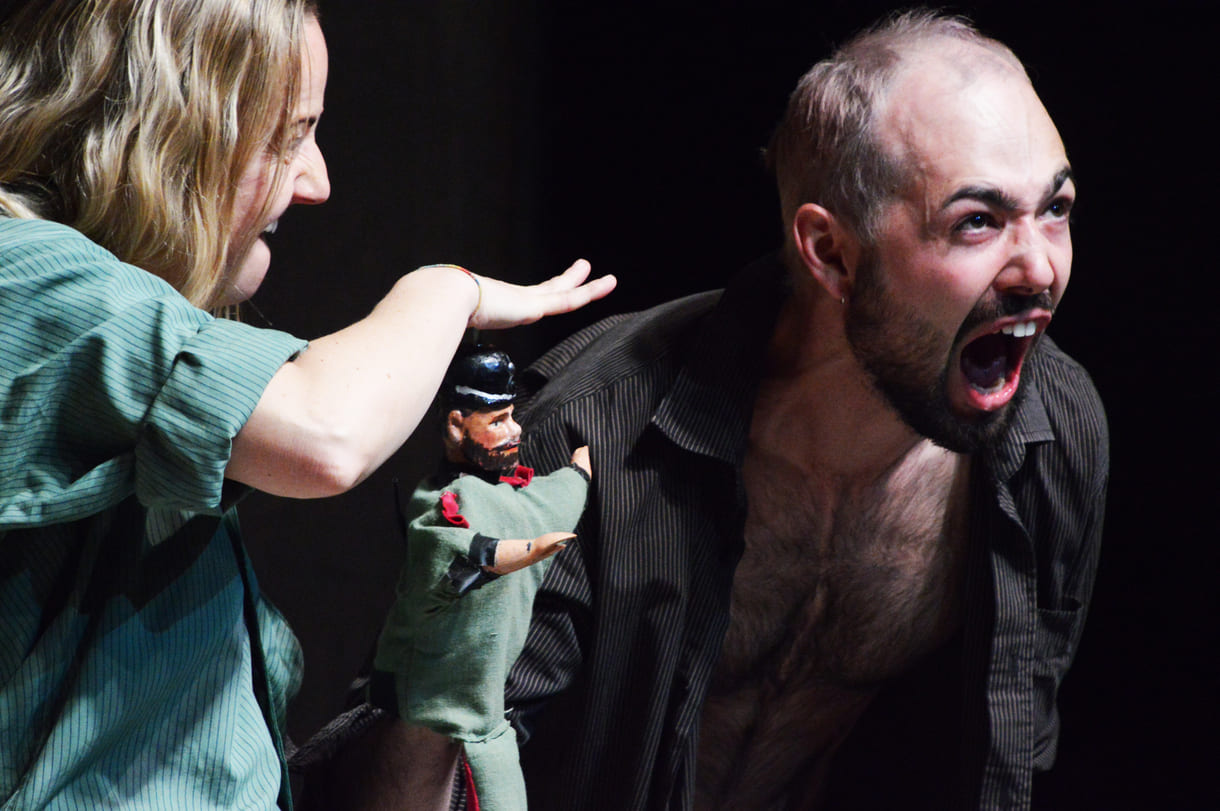
Gleich in der ersten Szene steht die Lust am Schießen, auch wenn’s „nur“ auf Feldhasen ist, zu der Touren in den USA einladen, im Zentrum. Und dazu Erfahrungen aus Recherchen in einem österreichischen Waffengeschäft. Dort bzw. auf der Homepage eines solchen Dealers ist 1:1 zu lesen, was – hoffentlich nicht mehr lange so gelten wird: In drei Stunden von null auf Waffe samt dem psychologischen Gutachten. Das war übrigens bisher in der Berichterstattung nach dem Massenmord an dem Grazer BORG noch kaum bis nicht zu vernehmen – und ebenfalls bislang offenbar noch kein Thema bei der angekündigten Verschärfung der Waffengesetze: Ein Unternehmen, das Waffen verkauft, sorgt auch gleich für das Gutachten!!!???
Die heftige und aufgrund der Aktualitäten – Graz sowie Krieg Israel-Iran – noch heftigere Eröffnungsszene lässt den Atem des Publikums stocken, auch wenn die Gruppe schon vorab das jüngste Stück als „theatralisches Gemälde über die Möglichkeit und Unmöglichkeit des Miteinanders vor der Kulisse internationaler Kriegsszenarien, unter anderem die gestiegene Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft“ ankündigte.

Und so fetzen sich Darsteller:innen heftigst – und verströmen dabei auch noch teils riesengroße Lust an gegenseitigen zumindest verbalen Verletzungen. Klar, jede und jeder im Publikum weiß, das ist „nur“ gespielt. Aber es wirkt über weite Strecken derart authentisch, dass es innerlich wehtut – und noch viel mehr, weil viele der Auseinandersetzungen allzu bekannt vorkommen, dass sie zum Spiegelbild dessen werden, was permanent – vor allem – auf Social Media abläuft; und dazu so manches das sich im analogen Leben abspielt: Trotz schier unendlich vieler Worte und Sätze findet Kommunikation miteinander selten statt – aneinander vorbeireden, die / den anderen ignorieren, überhören trotz oder eben auch wegen der Lautstärke…

Konnten Menschen zu Beginn ihrer Geschichte nur (über-)leben, wenn sie zusammenhielten, so scheinen wir alle nicht nur in Sachen Umgang mit der Umwelt, sondern auch miteinander ziemlich kräftig an der eigenen Auslöschung zu arbeiten. Dem Planeten selber wird’s überspitzt formuliert wurscht sein. Wie schon Jura Soyfer in seinem Stück „Der Weltuntergang“ den Planeten Saturn sagen lässt: „Er hat sich gedacht, ein Zusammenprall ist eh überflüssig. Die Menschen rotten einander sowieso über kurz oder lang aus!“ Als Die Sonne zur Versammlung der Planeten reif, um die Störung der Sphärenharmonie zu besprechen und die Erde als Verursacherin ausmachte, entschuldigt der Mond diese mit der Bemerkung: Die Erde hat Menschen.

Das aktionstheater ensemble hat natürlich auch Kinder der EINEN Welt (Ragazzi del mondo) wie immer gemeinsam entwickelt: Mastermind Martin Gruber mit dieses Mal Zeynep Alan, Isabella Jeschke, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Benjamin Vanyek (Schauspiel, Tanz und Text) sowie den Live-Musikern Andreas Dauböck (Drums, Klavier, Synthesizer, Looper, Gesang) und Pete Simpson (Gesang, Bass); und dazu noch Martin Ojster (Dramaturgie), Valerie Lutz und Martin Platzgummer (Bühne) sowie Luis Kaindlstorfer (Kostüme). Und wie ebenfalls praktisch immer zielt die Inszenierung darauf ab, dass sie die Zuschauer:innen nicht außen vor lässt und über „die anderen“ erzählt, sondern sich das Ensemble selbst sowie das Publikum in die „Selbst-)Kritik einschließt.
Und damit dies auch möglich ist, die Distanz, die vierte Wand durchbricht, weist trotz aller Heftigkeit auch „Ragazzi del Mondo“ die eine oder andere humorvolle Passage und Szene auf, auch wenn das Lachen dann – bewusst provoziert – nicht selten im Hals stecken bleibt.

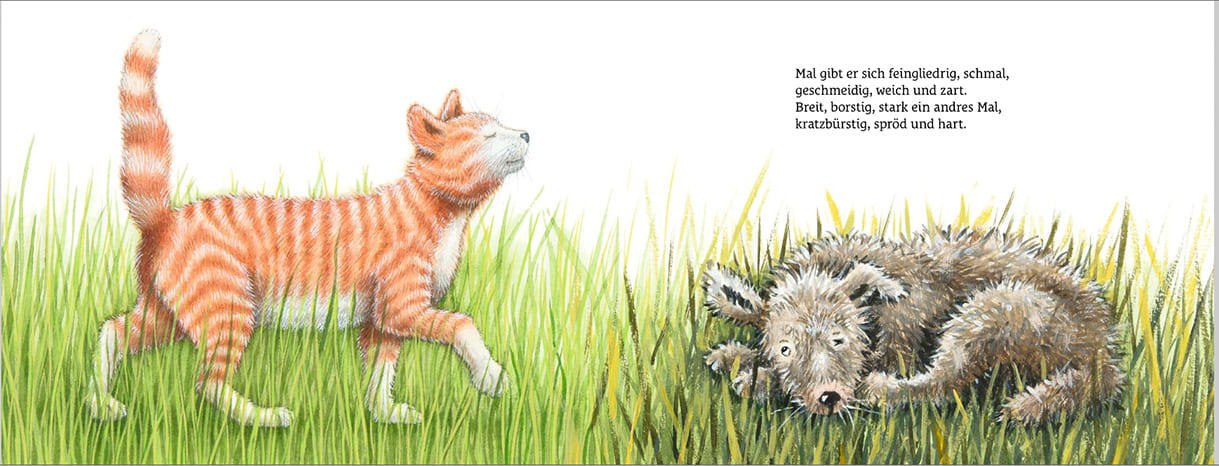
Ein Elefant trägt einen breiten, großen Pinsel fast wie einen Baumstamm in seinem Rüssel. Freundlich-neugierig schaut er auf die Maus mit ihrem zarten Malgerät, die auf einem bunten Farbtopf steht. So deutet der Autor und Illustrator Marcus Pfister schon auf der Titelseite seines jüngsten von mehr als fünf Dutzend Bilderbüchern die Vielfalt an, die Leser:innen und vor allem Schauer:innen auf den folgenden Seiten erwarten wird.
In „Jedem seinen Pinsel! Die bunte Welt der Malstile“ versammelt er viele seiner bisherigen Schöpfungen, einige davon Titelhelden früherer Bücher. Klar, dass da auch der Regenbogenfisch nicht fehlen darf, dem er schon rund ein Dutzend Abenteuer gewidmet hat. Hier aber spielt er nur eine „nebenbei“-Rolle.
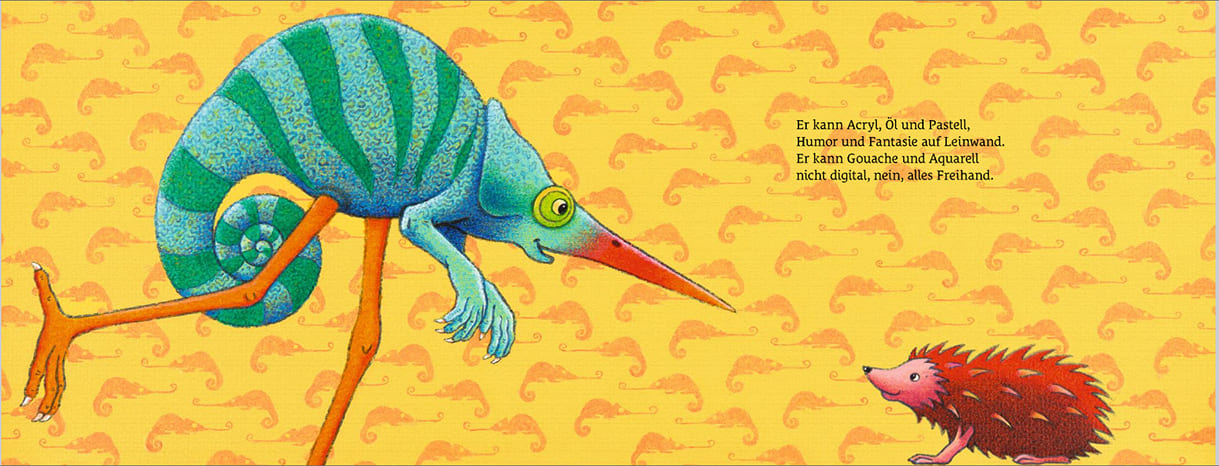
Pinguine, das tanzende Walross Franz-Ferdinand, Mondrabe, Pardiesvogel, Maus Mats, Igel Mitschka und noch so manch anderes seiner gemalten und mit Geschichten ausgestatten Tiere bevölkern zunächst 12 Doppelseiten, bevor’s auf vier weitere mit einem Überblick über Pfisters Schaffen geht – auf diesen erläutert er auch jeweils, zu welchen Pinsel und Farben sowie weiteren Illustrationsmöglichkeiten (nicht zuletzt die glänzenden Heißfolienprägungen) er gegriffen hatte.
Und was so alles Pinsel und Farbe – auch wenn’s in seltenen Fällen nur eine ist – aufs Papier „zaubern“ können, wie unterschiedlich scharfe Kanten oder ausfransende Striche ein Tier erscheinen lassen. Und vieles mehr.
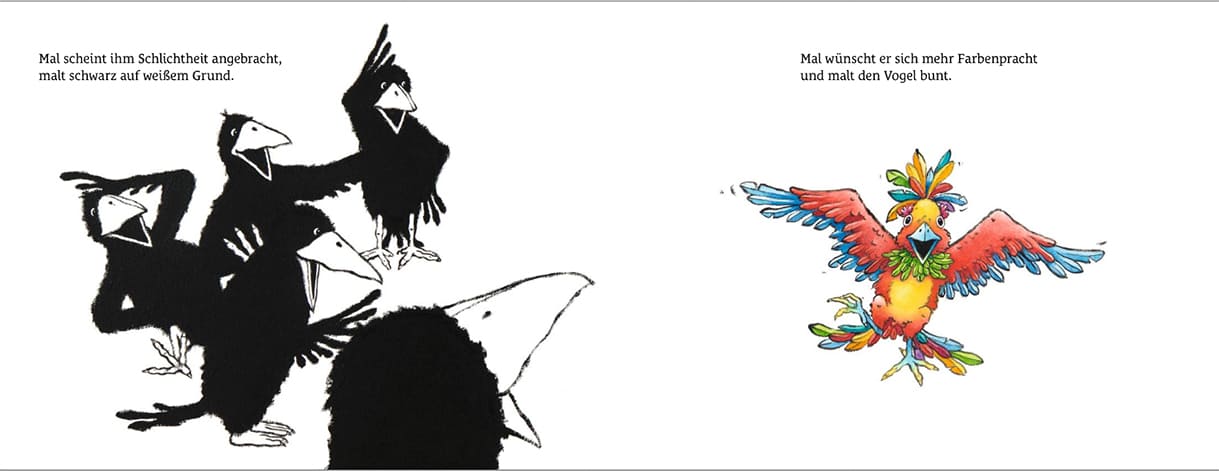
Alles erzählt aus der Sicht von Pinseln: „Mal scheint ihm Schlichtheit angebracht, malt schwarz auf weißem Grund“ – auf der einen Seite und als ergänzenden Gegensatz auf der gegenüberliegenden Seite: „Mal wünscht er sich mehr Farbenpracht und malt den Vogel bunt.“
Marcus Pfister will mit diesem Buch aber neben dem Überblick über die Vielfalt seiner Arbeit geben, sondern vor allem: Es würde mich sehr freuen, wenn daraus bei euch die Lust am eigenen kreativ-Sein geschürt wird. Ich wünsche euch viel Freude dabei!“
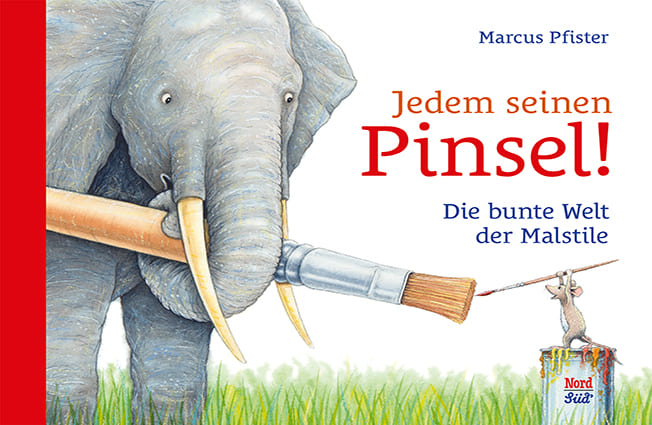

In einem mitreißenden Mix aus unterschiedlichsten Tanzstilen von Musical bis Breakdance, begleitet von einer Live-Band, sowie Schauspiel und Videos in Comic- und Computerspiel-Ästhetik zauberten vor allem Studierende verschiedener Abteilungen der Anton Bruckner Privatuniversität Linz eine mit auch viel Witz gewürzte zeitlose Story, die vor allem Gier aufs Korn nimmt. „Sin City oder die salzigen Tränen der Edith Lot“ nimmt Anleihe bei der mehr als 2000 Jahre alten Geschichte der Stadt Sodom, die hier Sodor heißt. Sie ist DAS Symbol für Ansammlung sündiger, vor allem gieriger Menschen und findet sich sowohl im hebräischen Tanach als auch der christlichen Bibel und dem islamischen Koran – wie viele andere Geschichten der drei großen, monotheistischen Weltreligionen.
Auf halbem Weg hinauf auf den Linzer Pöstlingberg liegt diese Uni schön im Grünen, fast „paradiesisch“. In der Studiobühne „rockten“ die mehr als zwei Dutzend jungen Darsteller:innen, meist gleichzeitig auch Tänzer:innen diese Story, die – im Gegensatz zu den religiösen Büchern – der dort namenlosen Frau des Lot einen Vornamen, nämlich Editz, gaben und sie ins Zentrum rücken. Da es sich um eine reife Ensemble-Leistung handelt, seinen hier keine Mitwirkenden erwähnt – sie alle, auch das Leading-Team mit Idee, Konzept, Regie, Choreo und so weiter sind hier „nur“ in der Info-Box alle genannt.
Die Stadt ist dem Verderben geweiht, der (jeweilige) Gott will wegen der Sündhaftigkeit ein Exempel statuieren und sie vernichten. Engel wollen wenigstens Edith Lot, hier eine Aktivistin gegen den Raubtier-Kapitalismus, samt ihrer Familie retten. Einerseits mit Flügel, andererseits wirken sie auf der Erde irgendwie wie Aliens und doch wieder wie heutige Menschen, suchen sie doch verzweifelt nach einem Ladekabel für ihr SmartPhone.
So alt die Geschichte in ihren Grundzügen, so praktisch zeitlos und besonders aktuell sind diese knapp mehr als 1½ Stunden gegen Menschheit und Planeten zerstörende „Sünden“ ebenso wie für den Widerstand dagegen und für eine (menschen-)freundlichere Welt. Denn hier ist Frau Lot nicht nur eine von einer himmlischen Macht Auserwählte „sündenfreie“, sondern eben eine Kämpferin für eine bessere Welt und Klima und dessen Rettung versus Zerstörung ein zentrales Thema.
Würde sich auszahlen, damit auf Tour zu gehen, oder die Story von anderen großen, jungen Ensembles eigenständig neu zu inszenieren.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Honig und Essig? Klingt aufs erste, naja, nicht gerade verlockend. Doch es ist ein Jahrtausendealtes erprobtes, vor rund 2500 Jahren auch schriftlich verbürgtes Hausmittel, genannt Oxymel (meist im Verhältnis 3 bis 4 zu 1)– der zweite Wortteil ist für Honig bekannt und oxy – ebenfalls aus dem Altgriechischen – steht für sauer.
Gut, das wäre somit nichts Neues. Aber die „vitalOxy“-Jungunternehmer:innen aus der HBLA in Salzburg-Ursprung bauten nicht nur auf dem Wissen Theresa Mühlbachers auf, die von ihrem Vater, einem Imker, viel über Bienen und Honig einbrachte, sondern konnte es auch mit der von Iris Mackingers mütterlicher Kräuter-Expertise vermengen. Im wahrsten Sinn des Wortes.
Die beiden Genannten sowie Tristan Scheibenbauer, Maximilian Scheikl und Nico Kräutner vertraten als Quintett das gemeinsam mit vier weiteren Jugendlichen betriebene Unternehmen VitalOxy. Die Jungunternehmer:innen suchten Rezepturen mit gesundheitsfördernden Wirkungen für verschiedene Anlässe und gaben ihnen selbsterklärende Namen: Immun, Kraft, Darm, Kater und soll in besagten Fällen helfen. Der fünfte süß-saure dickliche Saft, den sie nach Wien mitgebracht haben namens „Küche“ könnte als Marinade oder beim Kochen Verwendung finden. 13 Sorten hatten sie im Laufe der Produktion gemixt.
Was aber ganz besonders an VitalOxy ist: „Wir verwenden den sogenannten Zementhonig, ja, der heißt wirklich so“, versichern die Jugendlichen dem zweifelnd dreinschauenden Journalisten. „Naja, der Fachbegriff ist Melezitose-Honig, der ist so fest, dass ihn Imker:innen kaum aus der Wabe kriegen, weshalb er meistens weggeschmissen wird. Man könnte die Wabe samt dem festen Honig kochen, aber dann verliert der Honig seine Nährstoffe. Wir haben uns gedacht, wir probieren’s einfach aus, diesen harten Honig mit Essig zu vermischen und schonend zu erhitzen. Das ist ein eigenes Verfahren, das wir entwickelt haben
Wem die sogenannten grünen Daumen fehlen und bei der oder dem Pflanzen in der Wohnung somit regelmäßig eingehen oder nicht richtig blühen und gedeihen, für den dachten sich Schüler:innen der HTL Anichstraße (Innsbruck, Tirol) etwas aus, und machten es zu ihrer Geschäftsidee. Nein, sie schicken keine Gärtner:innen in diverse Wohnungen oder WG-Zimmer, sondern konzipierten relativ kleine und doch beachtliche, noch dazu dekorative Glashäuser. Diese Mini-Gärten im geschlossenen Glas, womit das Wasser in diesem kleinen geschlossenen Ökosystem im Kreislauf bleibt, lassen sich auch via Handy-App pflegen – der spezifisch fachliche Part der HTL’er:innen Silvana Schennet, Christian Baumann, Andreas Achrainer, Benjamin André und Hannes Egger, die die Hardware entwarfen und das Gehäuse dazu 3D-druckten und die Software programmierten für die unterschiedlichen EcoSphere-Produkte ihres Unternehmens „Grow Green“.
Wähl deinen eigenen Spruch und mach (d)ein T-Shirt zu einem einzigartigen. Nicht schon vorgedruckte Kleidungsstücke aus dem Geschäft, sondern individuell designt – das ist die Geschäftsidee der Junior-Company „Print it“ aus der Handelsakademie und -schule im Vorarlberger Bludenz. Wem keine passende Idee kommt, für den halten Shaden Khalil, Enkhlen Buyansargal, Eva Fuchs, Maxima Lorenzin und Isabel Bruggmüller, die ihr und ihrer Kolleg:innen Schüler:innen-Unternehmen aus der 2. Klasse BHAK/BHASch beim Bundesfinale der Junior Companies in Wien vertraten, auch schon einiges bereit – Highlight: MEGA – Make Empathy Great Again.
Ihre Firma ist Teil des Unterrichtes im Pflichtfach Projektmanagement mit zwei Wochenstunden. Für ihr Leiberl-Bedruck-Business haben sie sich auch einen Werbespruch ausgedacht: „Your style – our mission“.

Im ersten Teil der Berichte über jene Unternehmen, die Jugendliche für ein Schuljahr gründen, und in ihren Bundesländern gewonnen haben, wurden hier auf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… jene drei Junior Companies vorgestellt, die von der Jury auf die ersten drei Plätze gewählt wurden. Hier beginnt nun die Präsentation der anderen Landes-Sieger:innen – in alphabetischer Reihenfolge der Bundesländer; die Top 3 kamen aus der Steiermark, aus Wien sowie Kärnten; hier nun die nächsten drei von Schüler:innen gegründeten Unternehmen.
Wie schon bei den Erstplatzierten sowie in vielen anderen unternehmerischen Projekten – auch bei Jugend Innovativ in der Kategorie Entrepreneurship – setzt das Schüler:innen-Unternehmen aus dem Burgenland auf regional und nachhaltig. Laurin Breuer, Emma Pober, Lorena Balaj, Valerie Pfister und Finn Poller vertraten die Junior Company „Apfelrausch“ im Bundesfinale.
Auch wenn das Wort Rausch im Titel der Firma steckt, diese Jugendlichen produzieren aus Äpfel kein alkoholisches Getränk, selbst der Apfel-Ingwer-Shot kommt ohne Alk aus 😉 Des weiteren „haben wir Saft, Marmelade, Mus – entweder mit Zimt oder mit Chili und Rosmarin – im Angebot. Saisonal hatten wir auch Bratapfelmarmelade.“ Auf Äpfel als Basis für ihr Unternehmen „sind wir gekommen, weil bei uns in der Nähe Kukmirn ist, das auch Apfeldorf genannt wird“, berichten die Schüler:innen aus der Güssinger Höheren Bundeslehranstalt und Fachschule, die sich den Namen ecole gegeben hat. Das französische Wort für Schule würde durchaus für die Abkürzung verschiedener Begriffe stehen, meinen die Jugendlichen, wüssten es aber im Moment nicht – kein Wunder, es ist selbst auf der schuleigenen Homepage nirgends zu finden 😉
Sie verarbeiten nicht nur die Äpfel mit besonders kurzen Lieferwegen, sondern „wir haben auch darauf geschaut, dass wir umweltfreundliche und wiederverwendbare Verpackungen für unsere Produkte organisieren“.
„Wir machen aus Gabeln und Löffeln Schmuck, vor allem Ringe, aber auch Anhänger für Halsketten und haben sogar das Verfahren dazu selber entwickelt“, verkünden Sebastian Rogl, Lukas Hörth, Christina Valenta, Alexander Veit, Lukas Ondrusek aus der HTL St. Pölten und weisen einerseits auf ihre Schmuckkollektion und eine noch nicht verarbeitete exquisite, glänzende, reich verzierte Kuchengabel hin und zeigen andererseits Bilder von den Verarbeitungsschritten.
„SilverWear Jewellery“ haben die genannten fünf Jugendlichen und zwei weitere Schülerinnen hergestellt – bisher 65 Stück. Auch wenn es vielleicht nicht leicht ist, sich von so durchaus alten Erbstücken zu trennen, meint einer der Jugendlichen, „aber sonst würden sie ja vielleicht nur in einer Lade vergammeln“; jedes Stück kostet 24 €
Simon Franz Freilinger, Severin Anton Kickinger, Alois Hajek und Hons Ortner stehen vor und hinter einer rustikalen Verkaufshütte, mit kurzer Lederhose und ebenso trachtig wirkenden Hemden halten sie Flaschen in die Kamera oder weisen auf solche hin. Nach dem Rezept einer der Omas haben die erstgenannten drei Schüler (der vierte hilft „nur“ hier mit) der HTL Braunau (Oberösterreich) sechs verschiedene Liköre hergestellt.
„Eine Schnapsidee“ nennen die drei, die ihren Junior-Firmennamen AAF aus den Anfangsbuchstaben ihrer jeweiligen zweiten Vornamen gemixt haben, zu Beginn der Story auf ihrer Website ihr Unternehmen wortspielerisch.
Schnäpse und Liköre gibt es hektoliterweise, „aber wir wollten etwas Hochwertiges und das aber nachhaltig und umweltschonend herstellen“, so die Innviertler. „Unsere Zutaten sind aus biologischem Anbau, unsere Produktion umweltschonend, den Korn müssen wir allerdings zukaufen.“ Und manches ist auch ausgefallen, wo gibt es sonst Bratapfel-, Eiszuckerl- oder Rotwein-Chilli-Likör?
Ob auch wirklich schon alle, die am Schulball eifrig eine der sechs Sorten tranken, dies eigentlich schon durften (ab 18 Jahren)?
Wird fortgesetzt – die drei weiteren Finalist:innen werden in einem dritten Teil vorgestellt.

Ob Jugend Innovativ, Merkur oder auch der Bewerb der Junior Companies und sicher noch viele andere Gelegenheiten, die noch weniger an die Öffentlichkeit kommen – neben Kreativität, Einfallsreichtum und sehr viel Engagement zeigen Projekte von Schülerinnen und Schülern, dass sie Gedanken der Nachhaltigkeit stark verinnerlicht haben.
So setzten viele der neun Unternehmen (Gewinner:innen in ihren Bundesländern), die Jugendliche für ein Schuljahr gründeten und mit denen sie im aktuellen Bundesfinale landeten auf Re- und Upcycling. In diesem ersten Teil jene drei für ein Schuljahr gegründeten Unternehmen, die von der Jury auf Platz 1, 2 und 3 gereiht worden sind; in weiteren Teilen stellte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die sechs weiteren Finalist:innen, jeweils Sieger:innen in ihren Bundesländern, vor.
Beginnen wir, weil nach dem Lokalaugenschein von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die Jury sie zu den diesjährigen Gewinner:innen gewählt hatten mit [re]whey aus dem B/R/G Stainach (Steiermark). Katharina Ebenschweiger, Sophie Steinecker, Jakob Daum, Luca Neuper und Rasmus Zaihsenberger vertraten das Unternehmen beim Finale in der Wirktschaftskammer Österreich in der Wiedner Hauptstraße (Wien). Gemeinsam mit vier Kolleg:innen verkaufen sie Molkepulver. Aus einem Milchbetreib in der Region sammeln sie die Molke, lassen ihr – in einem Profibetrieb in Oberösterreich – durch natürliches und regionales Fruchtpulver Apfel- oder Himbeergeschmack zufügen, und es in Verpackungen aus abbaubarem Material abfüllen. „Die 180 Gramm reichen für ungefähr zehn Portionen – mit Milch oder Joghurt“, berichtet das Quintett dem Reporter. „Diese Molke würde ansonsten weggeschüttet werden“, vertrauen sie auf Nachfrage noch an.
Als Österreich-Gewinner:innen treten sie in der kommenden Woche, vom 1. bis 3. Juli in der griechischen Hauptstadt Athen beim Europa-Bewerb an. Ihre unmittelbaren Schulkolleg:innen hatten im Vorjahr, damals in Sizilien, erstmals den EM-Titel für rot-weiß-rot geholt; übrigens mit der Verarbeitung von einem anderen Abfallprodukt: Treber aus der Herstellung von Bier. Daraus stellten die Mitglieder der „Treberei“-Junior-Company unter Zugabe von Mehl und Ei unterschiedlichste Nudelsorten her, die es sogar in regionale Supermarkt-Regale schafften.
Zurück zum Österreich-Finale 2024/25, das – einen Tag nach dem School-Shooting in Graz daher nicht groß und bombastisch, sondern zurückhaltend, in kleinem Rahmen stattfand – mit der Bitte auch mit der Veröffentlichung mehr als eine Woche zuzuwarten:
Mit Platz 2 belohnte die Jury „Neutoro“ von Schüler:innen aus der Wiener Chemie-HTL (Höhere Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie). Nick Odehnal, Nico Oberortner, Kim Furigan, Kathrin Suschny und Sophie Schaffer öffneten für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… einen Mini-Kühlschrank auf ihrem Präsentationstisch um ihr Produkt – und das ihrer 13 Mitschüler:innenvorzustellen: Einen Geruchs-Adsorber.
Gut, solche Dinge gibt’s schon lange zu kaufen, „aber unsere Entwicklung überdeckt nicht wie andere nur Gerüche. Erstens entzieht unser Neutoro im Kühlschrank auch Feuchtigkeit UND vor allem ist er dauerhaft. Das Gehäuse ist 3D-gedruckt – aus recyceltem Filament, das Ganze ein Modulsystem und der Adsorber selber kann einfach in den Backofen gelegt, eine Stunde bei 110 Grad, danach wieder im Kühlschrank Gerüche und Feuchtigkeit aufsaugen“.
Der Stand der – von der Jury Drittplatzierten – Jugendlichen war bald um die Mittagszeit belagert. Mitglieder der Teams aus den anderen Bundesländern kauften hier kleine Gläser und löffelten eine Mahlzeit – à la Weltküche. „Spoon it“ nannten zehn Schüler:innen der sechsten Klasse im (Real-)Gymnasium in der Klagenfurter Mössinger Straße, vor allem dank der im Gebäudekomplex auch angesiedelten HTL in österreichweiten Schulbewerben ein Begriff, ihr Unternehmen.
„Ausgangspunkt war, dass unser Schulkantinen-Betreiber insolvent wurde“, berichten Dylan Stadler, Nina Raab, Somaya Burnić, Raphael Salbrechter und Daniel Pretnar, die ihre Schüler:innen-Firma in Wien vertraten zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Dann haben wir uns überlegt, wir könnten doch was anbieten, in der kleinen Teeküche haben zu experimentieren begonnen, was wir kochen könnten, das dann in der Schule nur mehr aufgewärmt werden muss. Und es sollte gut schmecken und abwechslungsreich sein“, setzen die fünf Jugendlichen mal fast im Chor, dann wieder nacheinander die Schilderung fort.
Die zehn jugendlichen Unternehmer:innen kochen – vor allem mit regionalen Zutaten, aber dennoch internationale Gericht – füllen sie noch heiß in Gläser mit Schraubverschluss a, die durch nochmaliges Erhitzen haltbar gemacht werden und dann vier bis sechs Wochen kühl gelagert werden können. Für 5 € pro Glas können sie in der Schulaula in einer kleinen Verkaufskoje erworben, aufgewärmt und – idealerweise mit mitgebrachtem Löffel – verzehrt werden. Im „Notfall“ wird das Ess-Werkzeug auch zur Verfügung gestellt. Und selbstverständlich werden die Gläser zurückgenommen.
„Gut 1400 solcher Gläser haben wir schon hergestellt, 900 verkauft, und wir haben auch drei verschiedene Toppings (60 Cent bis 2 €).
Auf ihrer Homepage listen sie nicht nur die 13 Speisen in Gläsern – von Kürbissuppe (Österreich) über Chili con Carne (Mexiko) und Chässpätzlie (Schweiz), Krumpigulyás (Ungarn) bis Beans and Rice (Uganda) und Couscous Maghreb (Marokko) auf, sondern liefern unter „Fun Facts“ so manche Fakten. Die sind alle echt, viele informativ, andere könnten unter die Rubrik „unnützes wissen“ fallen.
Dass Kürbisse botanisch zu Beeren zählen mag vielleicht verblüffen, warum sie gesund sind (vor allem Vitamin A) ist recht nützlich, aber, dass es auch einen Weltrekord – schwerster Kürbis 1200 Kilo gibt, eben eher Fun.
Apropos Bewerb: Bei Chili-Kochbewerben gibt es, so diese F&F-Rubrik, „spezielle „Anti-Schärfe-Teams“, die Eis, Milch und Joghurt für die Teilnehmer bereitstellen“.
Später verkleidete sich – meist Dylan Stadler – werbewirksam in einen Löffel – siehe Fotos, um die löffelfertigen Gerichte bildhaft darzustellen.
Wird fortgesetzt – die sechs weiteren Finalist:innen werden in eigenen Beiträgen vorgestellt.
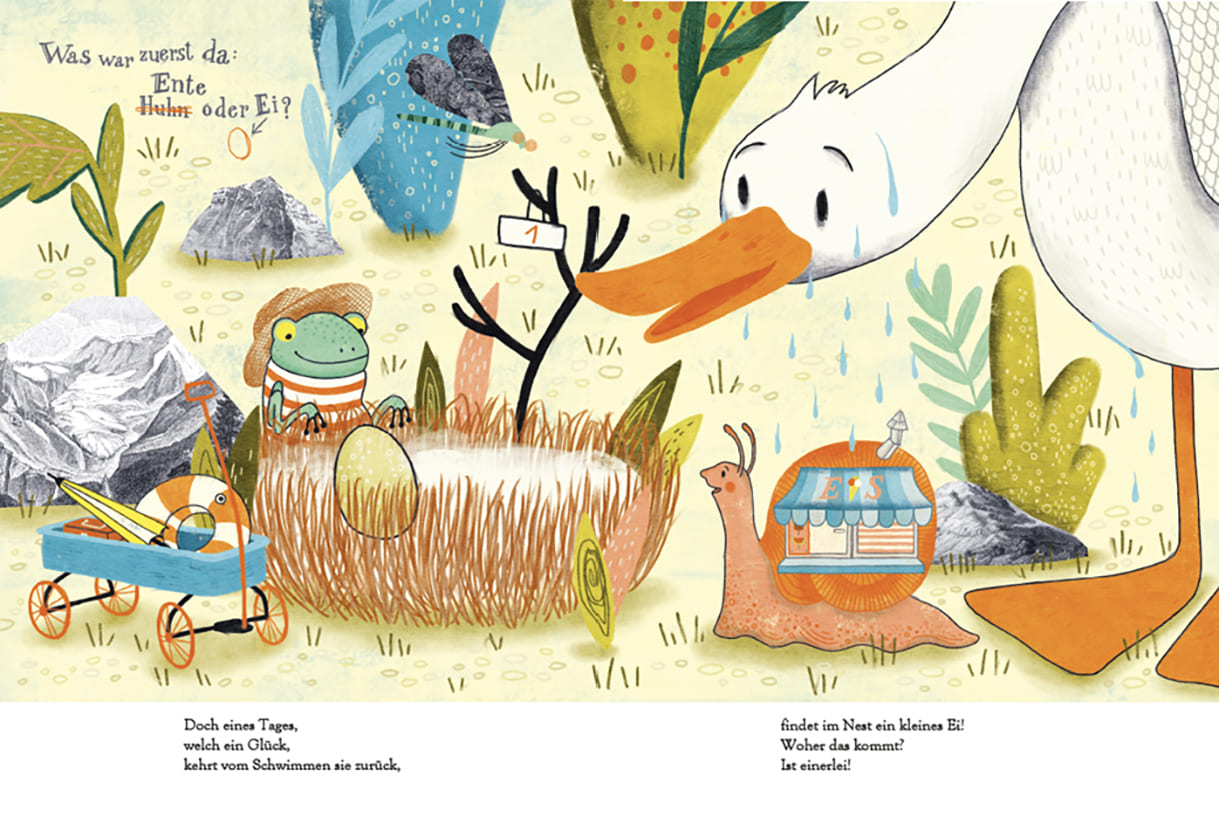
Schade, leider verrät der Titel des Bilderbuchs schon alles. Aber der Reim „Henne Jenne“ ist natürlich zu aufgelegt, drängt sich auf. Nachdem aber schon der Buchtitel so, dann brauch sich diese Besprechung nicht vor Spoilern fürchten, es gibt ja das Überraschungsmoment nicht.
Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Du als Leserin / Leser bzw. Bildbetrachter:in und beim Zuhören, wenn dir das Buch vorgelesen wird, weißt daher schon, dass aus dem Ei, das eines Tages im Nest der Entenmutter liegt, eben kein kleines Entlein, in dem Fall auch kein Schwan wie in Hans Christian Andersens „Das hässliche Entlein“ entschlüpft, sondern ein junges Huhn.
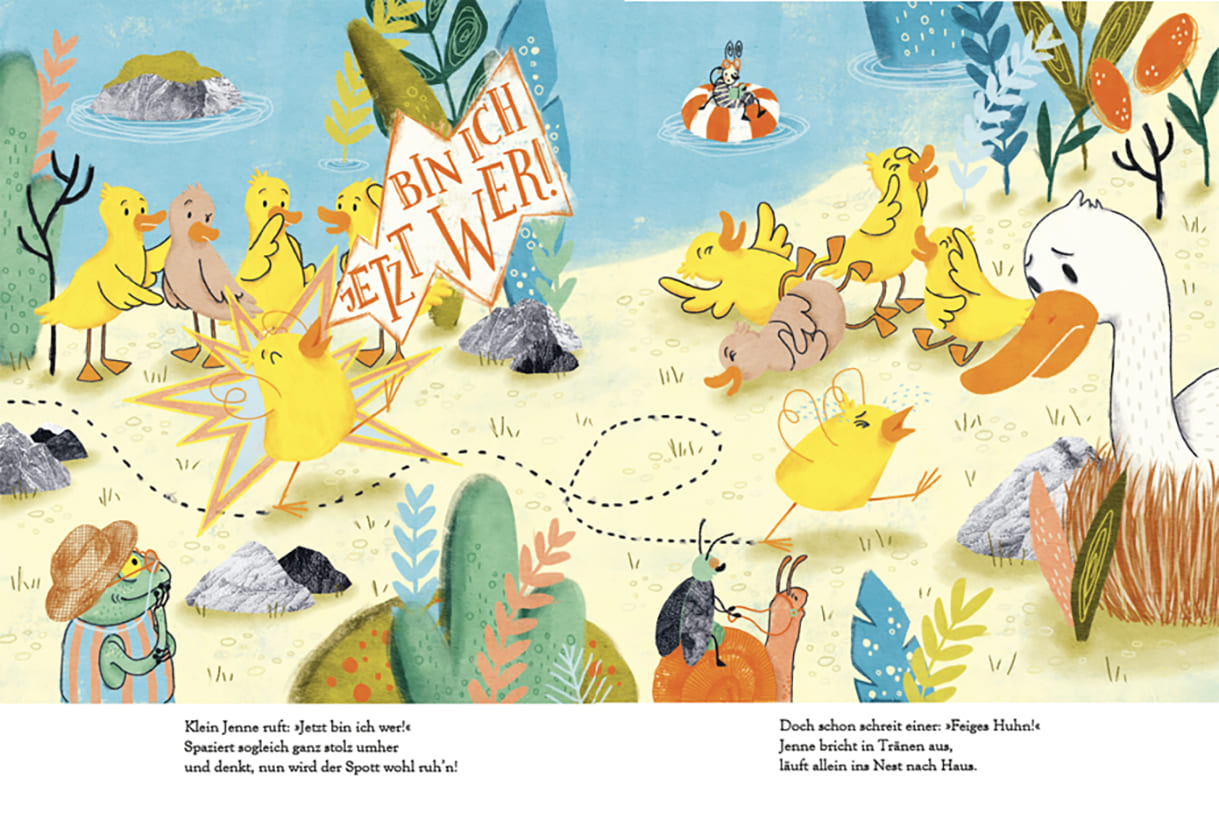
Bald ist das kleine Federvieh – und mit ihm seine „Mutter“ – von Sprüchen aus der Umgebung konfrontiert: „Seltsame Füße“ und erst „der Gang“… Außerdem will es nicht und nichts in Wasser, fliegen kann es auch nicht… Lauter Eigenschaften, die es zum Spott seiner Umgebung machen.
Wir aber wissen ja, es ist eine junge Henne – das erfährt Frau Ente von der Eule. Und stolz entfährt es Jenne, so nannte die Ente „ihr“ Junges schon zu Beginn, jetzt endlich zu wissen, wer es ist. Ähnlich widerfährt’s dem „kleinen Ich-bin-ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel ja erst gegen Schluss.

Doch Autorin Cornelia Travnicek, die sich schon im Jugendbuch „Harte Schale, Weichtierkern“ hervorragend in eine Außenseiterin hineinversetzt hat, beendet mit dieser (Selbst-)Erkenntnis das Buch noch lange nicht. Dass sie nun weiß, Henne zu sein, hindert die anderen Tiere nicht, sich über sie lustig zu machen – „feiges Huhn“ kriegt Jenne zu hören.
Was und wie der sozialen Mutter Ente einfällt, um ihr Junges auch dagegen zu stärken – nein, das sei nun hier wirklich nicht aufgedeckt, eine überraschende Wendung bleibt ja noch.
Schon verraten werden darf, nein soll sogar, dass die vielen bunten Zeichnungen von Raffaela Schöbitz den Text nicht nur illustrieren, sondern viel mehr zu entdecken anbieten, so manches, das beim ersten Mal vielleicht sogar übersehen wird. Und wie beispielsweise bei der in einem der Bilder gestellten Frage, „Wie klingt ein zerbrechendes Herz?“ trotz der schon angebotenen Comic-Sprachen-Ausdrücke „Pling?“, „Klonk?“ und „Krrrack?“ noch viel Raum für Weiter-Fantasieren offen lässt.
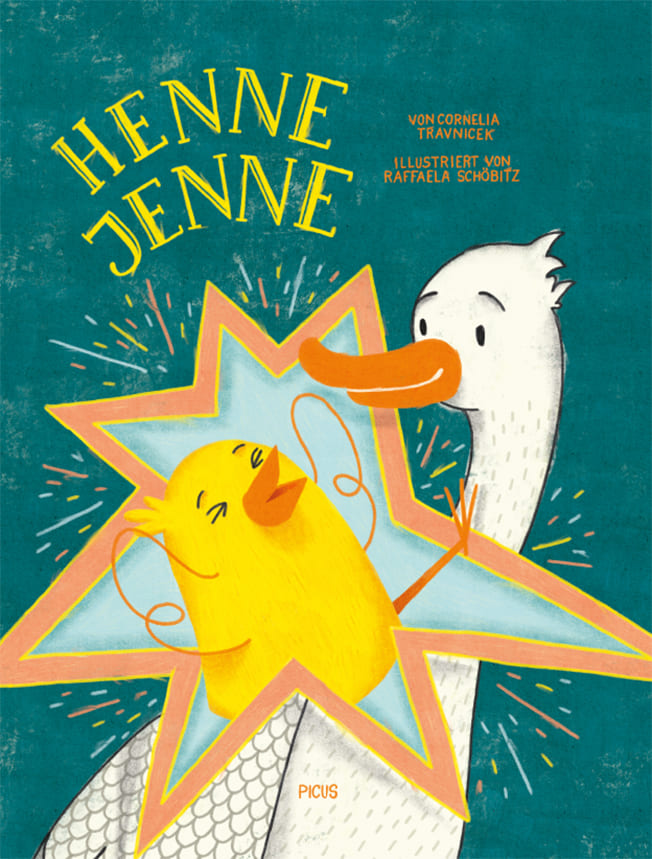

Ist „Hand made Tyrant“ mit Figuren im Theater Schubert professionelle künstlerischer (Hand-)Arbeit, so gab es am Tag nach der Premiere des besagten Stücks eine handgestrickte Performance zu einem ähnlichen Thema. Hubsi Kramar und die 3raum-anatomietheater-revivalband spielte, sang und musizierte „Die 11 Zehennägel des Donald Trump – eine Reinigung“ – in der Kunsttankstelle Ottakring.
Entsprechend Location, die den Charme einer abgefuckten tatsächlich ehemaligen Tankstelle versprüht, agierte auch die Crew – mit selbstgebastelten, fantasievollen Kostümen aus Karton – schlüpften sie in die Rollen des D.T. himself, der sich größer als Gott sah – er hätte die Welt ja an einem einzigen Tag erschaffen. Seiner Anhänger:innen, der Määääähga-Bewegung, Motto „Sheep first“ (Schafe zuerst).
Mit einer nur wenig überspitzten Pressekonferenz – die Originale lassen sich kaum toppen, samt Abführung eines „Journalisten“, der wagte, die nicht vorher vereinbarte Frage zu stellen, welches Buch er zuletzt gelesen habe.
Der Wortwitz Maga – Gaga – Dada schien fast aufgelegt, obwohl davor noch nie wer darauf gekommen war. Der schräge Titel erschloss sich im Verlauf des immer wieder improvisierten Abends voller Gags – allein durch Anspielungen auf den echten D.T. – aufgrund einer „Theorie“ für das jenseitige Agieren des US-Präsidenten: In seinem Thalamus, dem größten Teil des Zwischenhirns, sei ihm ein elfter Zeh samt dazugehörigem Nagel gewachsen. Der soll(te) in dieser Performance theatral entfernt werden, um das Quantenfeld als Verbindung zwischen Bewusstsein und Materie wieder in Ordnung zu bringen.

Die Parlamentsrampen sind abgesperrt. An einer Ecke davor steht ein weißer Kasten. Immer wieder gehen Menschen neugierig auf diesen zu. Wenn sie wollen, bekommen sie ein elektronisches Gerät ausgehändigt, das eine flache Platte vorne hat, Kabel zu Kopfhörern. An einigen Stellen, die wie Fenster in diesem Kasten aussehen, leuchten kräftig rot, aber auch in anderen Farben Lichter auf – und in den Kopfhörern ertönen Musik sowie Stimmen.
Çağdaş Çeçen hat diesen technischen Wunderkasten gebaut und auf der auf einem Zettel ausgedruckten aufgeklebten Beschreibung dazu heißt es unter anderem: „Diese Installation bringt zum Leuchten, was allzu oft im Dunkeln bleibt: Die Stimmen junger Menschen, ihre Erfahrungen, Perspektiven und Kämpfe. Sie ist Teil des dreitägigen Jugend-Kunst-Kultur-Festivals „DWG – Demokratie, was geht?“, einer Initiative die Jugendlichen Zeit und Raum gibt, sich künstlerisch – unterstützt von Profis verschiedener Sparten – zu betätigen, ihre Anliegen, Gedanken, Wünsche, Forderungen und Sichtweisen zu äußern. Im Herbst 2023 fand das erste Festival statt, nun steigt das zweite – bis einschließlich Sonntag, 21. Juni 2025.
„Gerade jungen Menschen, die mehrfach marginalisiert sind, wird zu oft das Gefühl genommen, etwas bewirken zu können. „Demokratie, Was geht?“ setzt dem etwas entgegen: Es macht hör- und sichtbar, was sie denken, fühlen und verändern wollen. Denn durch Geschichten lernen wir. Wer zuhört, wird empathischer. Und wer empathisch ist, hält eher zusammen.
Die Installation übersetzt dieses Prinzip in Licht: Auf kleinen Tafeln zeigen 3-D-gedruckte Reliefs Bilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten, von den Jugendlichen selbst erzählt. Um sie hörbar zu machen, braucht es einen Receiver – und die Bereitschaft, aktiv zuzuhören so wie auch in der Gesellschaft oft erst die bewusst Suche notwendig ist, um die Geschichten derer zu finden, die an den Rand gedrängt wurden. Doch hier holen wir sie zurück ins Zentrum. Ihre Stimmen leuchten. Ihre Geschichten strahlen. Und wir feiern sie – so wie jede Geschichte gefeiert werden sollte.“

Und weil der 20. Juni – seit einem ¼ Jahrhundert – der Weltflüchtlingstag ist, gab es eine kleine, feine, viele Initiativen – freie syrische Gemeinde in Österreich, Ichkeria (Tschetschenen), Ukrainer:innen,… einbeziehende, Demonstration dazu vom Ottakringer Yppenplatz zum Parlament. Lautstark wurde unter anderem skandiert: „Um Europa keine Mauern, Bleiberecht für alle und auf Dauer!“ Wobei nach Europa ohnehin nur ein minikleiner Bruchteil der mehr als 120 Millionen Menschen kommt, die laut UNHCR (Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen) derzeit auf der Flucht sind. Rund zwei Drittel Teil finden in den eigenen Ländern in anderen Regionen Zuflucht; die meisten der 43 Millionen Geflüchteten in anderen Ländern, landen in (Nachbar-)Staaten des globalen Südens.
„Flucht ist ein existenzielles Recht. Und in der Kriegsrealität von heute kann eines Tages jede und jeder von uns zu Geflüchteten werden“, brachte der erste Redner bei der abschließenden Kundgebung einen brisanten Gesichtspunkt ins Spiel.
Danach schilderte Evray Eskander bewegend seine rund 1½ Jahre dauernde langwierige und gefährliche Flucht aus dem syrisch-kurdischen Afrin. „Ich habe Menschen gesehen, die so lange gelaufen sind, dass ihre Füße geblutet haben… An einem anderen Tag hat uns Polizei aufgegriffen. Ein Polizist hielt mir eine Waffe an den Kopf und sagte: „Weißt du, was passiert, wenn ich dich erschieße? Nichts. Du wirst Fischfutter.“
Aber ich habe durchgehalten – weil ich geglaubt habe, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo ich in Frieden leben, lernen und arbeiten kann. Aber meine Familie darf nicht hier sein. Das neue Gesetz erlaubt es nicht mehr, dass ich meine Familie nach Österreich bringe – selbst wenn ich integriert bin, arbeite und alles tue, was von mir verlangt wird…. Ich bitte Sie: Denken Sie an uns. Denken Sie an Menschlichkeit. Integration beginnt mit der Familie – nicht mit Trennung.“
Seine Rede und so manche der Geschichten aus dem eingangs geschilderten „Wunderkasten“ zeigen noch stärker den ohnehin schon offensichtlichen Zynismus einer Broschüre für Kinder von Frontex, der EU-Agentur für die Kontrolle der Außengrenzen, über die „Der Standard“ vor wenigen Tagen berichtete.
Auf der Frontex-Website findet sich die 22-seitige Broschüre aus dem September 2024 mit bunten Bildern in 15 Sprachen zum kostenlosen Download – von Albanisch über Arabisch bis Farsi, Pashto und Türkisch, übrigens auch auf Deutsch – siehe Montage von Screenshots.
Abschiebung wird als „Leitfaden für Rückkehr“ beworben und geschildert, als würden Kindern dabei fast so etwas wie Abenteuer-urlaub machen. Abschiebezentren, oft isoliert abgelegene gefängnisartige Lager werden als Erholungsstätten mit Spielplatz-Charakter gezeichnet. Warnwesten der Bewacher:innen im Flugzeug kriegen ein nettes Bildchen mit der rage: „Welche Farbe wird die Weste wohl haben?“…

Zwar wird auch darauf hingewiesen, dass Kindern ihre von der UN-Konvention festgelegten Rechte zustehen, aber…
… der dortige Artikel 22 legt fest, dass geflüchtete Kinder besonders gut geschützt und unterstützt werden müssen und der Zufluchtsstaat dafür sorgen muss, dass Kinder mit der Familie vereint werden oder wenn das nicht möglich ist, sich jemand anderes gut um sie kümmern muss.
Und was heißt Rückkehr? Die meisten der Kinder aus Flüchtlingsfamilien kennen das Land, aus dem ihre Eltern flüchten mussten, gar nicht.
Die Lite der Sprachen (ver-)birgt noch einen weiteren Schuss Zynismus: Pashto – gesprochen vor allem in Afghanistan (auch Pakistan und Iran), Farsi (Iran), Russisch – sollen Kinder in ein diktatorisches Land verfrachtet werden, wo obendrein Mädchen keine weiterführende Schule besuchen dürfen? Oder in aktuell kriegführende, diktatorische bzw. autokratische Länder?
demokratiewasgeht -> festival-2025

Anlässlich des Weltflüchtlingstags forderte die österreichische Menschenrechtsorganisation Südwind einen grundlegenden Kurswechsel in der Asyl- und Migrationspolitik – hin zu einer solidarischen Aufnahme, menschenwürdigen Unterbringung und aktiver gesellschaftlicher Teilhabe von Geflüchteten. „Flucht ist kein Verbrechen, sondern ein Menschenrecht. Die Bundesregierung muss auf sichere Fluchtwege, Integration und Mitbestimmung setzen, statt auf Symbolpolitik und leere Ankündigungen“, erklärt Stefan Grasgruber-Kerl, Kampagnenleiter bei Südwind. „Fluchtursachen zu bekämpfen heißt: Klimagerechtigkeit, internationale Solidaritätsarbeit und menschenrechtsbasierte Politik.“
Anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni (2001 zum 50. Geburtstag der Genfer Flüchtlingskonvention eingeführt) wurden die aktuellen Zahlen bekannt gegeben. Die für Flüchtlinge zuständige Organisation der Vereinten Nationen, UNHCR registriert mehr als 120 Millionen Menschen, die ihre unmittelbare Heimat verlassen mussten, wobei zwei Drittel Zuflucht im eigenen Land finden (müssen), 43 Millionen Menschen sind Geflüchtete in einem anderen Land. Die meisten von ihnen finden Schutz in Nachbarländern des Globalen Südens. Nur ein Bruchteil hat Zugang zu Asylverfahren in Staaten wie Österreich.

Stellvertretend für die fehlgeleitete EU-Migrationspolitik nennt Südwind das neue Flüchtlingslager Vastria auf der griechischen Insel Lesbos. Das Nachfolgelager des berüchtigten Camps Moria liegt inmitten eines Hochrisikogebiets für Waldbrände und ist nur äußerst schwer erreichbar für externe Beobachter:innen. Hohe Sicherheitsmaßnahmen, eine abgelegene Lage und mangelnde Infrastruktur verhindern, dass NGOs und Medien Einblicke in die Zustände vor Ort bekommen. „Isolation schützt nicht vor Missständen. Flüchtlingsaufnahme darf nicht an den Rand gedrängt werden. Wir fordern offene, gut erreichbare Unterkünfte, die soziale und rechtliche Betreuung ermöglichen und keine Lager im Nirgendwo, die sich einer unabhängigen Kontrolle entziehen. Gleichzeitig braucht es sichere und legale Fluchtwege in die EU, etwa über Programme für humanitäre Aufnahme“, so Grasgruber-Kerl beim Lokalaugenschein auf der Insel anlässlich eines europäischen Netzwerktreffens der Grenzgemeinden und –inseln (BTIN) in der Gemeinde West-Lesbos.
Im Rahmen des – noch bis einschließlich Sonntag laufenden Jugend- und Kunstfestivals „Demokratie, was geht?“ gemeinsam mit der ÖH, der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, wurde am Abend des Weltflüchtlingstages im Wiener Gartenbaukino der Film „Bürglkopf“ gezeigt, der seine Premiere bei der Diagonale im März in Graz hatte. Lisa Polster (Regie und Drehbuch – gemeinsam mit Maira Vazquez Leven) dokumentiert darin das Leben von geflüchteten Menschen in dem weit ab- bzw hochgelegenen „Rückkehrzentrum Bürglkopf“ (Tirol, 1300 Meter Seehöhe, stundenlanger Fußmarsch ins Tal. Isolation der einen, wenige Kilometer entfernt befördern Seilbahnen Tourist:innen auf Berggipfel. Insaßen arbeiten für 1,60 € pro Stunde…
Vor diesem Hintergrund betrachtet Südwind die innenpolitischen Angriffe auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) mit großer Sorge. „Der Schutz von Menschenrechten ist nicht verhandelbar. Wer die Europäische Menschenrechtskonvention angreift, sägt an einer tragenden Säule unserer Bundesverfassung “, sagt Stefan Grasgruber-Kerl. „Was derzeit an politischer Rhetorik kursiert, ist nicht nur unverantwortlich, sondern gefährlich und ebnet den Weg für autoritäre Tendenzen.“
Ähnlich problematisch sieht Südwind die Bemühungen der Bundesregierung gegen den Familiennachzug. „Die Familienzusammenführung ist ein Menschenrecht und kein Privileg. Gleichzeitig schafft familiärer Rückhalt Stabilität und erleichtert die Integration. Es ist schlimm genug, dass lange Verfahren und hohe Hürden die Familienzusammenführung erschweren. Eine Aussetzung wäre eine integrationspolitische Bankrotterklärung“, so der Südwind-Sprecher.
Ein Schlüssel zu gelungener Inklusion ist die gesellschaftliche und demokratische Teilhabe. Südwind fordert daher mehr politische Mitsprache für Geflüchtete und Migrant:innen. Mehrere Pilot-Projekte zeigen einen großen gesellschaftlichen Mehrwert von Beteiligungsmöglichkeiten für Migrant:innen, sei es über Migrant:innenbeiräte oder Online-Beteiligung. Das Südwind-Projekt EMV-LII (Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion) ermutigt Migrant:innen dazu, sich aktiv in die Politik einzubringen. Gleichzeitig werden Gemeinden beim Aufbau nachhaltiger Beteiligungsstrukturen unterstützt. In Österreich arbeitet Südwind mit der Stadt Graz und ihrem Migrant:innenbeirat sowie der Marktgemeinde Lustenau zusammen.
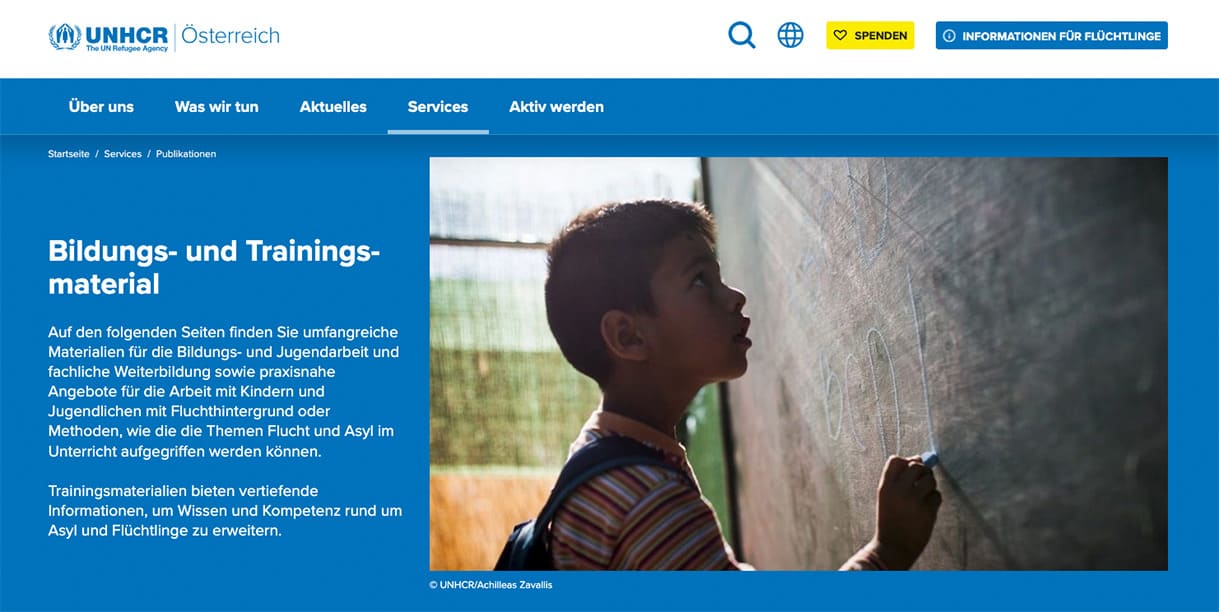
Eine Region, die besonders von Fluchtbewegungen innerhalb der eigenen Staatsgrenzen getroffen wurde, ist Tigray, im Norden Äthiopiens. Während des zweijährigen Bürgerkriegs zwischen der äthiopischen Regierung und der „Volksbefreiungsfront von Tigray“ (TPLF) verloren 700.000 Menschen ihr Leben. Eine Million flüchtete innerhalb der Region und lebt in notdürftigen Camps. „Oft wurden Schulen zu Notunterkünften umfunktioniert. Die Situation ist herzzerreißend. Auch zweieinhalb Jahre nach Kriegsende hausen Familien noch immer jeweils auf wenigen Quadratmetern, nur getrennt durch aufgehängte Planen oder Decken, die so gut wie keine Privatsphäre zulassen“, schildert Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt.
Diese österreichische Entwicklungsorganisation unterstützt, seit ihrer Gründung vor 28 Jahren, in Tigray Schul- und Berufsausbildungsprojekte. Mit Beginn des Bürgerkriegs im November 2020 leistete Jugend Eine Welt durchgehend wichtige Nothilfe für die hungerleidende und traumatisierte Bevölkerung, unter anderem dank der Unterstützung der Austrian Development Agency (ADA). „Der Krieg zerstörte nicht nur das Leben der Millionen Menschen in der Region, sondern traf auch das Bildungssystem, was für die jüngere Generation weitereichende Folgen hat“, so Heiserer. „Die Kinder hatten über mehrere Jahre keinen Unterricht. Schulen, die verwüstet wurden, müssen nun schnell wieder aufgebaut werden. Damit die Mädchen und Buben eine Perspektive haben.“

Während des Bürgerkriegs machten die bewaffneten Truppen in der Tigray-Region vor nichts Halt. Als sie beispielsweise durch die Stadt Adwa zogen, wo Jugend Eine Welt gemeinsam mit den Salesianern Don Boscos u.a. Jugendliche zu Solartechnikerinnen und -technikern ausbildete, rissen sie Türen der Schulen aus den Angeln, schleppten Tafeln und Bänke davon, verbrannten Hefte und Bücher. Mehr als 2.400 Mädchen und Buben verloren an nur einem Tag ihren sicheren Lern- und Schutzraum. „Einige Schulen, sofern sie nicht mehr als Notunterkünfte für Binnenvertriebene benötigt werden, sind mittlerweile wieder geöffnet. Doch viele Klassenzimmer haben keine Einrichtung mehr. Alles ist leer, außer dem staubigen Boden ist nichts mehr da“, skizziert Heiserer die aktuelle Lage. „Dank der Unterstützung der Austrian Development Agency (ADA) sind wir mittlerweile dabei die Schulen mit Tafeln, Tischen, Sesseln, Unterrichtsmaterialen sowie barrierefreien Toiletten auszustatten. Doch parallel müssen auch die Gebäude bis zum kommenden Schuljahr wieder hergerichtet werden. Dächer müssen gedeckt und Mauern verputzt werden. Darüber hinaus benötigen die Schulkinder sauberes Trinkwasser und eine warme Mahlzeit – damit sie nicht mit leerem Magen lernen müssen. Die Einrichtung eines Klassenzimmers kostet 4.000 Euro, eine Lehrkraft verdient rund 100 Euro pro Monat. Das sind kleine Summen, können aber Großes verändern!“
Bis alle Schulen wiederhergestellt sind, läuft der Unterricht weiterhin notdürftig unter freiem Himmel. Oft dient nur ein großer Mangobaum als Dach über dem Kopf. „Die Schulkinder rücken auf einfachen Holzscheiten zusammen und lauschen dem Lehrer, der seine Tafel an den Stamm lehnt“, schildert Wolfang Wedan, Nothilfe- Koordinator von Jugend Eine Welt, Eindrücke von seinen letzten Besuchen in der Tigray-Region. „Für die Kinder, die Gewalt und Flucht erlebt haben, bedeutet dieser provisorische Unterricht weit mehr als Lesen und Rechnen: Er schenkt Struktur, Sicherheit und eine Portion Normalität im Ausnahmezustand.“
suedwind -> weltfluechtlingstag 2025
unhcr.org/at -> bildungsmaterial zu Flucht

Eine robust wirkende Nähmaschine älterer Bauart, ein Dampfbügeleisen, eine schwarz bestoffte, samtig wirkende, Treppe und fast weißer Stoff. Hier wird genäht. Zunächst eine Puppe – gesichtslos – und doch ausdrucksstark dank des Puppen- und Schauspiels von Soffi Povo & André Reitter. Natürlich, das gibt ja schon der Titel vor, „basteln“ die beiden an einem Diktator.
Und nicht nur einem. Nach und nach produzieren sie wie am Fließband in „Hand made Tyrant“ solche; zugegeben, die meisten der mehr als vier Dutzend Figuren sind schon davor angefertigt worden – von Lisa Zingerle, Charlotte Fiedermütz, Louiza Brudermann, Sarah Wissner, die für die Puppen sowie die Ausstattung sorgten. Die zuletzt genannte Künstlerin ist auch für den Stücktext und die Regie verantwortlich und verwendete Motive aus Erich Kästners „Die Schule der Diktatoren“ sowie aus „The Dictator’s Handbook“ von Bruce Bueno de Mesquita und Alastair Smith, das übrigens teilweise Basis für die Netflix-Serie „Wie man ein Tyrann wird“ war, aber auch – siehe dazu später – aus Charlie Chaplins „Der große Diktator“.
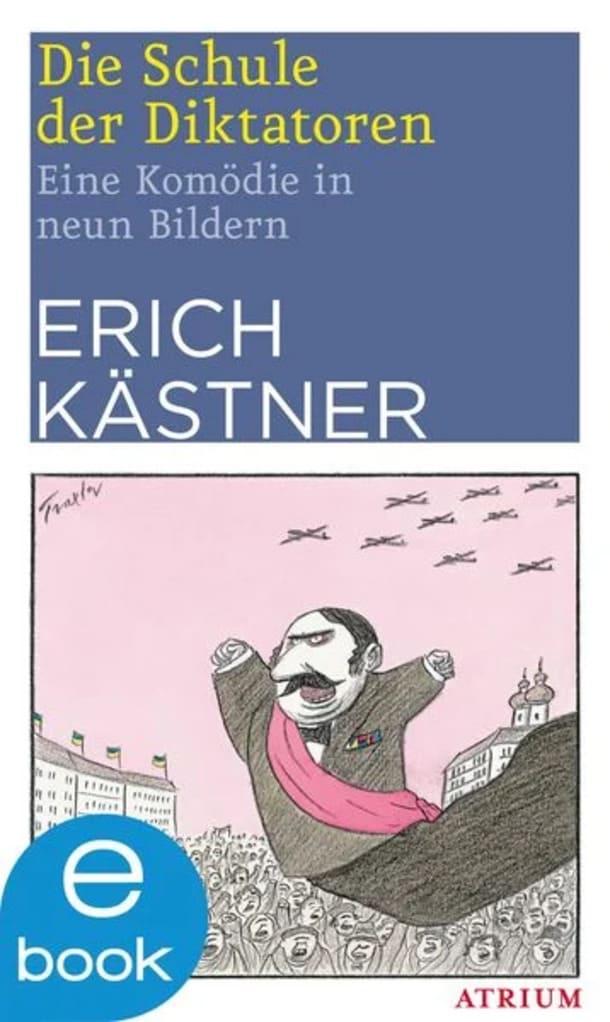
„Dieses Buch ist ein Theaterstück und könnte für eine Satire gehalten werden. Es ist keine Satire, sondern zeigt den Menschen, der sein Zerrbild eingeholt hat, ohne Übertreibung“, schreibt Kästner 1956 in der Vorbemerkung für sein Theaterstück, eine Komödie in neun Bildern.
Diktatoren kommen und werden gestürzt, oft vom nächsten ersetzt. Das spielt sich mit Fortdauer des Stücks ab, immer rascher purzeln die sich an die Macht putschenden Figuren die dunkle Treppe hinab. Namen aller möglichen bekannten einschlägigen Figuren aus der Geschichte von Hitler, Mussolini, Stalin bis Idi Amin, Mubarak und viele andere fallen – wie auch die Figuren.
Und dann erschaffen die beiden mit Hilfe von Seilen aus gleich aber viel größer gebauten Stoff-Körperteilen einen handgemachten Riesen-Tyrannen, der fast die Bühne zu sprengen droht – sozusagen ein Über-Diktator. Doch Hoffnung gebend beginnt bei einer der kleinen Figuren ein Herz zu leuchten…
Das hätte eigentlich gereicht. Als würde die Regisseurin und Stücktext-Autorin nicht auf die Kraft der Bilder des Stücks vertrauen, kommt gegen Ende eine Rede gegen Diktatur, für Menschlichkeit und den Weltfrieden. Darauf von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, meinte Sarah Wissner, dass dieser Schluss-Monolog von jenem des Friseurs und Gegenspielers von Anton Hynkel in Charlie Chaplins „Der große Diktator“ inspiriert sei bzw. an diesen erinnern solle.
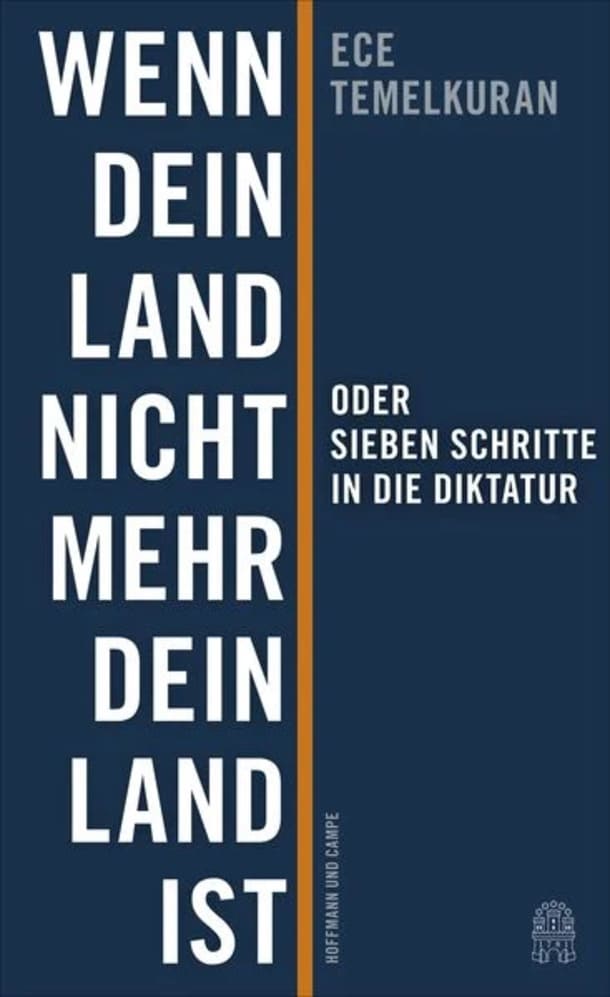
Und wenn schon was draufgesetzt werden musst, so hier auch noch das Zitat aus dem Buch von Ece Temelkuran „Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist“ mit der Fortsetzung im Titel „oder Sieben Schritte in die Diktatur“ (aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger, Verlag Hoffmann und Campe): „Dieses Buch will nicht schildern, wie wir unsere Demokratie verloren, sondern dem Rest der Welt helfen, Lehren aus dem Geschehen zu ziehen. Natürlich herrschen in jedem Land andere, ganz spezifische Umstände, und in manchen herrscht der Glaube, die eigene stabile Demokratie, die eigenen starten staatlichen Institutionen böten Schutz vor solchen „Komplikationen“. Doch die auffälligen Ähnlichkeiten zwischen dem, was die Türkei erlebt hat (Anmerkung der Redaktion: bezogen auf den Putschversuch Mitte Juli 2016 und die folgende, nochmals verschärfte Repression unter Recep Tayyip Erdoğan), und dem, was kurz darauf in der westlichen Welt begann, sind zu zahlreich, als dass man sie übersehen darf. Der politische Irrsinn, den wir als „erstarkenden Populismus“ bezeichnen und in der einen oder anderen Form inzwischen alle erleben, bildet eine Art Muster aus. Und obwohl es viele Menschen im Westen noch nicht artikulieren können, wächst die Zahl derer, die spüren, dass auch sie bald einen düsteren Sonnenaufgang erleben könnten.“

Zeiten ändern sich, die Stadtgesellschaft hat sich geändert, damit haben das auch die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen getan. Deshalb brauchen sie auch andere, neue Geschichten. Mit diesen Ausgangsüberlegungen will die neue Leitung des Theaters der Jugend ab der übernächsten Saison den Spielplan für das junge Publikum gestalten. Das erzählen neben Aslı Kışlal, über die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon hier berichtet hat, auch ihre künftige Stellvertreterin Bérénice Hebenstreit im Interview einige Stunden nach der Bekanntgabe in einer Presskonferenz mit Vizekanzler und u.a. Kulturminister Andreas Babler und Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.
Sie war es, die die neue Direktorin „ermutigt und unterstützt hat, mich zu bewerben, und mit der ich nun als Team die Leitung übernehmen werde“, wie Aslı Kışlal bei der besagten Medienkonferenz sagte.
Damit wollen die beiden aber alles andere als alles über Bord werfen. „Das Theater der Jugend ist eine traditionsreiche Institution. Wir möchten ihre Qualitäten und Stärken bewahren und gleichzeitig ihr Potential weiterentwickeln und neue Impulse setzen“, wiederholt die ab übernächste Saison neue Direktorin einen Satz aus dem Statement bei der medialen Vorstellung.
„Aber wir wollen einiges ergänzen und ändern“, so die beiden.
Auf die Nachfrage was, meinen Hebenstreit und Kışlal einerseits eine kooperativere Haltung anderen Einrichtungen der Stadt, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten – von der freien Szene bis hin zu Jugendzentren und andererseits, dass sich mehr Kinder und Jugendliche dieser multikulturellen, pluralistischen, vielfältigen Stadt auch auf der Bühne und in Stücken widergespiegelt erleben können.

Das große Haus, Renaissancetheater, dessen Name Kışlal durchaus in Frage stellt, „das ist aber sicher nicht vorrangig“ soll wie bisher vor allem für Kinder da sein. „Für die Jüngsten ab sechs Jahre gibt es aber zu wenig gute Stücke, wobei da deutsche Stadt- und Staatstheater einiges haben. Da sollten wir mehr zusammenarbeiten, uns austauschen, auch Stücke in Auftrage geben. Fantasie anregen, Empathie verbreiten und das alles mit Humor, da sollten wir junge Autorinnen und Autoren heranziehen, die Stücke für diese große Bühne schreiben können. Diese sollten die hiesigen Lebensrealitäten beinhalten. Wir wollen über Diversität nicht reden, sondern sie leben“, postuliert Aslı Kışlal, die das in ihrer bisherigen jahrzehntelangen Arbeit nicht nur, aber vor allem in Wien, auch praktiziert hat. „Das wofür ich jahrzehntelang gearbeitet und gekämpft habe, können wir nun in einem großen Haus umsetzen!“, freut sie sich – und wird beim Interview in einem großen Gastgarten in der Neubaugasse wenige Meter vom Renaissancetheater entfernt, immer wieder von Gäst:innen unterbrochen, um sie zu beglückwünschen.
Das designierte neue Leitungsduo will an Vielem dieser großen, traditionellen Kinderkultur-Einrichtung anknüpfen und betont, „dass wir hier mit offenen Armen aufgenommen worden sind. Obwohl wir erst ab der übernächsten Saison die Verantwortung haben, wurde uns gleich ein Büro eingerichtet, in dem wir arbeiten können.
Viele Mitarbeiter:innen waren auch bei der Pressekonferenz, treffen konnten wir sie vorher leider noch nicht, es sollte ja alles bis dahin geheim bleiben, nur mit dem Leitungsteam hatten wir direkten Kontakt. Aber damit die Mitarbeiter:innen nicht erst aus den Medien informiert werden, haben wir eine Videobotschaft aufgenommen, die alle bekommen haben. Anfang der kommenden Woche haben wir dann noch einen eigenen Termin mit allen.
Direktor Thomas Birkmeir und sein Stellvertreter, der Chefdramaturg Gerald Maria Bauer, haben uns herzlich und kollegial aufgenommen – so sollte s ja auch sein.“ Ist es leider in vielen Häusern nicht wirklich, da gibt es solche, deren Mitarbeiter:innen erst aus Medien von ihrer neuen künstlerischen Leitung erfahren oder wo Übergaben nicht wirklich stattfinden können…

Doch nun, da in einem vorigen Beitrag sowie schon öfter über ihre Arbeit auf dieser Seite Aslı Kışlal vorgekommen ist, eeendlich zu Bérénice Hebenstreit. „Seit 2017 arbeite ich als Regisseurin, hauptsächlich im Erwachsenentheater, aber schon auch für Kinder. Das erste Mal als ich für Kinder inszeniert habe, hat mich selber stark verändert. 2019 wurde ich vonm Landestheater Vorarlberg in Bregenz gefragt, ob ich „Vevi“ nach dem Roman von Erica Lillegg inszenieren möchte. Das ist eine österreichische Kinderbuchautorin (1907 – 1988), die erst wieder entdeckt werden muss. Ich würde ihre Vevi die österreichische Pippi Langstrumpf nennen. Anfangs hatte ich Zweifel, ich hab ja noch nie für Kinder ein Stück gemacht.“
KiJuKU will wissen, inwiefern diese Arbeit die Regisseurin verändert hat, noch dazu stark. „Ich hab mir davor dann Vieles angeschaut in verschiedenen Theatern und unter anderem beim Schäxpir-Festival und war extrem beeindruckt vom Niveau und wie ernst das junge Publikum genommen wird. Aber auch davon, dass da vieles für den Dialog mit dem Publikum inszeniert wird, das viel stärker und unmittelbarer reagiert. Diese Arbeit für das große Haus mit 500 bis 600 Kindern hat mich dann eben sehr verändert.“

Hebenstreit erzählt, dass sie so wie sie Erica Lillegg wieder ausgegraben hat – übrigens hat das Kinder- und Jugendtheater Next Liberty in Graz, wo sie selbst die Kunstschule Ortwein besuchte, Vevi in einer eigenen Inszenierung auf die Bühne gebracht – auch Maia Lazar wieder entdeckte und „Die Nebel von Dybern“ für das Theater Nestroyhof / Hamakom inszenierte.
Für ihre Regie von Urfaust/FaustIn and out (Goethe und Elfriede Jelinke) Im Volx Margarethen bekam sie einen Nestroy und war 2021 für den „zerbrochenen Krug“ von Heinrich Kleist“ für einen weiteren nominiert, „das war mein erster Klassiker“.
Im Herbst des Vorjahres inszenierte sie im Theater Erlangen (Deutschland) ihr zweites Kinderstück, Christine Nöstlingers viel zu wenig bekannten Roman „Hugo, das Kind in den besten Jahren“ und nennt den Roman „einen der anarchistischesten von Nöstlinger“.
So wie Aslı Kışlal „Mini-Horror“ von Barbi Marković so inszenierte Hebenstreit „Superheldinnen“ dieser österreichischen Erfolgsautorin.
„Wir kennen uns aber vor allem aus der aktivistischen Arbeit“, meinen die beidem im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… und da vor allem in Sachen „Aufbrechen patriarchaler Strukturen und generell von Machtgefällen leider auch in der Kulturbranche, die oft ja auch andere Ansprüche formuliert.“ So haben sie mit angestoßen, dass es Reports in Sachen Gender und Diversität für Theater geben sollte, „immerhin ist im September des Vorjahres der erste Bericht – für den gesamten Kulturbereich – erschienen“.

Gemeinsam mit Angela Heide, Julia Franz Richter, Johanna Rosenleitner, Birgit Schachner und Barbara Wolfram gründeten und betreiben die beiden die Plattform „Kill the Trauerspiel“ – „Für eine lebendige und progressive Kulturarbeit braucht es dringend Geschlechtergerechtigkeit und Diversität auf und hinter den Bühnen… ist eine Initiative, die sich für dieses Ziel einsetzt, indem sie konkrete Schritte initiiert, Allianzen aufbaut und eine Plattform für Austausch bietet“, heißt es auf der entsprechenden Website einleitend – Link am Ende des Beitrages.
„Und das wollen wir natürlich im Theater der Jugend dann auch umsetzen – gendergerechte Aufteilung in Besetzungen, Regie…“, bringt sich nun wieder Aslı Kışlal ins Gespräch ein. „Übrigens, für Jugendliche bezeichnen wir das Theater im Zentrum als verlängertes Wohnzimmer“.
Dort hatte Aslı Kışlal ihre ersten schauspielerischen Erfahrungen nach der Übersiedlung aus der Türkei nach Wien. „Ich hab in Christa Stippingers „wiener blut – keine operette“, einem modernen Romeo-und Julia-Stück gespielt. Da ging’s um Jugendbanden Anfang der 90er Jahre in Wien. Wir hatten Probenbesuche von Streetworkern mit Skinheads ebenso wie von türkischen Jugendbanden. Während ich noch auf meinen Auftritt gewartet habe stand eine Szene im Fokus, wo ein Skinhead einen türkischen Jungen mit dem Kopf in eine Klomuschel taucht, es ertönen Wassergeräusche. Im Publikum saßen zwei ältere Schauspieler:innen, die haben begonnen provokativ zu applaudieren, um die Reaktionen der Zuschauer:innen herauszufordern. Das wurde heftig, 20 bis 30 türkische Jugendliche wollten die beiden, die dann verschwanden, suchen und schlagen. Ich hab die beiden umarmt, geknuddelt und die Szene beruhigt, den Jugendlichen erklärt, dass das eben Schauspieler:innen sind. Das war der Moment, wo ich wusste, ich will Jugendarbeiterin werden.

Zuvor aber spielte sie noch in weiteren Jugendstücken, unter anderem „Trainspotting“ (Roman von Irvine Welsh, 1993). „Da gab es viele kritische Stellungnahmen. Der damalige Theater-der-Jugend-Direktor, Reinhard Urbach, hat gesagt: „Wenn die Kirche so laut schreit, dann haben wir was richtig gemacht!“
Aslı Kışlal ging dann in die Jugendarbeit, aber nie weg von Theater und Kultur. Im Verein echo konnten sich Jugendliche vor allem der zweiten Generation von Migrant:innen kulturell betätigen, mit dieser Crew inszenierte sie dann die gesellschaftspolitischen Satiren „Dirty Dishes“ und „Oma frisst“ – siehe den unten verlinkten Bericht…

„Eigentlich wollten wir uns ja als Team bewerben“, so Hebenstreit zu KiJuKU.at – unter den 40 Bewerbungen gab es auch sieben in Teams. „Doch dann wurde uns gesagt, es sei eine Hauptverantwortliche gewünscht“, fügt die künftige stellvertretende künstlerische Leiterin an. „Wir verstehen das auch als gegenseitige Kontrolle, nicht abzuheben“, so Aslı Kışlal (55) abschließend. „Außerdem vertreten wir auch zwei Generationen“, ergänzt Bérénice Hebenstreit (37)

„Das Theater der Jugend ist eine traditionsreiche Institution. Ich möchte ihre Qualitäten und Stärken bewahren und gleichzeitig ihr Potential weiterentwickeln und neue Impulse setzen. Kulturelle Teilhabe ist die Voraussetzung für ein soziales und verständnisvolles Miteinander. Kulturelle Bildung ist politische Bildung, die das Demokratieverständnis fördert – beides ist entscheidend für eine funktionierende Stadtgesellschaft. Das lustvolle (Er)leben kultureller Vielfalt auf und hinter der Bühne ist ein Schlüssel, damit sich viele unterschiedliche Menschen angesprochen fühlen und das Theater als das annehmen, was es sein kann: ein Ort, an dem spielerisch, intelligent und sinnlich Erinnerungen geteilt, Erfahrungen gemacht und Ideen für verschiedene Zukünfte eröffnet werden.
Ich wünsche mir, dass jedes Kind das Recht hat, Theater zu erleben – unabhängig vom Bezirk, der Schule oder der Familie, aus der es kommt. Das schönste Geräusch ist das Kinderlachen. Noch schöner ist es, wenn tausend Kinder gleichzeitig schreien, weil sie so aufgeregt sind, so berührt, dass sie das Leben feiern. Und es ist kein abstraktes Bild – es passiert im Theater für junges Publikum. Es ist mir selbst passiert bei meinem ersten Familienstück mit 1000 Sechsjährigen, und ich habe geweint.
Zugänge schaffen bedeutet auch, Zugänge für eine junge Generation an Künstlerinnen zu schaffen, sie für Theater für junges Publikum zu begeistern und Talente zu fördern. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass Theater für junges Publikum als eine ernstzunehmende Kunstbranche etabliert wird – mit den Institutionen, die dafür zuständig sind: Theaterwissenschaften für Dramaturgie, Konservatorien und Universitäten für Schauspiel und Regie, bildende Kunst für Bühnenbild und Kostüme. Auch für junge Autorinnen werde ich Rahmenbedingungen schaffen, damit sie große Stücke für kleine Zuschauer*innen schreiben können. Damit diese überall gespielt werden können, wollen wir andere Häuser ins Boot holen – mit Koproduktionen, Kooperationen und Netzwerken. Es ist eine große Aufgabe.

Ich habe eine Vision von einem Theater, das die gelebte Diversität der Kinder auf die Bühne bringt. Wer erzählt welche Geschichten für wen? Das, was ich seit vielen Jahren hinterfrage, wird hier Realität. Wir werden die Jugendlichen mit ihren Geschichten abholen, damit sie sich nicht allein fühlen. Und dabei werden wir den Humor nicht vergessen, denn er ist die beste Medizin.
Die Institution soll eine lernende Institution werden, und ich eine lernende Leiterin.
Mit Respekt und Freude sage ich: Ja, ich will!“

Wer in die Schule geht, sollte das Recht darauf haben, zwei Mal im Jahr mit der Klasse ins Theater gehen zu dürfen. Diese Forderung in einem offenen Brief an die (kultur-)politisch Verantwortliche heranzutragen, wurde – nicht zum ersten Mal – im Herbst des Vorjahres, bei „Luaga & Losna“ (Schauen und Hören), dem Internationalen Theaterfestival für junges Publikum in Vorarlberg diskutiert. In einem Vortrag der Vorsitzenden der Österreich-Sektion der internationalen Kinder- und Jugendtheaterorganisation ASSITEJ (Association internationale du théâtre pour l’enfance et la jeunesse), Anja Sczilinski (nunmehr Co-Vorsitzende gemeinsam mit Natascha Grasser), hatte diese Forderung vorgeschlagen.
Viele meinten, das wäre gut vor der Nationalratswahl an die Kandidat:innen heranzutragen. Was letztlich verworfen wurde, man wisse ja noch nicht, wer dann dafür zuständig sein werde, wurde Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auf Nachfrage geantwortet. Auch die diversen Koalitionsverhandlungen wären zu früh.
Ein „KulturKonvent“ für den u.a. vom Österreichische Musikrat (ÖMR) und Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren in der Öffentlichkeit sprechen, stellte – schon vor der herbstlichen Nationalratswahl – die Forderung damals an alle wahlwerbenden Parteien, sich für das Grundrecht auf kulturelle Bildung einzusetzen. Erst recht gilt dies für die Koalitionsverhandlungen: „Kultur ist nicht nur Kunst. Kultur ist der menschliche Ausdruck allen höheren Strebens und Schaffens. Der Kulturkonvent formuliert die dafür erforderlichen Grundlagen“, hieß es zu einer Tagung im Frühjahr 2023.
Anlässlich der Budgetrede des Finanzministers erging nun ein Offener Brief – allerdings ohne diese Forderung – allerdings ohne diese dezidierte Forderung, sondern „lediglich“ als Hilfeschrei gegen mögliche Kürzungen von Vorstand und Geschäftsführung der ASSITEJ-Austria an Kultur- sowie Bildungsminister und die Kultursprecher:innen der im Nationalrat vertretenen Parteien.
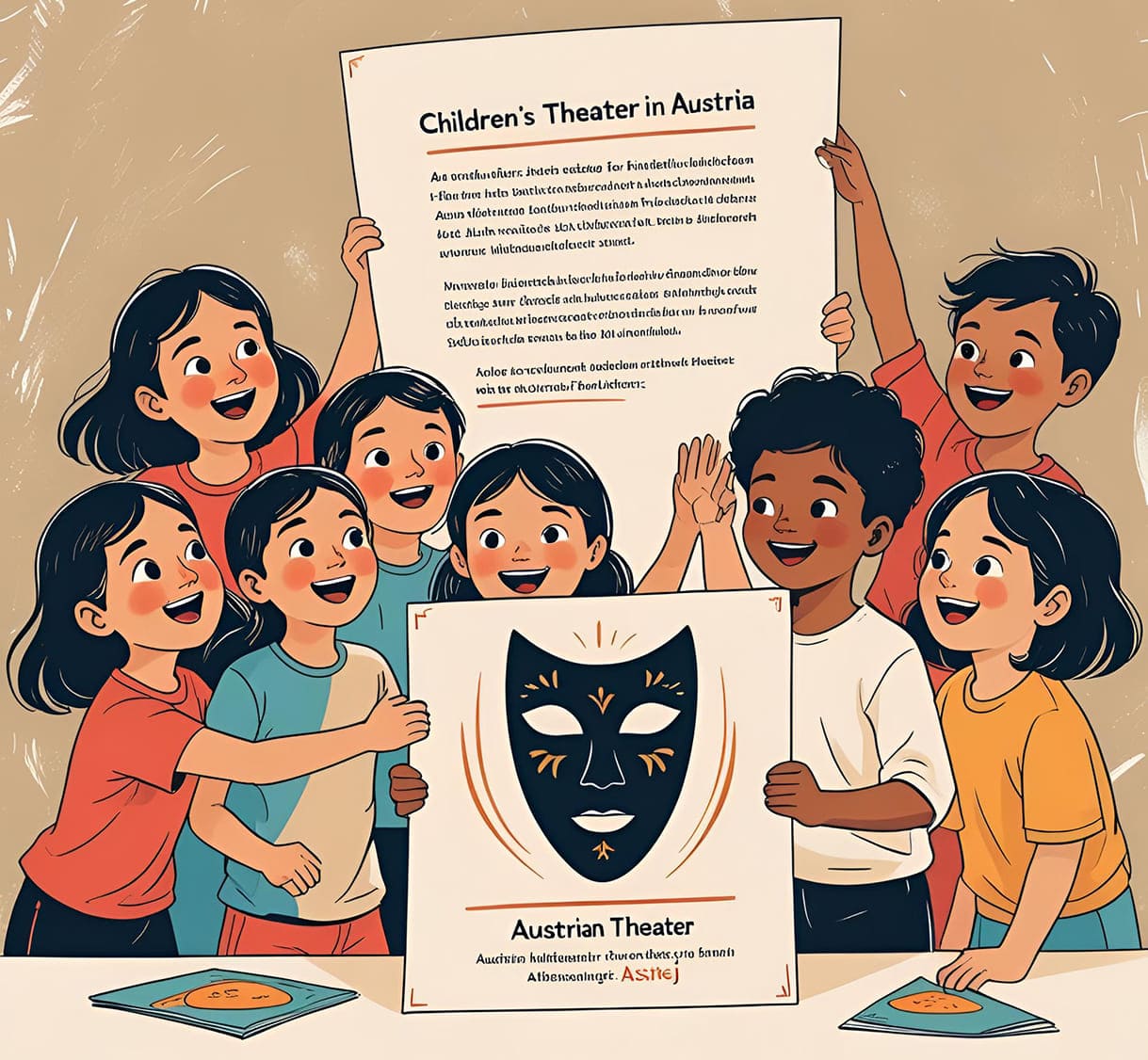
„Die derzeitige Lage in Österreich und der Welt ist keine einfache, dies ist sowohl dem Vorstand als auch allen Mitgliedern der ASSITEJ Austria bewusst. Auch wissen wir, dass in Zeiten, in denen der Geldfluss für Städte/Gemeinden, Bundesländer und den Bund wenig stark fließt, die Gesellschaft zusammenhalten und jeder*jede einen Beitrag leisten muss.
Allerdings müssen wir dringlich darauf hinweisen, dass Kürzungen im Kulturbereich und hier vor allem im Theater für junges Publikum, irreparable Schäden mit großer Tragweite für die Zukunft des Landes verursachen, die bis in die kleinsten Gemeinden und alle Gesellschaftsschichten verstärkt spürbar sein werden.
In Zeiten stark steigender Kosten ist das Kulturbudget höchstens marginal gestiegen. Sprich: der Kunst- & Kulturszene und hier vor allem den Institutionen, freien Gruppen und Einzelkünstler*innen, die sich im Bereich Theater für junges Publikum betätigen, geht es an die Substanz.
Wer hier weiter kürzt, riskiert langfristig unumkehrbare Verluste in der darstellenden Kunst für junges Publikum. Sie steht, wie keine andere für eine demokratische, offene, faire, soziale und menschliche Gesellschaft, weil sie genau dort ansetzt, wo die Entwicklung des Menschen am prägendsten ist: in Kindheit und Jugend.
Wir stellen die Drehschrauben für eine offene, humane, dialogfreudige, interessierte und demokratische Gesellschaft, die bei den Allerkleinsten beginnt, und die junge Menschen in den wichtigsten Lebensjahren in der Formung eines mündigen und freigeistigen Menschen begleitet.
Fragen und Antworten sowie Lebenswege und Perspektiven, die im Bildungssystem oder im Elternhaus nicht angesprochen werden, werden von unseren Mitgliedern angesprochen, egal ob Einzelkünstler*in, freie Gruppe, freies Theater oder größere Institutionen. Das eint diese Künstler*innen und Kulturschaffenden, die damit auch einen Teil des Staatlichen Bildungsauftrages übernehmen!
Theater für junges Publikum fungiert somit nicht nur als Kulturelle*r Nahversorger*in, sondern ist ein zentraler Ort des Lernens, der Persönlichkeitsentwicklung und der kulturellen Teilhabe. Gerade die Bundesregierung und die Bundesländer tragen Verantwortung, jungen Menschen künstlerische Ausdrucksformen zugänglich zu machen – nicht als elitär kodiertes Zusatzangebot, sondern als essentiellen Bestandteil von Bildung in einem umfassenden Sinn. Jedes Kind sollte mindestens einmal pro Schuljahr aktiv Theater für junges Publikum erleben können, unabhängig ihrer finanziellen, kulturellen oder sonstigen Hintergründe. Kultur und Bildung müssen hier stark ineinandergreifen und die kulturelle Bildung gemeinsam stärken und
gemeinsam Verantwortung übernehmen. Jede Kürzung in diesem Bereich bedeutet nicht nur einen Angriff auf die Kunst, sondern auch auf die Bildung junger Generationen – auf ihre Fähigkeit, kritisch, empathisch und gesellschaftlich verantwortungsvoll zu handeln.
Es ist wichtig, dass sich die ASSITEJ Austria, die für ihre Mitglieder sowie alle weiteren Akteur*innen im Theater für junges Publikum wie auch im Kulturbereich einsteht, aufzeigt, wie wichtig Theater für junges Publikum in allen seinen Facetten ist!

In der UN-Konvention der Kinderrechte im Artikel 13, zu der sich Österreich bekennt, steht: „Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.[…]
Artikel 31: Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben, staatliche Förderung (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben. (2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.“
Eine Kürzung des Etats für Theater für junges Publikum steht diametral zu diesen von Österreich unterzeichneten Zielen und Rechten! Ein weiteres Einschränken der Förderungen und Subventionen in unserem Bereich stellt viele Gruppen, Künstler*innen und Theater vor existenziellen Nöte.
Lassen Sie nicht zu, dass diese Situation eintritt, und stehen Sie für ein starkes Theater für junges Publikum ein. Nicht nur damit junge Menschen später den Weg ins Abonnement des Abendspielplans finden, sondern damit sie als eine offene, soziale und diskursfreundliche neue Generation aufwachsen, die mit ihren in den Theatervorstellungen, Workshops & Programmen der Kulturvermittler*innen, Schulveranstaltungen und selbst auf den Theaterbühnen erlernten Fähigkeiten und Sichtweisen für eine starke Demokratie eintreten.“

Die 15. Bundesmeisterschaft und zugleich die 1. Sparkasse Schülerinnenliga fand von 15.-18. Juni in Hohenems (Vorarlberg) statt. Meisterinnen wurden die Kickerinnen aus Wien – im Finale gegen ihre Kolleginnen aus Oberösterreich.
Die Fußballerinnen aus dem Polgar-Gymnasium, der Kooperationsschule des Wiener Fußballverbandes, traf vor de, Feiertag bei 27 Grad im Schatten im Stadion von Hohenems auf das in der Vorrunde ebenfalls ungeschlagene Team des BRG Rohrbach. Nach sieben Minuten brachte eine Energieleistung von Kapitänin Caroline Omerzu mit einem platzierten Schuss ins lange Eck den erlösenden 1:0-Treffer. Dann kam die Minute 13 – Glück für die einen, Pech für die anderen: Ein Idealpass von Ava Body auf die Wiener Goalgetterin Lenia Knofl und es stand 2:0. Eine Minute später war es wieder Knofl, die in einem Gestocher sogar im Sitzen ihren Torinstinkt bewies und mit diesem Doppelschlag auf 3:0 stellte.
Danach stellten die Oberösterreicherinnen um und das Finale wurde ausgeglichener. Nach dem Wechsel waren die Polgargirls überlegen und die souveräne Abwehr mit Lena Figura und Sara Kalajdžić präsentierte sich als unüberwindbares Bollwerk. Als das Finale dem Wetter Tribut zollte, schlug abermals Kapitänin Omerzu zu. Mia Neuhauser, die im nächsten Schuljahr in die Akademie nach St. Pölten wechselt, passte in die Tiefe zu Omerzu, die mit einem Schuss ins linke untere Eck den Endstand zum 4:0 herstellte.

„Das Kämpfen hat sich gelohnt“, stellten Veronika Zeppetzauer und Karl-Heinz Piringer, die Betreuer:innen, gemeinsam fest. Für Spielerinnen des Polgar-Gymnasiums (Donaustadt; 22. Bezirk) war es der 8. Schülerinnen-Liga-Titel; allerdings liegen zwischen diesem und dem vorangegangenen bereits sieben Jahre.
Viele Ehrengäst:innen aus dem sportlichen Bereich waren vor Ort: Johann Gartner, Chef im ÖFB für Frauenfußball, Bogdan Frisu, Akademieleiter von St. Pölten, sowie der Geschäftsführer vom Vorarlberger Fußballverband, Andreas Kopf. Die Geschäftsführerinnen vom Bundesministerium Birgitt Schalkhammer-Hufnagl und vom ÖFB Isabel Hochstöger organisierten die Bundesmeisterschaft gemeinsam mit den Vorarlberger Schulsport-Experten Christoph Neyer und Patrick Scherrer.
Finale
Polgar – Rohrbach (OÖ) 4:0 (3:0)
Torfolge: 1:0 (7.) Omerzu, 2:0 (13.) Knofl, 3:0 (14.) Knofl, 4:0 (53.) Omerzu.

Eltern halt. Feriencamp pubertierender Jugendlicher. Neben ihren unterschiedlichen Charakteren – von zurückhaltenden Teilnehmer:innen bis zu pseudohaften Ober-Checker:innen, Skepsis gegenüber Neuankömmlingen bis zu einer Flirtmeisterin. Doch diese zwölf Jugendlichen leiden unter ganz besonderen Eltern, die sie hierher in das Camp Pandora geschickt haben. Die Oldies sind alle berühmt, die meisten von ihnen Göttinnen und Götter oder wie Odysseus und Kassandra anderweitig weltbekannt.
Die meisten hadern einerseits mit dem, was sie von ihren Eltern mitgekriegt haben – oder auch nicht, Stichwort abwesende Väter, mit Rang- und Revierkämpfen, wechselnden Cliquenbildungen, kommen aber letztlich im Camp Pandora zum Schluss des Musicals „Monsters & Myths“, das kürzlich drei Mal im Dschungel Wien über die große Bühne ging: „Der reichste Schatz, den wir haben, sind wir selbst!“

Rund 1½ Stunden spielen, tanzen und singen die zwölf Jugendlichen der DraMotion Company, Vanessa Deimbacher (Rosalia, Tochter der Aphrodite), Maya Dittami (Diana, Tochter der Jagdgöttin Artemis), Ela Ježović (Heka, Tochter des Hirtengottes Pan), Valentino Pölzl ihren Bruder Teros, Mia Manich (Deliah, Tochter des Helden, Sängers und Poeten Odysseus) und Sophie Siquans deren Schwester Bella, Livia Nenescu (Metis, Tochter des Zeitgottes Kronos), Svenja Schmetterer (Floria, Tochter der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter), Sarah Schuster (Pallas, Tochter der Weisheitsgöttin Athene), Sebastiano Steinwender (Phobos, Sohn des Kriegsgottes Ares), Julian Styll (Lucian, Sohn des Unterweltgottes Hades), Madita Thill (Astra, Tochter der „blinden Seherin“ Kassandra).

13 der 14 zur Story passenden Songs oder umgekehrt die an diese angepasste Story (Idee und Buch: Domenika Arnetzhofer, Clara Montocchio, Richard Schmetterer, der auch Regie führte; Musikalische Leitung, Kostüme: Clara Montocchio; Choreografie, Organisation: Domenika Arnetzhofer) stammen aus mehr oder weniger bekannten Musicals. Einer der Songs – „Till the Morning Light“ wurde von Clara Montoccio geschrieben und von der jungen Crew gemeinsam performt – samt Video zur Musik, das fast zeitgleich mit der Bühnenpremiere auf YouTube on air ging – Link unten in der Info-Box, denn unter dem Titel und der Company findest du auf YouTube etliche gleichnamige Songs.


Zum ersten Mal in der Geschichte des Theaters der Jugend in Wien (vor mehr als 90 Jahren gegründet) übernimmt ab der übernächsten Spielzeit (Herbst 2026) mit Aslı Kışlal eine Frau die Leitung dieser Institution mit zwei Häusern, rund 30.000 Abonennt:innen und ca. 200.000 verkauften Karten – auch für Vorstellungen in anderen Theatern – und einer Auslastung von rund 95 % (Fakten und Daten aus einem Beitrag zur Geschichte des Theaters auf dessen Homepage). Sie wird damit die Nachfolge von Thomas Birkmeir antreten, der mit Ende der kommenden Saison (2025/26) als künstlerischer Direktor auf eigenen Wunsch nach rund einem Vierteljahrhundert aufhört.
Aslı Kışlal (55) ist Schauspielerin, unter anderem im Theater der Jugend, vor allem aber Regisseurin (jüngst im Schauspielhaus von Elias Hirschls „Content“ und Bühnenfassung samt Inszenierung von „Minihorror“ der Erfolgsautorin Barbi Marković), Leiterin von (Jugend-)Theater(-gruppen) und Ermöglicherin und Fördererin für junge Schauspieltalente mit vielsprachigen, multikulturellen Hintergründen.
Letzteres von Anfang der 90er Jahre an als
Kinderstücke am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten („Heidi“, „Das kleine Gespenst“), Inszenierungen am Staatstheater Mainz und dem Stadttheater Ingolstadt (Deutschland), für ihre Regie von „Stella – Das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm“ bekam sie den Deutschen Musical Theater Peis – übrigens als erste Frau überhaupt. Die schon erwähnte Dramatisierung von „Minihoroor“ (Barbi Marković) war als beste Off-Theater-produktion im Vorjahr für den Nestroy nominiert. Den Theaterpreis für junges Publikum, Stella“ bekam sie 2021 für „Medeas Irrgarten“ – Spezialpreis für innovative Formate, die über Bühnen hinausgehen“ und war zwei Jahre später für die Jugendproduktion „FutureLeaks – Escape Patriarchy“ nominiert..

Kışlal hat in Istanbul (geboren in der türkischen Hauptstadt Ankara) zwei Semester internationale Beziehungen studiert, übersiedelte mit 19 Jahren nach Wien, wo sie Soziologie und später Schauspiel studierte und seither lebt und hier so wie in anderen Städten (siehe oben) wirkt.
Im Folgenden einige Links von Beiträgen auf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… sowie den einzigen beiden noch verfügbaren im Kinder-KURIER über Stücke in den Aslı Kışlal in verschiedensten Funktionen tätig war – Regie, Dramaturgie, dramaturgische Beratung (outside eye)
es-war-eine-gemeinschaftsarbeit <- noch im Kinder-KURIER
von-der-kinoleinwand-in-live-schauspiel-switchen <-ebenfalls noch im KiKu

Es war wieder heiß geworden, der Festsaal der Handelsschule und -akademie gegenüber dem Künstlerhauskino dampfte richtiggehend. Feierlich ging’s zu. Alle Schülerinnen und Schüler der drei dritten Klasse Handelsschule erhielten ihre Abschlusszeugnisse – von den jeweiligen Klassenlehrerinnen und der Direktorin.
Ein Schüler bekam mehr: Julian Janda wurde die vor rund einem Monat verliehene Merkur-Statue überreicht.
Beste Projekte in zwei Kategorien, beste Schüler:innen der sechs Standorte der Vienna Business School, der privaten Handelsschulen und HAK des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, beste Lehrperson und jeweils auch jemand, der eine der Schulen vor Jahren absolviert und im Berufsleben hervorragenden Erfolg hat(te) – dafür verlieht die Jury jeweils einen Merkur bei einer festlichen Gala – Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat ausführlich berichtet; die Links unten am Ende dieses Beitrages.
Seit einigen Jahren gibt es noch eine weitere Auszeichnung, den Publikums-Merkur. Dafür sind alle Nominierten im „Rennen“, die Gala-Besucher:innen können mit ihren Handys voten. Die Wahl war eben auf den genannten Schüler gefallen. Als die Statue überreicht werden sollte, wurde Julian Jandas Name laut gerufen. Keine Reaktion, dann tauchte wer aus der Regie des Abends auf, flüsterte der Moderatorin: Dieser Schüler ist schon nach Hause gegangen. Eine Video-Botschaft an ihn wurde aufgenommen – siehe den entsprechenden Bericht.
Am Dienstag (17. Juni 2025) am späten Nachmittag / frühen Abend anlässlich der erwähnten Abschlusszeugnis-Verteilung dann die nachträgliche Übergabe. Von KiJuKU befragt, meinte Janda: „Ich hab nicht gedacht, dass ich die meisten Stimmen bekommen werde und so bin ich eben schon nach Hause gegangen.“
Auf die Nachfrage meinte er: „Ich bin dann schon noch am Abend informiert worden und sehen durfte ich den Merkur auch schon einmal, aber in Händen halten wird ich ihn erst heute.“
Obwohl der nun die Schule – noch dazu mit gutem Erfolg – absolviert hat, bleibt er ihr treu. „Ich mach ab Herbst den Aufbaulehrgang (AUL), der dauert drei Jahre, dann hab ich die HAK-Matura. Und dann kann ich meinen Traumberuf ergreifen, Straßenbahnfahrer. Das darf man erst mit 21 machen und nach der Matura bin ich dann 21!“
Diesen Beruf, so schildert er dem Journalisten, „wollte ich schon von ganz klein auf machen. Mich faszinieren Straßenbahnen, ich hab schon früh alle Stationen aller Linien gewusst.“ Auch die der U-Bahn-Stationen, erklärt Julian Janda auf KiJuKU-Nachfrage, „aber in der U-Bahn ist es mir zu dunkel, Straßenbahnfahren mag ich viel mehr“.
In der Schule haben ihn bis her die (betriebs-)wirtschaftlichen am meisten interessiert, „das war auch schon im Poly so“. Darum habe er sich ja für diese Schule entschieden – die übrigens auch schon die stolze Mutter besucht hat, wie diese am Rande gegenüber dem Reporter erwähnt.

Ein langer Laufsteg – an beiden Seiten die Publikumsreihen; der Catwalk – in dem Fall phasenweise Dog-Walk 😉 – mündet in eine Art offener Halfpipe samt davor postierter Sieges-Treppe für 1., 2., 3. Wie sie von vielen Bewerben her bekannt ist.
Hier spielte sich bei Schäxpir Ausgabe Nummer 13 – Theaterfestival für (nicht nur) junges Publikum – von Anfang bis Ende „Deadly Poodles“ der Erfolgsautorin Barbi Marković ab. Eine schräg-witzig-bissige Satire auf (Selbst-)Optimierungswahn mit Anspielungen auf Castings-Shows à la Heidi Klum und Assoziationen an Goethes Faust – vom Seelenverkauf bis zu „des Pudels Kern“.
Das Landestheater – wegen Umbaus im Ausweichquartier Ursulinenhof-Saal – eröffnete als Mix aus Ensemblemitgliedern und Schauspielstudierenden der Anton Bruckner Uni mit diesem vordergründig heiteren und tiefgründig satirischen 1¼-stündigen Stück das Schäxpir-Festival und spielte auch noch am letzten Tag.

Angesagt, erzählt und mitunter bewertet von Angela Waidmann, schlüpfen Markus Ransmayr in die Rolle eines Arztes, der so auf seine Fitness schaut, um ja nicht Patient zu werden, Lara-Luna Wojtkowika in die von Rebecca, einer übereifrigen, streb- und arbeitssamen, ja Workoholicerin, Vivian Micksch in die der alles mit Make-Up übertünchenden Lady Barbie mit ihren unbegrenzten Ansprüchen und schließlich Daniel Klausner als Contra-punkt, der als Dennis alles unheieieieimlich laaaaaangweilig findet. „Boring“ ist wohl das häufigste Wort in dieser Aufführung. Klausners Auftritte – als Dennis – gruppieren sich um den englischen Begriff für fad.

Nach dieser Ouvertüre der menschlichen Charaktere geht’s um „des Pudels Kern“. Die Stage verwandelte sich am Gipfel der Skater-Ramp in eine Tierhandlung mit bunten Pudel. Die vier Schauspieler:innen verwandeln sich abwechselnd in diese, immer ein Pudel für einen der Menschen. Alles Luxus-Tierchen mit dem Versprechen den Protagonist:innen zu mehr – vor allem – Ansehen zu verhelfen; mit elendslangen Verträgen voller „Kleingedrucktem“. Vor dem die Erzählerin warnt – und es dann doch zulässt.

Und so tauschen die Menschen im Glauben, mit dem jeweiligen Luxushündchen stellvertretend Zaubermittel für die von ihnen gewünschten Eigenschaften zu kriegen, ihre Seele mit der Tierhandlung, machen sich zu Sklav:innen der durch den jeweiligen Pudel verkörperten Optimierungs-Strategie – (seelen-)tödliche schicke, zurechtfrisierte und -geschnittene Luxushündchen, die Macht über ihre Besitzer:innen gewinnen.
Diese Strategie aber verfängt bei Dennis gar nicht. Er der alles langweilig findet, will sozusagen nix, vor allem nichts kaufen, da beißen sich die Hündchen und Marketingstrategie sozusagen die Zähne aus 😉
Vor allem die vier Protagonist:innen – ob als Menschen oder als Hunde zeigen eine große Bandbreite an Können – Schauspiel, Tanz, ansatzweise auch akrobatisch auf der Skater-Ramp oder Rad schlagend auf dem Laufsteg, Gesang, manches auch chorisch aufgeführt – und „über“dressiert von der Erzählerin / Moderatorin / Bewerterin auf dem Thron, pardon dem Schiedsrichter:innen-Stuhl wie beim Tennis.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Friedliche Aliens tummeln sich bei der Blumen-Ernte auf der Erde. Die Außerirdischen schätzen die Wiesen des blauen Planeten. „Gloomies“ (Filippo Landini; Verlag Ravensburger) heißt dieses Brettspiel, das von der Österreichischen Spieleakademie zum Spiel der Spiel auserwählt wurde. Am Wochenende stellten Vertreter:innen dieses „spielwütigen“ Vereins die Top-Spiele in sieben Kategorien (Kinder, Familie, Freunde, Experten, Karten, Trend sowie Hauptpreis) vor.
„Gloomies“ fand bei der Kommission den größten Anklang, „es macht Spaß und ist für nahezu alle Zielgruppen interessant“, so das Gesamturteil. In diesem Spiel „wollen Blumen-Liebhaber Mondlilien, Sonnendisteln oder Galaxie-Mohn ernten – doch zuerst müssen diese noch gepflanzt werden. In zwei Phasen gilt es, die wunderschönen bunten Holzblüten zu platzieren und somit zu pflanzen, ehe in der zweiten Spielphase Ernten am Programm steht. Dabei werden die bunten Blumen höchst anschaulich wieder vom Plan genommen – um andere Garten-Gloomies zu schmücken.“
Beim Spiele-Hit Kinder „Käpt’n Kuck“ (Gerard Ribas; Verlag: Pegasus) stechen die Spieler:innen gemeinsam in See, um die Schatzinsel zu finden, deren Abbildung nur wenige Sekunden betrachtet werden darf. Wer hat sich Details wie Palmenhain, Äffchen oder Haifischflosse gut gemerkt? Mittels Karton-Fernrohr, in das Bild-Ausschnitte der Insel-Abbildung aus Karton eingelegt werden, gilt es nun festzustellen, ob die gesuchte oder eine andere Insel vor einem / einer liegt. Abwechselnd nehmen die Spielenden die Rolle des Ausgucks mit dem Fernrohr an, der das Gesehene möglichst gut zu beschreiben versucht, um so mit Hilfe der ganzen Besatzung richtige von Fake-Details zu unterscheiden. Werden jedoch Piraten im Fernrohr erblickt, heißt es „an die (originelle) Würfel-Kanone“, und auf ein gutes Ergebnis gehofft, um nicht erwischt zu werden.
Im Spiele-Hit Familien Ziggurat (Matt Leacock und Rob Daviau; Verlag: Schmidt Spiele) dreht sich alles um das Entdecken und Erforschen einer dreidimensionalen Karton-Stufenpyramide in gleich mehreren Etappen. Vor Feuergeistern – so erzählt das sechs Kapitel umfassende Geschichtenbuch – sollen sich die Spieler:innen in Acht nehmen. Damit startet eine packende Hintergrundgeschichte, die nicht nur für immer neue Details und Wendungen, sondern auch Regelanpassungen, neue Herausforderungen und sogar Sticker für die „Charakterbögen“ der Mitspieler:innen sorgt. Immer gilt übrigens der spannende Grundsatz: Keiner wird zurückgelassen, gewonnen wird nur gemeinsam, wenn es alle schaffen!
In der Kategorie Spiele für Freund:innen entschied sich die Spiele-Akadmie für „Cut it!“ (Elisabeth und Günter Burkhardt; Verlag: Game Factory) Jede Menge mit bunten Quadraten bedruckte Zettel sowie vier Scheren und Ergebnisbögen finden sich in der Schachtel. Und es geht, entsprechend dem Spiele-Titel, tatsächlich um Ausschneiden. Wie groß die späteren Puzzleteile werden, hängt ganz von den Spieler:innen ab, solange nicht mehr als zwei Schnitte erfolgen. Indirekt jedoch auch von den bunten Würfeln, deren Augenzahl die Wertigkeit der gleichfarbigen Quadrate am abgeschnittenen Zettel bestimmt. Je mehr, desto besser sollte man meinen, doch so simpel ist der Schneidespaß dann doch nicht: An Bedingungen geknüpfte Bonuspunkte und die Herausforderung, am Ende möglichst alle Teile wieder zusammenpuzzeln zu können, bieten viel Raum für Taktik und Strategie.
Das für Fachleute ausgewählte beste Spiel des Jahres bezieht seinen Titel aus dem seit Jahrzehnten bekannte program: SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence / Suche nach außerirdischer Intelligenz). In diesem Spiel (Tomáš Holek; Verlag Heidelbaer / Czech Games Edition) mit drehbarem Karton-Sonnensystem gilt es Daten von ein bis zwei außerirdische Zivilisationen auf dem das Sonnensystem abbildenden Spielplan zu finden. Das verändert nicht nur die Regeln, sondern die Art, wie die Spieler:innen zu Punkten kommen. Der bewegliche Spielbrett-Mechanismus erlaubt viele Variation und damit eignet es sich gut, mehrmals zu spielen ohne langweilig zu werden.
Das Kartenspiel „Castle Combo“ (Grégory Grard, Mathieu Roussel, Stéphane Escapa; Verlag: Kosmos) lässt die Mitspieler:innen abwechselnd Gefolgsleute anwerben. Schlossbewohner wie Nonnen, Mäzene oder seine Majestät der König oder Dorfbewohner wie Knappe, Bäckerin und Kanonier glänzen mit Eigenschaften, die möglichst gut harmonieren sollten, um am Ende der neun Runden die beste Combo zu bilden.
Der Spiele-Hit Trend zeichnet Spiele aus, die einem im Trend liegenden Genre angehören bzw. die Themen behandeln, die aktuell bewegen. Die Haupttrends 2025 waren dabei aus Sicht der Jury „Roll & Write-artige Ankreuzspiele“, die auch den Spiele-Hit Trend stellen, kompakt-kleinformatigen „Pocket-Games“ sowie Spiele zum Thema „Natur und Umwelt“.
In „Fliptown“ (Steven Aramini, Naomi Ferral; Verlag: Strohmann Games), sind die Mitspieler:innen drauf und dran, ruhmreiche Westernhelden mit Legenden-Status zu werden und versuchen in der Wildnis, im Bergwerk oder auch in der Stadt beim Casino oder am Friedhof Ruhm und / oder Reichtum zu erlangen. Überfälle auf Viehherden, Postkutschen oder gar Eisenbahnen helfen ebenso am Weg zum Ruhm – ein wenig Glück in Form von Poker-Karten vorausgesetzt, die hier die sonst üblichen Würfel bei derartigen Spielen höchst stimmig ersetzen. Und am Ende jedes Durchgangs kommt es auch zum Showdown: Einerseits wenn’s um eine gute Hand beim Pokern geht, wo für etwas Gold auch Kartenwerte manipuliert werden dürfen, andererseits beim Sheriff, der mehr oder weniger gesuchte Outlaws vielleicht einkassiert – und die eine oder den anderen Spieler/in gegen eine Handvoll Dollar wieder frei lässt. Ein höchst atmosphärisches, im Western-Milieu angesiedelter Flip & Write Spiel.
Ein Viertel Jahrhundert kürt die Österreichische Spieleakademie das Spiel-der-Spiele und präsentiert den Österreichischen Spielepreis mit mehreren Kategorien. Anlässlich dieses ¼-Jahrhunderts meinen die (Brett- und Karten-)Spiele-Fachleute: „Autoren, Redakteure und Verlagsleiter schaffen es immer wieder, mit neuen Ideen zu verblüffen. Zudem hat internationale Vernetzung und technischer Fortschritt in Bezug auf Produktion, Grafik und Entwicklung die Zahl der jährlich veröffentlichten Spiele von wenigen Dutzend Anfang der 1980er und einigen hundert um die Jahrtausendwende auf mittlerweile über zweitausend ansteigen lassen. Dabei wurden auch Spiel-Ideen, die vor 40-50 Jahren noch als unrealisierbar oder zu kompliziert für die Mehrheit eingestuft wurden, umgesetzt und auf den immer größer werdenden, zunehmend auf Nachhaltigkeit achtenden Markt gebracht. Keine schlechte Entwicklung und wir Konsumenten können aus dem Vollen schöpfen und die Auswahl genießen!
Summa summarum gilt: Das Spiele-Angebot ’25 überzeugt nicht nur in punkto Themen-Vielfalt, Zugänglichkeit und Design, sondern begeistert Jung und Alt mit anhaltendem, abwechslungsreichem Spielvergnügen auf qualitativ hohem Niveau, das nicht nur ohne Zusatzkosten auskommt, sondern insgesamt ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet!“
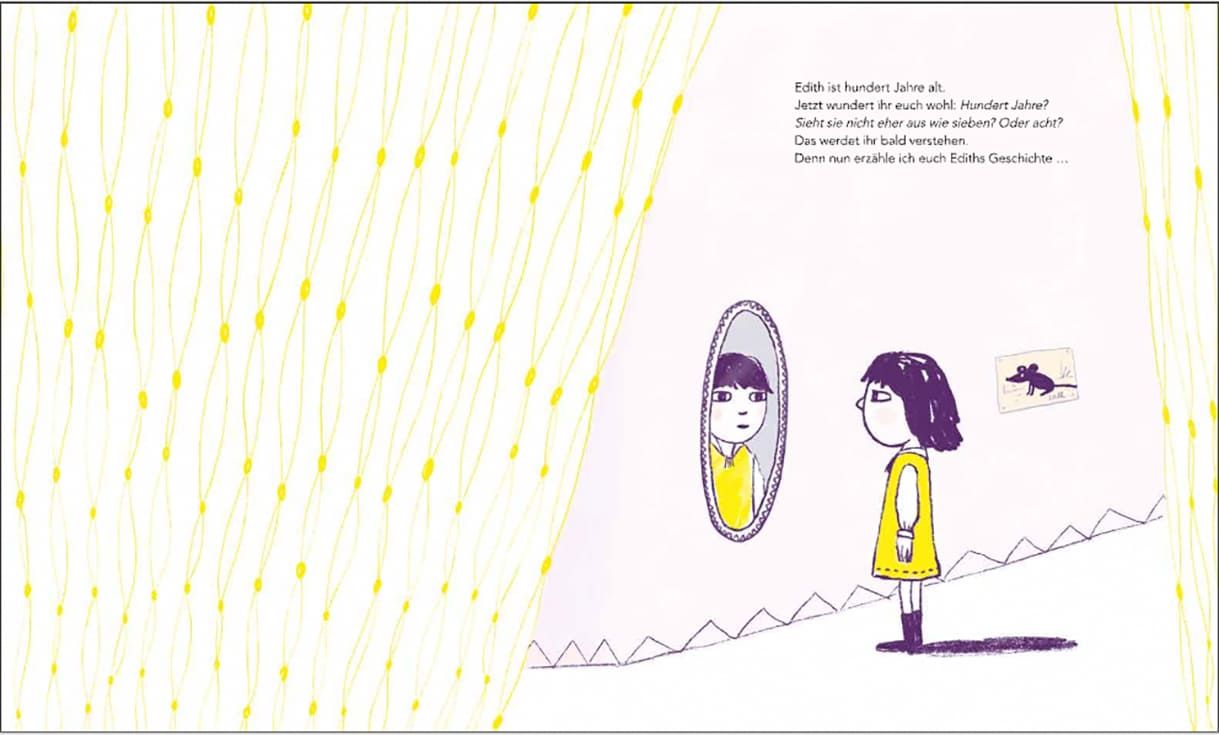
Schon der Untertitel gibt einen Gutteil der Geschichte – geschrieben und gezeichnet von Catharina Valckx (Übersetzung aus dem Französischen: Julia Süßbrich) vor: „Edith – das Mädchen von hundert Jahren).
Pippi Langstrumpf und davor schon Peter Pan sind vielleicht die (welt-)berühmten Vorbilder: Ewig Kind bleiben, nie erwachsen werden (wollen). Für Edith, die Titelfigur dieses 80 Seiten starken, leicht lesbaren mit vielen Bildern im Stil angelehnt an Kinderzeichnungen illustrierten Buches, haben die Eltern zwei Feen kommen lassen, um die Tochter mit ungewöhnlichen Gaben zu versorgen.
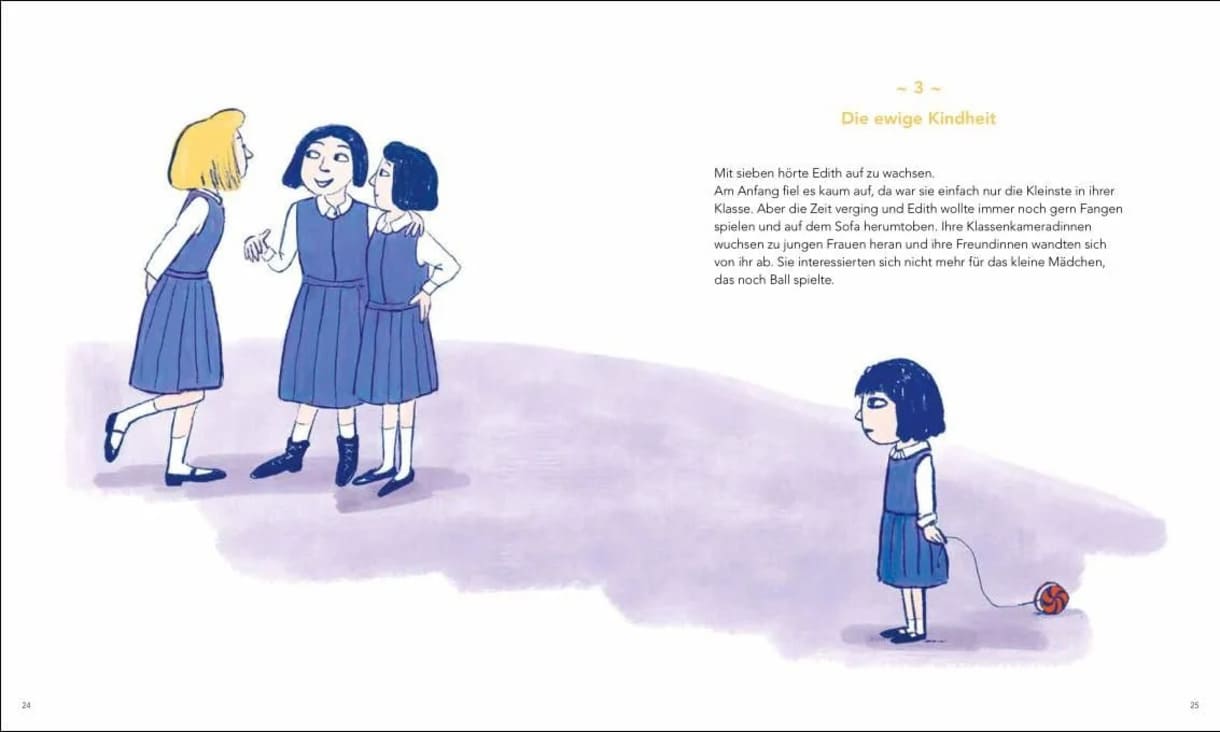
Die erste verlieh ihr die Fähigkeit, Dinge zum Leben zu erwecken, die zweite eben, ewig Kind bleiben zu dürfen. Oder vielmehr müssen. Denn bald findet Edith als sie das Alter von sieben Jahren überschritten hat, es zunehmend als Last, genau auf diesem Stand „eingefroren“ zu werden. Immer bleibt sie wie sieben (7)! Schulkameradinnen können mit ihr und sie nix mit ihnen anfangen.
Sie ist 100 – und noch immer ein Kind, ihre Eltern sind schon tot… Edith hat nur ihren Hund Fussel als einzigen Spielgefährten und zaubert sich mit ihrer zweiten magischen Fähigkeit eine Zitrone zu einer weiteren Freundin, die sie Ikki nennt. Die beiden wollen ihrer menschlichen Freundin Gutes tun und machen sich auf die Suche nach einer Fee, die sich vom Fluch der guten Gaben befreien könnte…
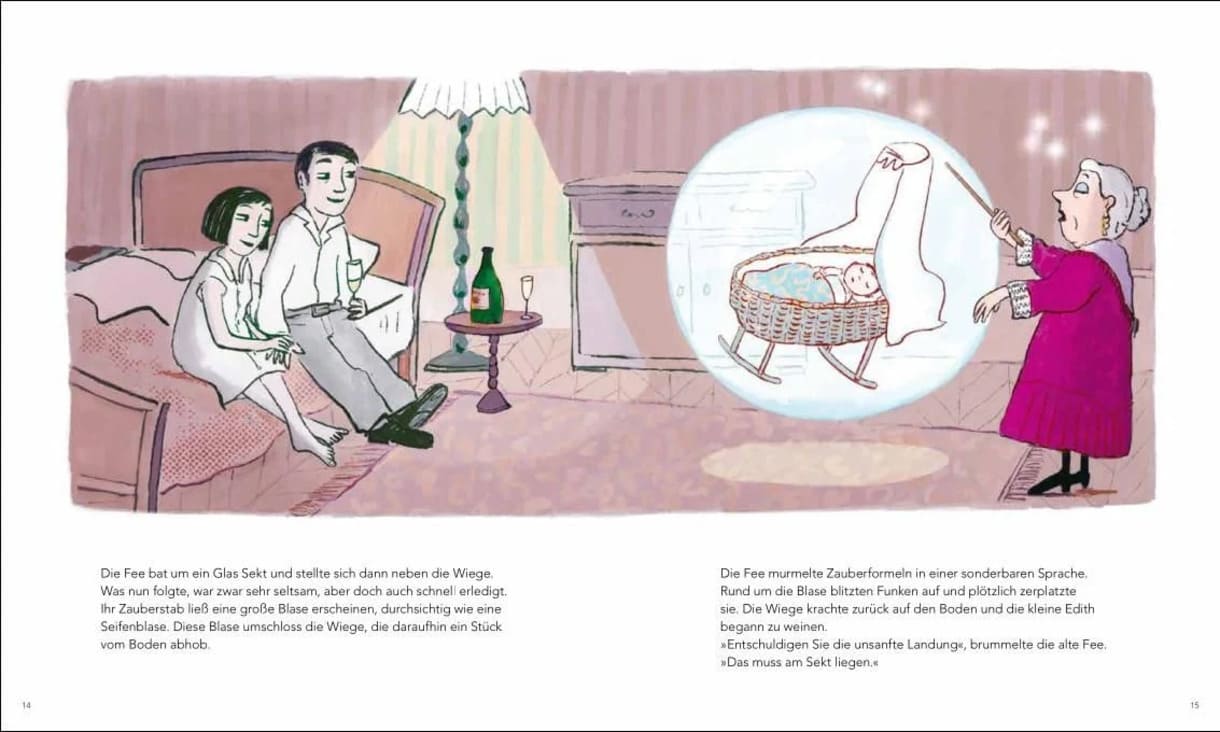
Was und wie sich abspielt, um ob es ein Happy End gibt – das immerhin Altern und Sterben umfassen würde? Das sei hier sicher nicht verraten.
Ein Buch, das ganz schön viel anregen kann in Sachen Wünsche und das noch dazu im guten Glauben für andere!
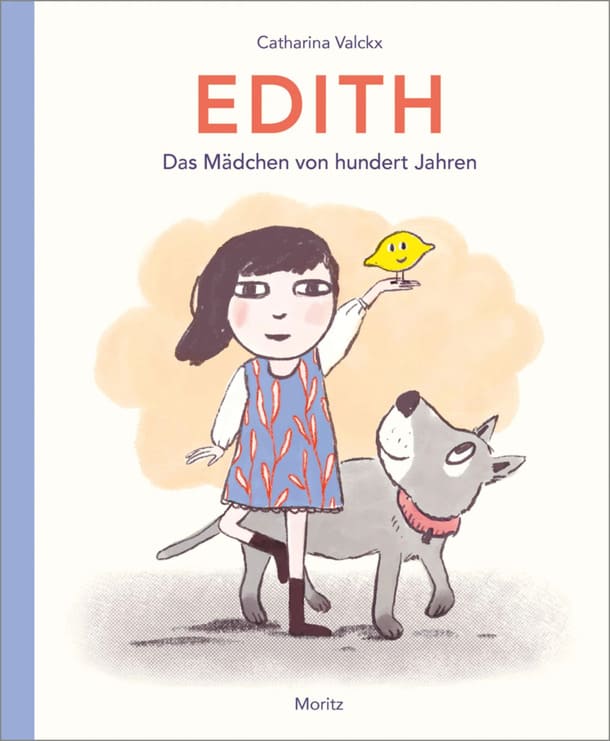

„Ein Quadrat als Revier. Ein Palast hinter einem Bauzaun. Eine Schwester, die anders ist als andere Schwestern. Der Hauptfigur Liv, durch deren Augen wir auf ihren Alltag blicken, macht das nichts aus. Voller Liebe und Begeisterung erzählt sie von ihrer kleinen Schwester Lea, die eine Behinderung hat. Doch Lea ist ihrer großen Schwester auch manchmal peinlich und manchmal ist sie sogar wütend auf sie. Dass der Text Livs ambivalenten Gefühlen in der Beziehung zu Lea Raum gibt, ist eine seiner großen Stärken (…)“
Unter anderem damit begründet die Jury, dass Fabienne Dür für „Löwenschwester“ einen der beiden Retzhofer Dramapreise für junges Publikum zugesprochen wurde. „Ein zarter, poetischer und zugleich kraftvoller Text, der vom Anderssein erzählt, von Geschwisterliebe, Freundschaft und einer leisen Magie der Kindheit“, fanden Henrieke Beuthner (Lektorin, Rowohlt Verlag), Götz Leineweber (Dramaturg, Regisseur, Dschungel Wien), Armela Madreiter (Autorin), Ferdinand Schmalz (Autor) und Petra Thöring (Dramaturgin, Hessisches Landestheater Marburg).
In der Begründung heißt es ferner: „Der Text, den wir heute unter anderem auszeichnen möchten, hat uns in der leichtfüßigen Ernsthaftigkeit, in der er auf die Lebenswelt eines jungen Menschen blickt, sehr bewegt. Es ist ein Text, der Kindern und Raum gibt, ohne zu idealisieren, zu belehren oder zu belächeln. (…) Die Stärke dieses Textes liegt nicht nur in seinem bemerkenswerten Umgang mit Sprache und Bildern – schlicht, klar, poetisch, ruhig und voller Details und Eigenheiten – sondern auch in seinem selbstverständlichen Umgang mit verschiedenen Lebensrealitäten und den Themen Inklusion und Diversität.“
Diese Juror:innen vergaben einen zweiten Preis für junges Publikum an Stefan Wipplinger für „Kri“ und begründeten dies unter anderem so: „Stefan Wipplinger beschreibt mit „Kri“ die fragilen, manchmal ausgrenzenden und gefährlichen Dynamiken von Gemeinschaften, er lotet die Abgründe des gesellschaftlichen Zusammenlebens aus, aber auch die Möglichkeiten für Veränderung, er lässt aus dem (anonymen) Raunen vom Anfang eine Dorfgemeinschaft entstehen, schält mehr und mehr einzelne Figuren heraus – gleichzeitig stellt er der Wucht der Vielstimmigkeit eine einzelne Person gegenüber und eröffnet mit einer Hauptfigur wie Kri den Raum für einen mutigen, starken, neugierigen jungen Menschen, der selbstbestimmt, gänzlich unangepasst und unabhängig von den Regeln der Erwachsenen lebt.
Stefan Wipplinger tut all das mit einer zarten, rhythmischen, genauen und tastenden Sprache, die nach Worten und Antworten sucht, die um Gewissheiten ringt, die von den Vorurteilen, den Befindlichkeiten und dem Wunsch nach einfachen Antworten innerhalb einer Dorfgemeinschaft erzählt, von Aufbruch und Anderssein – atmosphärisch und dicht, mit subtilem Witz und, mit Kri im Zentrum, mit einem sympathischen Hauch von Anarchie.
Lustvoll entwirft er eine Hauptfigur, die in leiser Beiläufigkeit und mit bestechender Klarheit die vermeintliche Ordnung, die Regeln und (ungeschriebenen) Gesetze des Dorfes ins Wanken bringt, die bewusst (oder unbewusst?) gehöriges Chaos mit sich bringt – manchmal einfach nur, indem sie Fragen stellt. (…)“
Werden die Dramapreise für junges Publikum nur zweijährlich, so jene für Erwachsene jedes Jahr und dies schon länger vergeben, heuer zum zwölften Mal. Preistäger*in 2025: lynn takeo musiol für „Lecken3000“.
Alexandra Althoff (Dramaturgin, Max-Reinhardt-Seminar), Thomas Jonigk (Dramaturg, Burgtheater), Martin Thomas Pesl (Journalist, Nestroy Preis-Jury), Eva-Maria Voigtländer (Dramaturgin) und Ivna Žic (Autorin, Regisseurin) als Juror:innen begründeten ihre Entscheidung wir folgt: „LECKEN 3000 – der Titel ist plakativ, eine pornografisch angehauchte Headline, die sich sofort einprägt, den Lesenden aber ein Versprechen mit auf den Weg gibt, das sich – zum Glück – nicht einlöst. Musiols Theatertext erweist sich als ein ebenso witziges wie brisantes Drama zum Thema Machtmissbrauch bzw. sexueller Missbrauch und den emotionalen, juristischen, politischen und ethischen Fragestellungen, die damit verbunden sind. (…) Musiols Personal kommt aus der queeren Community, worum es geht, ist Missbrauch unter Frauen, zudem noch unter Frauen, zwischen denen ein starkes Machtgefälle und ein deutlicher Altersunterschied besteht. Wie damit umgehen, dass die Community, die man als besonders unterstützens- und beschützenswert wahrnimmt, nicht bedingungslos vorbildlich ist, sondern ähnliche Untiefen aufweist wie die heteronormative Mehrheit, wie die männlich dominierte Gesellschaftswelt? (…) Dass lynn t musiol sich des konfliktbeladenen Themas dennoch annimmt, spricht für Musiols Mut. Und dass das Vorhaben großartig gelingt, das ist Musiols gedanklicher und handwerklicher Brillanz zu verdanken: Hier ist ein Theatertext in einer unverkennbaren, sich am Zeitgeist orientierenden Kunstsprache entstanden, der uns ein Figurenarsenal von größter Unverkennbarkeit, Direktheit und Unverfrorenheit zumutet. Und das macht unglaublichen Spaß. Das ist sinnlich, witzig, jenseits von gedanklicher Zensur oder mittelmäßigem Kompromiss: LECKEN 3000 ist ein aufregender, politisch relevanter Theatertext, dem möglichst viele Aufführungen und Inszenierungen beschert sein mögen.“
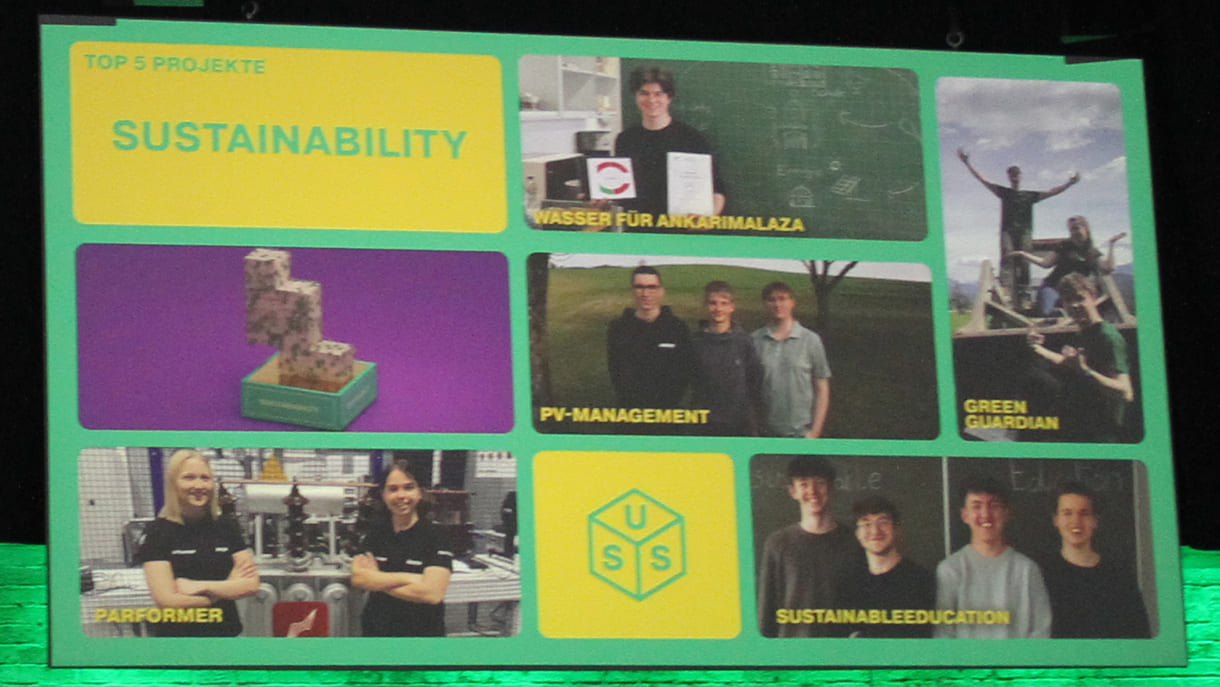
Nachhaltigkeit ist ein Begriff, ja ein Prinzip, von dem seit einigen Jahren allüberall die Rede ist. Bei Jugend Innovativ gibt es schon seit vielen Jahren einerseits eine Kategorie, die sich diesem Thema widmet; ursprünglich als „Kilmaschutzinitiative“ in Zusammenarbeit mit einer großen Bankenkette, dann auf Sustainability – entsprechend der anderen englischsprachigen Bezeichnungen – umbenannt.
Seit einigen Jahren finden sich Nachhaltigkeits-Überlegungen übrigens auch bei vielen Projekten anderer Kategorien – insbesondere bei Engineering sowie unternehmerischen (Entrepreneurship) – siehe die bisher erschienen Berichte über die anderen sechs Kategorien 😉
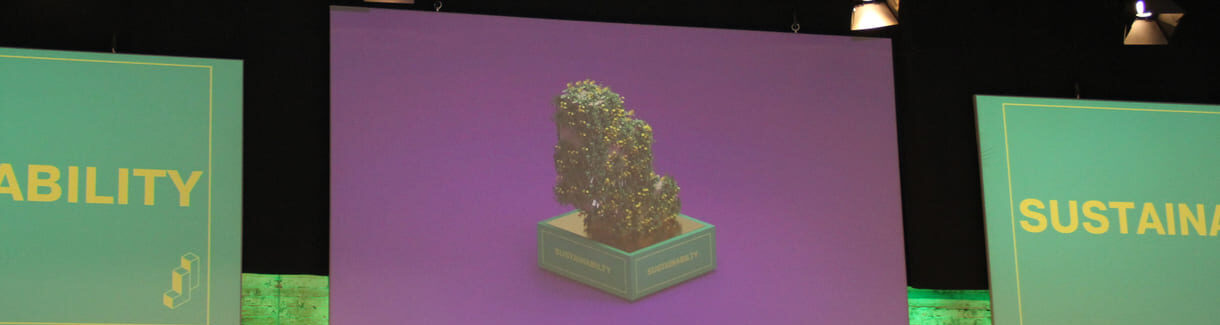
Doch hier geht es um die fünf Final-Teams, die ihre Arbeiten bewusst für Sustainability eingereicht haben – ach ja, obwohl die Preisträgerinnen längst feststehen – siehe Bericht darüber, Link am Ende des Beitrages – werden die Projekte auch hier in der Reihenfolge der Liste der Organisatorinnen dargestellt.
Besonders im Sommer und um die Mittagszeit fällt natürlich viel Strom aus der kraft der Sonne an. Speicher von Photovoltaikanlagen sind daher fast „übervoll“, können Energie nicht mehr speichern. Jakob Stadler, Manuel Klär und Felix Stadler aus der HTBLA Neufelden (Oberösterreich) ersannen eine Möglichkeit, dass der gespeicherte Strom nicht erst am Ende, sondern gleich von Anfang an, bevor die Speicher noch voll sind, ins Netz eingespeist werden könnte. Die programmierte Simulation der Steuerung verknüpften sie in ihrem Projekt „PV-Management mit Prognose & Getreidetrocknung“ mit der einer Getreidetrocknungsanlage, die von dieser Sonnenenergie versorgt werden könnte.
… lautet der Titel der Arbeit von Alexander Flassig und Konstantin Wolf aus der HTBLVA Pinkafeld (Burgenland), der das Projekt aber nicht wirklich annähernd beschreibt. Ankarimalaza ist ein Ort an der Ostküste der afrikanischen Insel Madagaskar. Für den Entwicklungshilfeverein „Vanilla Aid“ sollten die beiden eine Wasserversorgungsanlage konzipieren – samt der Analyse von Wasser- und Bodenproben und möglicher Varianten einer solchen Anlage.
Die beiden Schüler kamen jedoch – durch einen Lokalaugenschein eines der Lehrer drauf, das – allein – würde nicht reichen. Viele Bewohner:innen holen ihr Wasser aus dem sumpfigen Fluss in der Nähe, gebaute Brunnen mit sauberem Wasser aus der Tiefe werden daher gar nicht instandgehalten. „Das wirklich Problem“, so Konstantin Wolf zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, „ist mangelnde Bildung, weil die meisten Kinder nicht in die Schule gehen können, sondern arbeiten müssen, um die Familien mit zu ernähren. Daher haben wir uns überlegt, wie beiden gleichzeitig geholfen werden kann – den Kindern und den Familien. Wir wollen, dass jedes Kind, das in die Schule geht, ein von der Entwicklungshilfeorganisation finanziertes Nutztier bekommt; etwa ein Huhn, dann hätte die Familie Eier.
Ähnlich wie „Agrarbot“ – siehe Kategorie Engineering II – soll die Entwicklung „Green Guardian“ von Schüler:innen der HTL Mössingerstraße (Klagenfurt, Kärnten) Unkraut von Nutzpflanzen automatisch unterscheiden, und erstere auf Feldern vernichten.
„Wir arbeiten mit Strom“, erklärt Anna-Lena Lubach kurz auf den Punkt gebracht den Unterschied der Vorgangsweise des Roboters, den sie gemeinsam mit Niklas Ebner und Luca Piskernig ausgedacht, gebaut und programmiert hat. Das Trio „fütterte“ die Maschine mit unzähligen Fotos von Nutzpflanzen sowie Unkraut, mit Hilfe von KI lernt der geländegängige Roboter die voneinander zu unterscheiden. Bei letzteren aktiviert er Hochspannungs-Laser – was den Einsatz von chemischen Unkrautvertilgungsmitteln unnötig macht.
Achja, im Sinne der Nachhaltigkeit fährt „Green Guardian“ mit Strom aus einer kleinen PV-Anlage auf dem Roboter-„Rücken“.
Bei so manchen Projekten von Schüler:innen im Bundesfinale von Jugend Innovativ taucht spontan die Frage auf: Wieso ist da bisher niemand draufgekommen? Besonders massiv erfolgt dies beim Projekt der beiden Linzer HTL-Schülerinnen Anna Gasselseder und Anja Hönegger auf.
Ein Engpass bei der Versorgung mit Energie bzw. im Fall von Black-Outs sind Transformatoren, die den über Hochspannungsleitungen transportieren Strom auf jene niedrige Spannung umwandeln, der in Haushalts- und anderen Geräten verträglich ist. Wartezeiten auf neue Transformatoren sind bis zu fünf Jahre, sie sind obendrein sehr teuer.
Die beiden genannten Schülerinnen hatten folgenden Gedanken, den sie in ihrem Diplomprojekt ausführlich behandelten und zu Ende führten – einschließlich der Programmierung der dafür notwenigen Software: „Wir schalten bis zu vier Transformatoren parallel.“
Mit Hilfe von „ParFormer – A Calculation Tool for the Energy Transition“ können Spannungen und Lastflüsse berechnet, Netzschwankungen simuliert und Überlastungen vermieden werden. Netz Oberösterreich hat an der Arbeit der beiden großes Interesse gezeigt, berichten die beiden jungen Frauen dem Reporter.
Was ist Nachhaltigkeit, was sind vor allem die sogenannten 17 SDG-Ziele, wofür steht das oft verwendete Kürzel überhaupt?
Sustainable Development Goals – Nachhaltigkeitsziele auf die sich die Staaten der Welt in der UNO vor rund zehn Jahren (2016) geeinigt haben.
Jetzt können die auswendig gelernt und runter„gebetet“ werden, aber bringt das was?
Eher weniger, dachten sich Leo Mühlböck, Benjamin Edlinger, Leander List und Kacper Bohaczyk vom Wiener TGM (diese HTL heißt noch immer so, obwohl das Kürzel für Technologisches GewerbeMuseum steht). Mit „sustAInableEducation“ – wobei das AI natürlich für die englische Abkürzung von Künstlicher Intelligenz steht – ist eine damit programmierte Lernplattform in Sachen Nachhaltigkeit.
Der Quiz soll tatsächlich Wissen abfragen und – mit richtigen Antworten – erzeugen. Dabei wird nicht auf Ankreuzerln und Multiple Choice gesetzt, sondern „unser Quiz basiert auf Storys, in die Nachhaltigkeits-Themen eingebaut sind und wo du dann immer wieder an Entscheidungspunkte kommst, wo es auf dein entsprechendes Wissen ankommt.“
Die vier Jugendlichen haben ihre fragende lernplattform auch schon bei Schüler:innen einer ersten und einer fünften Klasse des Gymnasiums Ödenburger-Straße im benachbarten Bezirk Floridsdorf ausgetestet, um daraus selbst für Adaptierungen zu lernen.
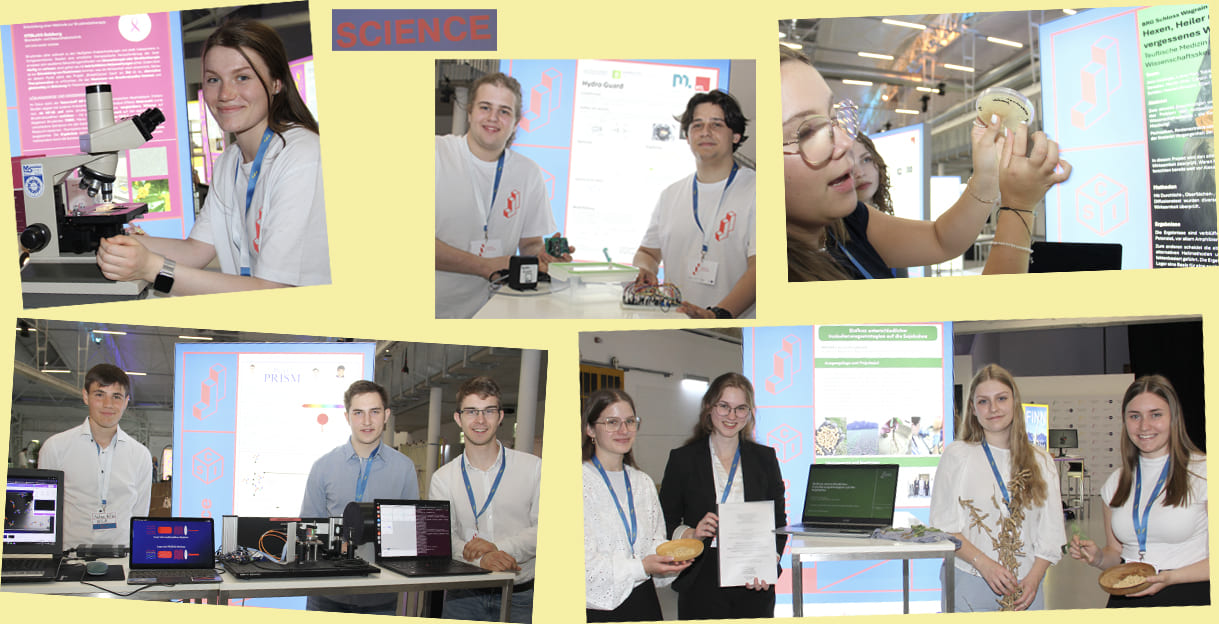
Mit dem Beginn des Titels ihres Projekts hatten die Jugendlichen aus dem BRG Schloss Wagrain im oberösterreichischen Vöcklabruck schon ihren Spitznamen für viele ihrer Final-Kolleg:innen schon weg: „Seid ihr die Hexen?“, tönte es mehrfach in der Expedithalle der ehemaligen Brotfabrik in Wien-Favoriten.
Mit „Hexen, Heiler und Schamanen – vergessenes Wissen modern interpretiert“ haben sich Carolin Bayer, Isabell Bayer, Tamara Demeter, Jana Haslinger, Lukas Mayr, Kilian Pouget, Marlene Sageder, Julia Schiller, Hannah Strasser, Martin Uhlir, Tobias Wagner und Eva Waldl eben genau damit wissenschaftlich auseinandergesetzt. Hilft das Pech aus dem Baumharz, zu einer Salbe verarbeitet, hat das abgestreifte Sekret von der Haut von Erdkröten wirklich antibiotische Wirkung? Was können Johanniskraut oder Ringelblumen und vieles mehr?
Die Jugendlichen untersuchten die Substanzen mit wissenschaftlicher Akribie und mit Hilfe von Geräten – Agar-Diffusionstest, LD 50, Dünnschicht-Chromatografie… und meinten gegenüber Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ihre Ergebnisse zusammenfassend: „So stark wie oft behauptet, sind die heilenden Wirkungen nicht, ein bisschen antibiotische Wirkung hat das Erdkrötensekret schon und auch Knoblauch und Zwiebel helfen – aber nicht so besonders viel.“
Weil die Sojabohnen bei uns nicht heimisch sind, müssen sie gegen hier vorkommende Bakterien sozusagen geimpft werden. Das passiert schon – nach einem patentierten Verfahren eines Unternehmens. Was die Firma (Ensemo) nicht wusste / weiß: Was genau ändert sich durch die Seed-injektion auch „Inkulierungsstrategie“ genannt. Das wollten sie von Jugendlichen der HBLFA Francisco Josephinum im niederösterreichischen Wieselburg herausfinden lassen.
Lea Bauer, Karoline Pernkopf, Magdalena Mayer und Linda Ziegelwanger säten für ihr Projekt „Einfluss unterschiedlicher Inokulierungsstrategien auf die Sojabohne“ Samen auf dem schuleigenen Versuchsfeld und entnahmen regelmäßig proben, um sie im Labor zu untersuchen. Wobei die Schülerinnen nicht nur die von der Firme „be-spritzten“ Sojabohnen untersuchten, sondern mit anderen Methoden experimentierten. „Wir haben den Wirkstoff zum Beispiel auf die Samen aufgebracht, statt sie zu impfen. Unsere Arbeit war die genaue Analyse aller möglichen Werte wie Stickstoffgehalt und anderer.“
Die Brustkrebserkrankung der eigenen Uroma war der Antrieb für die Schülerin der Salzburger HTLuVA Viktoria Marie Versnik sich der Forschung in diesem Bereich zu widmen.
Chemotherapien helfen in hohem Ausmaß gegen diesen Krebs, aber ein Stoff, der vom vietnamesischen Käseholzbaum gewonnen wird, könnte auch helfen – mit weniger negativen Nebenwirkungen als Chemo.In einem Praktikum an der privaten Paracelsus Medizin-Uni begann sie ihre wissenschaftliche Arbeit „BreastCancer Care – Entwicklung einer Methode zur Brustkrebstherapie“, die sei mit ihrem Diplomprojekt fortsetzte: Aus dem vietnamesischen Käseholzbaum kann ein Stoff mit dem technischen Namen MF-15 gewonnen werden, der therapeutisch gegen Brustkrebszellen eingesetzt werden kann.
In ihrer Arbeit untersuchte die Schülerin anhand von 7500 Zellen unter Zugabe unterschiedlicher Dosen dieses Käseholzbaum-Extraktes die Wirkung. Und das stimmte sie – und ihre universitären Partner:innen hoffnungsfroh. „Mein Uroma (98½ Jahre) wollte immer wieder auch über den Fortschritt meiner Arbeit informiert werden“ und hat regen Anteil an der Arbeit der Urenkelin genommen.
Bis ein daraus entwickeltes Medikament allerdings zum Einsatz kommen darf, brauche es natürlich klinische Studien, so die Schülerin.
Laserstrahlen mit denen scharf geschnitten werden kann, stammen aus einem sehr schmalen Bereich von Lichtfrequenz, sind sogenanntes monochromatisches oder einfärbiges Licht, das aus dem breiten bunten Spektrum des eingefangenen Lichts herausgefiltert werden muss.
Mehr vom farbigen Licht für solche, einfärbigen, dichten Strahlen zu nutzen, nahmen sich Andreas Walter, Jonas Stadelmann und Alexander Pflegerl aus der HTL Bregenz vor. Das Trio – jeder aus einer anderen Klasse – kannte sich schon von einem Projekt für die First Lego League, bei dem sie Sonnenenergie direkt aus dem Weltraum holten (Spacebased Solar Power).
In einer Versuchsanordnung an der sie tüftelten und die sie auch bauten kamen sie zum Schluss, die Molekülmechanik der Lichtstrahlen zu verändern. Mit „Prism“ so ihr projekt-Titel könnte der bestmögliche Wirkungsgrad der Umwandlung von buntem in einfärbiges scharf und gezielt schneidendes Licht erfolgen. Zur Anordnung der erforderlichen „Lichtwandler“ programmierten die drei Schüler noch eine quantenmechanische Simulation mit selbstlernendem Algorithmus.
Robin Luger und Nils Moosbrunner von der HTL Dornbirn (Vorarlberg) haben ihr Projekt mit dem nicht ganz einfachen Titel „HydroGuard – Transientenbetrieb von Zinnoxid-Gassensoren zur selektiven Wasserstoffdetektion“ an und mit der Montanuni Leoben (Steiermark) durchgeführt. Der „Wasser-Wächter“ ist ein Sensor, den die beiden so modifizierten, dass bei einem Leck in einer Gasleitung, bei dem verschiedene Gase entweichen, durch gezielte Temperaturwechsel jedes einzelne erkannt werden kann.
„Unser Sensor kostet wenige Cent im Vergleich zu kommerziellen Sensoren um einige Hundert Euro“, so die beiden Schüler zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Was auf den ersten Blick vielleicht aussehen mag wie ein überkandidelter High-Tech-Sechs-Eierkocher ist eine medizin-technische Entwicklung der vier Schülerinnen der HTLuVA Salzburg Leticia Schubert, Paula Schachinger, Julia Wimmer und Katharina Reindl. Ihre Apparatur misst – und das automatisch und ohne immer wieder den Deckel öffnen zu müssen, um nachzuschauen, wie sich die Gabe von Medikamenten gegen das Wachstum von Blutgefäßen an den Eiern im Frühstadium – den ersten sieben Tagen – der Brut auswirkt.
Wachsen Blutgefäße beeinträchtigen sie Sehnen. Medikamente können ersteres be- bzw. verhindern. Das haben Forscherinnen und Forscher des Institut für Sehnen- und Knochenregeneration der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg zwar auch beobachten können, aber bisher einzeln und immer wieder einzeln ins jeweilige Ein reinschauen müssen. Die vier Jugendlichen entwickelten – und bauten mit „OvoView“ ein Gerät plus Software, das diese Entwicklung – ohne den Deckel heben zu müssen und damit möglicherweise den Prozess oder das Wachstum der Küken zu beeinflussen – mit Hilfe einer Kamera festhält. Diese Bilder lassen die Schülerinnen von bildverarbeitenden Algorithmen gleich analysieren wobei Farben gefiltert und Kontraste verstärkt werden.
Heben drei Jugendliche in der Katgorie Design ein praktisches mechanisches Aufwickel-Gerät für Feuerwehrschläuche entwickelt, so dachten sich drei andere Schüler – aus der HTL Braunau (Oberösterreich) – eine digitale Hilfe für den direkten Einsatz in großen, mitunter unübersichtlichen Gebäuden ersonnen und programmiert.
Unglaublich ist’s bisher, was Felix Auer, Konstantin Bandat und Elias Mutter dem Journalisten zeigen: Das was im Wiener Dialekt „Kaszettl“ genannt wird, halten sie ihm vor Augen und Kamera – ungefähr A7-klein (ein A4-Blatt drei Mal je in der Hälfte gefaltet) gibt an, welcher Brandmelder Feueralarm ausgelöst hat – mit ungefährem Standort.
Von öffentlichen Gebäuden, ob Krankenhäuser, Schulen oder auch Bürokomplexen gibt es digitalisierte Pläne. Und die nahmen sich die drei Schüler her. „Wir haben sie mit Hilfe einer KI und einem dafür programmierten Filter aber vereinfacht: Beim Einsatz sind viele grafische Informationen nicht wichtig, es geht doch darum, möglichst rasch zum Brandherd zu kommen, das kann mitunter Leben retten!“
In „Helios“ wie sie ihr Projekt nach dem griechischen Sonnengott und Himmels-Wagenlenker nannten, werden nun die schematischen Innenpläne der Gebäude auf einem eigens gebauten mobilen Endgerät mit Display angezeigt und bringen die Feuerwehrleute raschestmöglich zu jenem Brandmelder, der den Alarm ausgelöst hat.
Übrigens, einer des Trios, Konstantin Bandat wird nun nach der Matura seinen Zivildienst bei der Braunauer Feuerwehr leisten, um die Umsetzung des Projekts abschließen zu können.
Politik – ein garstiges Geschäft, meinen viele. Nicht wenige in diesem aber entscheidenden Feld Tätige befördern dies durch ihr Agieren und / oder ihre Äußerungen. Was zu dem Phänomen führt, das „Politikverdrossenheit“ genannt wird, aber eher Politiker:innen-Verdrossenheit heißen müsste. Denn als der Schulsprecher der HTL Hollabrunn (Niederösterreich), Clemens Bauer, über seine Arbeit regelmäßig auf Social Media informierte, stiegen seine Zustimmungswerte enorm, berichtet er über die Anfänge des Projektes „Somes“ (Social Media Frames).
Gemeinsam mit den ebenfalls an Politik, insbesondere österreichischer Innenpolitik interessierten Mitschülern Tim Herbst, Florian Nagy und Lukas Zöhrer woll(t)en sie mit übersichtlicher, vereinfachter Darstellung von Fakten zum Beispiel über das Abstimmungsverhalten der 183 Abgeordneten im Nationalrat informieren statt polemisieren.
„Klar, auf der Homepage des Parlaments findest du viele Informationen, aber selbst wenn du – wie wir – interessiert bist, ist es schon seeeehr kompliziert“, meinen die Burschen und gaben auf dem Laptop an ihrem Stand den einen oder anderen Einblick in die übersichtlich gestaltete Website: somes.at/alpha
Gabriel Vogler, David Koch, Bastian Uhlig und Julian Burger stehen vor, neben und hinter einer mehrere Tische umfassenden Versuchsanordnung mit offenen und geschlossenen Behältern mit Wasser, Schläuchen, Drähten und Computern. Mit „Fenrir – Zum Schutz von OT (Operational Technology)-Netzwerken“ simulieren die vier Schüler der HTL Rennweg – eines von sieben (!) Teams aus dieser Wiener Schule im diesjährigen Jugend-Innovativ-Finale – eine Kläranlage. Aber nicht wie eine solche funktioniert oder verbessert werden könnte, haben sie sich zur Aufgabe gestellt, sondern die Abwehr von Angriffen auf Hard- und Software (Operational Technology), also einer Cyber-Attacke nicht nur auf die Software einer solchen Anlage, sondern auch die mechanischen Teile.
Auswendig lernen statt Inhalte zu verstehen – ist wohl allen aus der Schule bekannt, solchen, die noch dort sind und all jenen, die diese Phase ihres Leben schon (laaaange9 hinter sich haben. Das Notensystem befördert dies noch dazu.
Auch durch Einsatz digitaler Mittel hat sich das Prinzip kaum geändert. Julia Mayer, Viktoria Huemer und Dominik Illich von der IT-HTL Ybbs an der Donau woll(t)en diese Grundhaltung mit ihrer Lern-App Quivio, in die sie auch Künstliche Intelligenz einbauten, ändern.
So gibt es keine Auswahl-Antwortmöglichkeiten auf Fragen (Multiple Choice), sondern Verständnisfragen und die Möglichkeit bzw. das Erfordernis, in eigenen Worten und differenziert Fragen zu beantworten. Und die KI kann rückmelden, dass vielleicht Teile der Antwort richtig sein, andere nicht, aber samt der Anmerkung, was, warum nicht stimmt und wie es korrekt wäre bzw. ist.
Das Trio will den Quellcode für „Quivio“ unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlichen, damit andere vielleicht diese KI-basierte Lern-App weiter entwickeln können.

Michela Galiceanu, eine der vier Tänzer:innen der folgenden Performance „Vakuum“ von Potpourri Dance begrüßt – mitten auf der Bühne stehend mit Mikrophon die ankommenden Zuschauer:innen, ob in Gruppen oder einzeln. Freut sich spürbar, wenn die eine oder der andere darauf auch direkt reagiert.
Auf einander reagieren, das gilt für (Tanz-)Theater natürlich immer, in dieser dichten, heftigen ¾ Stunde erst recht. Unmittelbar. Erste Runde der unterschiedlichen Phasen der vom House-Dance kommenden, auch Hip-Hop-Elemente wie Breakdance, Locking, sowie afro- und lateinamerikanische Elemente einbauenden Körper-Akrobat:innen sind abwechselnde 1:1-Battles. Die eingangs Genannte ist zunächst Judge (Punkte-)Richterin, aber auch indieser Rolle wechselt sie sich mit Dominique Elenga, Rafael Hellweg und Rosa Perl ab. Die vier haben die Choreos gemeinsam mit Farah Deen, Olivia Mitterhuemer entwickelt. Diese beiden hatten die Idee und leite(te)n das Projekt künstlerisch.
Und – so berichten sie in einem rund zehnminütigen Gespräch vor der Vorstellung – sie haben in Salzburg mit Jugendlichen aus vier Schulen Workshops abgehalten. Dabei ging es zwar auch um Tanzen, aber in erster Linie um jene Themen, die die Schülerin beweg(t)en. DRUCK – von dem, ständig Leistungen erbringen zu müssen über jenen, immer im Vergleich mit anderen zu sein – off- und online – sowie gesellschaftspolitischem. Und das war schon deutlich nach der Corona-Pandemie als die Workshops stattgefunden haben.
Den Input von den Jugendlichen brachten die beiden Leiterinnen in den Probenprozess mit den vier Tänzer:innen, die einander alle vorher nicht gekannt hatten, ein. „und wir haben auch unsere eigenen Perspektiven mit eingebracht“, erzählen die vier im Nachgespräch unmittelbar nach der auspowernden Aufführung.
Die unterschiedlichsten Formen von Druck sind noch viel stärker als in den Eröffnungsbattles in anderen Phasen zu erleben. Am heftigsten, wenn die vier in Super-Zeitlupe sich immer wieder auch synchron bewegen, minutenlang das eine oder andere Bein heben und verrenkt die Balance halten. Noch ärger in jener Szene, als sie fast keine Luft zum Atmen haben – und damit der gesamte Raum im Theater Phönix beim Linzer Schäxpir-Festival in gefühlt ewiger Stille verharrt.
Krass, dass die zweite der Aufführungen praktisch zeitgleich mit dem School-Shooting im Grazer BORG Dreierschützengasse stattgefunden hat.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Wie soll oder könnte ich reagieren – in einer schwierigen, komplizierten, peinlichen oder wie auch immer nicht einfachen Situation?
Hast du dir / haben Sie sich schon einmal so etwas gefragt? Darüber Gedanken gemacht? Wahrscheinlich hat sich jede und jeder schon das eine oder andere Mal geärgert: „Ach, da hätte ich das doch heftiger oder entspannter, jedenfalls genau anders machen sollen…
Aber wie?
Nun, dafür gibt es derzeit – bis zum Ende des Schäxpir-Festivals – internationales Theater für (vor allem) junges Publikum – eine spannende, witzige Gelegenheit. BFAR – Büro für angemessene Reaktionen.
Acht Kinder und junge Jugendliche sind mit dem JES – Junges Ensemble Stuttgart – nach Linz gekommen: Charlotte, Frieda, Gesa, Greta, Josefine, Levi, Matilda, Vilna. Sie arbeiten inmitten von mobilen, flexiblen Wänden in Kojen mit Abteilungen, zwischen Karton-Kisten für und mit Akten, Schreibmaschine, Schredder, einer „Rohrpost“.
Am Start-Schalter empfängt dich eine der – mit hell-lila Kappe und ebenso gefärbten gerade aktuellen Schwebe-Patschen ausgestatten – Büro-Mitarbeiter:innen, dein Akt wird erstellt.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du gern anders gehandelt hättest, kannst du gleich zur Beratung. Fällt dir nichts ein oder traust du dich nicht eine solche Begebenheit preiszugeben, darfst du ins Archiv mit schon gesammelten Fällen und dich von einem dieser Akten inspirieren lassen.
In der Erstberatung geht es weniger um deinen „Fall“, sondern anhand von Tier-Bildern wird unter anderem erfragt, wie du allgemein reagierst; eher wie eine giftige Schlange oder eine Eule oder …
In einem der beiden Reaktor-Räumen kannst du dann deinen Fall besprechen. Wenn du willst, wirst du eingeladen, die entsprechende Situation nochmals hier unter den „Labor“-Bedingungen ohne den Stress durchzuspielen. Die Kinder bieten – zumindest taten sie bei dem hier rezensierenden Probanden – an, dass eine oder einer in deine Rolle damals schlüpft und du von außen zusehen kannst, wie eine andere, eine angemessene Reaktion, ablaufen könnte…
In einem weiteren Reaktor-Raum kannst du eine Art Telefonberatung durchspielen, oder etwas dazu schreiben, das du vielleicht gleich schreddern willst oder auch eine Postkarte an wen auch immer verfassen. Gegen Ende wird, so du zustimmst, dein Akt per Rohrpost – ein Laubbläser an einem durchsichtigen langen, breiten Schlauch, ins Archiv befördert und dort – entsprechend dem Inhalt in eine der Box eingeordnet.
Erleichtert für kommende herausfordernden Situationen, kannst du nach der ernsthaften, kompetenten und doch von Witz durchzogenen „Behandlung“ dieses Büro verlassen.
Dieses BFAR ist im Glaskubus am Linzer O.K.-Platz (für Offenes Kulturhaus) gegenüber dem Container mit Infos und Tickets fürs Schäxpir-Festival und angrenzend an das im Ursulinenhof gelegene Festival-Büro untergebracht.
Bobby und Chalodde – so ihre Spitznamen – sind zwei BFAR-Mitarbeiterinnen, die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ein bisschen zur Entstehungsgeschichte dieses „Büros“ erzählen: „Schon im Oktober des Vorjahres wurden wir vom JES, bei dem wir alle Theater-Workshops machen, gefragt, ob wir Lust haben, bei so einer Aktion mitmachen wollen. Im Herbst haben wir dann intensiv über Reaktionen geforscht, darüber viel geredet, Interviews mit Leuten geführt, die Erfahrungen mit Konflikten haben, und dann begonnen, verschiedene Situationen durchzuspielen. Im Jänner und Februar haben wir dann viel öfter geübt, weil wir dieses Büro schon in Stuttgart, nicht im Theaterhaus, sondern im Clubtopia, einem leeren Lokal, schon einmal aufgebaut hatten. Da waren zum Teil auch andere Kinder dabei. Wir haben auch besprochen und durchgespielt, was wir tun können, wenn jemand aggressiv wird. Dann können wir uns auch eine der Erwachsenen wenden, mit denen wir das BFAR aufgebaut haben (Larissa, Lilly, Frederic).
Wäre spannend, so eine Einrichtung nicht nur im Rahmen eines Theaterfestivals und nicht nur für bereits interessierte Besucher:innen, die das schon bewusst buchen, zu eröffnen 😉
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.


Ein Wald voller weißer, eleganter Kleider. Die meisten hängen in unterschiedlicher Höhe von der Decke, eines auf einem umgedrehten schwarzen Schirm, ein anderes scheint zu stehen. Auf dem Boden liegen viele Äpfel. In einem eingezäunten Geviert warten mehrere Dutzend kleinwunzige und große Kreisel darauf, von den Besucher:innen der interaktiven Ausstellung „Was ist, was war, was wäre“ in Schwung gesetzt zu werden. Mit den Drehungen ertönen auch unterschiedliche Klänge.
An anderen Stellen, meist neben oder unter einem der Kleider können die Gäst:innen zeichnen, Türme bauen, sich mit Pappteller-GesichtsMasken in unterschiedlichsten Stimmungen durchschauen und vieles mehr. Die Aktions-Stationen sind jeweils mit Fragen rund um Theater verknüpft: „Sollte Theater verführen? Oder soll es ärgern, provozieren, verwirren?“
Die interaktive Ausstellung war Teil des Theaterfestivals für junges Publikum in Linz (Schäxpir, Ausgabe 13) – im „Sonnenstein-Loft“ nahe dem Ars Electronica Center.
„Ist das Theater ein Haus, wo wir träumen dürfen? Können wir im Theater Ideen und Wünsche fliegen lassen? Kann das Theater ein Haus sein wo mehrere Realitäten in Zeit und Raum schweben können?“ Und dazu die Bitte: „Nimm ein farbiges Papier. Schenk uns einen Wunsch fürs Theater oder für die Welt.“
Mit dem Attribut „magisch“ fürs Theater liegen Papier und Pinsel bereit, dazu Schälchen „nur“ mit Wasser – malst du Bilder, verflüchtigen die sich rasch – wie mitunter Figuren und Szenen auf der Bühne. Die vielleicht dennoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Möglicherweise auch dein Wasser-ohne-Farben-Bild 😉
Nachdem das Leben nicht nur Sonnenseiten zu bieten hat, spielen sich auf Bühnen natürlich auch traurige Geschichten oder zumindest Szenen ab. Abschieden ist eine weitere Station gewidmet. Aus schwarz beschichteten Blättern kannst du Gedanken an Personen oder Situationen, von denen du dich verabschieden musstest, kratzen – und an Metallboxen mit elektrischen Kerzerln wie an Grabsteinen befestigen.
Auf alten Schreibmaschinen kannst du ein kurzes Theaterstück oder eine Szene verfassen, auf einer anderen einen Brief an eine Freundin oder einen Freund… oder was auch immer 😉
Schwarz sind übrigens auch die Seiten eines Tabu-Buches – denn auch für solche ist am Theater Platz. Und das sind noch nicht alle der 14 Stationen, die die langjährige Theaterautorin und -Regisseurin sowie -leiterin Hanneke Paauwe (aus den Niederlanden, die derzeit in Brüssel lebt) nach Linz mitgebracht hat. Noch einige mehr hatte sie für das Vorstadttheater Basel (Schweiz) anlässlich dessen Umzugs in eine neues Haus kreiiert.
Das Magische, Märchenhafte wollte sie mit Fragen an die Besucher:innen verknüpfen, sie zu deren eigenen Gedanken – im Kopf und mit Händen malend, schreibend, bauend, spielend – einladen. Auf die Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, weshalb „nur“ weiße, wenngleich verschieden geschnittene Kleider, die an Hochzeitsgarderobe erinnern und nicht wie im Theater bunte, vielfältige Kostüme, meinte die Theaterliebhaberin: „Mit Hochzeitskleidern taucht als erstes die Assoziation an Liebe auf, außerdem hatte ich das Bild eines Birkenwaldes im Kopf und sie strahlen – auch mit den Äpfeln – etwas Märchenhaftes aus. Und wo darfst oder sollst du sogar einmal auf einem weißen Kleid schreiben?“
Mit den vielen Fragen an und rund um das Theater, den Kleidern auf unterschiedlicher Höhe, den vielen verschiedenen Interaktionen ergeben sich allein schon durch Wechsel vom Gehen und Stehen ins Hockerln, Knien, Sitzen immer wieder Perspektivenwechsel.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Was ein wenig distanziert bei der Schilderung der Jugend von „Therese“ in Salzburg beginnt, wird bald dicht und dichter. Ob die wechselvollen Lebenslagen samt dazugehöriger Gefühle und Stimmungen der Hauptperson vor allem in Wien oder – in eher wenigen Situationen – auch die Rollen anderer Personen, die ihr nahestehen: Rita Luksch vermittelt die gewaltige Textfläche in rund zwei Mal 50 Minuten mit einer Pause ohne Momente der Langeweile aufkommen zu lassen. (Zwischenbemerkung: Diese Rezension hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… weitgehend von jener nach der Premiere im „Gleis 21“ / Wien-Favoriten, Sonnwendviertel vor fünfeinhalb Jahren übernommen – damals noch im Kinder-KURIER erschienen.)

Sie selbst hat Arthur Schnitzlers gleichnamigen Roman, in der Rezeption mitunter als innerer Monolog beschrieben, in eine Bühnenfassung umgearbeitet. Und macht dieses Frauenschicksal Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts seit fünfeinhalb Jahren auf kleinen Bühnen, zuletzt im Pop-Up Kunstfreiraum Stachel in Neulengbach (Niederösterreich) lebendig.

Die Zutaten zu dieser „Auferstehung“: Rita Lukschs überzeugendes Schauspiel, dazu die Stimmungen und Gefühle untermalende, begleitende, hin und wieder auch hervorhebende Live-Musik eines ganzen, kleinen elektro-akustischen experimentellen Tonstudios von und mit Georg O. Luksch. Dazu gesellen sich an den Hintergrund projizierte Bewegtbilder. Die gesamte Vorstellungsdauer läuft ein Experimentalfilm von Erich Heyduck ab. Er hat Bilder vor allem aus dem Wien um die vorvorige Jahrhundertwende so verfremdet, dass sie eine Art blasses Hintergrundambiente bilden – meist in der Form als handelte es sich um Negativ-Streifen oder nur Konturen von Personen, Gebäuden und Fahrzeugen. Heyduck ist einer der Initiatoren und Mitbetreiber des oben genannten Kulturraums „Stachel“, wenige Gehminuten vom Bahnhof Neulengbach Stadt entfernt – mehr dazu in einem weiteren, unten verlinkten, Beitrag.

Die Mutter, verarmte Adelige, will die Tochter mit einem alten Adeligen verkuppeln, um die Familie nach dem Tod des Ehmanns und Vaters, einem Offizier, finanziell zu sanieren. Ihre in Zeitschriften abgedruckten schwülstigen Drei-Groschen-Romane bringen nicht allzu viel ein. Doch Therese ist schon früh trotz des Umfelds eine sanft-kämpferische Frau, die ihren Weg gehen will. Sie flüchtet nach Wien und begibt sich „in Stellung“, als Kindermädchen bei wohlhabenden Familien. Die sie immer wieder wechseln muss.

Ihr Jugendfreund, der ihr eher Freund ist, während er mehr zu wollen scheint, studiert in Wien Medizin. Doch schon in Salzburg verliebt sie sich in einen Leutnant. Und da reicht der Schauspielerin ein Blick und eine Nuance an Veränderung der Stimme, um dies ins Publikum schwingen zu lassen, wenn sie von der ersten flüchtigen Begegnung mit diesem erzählt.

Viel intensiver, wenngleich auch nur mit minimalen Bewegungen und gedämpfter, verzweifelter Stimme, schildert Hatzmann-Luksch etwa jene Momente, als sie ihr Kind aus einer Liebschaft mit einem Künstler, der sich schon davor verflüchtigt hat, zur Welt bringt. Was soll sie tun? Zur Mutter nach Salzburg kann und will sie nicht zurück. Um das Kind als alleinstehende Frau, die angewiesen ist, andere Kinder in Diensten zu betreuen, kann sie sich nicht kümmern. So gibt sie Franz in Pflege bei einer alleinstehenden Bäuerin. Und ist nur alle zwei, drei Wochen glücklich, wenn sie ihren Sohn besuchen kann. Von dem sie sich aber dennoch zunehmend entfremdet. Bis hin zum tödlichen Drama als er ein junger Erwachsener geworden ist…
Therese-Kritik nach der Premiere -> damals noch im Kinder-KURIER

Einst ein Supermarkt in einem großen Eckhaus, wenige Gehminuten vom Bahnhof Neulengbach Stadt (eine halbe Zugstunde von Hütteldorf in Richtung St. Pölten) entfernt. Danach lange leergestanden, heute „Herberge“ für Gemälde, Skulpturen, Installationen und in einer nur halb abgedeckten Ecke wenige Schritte vom Eingang entfernt für Theater, Konzerte und andere Kulturveranstaltungen. Der Name ist sozusagen gleich Programm: Pop Up Kunstfreiraum Stachel.
Das Eckhaus mit großen Glasfronten versprüht den Charme vieler abgefuckter Hütten, die immer wieder in allen Ecken und Enden der Welt durch Kultur neues Leben eingehaucht bekommen. Die Ausstellungen laufen unter dem Motto: Kunst ist DADA.
Dort verfolgte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… eine Aufführung von „Therese“, einer vom Ensemble 21 dramatisierten Fassung mit Live-Musik von Arthur Schnitzlers gleichnamigem Roman, am 11. Juni 2025 im südoststeirischen Straden in der Reihe ARTigKLASSISCH – Stückbesprechung und Termin-Details (auch weiterer Aufführungen) in einem eigenen Beitrag – Link am Ende dieses Artikels.
Bilder, die an die Epoche des phantastischen Realismus erinnern, finden sich großen im Ausstellungsraum ebenso wie Skulpturen mit augenscheinlich (gesellschafts-)politischem Inhalt, etwa einer Art Diktatoren-Ecke mit dem nordkoreanischen Atomraketen-Liebhaber Kim Jong-un, Waldimir Putin als „Energie-Junkie“ mit einer Hand am Abzug des Ölkanister-Hahns, dem US-Präsidenten Trump, der alle überragen will und nicht weit von den Genannten entfernt ein Kopf, dem Würmer daraus wachsen („Entwurmung eines Politikers“).
Bei Abgang zum Klo im Stiegenhaus ein riesiger Fisch – gebaut als Plastikmüll. Vor allem Getränkeflaschen wurden von Gerhard Malecik, der gemeinsam mit Erich Heyduck Ausstellung und den Kunstraum konzipiert, zu einer Reihe von Kunstobjekten upgecycelt.
Stachel hat sich auch ein Manifest geschrieben: „Wir stehen auf dem fruchtbaren Boden der Veränderungen – Die Freiheit der Kunst – der Kunst ihre Freiheit.
Unser Zusammenschluss erfolgt aus der Gleichheit menschlicher und künstlerischer Gesinnung. Wir betrachten es als unsere Pflicht, dem humanitären und kulturellen Aufbau eines freien und vielfältigen Europas, unsere besten Kräfte zu widmen.
Wir plädieren für die Freiheit der Künste in all ihren Ausdrucksformen und unterstützen diese mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln… (auf der in der Infobox verlinkten Website ist das Manifest in voller – nicht allzu langer – Version zu lesen.)

Im „Raumschiff“ auf dem Linzer Pfarrplatz gibt’s beim Schäxpir-Festival eine Installation mit riesigen Seiten eines erst im Herbst erscheinenden Comics. KiJuKU-Bericht Nummer 5.
Schon der Ort wirkt schräg. „Raumschiff“ heißt die ein wenig abgefuckt wirkende Location am Linzer Pfarrplatz (Raum zur Vermittlung von zeitgenössischer Kunst und zur Förderung von interdisziplinärer Zusammenarbeit). Was für die Performance „Saloon“, pardon „Workshop“ wie die beiden Künstler:innen mehrfach betonen, fehlt: die klassische aus Westernfilmen bekannte schwenkbare Flügeltür.
Noch bis zum Ende des Schäxpir – Theaterfestivals für junges Publikum in Linz – ist die Ausstellung großformatig auf Stoff gedruckter Seiten eines Comics zu sehen, der erst im Oktober erscheinen wird. Mia Oberländer arbeitet an diesem wohl schräg werdenden Werk namens „Saloon“. Mitten in eine US-amerikanische Wüste pflanzt sie eben einen solchen – als Begegnungsort für ein Familientreffen mit pseudolustigem Onkel, einer Jugendlichen mit Liebeskummer, einer diktatorischen Oma, ihrem Sohn – und Vater der mitwirkenden Kinder -, der sich immer wieder in einen Hund verwandelt, seiner Frau und Mutter der Kinder, mit einem Kopf größer als ein Medizinball – bemalt als Comic-Schädel. Die „Wände“ sind die Stoff gewordenen Comic-Seiten.
Aus der Ankündigung zur Performance – ausgehend von dem entstehenden Comic, die an einigen Tagen – aufgeführt wurde stammt noch der Satz, der in dieser knapp mehr als ¾ Stunde zitiert wird: „Der Tisch war schon sauer, bevor sich überhaupt hingesetzt wurde. Die Stimmung ist vergiftet, aber wer ist schuld?“

Um Streits und Umgang mit diesen wird sich der Comic von Mia Oberländer drehen. Und da sind eine Szene des Familientreffens einerseits und die Anreise im Auto dazu das, wozu Raha Emami Khansari und Lukas Gandler (Regie: Henri Hüster) Freiwillige aus dem Publikum mit hinein holen. Für die Autoreise braucht’s zwei „Kinder“, die nerven. Wobei da üblicherweise ja eher diese Autoreisen das wirklich mühsame sind. Kinder sind dann eher diejenigen die an- und aussprechen, was wahrscheinlich auch Erwachsenen auf den Hammer geht – aktuell gab’s doch jede Menge Berichte über Kilometer-lange Staus am Pfingstreise-Wochenende. Da ist nerven ja wohl die angemessenste aller Reaktionen;)
Wie auch immer, diese sowie die Familiensituation würden vor allem davon leben, wenn die „Einspringer:innen“ wirklich eintauchen können / dürfen in diese Rollen. Wirkte eher – vor allem am Familientisch – so, als müssten sie nur nachsagen, was ihnen die beiden Performer:innen vorsagen.
Mit ordentlichen Portionen von Humor gewürzt sind die Passagen, wo die beiden als Beamte vom Büro für Streitschlichtung auftreten und bemühte einschlägige Szenarien wie sie aus Ratschlag-Büchern, -sendungen, -videos, Werbungen für einschlägige Seminare und Workshops, nur leicht überdreht auf die Schaufel nehmen. Oder neue Begriffe kreiieren, pardon Angebote an Erklärversuchen zur Ausbildung in Sachen „performative Mediation“ finden sich im Internet tatsächlich 😉
Lacher rufen auch nur allzu bekannte Phrasenhervor wie: „Das ist jetzt trotzdem kein Grund, gleich ein Drama zu machen…“
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Fell, Haut, Federn, Schuppen, Panzer… die äußere Schicht von Tieren kann – wie vieles andere – ganz schön unterschiedlich sein. Viele der vielfältigen schützenden oder / und verletzlichen Oberflächen – „übersetzt“ in Stoffe – zaubern Christine Kristmann, Anne Pretzsch in der rund ¾-stündigen tänzerischen Performance „Fell me“ aus… – nein, woraus das wird hier jetzt sicher nicht gespoilert. Vielleicht hast du ja einmal die Gelegenheit diese – für Kinder ab 3 Jahren gedachte, aber sicher auch (weit) ältere Besucher:innen faszinierende Stück irgendwo zu erleben.

Manchmal tanzen sie mit kuschelligen, longzotteligen Kostümen als Bären, dann verwandelt sich ein Zebrakleid durch Wenden auf die Innenseite in ein Krokodil, das andere in einen Leoparden – und wieder zurück. Schlangen, Schnecken, Vögel, Walflosse, Qualle, eine Art Oktopus – aber mit vielen, fast unzähligen Tentakeln entstehen aus den Kostümen und den entsprechenden tänzerischen Bewegungen – schwebend, kriechend, schwimmend, anschleichend, rennend, springend… – vor den inneren Augen. Die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling spielen die beiden ebenfalls. Dies ist eine der gaaaanz wenigen Szenen, in der die beiden auch etwas dazu sagen.
Auch zwei erklärende Sätze aus dem Ankündigungstext kommen zur Sprache und noch einige wenige Fakten aus dem Universum der Tierwelt.

Neben der dominierenden Körpersprache spielt noch eine weitere eine große Rolle: Musik, live gespielt von Sebastian Russ mit Akustik-Gitarre sowie einer Reihe von Percussions-Instrumenten – und unterstützt von vielen aus dem Publikum an die die beiden Performerinnen, die auch die Show erfunden haben – Klangstäbe, Triangel, Kastagnetten und ähnliches verteilen.
Wichtig zu erwähnen ist als Vierte im Bunde Janina Capelle. Sie hat sich die Kostüme ausgedacht und auch geschneidert. Zum einen erinnern die verschiedenen Stoffe in den zurechtgeschnittenen und -genähten Formen an die jeweiligen Tiere, zum anderen geben sie aber dabei der Fantasie viel Raum.
Am Ende der Show – das sei schon verraten – laden die Tänzerinnen das Publikum ein, Eigenschaften zu nennen für ein Tier, das noch nie wer gesehen hat. Aus den vorhandenen Materialien versuchen die beiden dann solch eine Kreatur zu erschaffen.
Und so „nebenbei“ vermittelt „Fell me“, dass das Leben auf der Erde bunt und vielfältig ist und wie dies fasziniert; vielleicht aber auch, dass das englische „fell“ neben dem Substantiv Fell auch schlagen oder fällen bedeutet, was der Mensch mit so manchen „Fellwesen“ ja macht.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Auf dem ausgerollten Tanzboden steht in der Mitte ein Haufen Ton (Lehm), dahinter liegen zwei Menschen. Eine dritte Person formt Kügelchen, Schlangen und andere Kleinformen aus Stückerln von diesem formbaren Material. Irgendwann nimmt Efrat Vonsover Avni einen kleinen Brocken Ton, klatscht ihn auf eine der beiden Liegenden, zieht und zerrt an den Beinen von Gat Goodovitch und stopft sie mit deren Kopf in eine Höhle des großen Berges, formt ihre Arme und Beine zu einer Art liegender Skulptur. Ähnlich verfährt sie mit Roni Sagi. Ihn rammt sie weiter oben in den Berg.

Die beiden mit dem Kopf „Eingegrabenen“ beginnen ihre Beine zu heben, Kopfstände zu machen, Füße zu „verknoten“.
Natürlich verharren sie auch nicht in diesen Positionen, befreien sich aus ihren „Kopfgefängnissen“ und bemächtigen sich des Materials. Verspielt baut er sich aus einer schmalen Ton-Platte eine tierische Ganzkopf-Maske. Sie befreit ihn davon, beginnt dagegen ihn zu „formen“ und beide gehen zu Musik (Maya Guttmann) in gemeinsames Tanzen über.
Nach knapp mehr als einer ¼ Stunde steht sie in dem großen eingangs erwähnten Berg, ihr Kollege Roni Sagi sowie die erstgenannte Efrat Vonsover Avni, die in der Folge die meiste Zeit an der Seite beobachtet, drücken und treten auf den Ton ein, „verankern“ Gat Goodovitch recht fest darin und lassen sich von Kindern aus dem Publikum dabei helfen. Diese neue Standfestigkeit ermöglicht der Tänzerin fast unglaubliche Bewegungen, ohne hinzufallen.

Nach ihrer Befreiung schneiden sie und ihr Kollege ein Stück nach dem anderen mit einer Nylonschnur an zwei Holzgriffen – die übliche Methode, Ton zu teilen – ab. Aus einem Stück gestaltet er sich eine Irokesenfrisur bzw. Sekunden später zum Hahnenkamm. Sie baut sich ein Handy mit Klapp-Display, um für Selfies aller Art zu posieren… Augenblicke später werfen sie die Tonbatzen weg oder formen sie um, versinken ins formende Spiel oder spielerische Formen 😉
Dass ausgerechnet die Frau ein Baby formt und der Mann eine Schlange lässt sie als einzigen kleinen Wermutstropfen in Klischeerollen kippen. Danach gehen sie über in lustvolles Werfen und Schmeißen von Tonteilen, Efrat Vonsover Avni (Konzept & Choreografie) beginnt kleine Tonstückerl an Menschen im Publikum – nicht nur an Kinder – zu verteilen und animiert sie, diese ebenfalls auf die Spielfläche – wegen Regens nicht im Freiraum des Lentos-Museums am Donauufer, sondern einem großen Raum im Ursulinenhof, zu werfen.
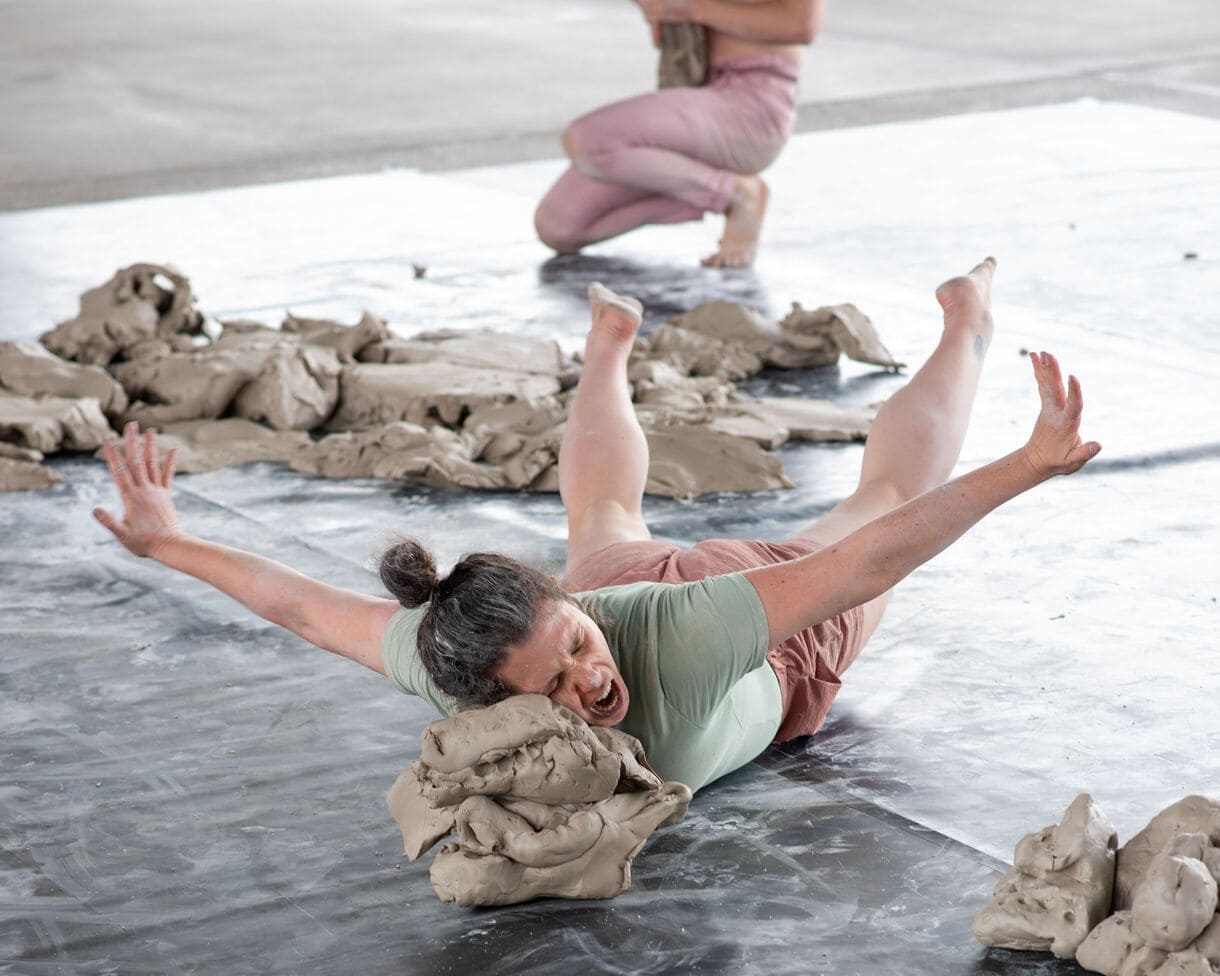
Bald danach beenden die Performer:innen ihr Spiel und geben die Tanz- und Aktionsfläche frei für Zuschauer:innen, von denen die meisten schnell in kreativem Gestalten voll aufgehen.
Der englische Titel kann natürlich weit mehr als es die Übersetzung vermag: „ClayPlay“ von der Gruppe Lazuz (Österreich/Israel) sagt alles und ist verspielt wie das was die drei Performer:innen rund eine ¾ Stunde eben mit diesem Material Ton (Lehm) anstellen – und zwischendurch auch einige sowie nach der Show alle, die wollen.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Wer waren nun mal Valentina Tereschkowa, Ida Pfeiffer oder gar Felicity Aston und Jeanne Baret? Auch wenn mittlerweile das erste Viertel des 21. Jahrhunderts vorbei ist, werden Frauen und ihre Leistungen – in den meisten Ländern – nicht als gleichwertig wahrgenommen. Das Linzer Theater des Kindes – mit Premiere beim aktuellen, dem 13., Schäxpir-Festival – stellt in „Die Ersten“ die genannten vier Frauen – stellvertretend für viele ihrer Geschlechtsgenossinnen – dem Publikum auf spannende in unterschiedlichen Szenen vor.
Simone Neumayr schlüpft in dieser guten Stunde in die Rollen der doch nicht unbekannten Kosmonautin und damit ersten Frau im Weltall, der doch einigermaßen bekannten Reise-Schriftstellerin, der ersten Frau, die allein die Antarktis durchquerte und jener Naturforscherin, die aber kaum bekannt ist und als erste Frau an Bord eines französischen Schiffes 1766 die Welt umsegelte – als Mann verkleidet, anders wäre ihr das nicht möglich gewesen.

Bevor sie mit wenigen Handgriffen, einem Seil sowie einem großen weißen Stoff Segelschiff, Eiswüste, aus einer Metallkiste eine Weltraumkapsel (Bühne: Michaela Mandel) erschafft und zentrale Lebensstationen der vier Pionierinnen in Worten und Schauspiel erzählt, taucht sie als Suchende auf. Mit Schmetterlingsnetz, breitkrempigem Tropenhut und einer Art Geigerzähler taucht sie aus dem „Bauch“ des Theaters auf den der Blick dank des ausnahmsweise weggezogenen schwarzen Vorhangs freigegeben wird, auf. Leicht verwirrt blickt sie sich um.
Perdita Polaris, so ihr Name, ist Sammlerin von Geschichten, vor allem über Menschen, die forschen, entdecken… und selber vergessen wurden, verloren gegangen oder weniger bekannt sind. (Perdita kommt übrigens aus dem Italienischen und steht für Verlust, leck, undicht…). Doch ihre bisherige Sammlung besteht praktisch nur aus Forschenden mit Bart 😉

Und damit stößt sie auf ein Bildnis von einem jungen Menschen mit Schnauzbart, wird stutzig, das Gesicht zeige doch eine Frau. Und damit führt sie das Publikum in die Geschichte der Jeanne Baret, die nicht nur, verkleidet mit dem Vornamen Jean, als Assisteint(in) und Freundin des Naturforschers Philibert Commerson auf den Schiffen Boudeuse und Étoile als erste bekannt gewordene Frau die Welt umsegelte. Die Botanikerin erforschte zahlreiche Pflanzen. Erst rund 250 Jahre später wurden ihre Leistungen anerkannt – einige französische Städte benannten Straßen nach ihr, 2012 und 2023 wurden Pflanzen(gattungen) nach ihr benannt und im Vorjahr anlässlich der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris wurde für sie – sowie für neun andere Frauen aus der französischen Geschichte – eine Statue aufgestellt.

Die vielleicht bekannteste – wenn auch nicht unbedingt dem Namen nach – ist die erste Frau im Weltall. Valentina Tereschkowa, Textilarbeiterin, die sich im Abendstudium zur Technikerin weiterbildete, begeisterte Fallschirmspringerin war, umkreiste 1963 an Bord der Raumkapsel Wostok 6 drei Tage lang die Erde.
Ihre Popularität in der Sowjetunion und bald danach darüber hinaus als Pionierin setzte sie danach viele Jahr(zehnt)e für Gleichberechtigung von Frauen ein. Schlug sich später auf die Seite Waldimir Putins, beantragte in der Duma (dem russischen Parlament) eine Verfassungsänderung, damit er länger als die auf zwei Amtsperioden begrenzte Zeit herrschen könne, unterstützte den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
Letzteres thematisiert das Stück und lässt die Protagonistin fast ratlos zurück: „alles so kompliziert!“ – einerseits Pionierin, andererseits den Krieg verherrlichen?! Wobei sich noch angeboten hätte zu erwähnen, dass sie zu den Gründer:innen der Junarmija gehörte, einer Organisation, in der Kinder und Jugendliche auf Soldat:innen gedrillt werden.
Aber Perdita Polaris ist ja forschende Geschichten-Sammlerin – da gehört eben auch nicht so Feines in ihre kleinen Büchlein, die sie in einer hölzernen Umhängekiste trägt, und so tut, als würde sie all die erzählten Erkenntnisse per Knopfdruck dort hinein befördern (Kostüme: Anna Katharina Jaritz).
Ida Pfeffers (1797 – 1858) späte – auch festgehaltenen Weltreise-Erlebnisse (rund ¼ Million Kilometer auf Meeren und mehr als 30.000 km an Land auf vier Kontinenten) und Erkenntnisse hat sie in den längst auch bekannten 13 Reisetagebüchern (in sieben Sprachen übersetzt) veröffentlicht, es gibt auch ein tolles Bilderbuch über sie – Link zu einer Buchbesprechung unten am Ende des Beitrages.

Dass forschendes Reisen nicht immer ein Vergnügen ist, nicht selten gerade das Gegenteil – an die Grenzen und darüber hinaus gehen, kann lebensbedrohlich werden und sein. Das schildert die Schauspielerin als Felicity Aston, die 2012 als erste Frau im Alleingang die Antarktis durchquerte. Schnaufen, schleppenden Schrittes, an der Kippe zum Umkippen… – weshalb sie Aston auf die ihr gestellte Frage, ob sie noch einmal so eine Expedition wagen würde, antworten lässt: Sofort, aber nicht alleine. Menschen seien dafür geschaffen, miteinander zu agieren.
Und damit wendet sich die Schauspielerin an die eine und den anderen im Publikum – vielleicht würde Perdita Polaris ja einmal deren oder dessen Geschichte sammeln.
Was ein schöner Schluss (gewesen) wäre. Aber nein, der Regisseur Henry Mason, vertraute offenbar nicht ganz auf diesen spannenden Bogen der Geschichtensammlerin und ihrer vier Pionierinnen – Untertitel „Von den Frauen, die die Welt entdeckten“ – er erfand eine Rahmenstory: Anfangs ertönt aus dem Off eine Stimme (die von Harald Bodingbauer, Assistent der künstlerischen Leitung des Theaters des Kindes): Bedauerlicherweise könne heute nicht gespielt werden, die Schauspieler:innen fehlen… und Perdita Polaris muss zu Beginn sagen, dass sie gar nicht wisse, wo sie sich hier befinde… Dieses doch seltsame Intro – alle wissen ja schon vorher zu welchem Stück sie gekommen sind – muss natürlich noch zu einem Kreis geschlossen werden; worauf viele gar nicht mehr hören.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.


Wild, aufgeweckt, neugierig voller Entdeckungsdrang – das war auch Ida. Alles wollte sie wissen und erforschen, vor allem in der Natur. Sie war mit ihren Brüdern auf „Expeditionen“ und sammelte Insekten. Das war vor mehr als 200 Jahren in Wien und sie hieß mit Nachnamen Reyer – das kommt erst ganz hinten im (Bilder-)Buch „Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf“.
Vorne dreht sich alles inmitten kunterbunter Bilder, die sehr viel zum Schauen und Entdeckten bieten, um dieses besondere, aber grundsätzlich vielleicht um jedes Kind. Und auch das Schicksal vieler Mädchen, nicht selten sogar heute. Hier taugte der Mutter die Lebendigkeit der Tochter nicht so wirklich, sie sollte ein biederes, angepasstes Mädchen, später eine Frau werden, die heiratet und Kinder kriegt. Dem ordnete sie sich unter, wurde zu Frau Pfeiffer.
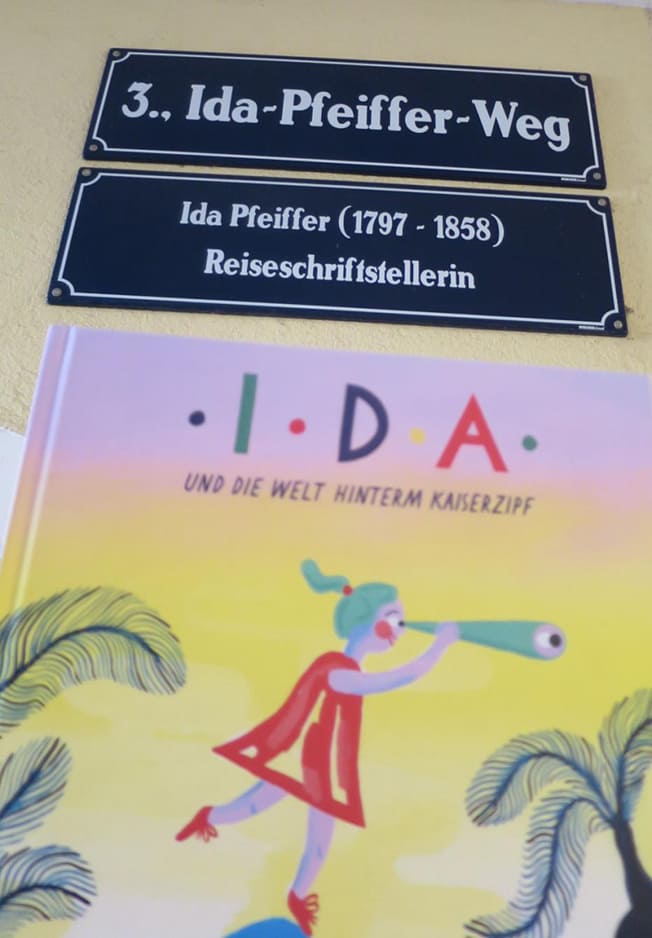
Aber als ihre beiden Söhne erwachsen waren, erwachte in ihr wieder der alte Forschungsdrang – und sie machte sich auf, die Welt zu erkunden. Zwei Weltreisen mit viele Entdeckungen und Erkenntnissen – eine Zeitlang lebe sie bei einer indigenen Gruppe auf einer indonesischen Inselgruppe. Vieles aus ihren Er-fahrungen verarbeitete sie zu mehreren Büchern und wurde bekannte Reiseschriftstellerin.
Aber auch wenn du vielleicht, sogar wahrscheinlich wie sehr viele Menschen, von dieser Frau noch nie gehört hast, kannst du mit diesem Bilderbuch von Linda Schwalbe selber auf eine spannende, Entdeckungsreise gehen – selbst beim 17. Mal Durchblättern werden dir vielleicht noch immer wieder neue Details auffallen.
Erstveröffentlicht damals noch im Kinder-KURIER
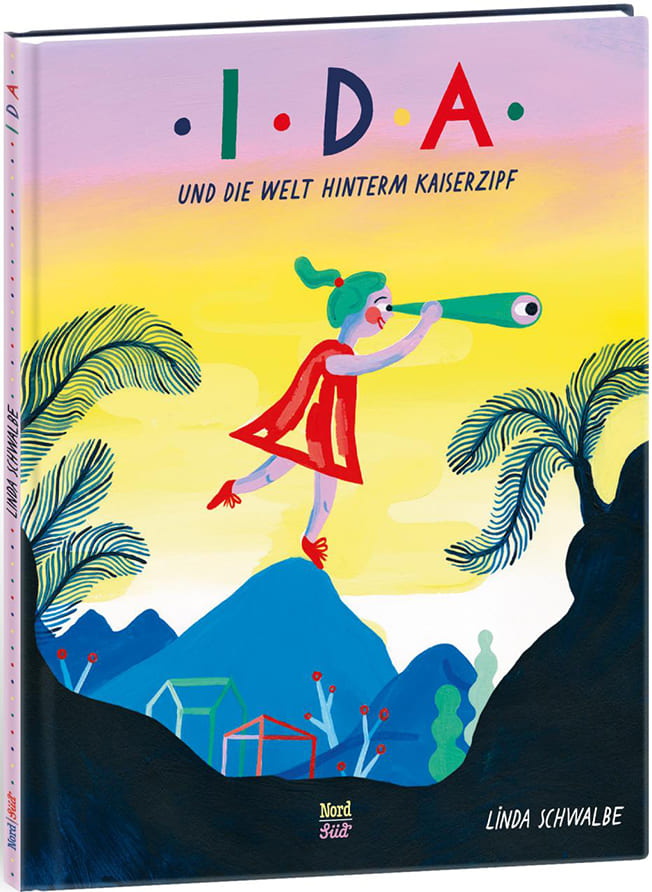

Ein stilisierter Wald aus flachen, geschätzt A4-formatigen, hölzernen Bausteinen liegt im Halbdunkel einer erhöhten Bühne – mit ein bisschen Einblick in das Darunter. Leise, sanfte, atmosphärische Töne. Vier Schauspielerinnen bewegen sich in etwas, das Schneckentempo genannt werden könnte. Laaaaangsam kriechen, klettern, rollen sie zwischen diesen „Bäume“ und bringen – beim ersten Mal überraschend und erschreckend – einen solchen hölzernen „Turm“ zum Einsturz. Es ist nicht der letzte, der „dran glauben muss“.
„Wo ist Wald?“ heißt die neueste Performance von makemake produktionen.
Pam Eden, Nora Jacobs, Martina Rösler und Johanna Wolff bewegen sich nicht nur in unterschiedlichsten Geschwindigkeiten auf, unter, neben der Bühne, sie haben das Stück auch mit entwickelt (Text & Dramaturgie: Anita Buchart, Mika Tacke; Komposition: Elise Yuki Mory; Bühne: Mirjam Stängl; Kostüm: Maria-Lena Poindl; Endregie: Kathrin Herm). Die vier verwandeln sich in Käfer, Eule, Fuchs, Tausendfüßler, eine Eintagsfliege, einen Stein, Knöllchen-Bakterien, Pilze, die ihre Mycel-Fäden ziehen, zwei von ihnen werden eine Spinne, zwei andere wollen Baum werden…

Im Laufe der knapp 1¼ Stunden lassen sie viel von dem, das in, um, unter und über einem Baum und seinen Artgenossen, die gemeinsam einen Wald ergeben, abspielt vor allem über ihre Bewegungen und ihr Spiel mit den Holzplatten lebendig werden. So manches erzählen sie – in österreichsicher Gebärden- sowie deutscher Lautsprache. Oft kommen erst die Gebärden und für jene, die diese Sprache nicht können, kommt das Gesagte danach in der Antwort auf eine Frage oder im Dialog in hörbaren Sätzen zur Sprache.
Letzteres dokumentiert, dass hier die Gebärdensprache nicht „nur“ der Übersetzung dient, sondern eigenständiges Element der Inszenierung ist. Schön langsam kommt der Gedanke von Inklusion auch in der heimischen Theaterlandschaft an. Wobei das internationale Festival für visuelles Theater von Arbos, das am Abend vor dem hier besprochenen KiJuKU-Besuch im Linzer Phönix-Theater mit „Der kleine Prinz“ in eigenständiger Gebärdensprache, die auch nicht „nur“ das Gesprochene gedolmetscht hat, in Wien zu Ende ging, aber schon vor mehr als einem ¼-Jahrhundert als Gehörlosentheater-Festival begonnen hatte – da folgt noch eine Stückbesprechung.

Obwohl die Performerinnen natürlich Menschen sind, spielt sich das Stück vor allem aus Blickwinkeln von Pflanzen und Tieren, die vielfach in Symbiose Wälder bevölkern, ab. Samt Kopfschütteln darüber wie Menschen mit diesen Lebensräumen umgehen, sie zerstören, ja gar vernichten und seltsam über so manches denken. Während diese Wesen einen umgefallen, geknickten Baum „Totholz“ nennen, ist dieser doch voller Leben!
Hin und wieder jedoch switchen die Schauspielerinnen auch in den Rollen von Tieren in menschliche Perspektiven – etwa, wenn die Borkenkäfer den Tausendfüßler mit einem „Witz“ über die vielen Schuhe aufziehen wollen. Und geben erst recht damit solche menschlichen Überheblichkeiten der unfreiwilligen Lächerlichkeit preis 😉
Irgendwie erinnern wohl auch die Szenen zu Beginn, wo die „Tiere“ einen Baum nach dem anderen „schlägern“, an unseren Umgang mit Wald. Gegen Ende kommen auch noch die von Menschen gepflanzten monokulturellen Fichtenbaum-Plantagen zur Sprache, während die Performerinnen als „Tiere“ ganz unterschiedliche Bäume aus den Holzbausteinen wieder – und anders – aufbauen.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.


Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… portraitiert aber wie immer (und davor im Kinder-KURIER) – unabhängig von den Preisen – alle 35 Projekte – aufgeteilt auf die sieben Kategorien (Design, Engineering I sowie II, Entrepreneurship, ICT & Digital, Science, Sustainability) in eigenen Beiträgen, vier davon sind schon erschienen, die anderen drei folgen – sorry, wird noch etwas dauern, aktuell ist KiJuKU.at beim Kinder- und Jugendtheaterfestival Schäxpir im Einsatz. Die Beiträge sind bzw. werden bei den jeweiligen Kategorien verlinkt.
1. Preis: 2.500 € pro Projekt
2. Preis: 2.000 €
3. Preis: 1.500 €
Anerkennungspreis: 750 €
Außerdem gibt es – wie schon im einleitenden Beitrag erwähnt – die oft noch viel gewichtigeren „Reisepreise“ – Teilnahme an internationalen Bewerben oder Messen – die werden nach allen Kategorie-Preisträger:innen aufgelistet.
Hier nun die Preisträger:innen
1.Preis: Gerät zum mobilen Aufrollen von Feuerwehrschläuchen – HTL Wolfsberg (Kärnten)
„Die Jury ist besonders von der Praxisnähe des Projekts überzeugt. Die durchdachte Rollmechanik und die intensive Beschäftigung mit verschiedenen Lösungsansätzen zeigen sehr gut, wie Design und Technik sinnvoll zusammenspielen können. Besonders positiv fiel auf: Alle Ansätze wurden ausprobiert und in der Praxis auf den Prüfstand gestellt.
Gerade in Zeiten, in denen Feuerwehreinsätze durch Waldbrände oder Überschwemmungen immer häufiger werden, ist jede Entlastung im Einsatz wertvoll. Das Aufrollen der Schläuche gelingt hier mit minimalem Kraftaufwand – und zwar für alle: unabhängig von Alter, Geschlecht oder körperlicher Stärke. Eine wirklich gelungene Lösung mit spürbarem Nutzen!“ (Für die Jury sprach Hauke Unterburg, Produktdesigner und Co-Gründer ante up, sowie Lehrender an der NDU St. Pölten und am FH-Campus Wieselburg)

2. Preis: JourneyPlanner – HTL Rennweg (Wien)
3. Preis: Stretching the Limits: Die Power auxetischer Materialien – BG/BRG Lienz (Tirol)
Anerkennungspreise:
* FINN Kitchentools – Wiedner Gymnasium – Sir Karl Popper Schule (Wien)
* ScrumpliCity – Build Your Scrum Knowledge – HTL Rennweg (Wien)
1.Preis: MagLift – HTL Rennweg (Wien)
„MagLift ist ein innovatives magnetisches Drohnenstartsystem, das ein bestehendes Problem in der Versorgung von abgelegenen Gebieten mit lebensnotwendigen Gütern löst. Das Projekt ist ein herausragendes Beispiel für technische Kreativität und Engineering auf höchstem Niveau. Es basiert auf einer eigenständigen Projektidee und zeichnet sich durch eine umfassende Herangehensweise sowie zahlreiche Experimente aus, die zur Weiterentwicklung beigetragen haben. Das Projekt wurde überzeugend und professionell präsentiert – inklusive einer Flugvorführung – und ist bereits für die praktische Umsetzung und Verwertung.“ (Christian Monyk, Forschungskoordinator am AIT – Austrian Institute of Technology)
2. Preis: PrintReClaim – Andorf Technology School – HTL Andorf (Oberösterreich)
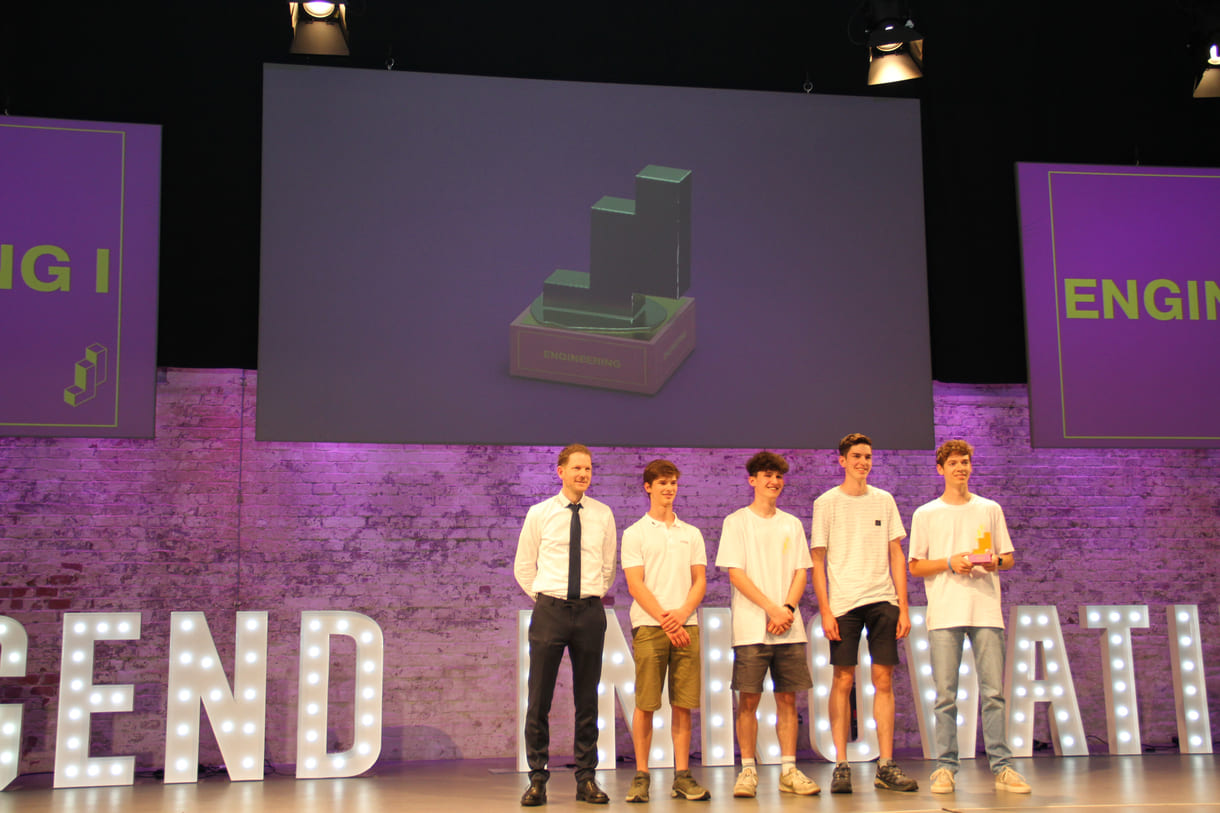
3. Preis: Hallenkranbahn aus Holz: Bemessung, Konzeptentwicklung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit sowie der Ökologie – Holztechnikum Kuchl (Salzburg)
Anerkennungspreise:
* Outdoor-Noise-Cancellation: Reduktion von Straßenlärm durch aktiven Gegenschall – HTBLVA Mödling (Niederösterreich)
* SkyScrubber – HTL Rennweg (Wien)
1.Preis: LiveSaferOverview: AI supported emergency services coordination – HTL Mössingerstraße (Kärnten)
„LiveSaferOverview: AI supported emergency services coordination: Euer Projekt adressiert eine sicherheitskritische Herausforderung mit großem Mehrwert für den Katastrophenschutz und die effiziente Tunnelrettung. Besonders beeindruckt hat eure strukturierte Herangehensweise sowie die enge Zusammenarbeit mit der ASFINAG.
Die Eigeninitiative und das selbstständige Erarbeiten der technischen Grundlagen werden von der Jury besonders gewürdigt. Die KI-gestützte Analyse des Bildmaterials der vorhandenen Tunnelkameras zur Optimierung der Rettungskoordination ist ein innovativer und praxisnaher Ansatz.“ (Maria Cecilia Perroni, Senior Lecturer und Researcher Digital Manufacturing, Automation and Robotics an der FH Technikum Wien)

2. Preis: The Hexaframe – intelligente Sonnenbrille – Wiedner Gymnasium – Sir Karl Popper Schule (Wien)

3. Preis – LifeWatch – Die Innovativste Wanduhr – HTL Rennweg (Wien)
Anerkennungspreise:
* EcoMorph – Eine Modulare Plattform für vielseitige Mobilität – HTBLA Eisenstadt (Burgenland)
* AgrarBot – HTL Rennweg (Wien)
1. Preis: Schoolbash – sichere Partys für Jugendliche – Maygasse Business Academy/ BHAK/BHAS Wien13
„Die Jury lobt den kreativen und originellen Ansatz dieses Projekts, der ein ganzheitlich durchdachtes Sicherheitskonzept für Schulpartys und Jugendevents schafft. Besonders positiv ist die Idee eines Safe Spaces, der die Sicherheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt, hervorzuheben.
Das unternehmerische Potenzial des Projekts und die kommerzielle Verwertbarkeit sind klar aufgrund der bereits realisierten Gewinne erkennbar. Ein spannendes Konzept mit gesellschaftlicher Relevanz.“ (Constanze Stockhammer, Impact & Social Business Consultant – Wirken.org)

2. Preis: IncluNet – HTBLVA Dornbirn (Vorarlberg)

3. Preis: Kayf.app: Datenzentralisierungs- und Automatisierungsplattform – TGM – Die Schule der Technik (Wien)
Anerkennungspreise:
* Polyflex – HTBLVA Mödling (Niederösterreich)
* Curiosity Crates – BHAK/BHAS Bruck a. d. Leitha (Niederösterreich)
1.Preis: OvoView – Entwicklung einer Versuchsanlage zur Analyse von Medikamenten für die Heilung von Sehnen – HTBLuVA Salzburg
„Das Projekt hat hohe gesellschaftliche Relevanz und adressiert zwei wesentliche Themen: Reduktion von Tierversuchen in der medizinischen Forschung und Ermöglichung stabiler Testprozesse für höhere Sicherheit in der Auswertung der Proben und damit eine deutliche Qualitätssteigerung. Durch die Kombination von Hardware- und Softwarelösungen mit einfachster Anwendbarkeit für den Benutzer wurde ein bestechendes Gesamtkonzept entwickelt. Der bestehende Inkubator wurde adaptiert, die Kamera integriert und die notwendige Software zur Bildauswertung für die Anforderungen angepasst. Damit wurde eine fertige vollwertig einsetzbare Lösung geschaffen. Im Zuge des Projekts mussten auch organisatorische Hürden überwunden werden: das Team hat dies beherzt durch personelle Verstärkung und Steigerung der Produktivität gelöst, sodass das Projekt in einem kurzen Zeitfenster erfolgreich umgesetzt werden konnte. Besonders beeindruckt war die Jury auch durch die vorbildliche Teamarbeit und perfekte Rollenverteilung.“ (Elisabeth Stiller-Erdpresser, Client Manager, Atos IT Solutions and Services GmbH)
2. Preis: HELIOS – Indoor Navigation für Feuerwehren – HTL Braunau (Oberösterreich)
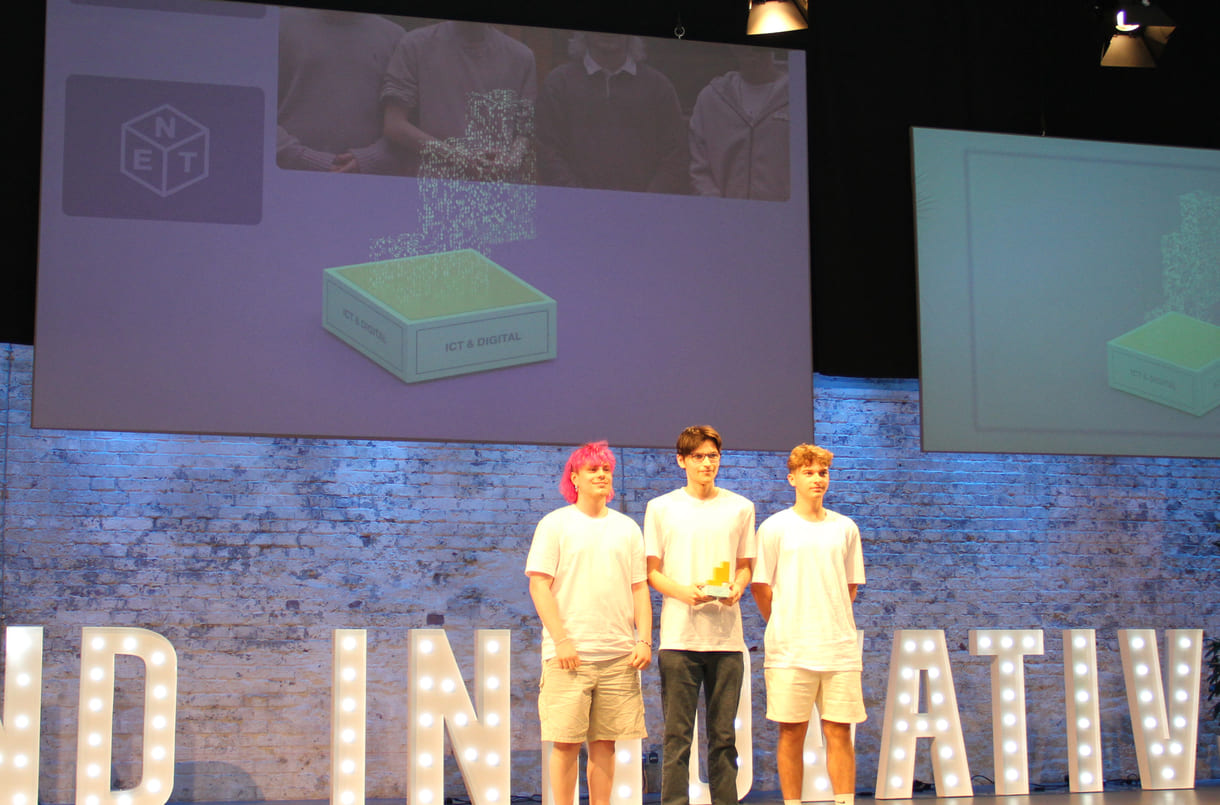
3. Preis: SOMES – Plattform für politische Transparenz – HTL Hollabrunn (Niederösterreich)
Anerkennungspreise:
* Fenrir – Zum Schutz von OT-Netzwerken – HTL Rennweg (Wien)
* Quivio – IT-HTL Ybbs/Donau (Niederösterreich)
1.Preis: PRISM – HTBLVA Bregenz (Vorarlberg)
„Bei dem Projekt handelt es sich um die Entwicklung einer neuen Simulationsmethode zum Auffinden von speziellen Molekülen, mit denen man schneller und günstiger Breitbandlaser erzeugen kann. Diese Laser sind wichtig für den Einsatz in der Medizin, Industrie, Forschung bis hin zur Weltraumtechnik.
Besonders beeindruckt hat uns das sehr hohe wissenschaftliche Niveau dieser Arbeit, die Innovation, die interdisziplinäre Zusammenarbeit dreier verschiedener Fachrichtungen der Schule und besonders der Enthusiasmus mit dem die drei Schüler sich nicht nur Unterstützung, sondern auch wissenschaftlichen Feedback bei nationalen und internationalen Einrichtungen geholt haben. Das Potential zu einer wirtschaftlichen Umsetzung zu kommen, und einen gesellschaftlichen Nutzen zu erzielen wurde als sehr hoch eingeschätzt. Insgesamt konnte dieses Projekt bei der Jury in allen Kategorien hoch punkten.“ (Reingard Grabherr, Insitutsleiterin für molekulare Biotechnologie, BoKu Wien)

2. Preis: HydroGuard – HTBLVA Dornbirn (Vorarlberg)
3. Preis: Hexen, Heiler und Schamanen – Vergessenes Wissen modern interpretiert – BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck (Oberösterreich)
Anerkennungspreise:
* BreastCancer Care – Entwicklung einer Methode zur Brustkrebstherapie – HTBLuVA Salzburg
* Einfluss unterschiedlicher Inokulierungsstragien auf die Sojabohne – HBLFA Francisco Josephinum Wieselburg (Niederösterreich)
1. Preis: ParFormer – A Calculation Tool for the Energy Transition- LiTec – HTL Paul-Hahn-Straße (Oberösterreich)
„Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur optimalen Nutzung des Stromnetzes im Kontext der Energiewende. Die effiziente Parallelschaltung von Leistungstransformatoren für Netzbetreiber ist ein spannender Ansatz, um bestehende Ressourcen besser zu nutzen, eine sichere, nachhaltige Netzbetreibung zu ermöglichen bzw. auf bestehende Engpässe beim Netzausbau zu reagieren.
Aktuelle Ereignisse wie z.B. das Blackout auf der Iberischen Halbinsel im April dieses Jahres zeigen die hohe Relevanz des Themas. Die Idee ist bereits mit einem Netzanbieter in konkreter Umsetzung.
Das Team überzeugt durch interdisziplinäre Herangehensweise, großem Engagement und einem klaren Plan für die Weiterführung.“ (Benjamin Zucali, Payer & Partner – ESG Consulting)
2. Preis: PV-Management mit Prognose – HTBLA Neufelden (Oberösterreich)
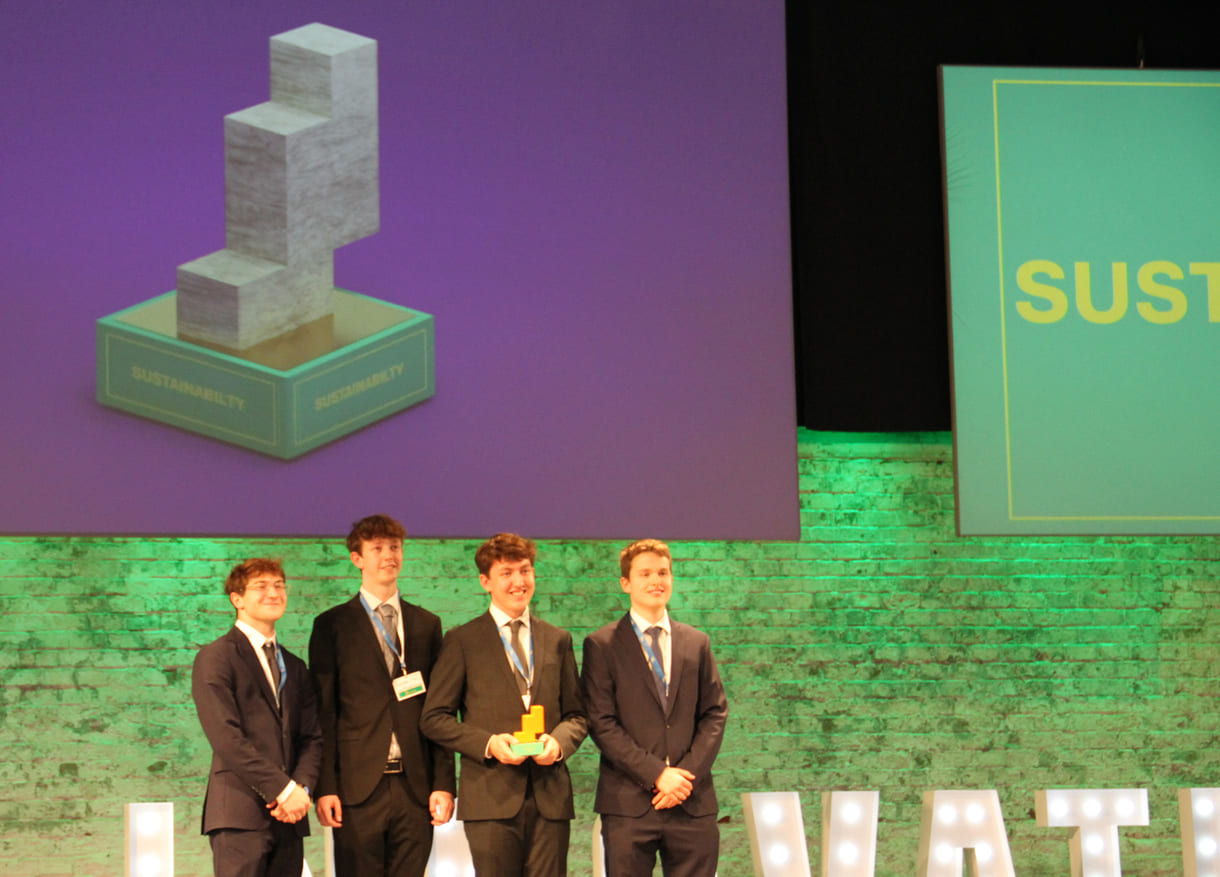
3. Preis: sustAInableEducation – TGM – Die Schule der Technik (Wien)
Anerkennungspreise:
* Wasser für Ankarimalaza – HTBLVA Pinkafeld (Burgenland)
* Green Guardian – HTL Mössingerstraße (Kärnten)
36. European Union Contest for Young Scientists 2025, Riga (Lettland)
Luxembourg International Science Expo 2025
MILSET Expo-Sciences International 2025 (ESI), Abu Dhabi (Vereinigte Arabisch Emirate)

Rund eine Woche, bevor die neun Landessieger ihre jeweilige Junior-Company im Bundesfinale des Bewerbs der besten Schüler:innen-Firmen präsentieren, stellten sich im Österreich-Finale von Jugend Innovativ (JI) auch die fünf besten Wirtschaftsprojekte vor – und dem Bewerb vor der der Jury. Auch wenn schon am Donnerstag (5. Juni 2025 die Preise vergeben worden sind , Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… stellt sie – wie auch alle anderen 30 Finalprojekte in der jeweiligen Kategorie in jener Reihenfolge vor, die sich aus der JI-Startliste ergibt.
Wenn Leon Rozboril über die Anfänge von „Curiosity Crates“ (Neugier-Box) zu schildern beginnt, kommt er ins Schwärmen über Erlebnisse aus seiner Volksschulzeit, die Augen beginnen zu leuchten. „Wir hatten chemische Experimente gemacht und ich war begeistert davon. Leider gab es so etwas im Gymnasium nicht mehr.“
Diese, seine eigene Lust und Freude am Experimentieren, am Eintauchen in Chemie, aber auch Physik, Naturwissenschaften, Mathematik – das was als MINT-Fächer (I für Informatik, T für Technik) steht, hat er gemeinsam mit Jan Hager und Manuel Pichl in seiner jetztigen Schule, der BHAK /BHASch Bruck an der Leitha (Niederösterreich) zu einem Projekte der Kategorie Entrepreneurship verpackt.

Eingepackt in eine Kartonbox sind Unterlagen für ein halbes Dutzend einfacher Experimente, die Pädagog:innen mit ihren Schüler:innen durchführen können – gedacht für das letzte Jahr in der Volksschule. Gebrauchsfertige Anleitungen wie Turm- oder Hochhausbauten aus Papier und Klebestreifen, Papierflieger, Untersuchungen mit einer Lupe, Kressesamen usw. Ersteres als Aufgabe für kleine Teams, Zweiteres durchaus auch als Bewerb der einzelnen Kinder.
Neben dem Basteln und Beobachten verbinden die Inhalte der Curiosity Crates, die sie an Schulen verkaufen, vielleicht noch mit Anleitungs-Videos bzw. Links zu solchen bestücken wollen „Informationen zu Berufen mit denen diese Versuche verbunden sind – Architektur, Pilot:in…“
Inklusion ist ein weit verbreitetes Schlagwort. Barrierefrei sollen, eigentlich müss(t)en nicht nur Gebäude usw. sein, sondern auch die digitale Welt. Ist (noch?) lange nicht oder bei Weitem so, fanden Tymofii Nosov, Sedat Sallamaçi und Joshua Matt von der HTBLVA Dornbirn (Vorarlberg). Wer nicht lesen kann, tut sich besonders schwer, ist von vilem ausgeschlossen.
Das Trio arbeitete mit Caritas Werkstätten und der Lebenshilfe im westlichsten Bundesland zusammen und begann eine App zu programmieren, die auf bildlichen Inhalten aufbaut, die aber natürlich für jene, die nichts oder schwer sehen, auch zum Hören sind, aber auch als Text – dann sicher in einfacher Sprache – ausgegeben werden können.
Zunächst ist daran gedacht, sozusagen eine eigene inklusive Social-Media-Plattform aufzubauen, bei der di User:innen (Nutzer:innen) sowohl Fotos posten als auch Bilder zeichnen oder mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz Bilder gestalten, die sie auch per Mikrofon ansagen können. Da es noch mehr unterschiedliche, individuellere Anforderungen gibt, könnten auch eventuell für Menschen mit Epilepsie das Scroll-Tempo begrenzt oder Schwarz-Weiß-Filter aktiviert werden.
Beim Einloggen würden Werkstatt-Mitarbeiter:innen helfen. Noch ist IncluNet in Entwicklung, „Wir wollen es bis Jahresende fertig programmiert haben“, hoffen die drei Schüler. Und vielleicht auch darauf, dass Partner einsteigen und dieses Netz, um diese Plattform dann auch darüber hinaus öffnen zu können.
Wie das Duo von „PrintReclaim“ Abfälle, die beim 3D-Drucken entstehen recycelt – siehe Bericht in der Kategorie Design (ganz unten verlinkt) – so will auch eine (große) Gruppe von Schülern der HTL Mödling Abfall vermeiden. Reißen Saiten in Tennisschlägern, so fallen diese als Kunststoff ist an – und erhöhen Müllberge. Bisher.
David Djordjević, Timo Kantilli, Eric Marouschek, Rajko Petrović, Vojin Rakić, Ravajel Ravajeljan, Jovo Šašić, Ivan Stević, Semih Ünal und Tyrone Weikmann begann solches gerissenen Saiten zu sammeln, reinigte sie und in Zusammenarbeit mit Chemiefirmen wird dieser Kunststoff geschreddert, aus dem Granulat werden verschließbare (Jausen- und andere) Boxen hergestellt.
„Polyflex“, so das Projekt der zehn Schüler – von denen nicht alle beim Foto für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… dabei sein konnten – vermarktet aber nicht nur den bisherigen Abfall, sondern bietet Workshops an, wo der Gedanke, dass so manches was bisher im Müll landet, Ausgangsmaterial für Recycling sein könnte, vermittelt werden soll.
Riesen-Partys mit bis zu 4000 Leuten stellten Paul Graf und Valentin Krissmanek aus der Handelsakademie in der Wiener Maygasse (Hietzing; 13. Bezirk) mit ihrem Unternehmen „Schoolbash“ schon auf die Beine, organisierten Dutzende Clubbings – und das seit zwei Jahren. Je länger sie das – früher mit einem dritten Kollegen (Felix Hawle) machten, desto mehr wurde ihren Besucher:innen und damit ihnen selbst Sicherheit in mehreren Bereichen ein zentrales Anliegen.
Getränke auf K.O.-Tropfen testen, Verhindern von Diskriminierungen, (sexuellen) Belästigungen, Drogen usw. sind must haves der Veranstaltungen, die sie organisieren – über Teststreifen und Awareness-Teams. Auch wenn „dadurch natürlich Kosten anfallen, wollen wir faire Preise garantieren“, meinen die beiden zu KiJuKU.at „Die Tickets kosten bei uns 8 bis 15 €.“ Organisiert werde vor allem über Schulsprecher:innen und wie bei Schulbällen, vorerst in Wien und Niederösterreich, „wir wollen aber auf die ganze DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausweiten“, geben sich die beiden Eventmanager unternehmerisch optimistisch.
War das jetzt in meinen eMails, als Nachricht via WhatsApp, Insta, gar Facebook oder kam das als SMS? Wem passiert es nicht, immer wieder zu suchen, wo sich welche Info findet?
Ankush Ahuja, Alexander Awart, Pavel Bakshi und Gioia Frolik aus dem TGM (Wien-Brigittenau; 20. Bezirk) präsentierten im 38. Jugend-Innovativ-Finale ein Werkzeug, das sie gemeinsam mit Tobias Fischinger ausgedacht, umgesetzt, programmiert und online gestellt haben.
Ihre – englischsprachige Website – von der die Anwendung downgeloadet werden kann (Free-Version ohne sowie kostenpflichtige – 10 €/Monat mit Support), stellt die Angebote für kooperative Dokumenterstellung, Suchfunktionen über alle Kanäle samt KI-basierter Unterstützung im Detail dar – kayf.app
Übrigens, wie einigen andere Projekte auch, setzt diese Gruppe auf open source – also Programmierung, die transparent ist und von anderen weiterentwickelt werden kann.
Ach ja, die Nachfrage beim Team, wofür Kayf denn vielleicht eine Abkürzung wäre, ergab: „Kayf ist ein russisches Wort und bedeutet so etwas ähnliches wie bei uns cool!“
Wird forgesetzt – weitere Kategorien sowie Preisträger:innen

Hinter dem mächtigen eBike, das aufs erste fast wie ein Motorrad wirkt, hat Andras Farkas aus der HTBLA Eisenstadt 3D-gedruckte weitere „Fahrrad-Rahmen“ mit anderen Sportgeräten. Weil er selbst gern radelt, wakeboardet und Ski fährt, hat er sich – unabhängig aber vielleicht vergleichbar wie Emanuel Ullmann für seine Küchengeräte, ein modulares System ausgedacht, entwickelt und eben auch schon ansatzweise gebaut. Für das eBike, das er Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erklärt, werde die jetzige Verbindung zu den Rädern noch auf Schnellverschlüsse umgebaut. Dann werde der Umbau zu einer Art Jet-Ski auf dem Wasser und einem Bob auf der Schneepiste leichter und natürlich rascher erfolgen können.
Der Rahmen aus Carbonfasern kombiniert große Festigkeit und geringen Materialeinsatz. Verschiedene modulare Schnittstellen machen „EcoMorph“ in weiterer Folge zu einem Hybrid aus eBike, eSchneemobil und eHydrofoil-Wasserfahrzeug. Der Ladestand der Batterie soll in Echtzeit überprüfbar. Beim Wechsel auf das E-Foil etwa muss die Bremsleitung dank eines Schnellverschlussmechanismus nicht komplett entfernt werden.
Passiert in einem Autobahntunnel ein Unfall, werden beide Richtungs-Röhren gesperrt, die Feuerwehr rast an den Ort des Geschehens, Rettung und Polizei in die zweite Röhre – über sogenannte Querschläge kommen sie an den Unfallort. Doch welches ist der nächstgelegene Durchgang zur anderen Röhre?
Bisher können wertvolle, weil mitunter lebensrettende Minuten mit dieser Suche bzw. mit Hin- und Herfunken vergehen. Nicht so, wenn künftig vielleicht das Projekt „LifeSaverOverview: AI-supported emergency services coordination“ der beiden Maturantinnen Johanna Maier und Alina Nessel aus der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt (Kärnten) umgesetzt wird. Sie trainierten die Künstliche Intelligenz mit rund 80.000 Fotos von Einsatzfahrzeugen – aus jedwedem Blickwinkel.
Dieses nunmehrige Wissen der KI ermöglicht via Kameras in allen Tunnels das Erkennen, welches Fahrzeug ist eine Feuerwehr, eine Rettung, ein Polizeiauto – und so kommen diese Informationen an die rettenden Kräfte.
Was vom Prinzip her vielleicht einfach klingt, war – und das neben allen schulischen Aufgaben – mordsmäßig viel Arbeit mit den schon genannten vielen Fotos. Aber der Projektbetreuer von der ASFINAG, der alle drei Jugend-Innovativ-Finaltage mit den beiden Schülerinnen an ihrem Stand verbrachte, strahlte angesichts der so gut brauchbaren, einsatzbereiten von den beiden entwickelten Unterstützung bei rettenden Einsätzen.
Ein beachtliches Trum aus Metallgestell, Rädern unten dran, einer Kiste – ebenfalls aus Metall und vielen Drähten zieht bei einem der Ausstellungsständer der 35-Finalprojekte viele Blicke auf sich. „AgrarBot“ nannten bzw. nennen Erik Steger, Benjamin Kerschner, Milan Sebastian und Burhan Özbek, ein Team aus HTL Rennweg diesen Roboter. Der kann Unkraut jäten – und zwar indem er die Wurzeln derselben zerschneidet. Wie ihre Kolleginnen aus Kärnten den Tunnelkameras sozusagen per KI das Erkennen von Einsatzfahrzeugen beigebracht haben, so lehrten die vier Rennweger HTL’er ihrem Roboter mit Hilfe von KI zu checken, was Unkraut ist und welche Pflanzen nicht zerstört werden sollen.
Im Gegensatz zu schweren Maschinen, die das vielleicht auch könnten, schont dieser Leichtroboter die Felder – denn dies war einer der Ausgangspunkte des Projekt: Erik Stegers Bruder hatte Praktika auf einer Biolandwirtschaft in Niederösterreich gemacht und davon berichtet.
Der Roboter kann aber auch neben dem Unkrautzerschneidern auch mit anderen Werkzeugen und Messgeräten bestückt werden, etwa bewässern, säen oder „nur“ Messdaten über den Boden sammeln – und über einen Kleincompter an eine Website senden, mit der Landwirt:innen Bodenqualität überprüfen können.
Dass es in der Expedithalle in der Brotfabrik, in der die Ausstellung der Finalprojekte und schließlich auch die Award-Show mit Würdigung aller Arbeiten samt Auszeichnung der von Jurys nochmals um den Tick herausragender befundenen Arbeiten viel zu heiß war und alles andere als gesunde Luft hatte, das spürten (fast) alle. Die neuartige Wanduhr des Teams von „LifeWatch“ aus der HTL Rennweg zeigte es auch, sobald sie im Einsatz war.
Thomas Rödler, Maximilian Ihl, Christoph Ballensdorfer und Paul Exler hatten erfahren, dass stickige Luft in Klassenzimmern die Konzentration rapide verschlechtert. Dazu gab es übrigen schon vor Jahren ein Jugend-Innovativ-Finalprojekt aus Linz: Ergebnis: In einer durchschnittlich besetzten Schulklasse sollte jede Stunde sechs bis sieben Mal gelüftet werden. Die HAK (Handelsakademie) Pernerstorfergasse in Wien-Favoriten hat seit Jahren neben jeder Tür ein CO2-Messgerät mit Ampelsystem: Bei Rot dringend lüften, bei Gelb wäre es angebracht…
Die genannten Rennweg-Schüler verbauten in ihre Wanduhren Sensoren – und die entsprechende Anzeigen – für Kohlendio- sowie -monoxid und Stickoxiden, aber auch für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lautstärke; die Uhrzeit natürlich auch 😉
„The Hexaframe – intelligente Sonnenbrille“ wählte Laurin Röblreiter aus der Sir-Karl-Popper-Schule als Titel für seine – eben Sonnenbrille. Das „intellgente“ daran: in beiden Bügeln sind Platinen sowie – so der Plan – minimalistische Lautsprecher. Diese „Kopfhörer“ transportieren den Schall nicht ins Ohr, sondern über die Schädelknochen an denen die Bügel anliegen. Noch ist es „nur“ eine Idee und die Vorarbeit für einen Prototypen. „Solche kleinen Akkus habe ich noch nicht“, gesteht er dem Reporter. „Und im Gegensatz zu (rausch-unterdrückenden) Kopfhörern bist du dann zum Beispiel beim Musikhören nicht ganz abgeschnitten von deiner Umwelt, kannst damit auch Radfahren und gleichzeitig auf den Verkehr achten.“
Dass Menschen, die Brillen brauchen, um gut sehen zu können, müsse kein Hindernis sein, meint er zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „dieses High-Tech-Brillengestell könnte sicher so konstruiert werden, dass auch optische Gläser eingesetzt werden könnten – vielleicht nicht bei einer Fassung wie Ihrer“, spielte er auf die John-Lennon-mäßige des Journalisten an – laur.in/
Wird forgesetzt – weitere Kategorien sowie Preisträger:innen

So, nun auch die Story zum Foto im Auftakt-Bericht zum diesjährigen Jugend-Innovativ-Bundesfinale: Die kreative Version des vielfach und noch dazu dehnbaren – seit einigen Jahren aktuellen – Logos dieses Bewerbs für erfindungsreiche Schüler:innen stammt von Jugendlichen aus dem B/R/G Lienz (Osttirol). „Stretching The Limits: Die Power auxetischer Materialen“ nannten Teresa Neumayr, Moritz Engl, Paul Unterluggauer, Sophie Gailer, Marie Pichler und Klara Duong ihre Arbeit, mit der sie es aus 42 Projekten in der Kategorie Design eben ins Finale der Top 5 – jeder Kategorie geschafft haben. Klingt höchst – naja, fast wie eine Geheimwissenschaft.
Das Foto sagt da schon einiges mehr. Und worum es geht, erklärten – und vor allem zeigten – die sechs Schüler:innen nicht nur Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Wenn sich ein Material dehnen lässt, dann üblicherweise in eine Richtung – in die Länge gezogen, wird Gummi oder was auch immer schmäler.
Diese mit dem für die meisten sicher neuen Wort beschriebenen Werkstoffe werden dann nicht nur länger, sondern auch breiter. Zuerst am Computer konstruiert und dann 3D-gedruckt haben die 7.-Klässler‘:innen scheinbar fast eine spielerische Lust entwickelt, immer neues zu kreieren: So manches kann sich nicht nur längs und breit ausdehnen, sondern auch wölben, also in die dritte Dimension erweitern. Die vielen bunten Teile, die sie auf ihrem Präsentationsstand ausbreiteten, luden auch viele Kolleg:innen von anderen Projekten, nicht zuletzt auch den Journalisten dazu ein, großen Gefallen an diesem haptischen, immer wieder verblüffenden „Spiel“ zu gewinnen.
Ob und wenn ja, was sie gewonnen haben – wobei wie immer kein Projekt leer ausgeht – wird erst bei der Award-Gala Donnerstagnachmittag verraten – und darf erst ab Freitag in Medien bekannt gegeben werden.
Die Reihenfolge der Vorstellung der Projekte richtet sich – wie schon im vorigen Beitrag zu Engineering I (das war jene Kategorie, wo KiJuKU schon am ersten Tag alle fünf Teams getroffen hatte) nach einer zur Verfügung gestellten Liste und besagt nichts über die Wertigkeit.
Eines von sieben Teams aus der HTL Rennweg (Wien-Landstraße), die es dieses Jahr ins Finale geschafft haben (Rekord!) hat – ausgehend von einer eigenen Klassenreise in die schwedische Hauptstadt Stockholm – wobei das Ziel nichts zur Sache tut – eine Lücke bei Organisieren entdeckt. Für Einzel- oder auch Familienreisen gäbe es schon genügend digitale Werkzeuge, um bei der Planung zu helfen. „Für Gruppenreisen haben wir nichts Brauchbares gefunden“, nannten die vier Schüler:innen Stefania Manastirska, Severin Rosner, Roman Krebs und Raven Burkard den Ausgangspunkt, selber Entsprechendes zu programmieren und gestalten: Eine eigene schlanke Website mit den Funktionalitäten, dass nicht nur eine Checkerin / ein Checker alles vorgibt, sondern alle Beteiligten reinarbeiten kann: journeyplanner.io
Häuser, Busse, Büsche ausgeschnitten aus Papier und zusammengesteckt – kommt ohne Kleber aus. Diese Teile finden sich neben einem Laptop des Projektteams „ScrumpliCity – Build Your Scrum Knowledge“ (HTL Rennweg, Wien 3). Lisa-Marie Hörmann, Marco Janderka, Sophie Nemecek und Felix Wollmann erklären den Sinn und Zweck – und müssen zunächst eine Bildungslücke des Journalisten schließen: Scrum ist ein digitales Werkzeug für Projektmanagement – und das seit Jahrzehnten!

An berufsbildenden höheren Schulen wo genau diese Kompetenz vermittelt wird und für viele Arbeiten erforderlich ist, kennen praktisch alle dieses Tool. Wenn’s im Unterricht um die Grundlagen geht – oder für andere Menschen, die Projekte organisieren soll(t)en, und Scrum erlernen (wollen), sei dieses spielerische Herangehensweise gedacht, so erklären die vier Jugendlichen. Die Spieler:innen schlüpfen in die verschiedenen Rollen und das in einer Art Brettspiel – für das sie die Objekte erst selber ausschneiden – Vorlagen gibt’s zum Downloaden.
Das Spiel, für das sich die Gerannten auch den passenden Namen einfallen haben lassen, ist natürlich ein kooperatives, geht es doch ums Erlernen von (besserem) Organisieren von Projekten und da ist Teamarbeit ein zentrales Element. scrumplicity.app
Immer wieder tauchen im Jugend-innovativ-Finale Jugendliche mit Feuerwehr-Helm oder -Montur auf. Ein Großteil der Brandbekämpfung und anderer Aufgaben liegt in Österreich bei Freiwilligen. Und aus ihrer praktischen Arbeit stoßen jugendlich Feuerwehrleute immer wieder in ihrer regelmäßigen Tätigkeit auf so manchen Verbesserungsbedarf, die der den Einsatz selber oder die Tätigkeiten darum herum erleichtern oder stark verbessern könnte.
In der Kategorie Design – ein weiteres „brandheißes“ (das musste sein, hat sich aufgedrängt!) Projekt landete in der Kategorie ICT & Digital – kommt natürlich in einem weiteren Beitrag. Nun also zu den beiden FF-Jungmännern Florian Amann und Marco Kainz, die mehr als die Hälfte ihres Lebens schon bei der Freiwilligen Feuerwehr (FF) sind und als Dritten im Bunde Tobias Jacopich von der HTL Wolfsberg (Kärnten), der nun auch FF’ler ist:
Nach dem Löscheinsatz, wenn du ohnehin schon „geschlaucht“ bist, musst du die elendslangen, oft vielen, Schläuche händisch aufrollen, erzählt das Trio dem Reporter. „Es gibt zwar so etwas Ähnliches wie Kabeltrommeln“, die seien aber nicht wirklich ausgereift und brauchbar. „Unser Aufrollgerät ist geländegängig, hat Gummireifen, damit funktionieren die ohne Aufpumpen und es ist mechanisch, nicht elektrisch – also auch nicht fehleranfällig.“ Außerdem haben die Schüler aus der langjährigen praktischen Erfahrung ein „Gerät zum mobilen Aufrollen von Feuerwehrschläuchen“ so – selber aus Holz gebaut, dass er schmal, platzsparend, griffbereit im Feuerwehrauto verstaut werden kann.
„Schon als Kind hab ich meiner Oma beim Kochen geholfen. Da war ich noch so klein, dass ich nicht einmal zur Arbeitsplatte in der Küche hinaufgekommen bin und auf eine kleine Leiter steigen musste“, erinnert sich Emanuel Ullmann aus der sechsten Klasse des Wiedner Gymnasiums / Sir-Karl-Popper-Schule im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… an die Anfänge seiner Leidenschaft.
Eine übervolle Lade mit Küchengeräten hat er auf den Präsentationstisch seines Design-Projekts gestellt. Die könnte deutlich entlastet werden, gäbe es für alle – ob Schöpflöffel, Schnitzelklopfer, Tortenheber oder was auch immer nur einen einzigen Griff mit dem die jeweiligen Utensilien – dann nur der Werkzeugteil – verbunden werden könnten.
„Ich hab schon ein Stecksystem gehabt“, erzählt der Jugendliche. Das sei aber nicht optimal gewesen „und daher hab ich jetzt einen neuen Mechanismus gebaut, bei dem Werkzeugteil und Griff haltbarer miteinander verbunden sind.“
Vorläufig alles „nur“ 3D-gedruckte Modelle, „aus Stahl wäre es zu teuer gewesen“. Wobei es dem Schüler, wie er ergänzt, nicht nur um den Mechanismus gegangen ist, „ich hab vor Kurzem eine Idee fürs Design gehabt und mich dafür beim Edelweiß inspirieren lassen, als etwas typisch Österreichischem“.
Das Tüfteln des Reporters, ob der Name „Finn Kitchentools“ möglicherweise für eine Abkürzung – wofür auch immer – steht, zerstreut der Erfinder: „Nein, ich mag nordische Namen, aber wenn Sie eine Idee haben, wofür das stehen könnte, sagen Sie’s mir bitte!“
Wird forgesetzt – weitere Kategorien sowie Preisträger:innen

Die Reihenfolge, in der hier die fünf Finalprojekte aus der Kategorie Engineering I vorgestellt werden, ist keine Wertung, sondern ergibt sich aus der übersichtlichen Liste, die das Jugend-Innovativ-Team Journalist:innen und Fotograf:innen zur Verfügung gestellt hat.
Florian Gaisberger hält Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… einen kleinen blau-weißen Kunststofffisch vor die Kamera. Und dazu einen nicht gerade kleinen Plastiksack mit Abfällen. Der Fisch – nicht einmal handgroß – wurde 3D-gedruckt, die Abfälle aus dieser Produktion machen ein Vielfaches davon aus.
Und so dachte sich der genannte Schüler der HTL aus dem oberösterreichischen Innviertel-Nord in Andorf gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Eggetsberger: Das kann, nein das darf nicht sein. Große Unternehmen recyceln Filament, das beim 3D-Druck abfällt, aber was ist mit all jenen Kunststoffteilen, die dabei in privaten Haushalten, Schulen oder auch in kleinen Firmen an- bzw. abfallen, vor allem bei Farbwechseln.
Das Duo plante gleichsam Klein-Recycling-Anlagen – und baute schon eine solche, die in der schuleigenen Werkstatt „seit voriger Woche fertig ist“. Die Abfälle werden erst auf klitzeklein geschreddert, dann erhitzt, geschmolzen und zu neuem Filament aufgerollt, das wieder bei späteren 3D-Drucken eingesetzt werden kann.
Die Frage, ob sie diese ihre Erfindung zum Patent angemeldet haben, verneinten die beiden: „Wir wollen, dass jede und jeder das auch nachbauen kann, es soll ja möglichst viel Abfall vermieden werden.“ Eines von vielen Beispielen bei Jugend-Innovativ-projekten egal welcher Kategorie wo Schüler:innen Nachhaltigkeit mitdenken oder sogar ins Zentrum stellen.
Eggetsberger und Gaisberger wollen die mit ihrem Projekt „PrintReclaim“ Bauanleitung online stellen, so dass sie für alle zugänglich ist.
Vor einigen Jahren hatten Jugendliche eins Finalprojekts sogar ein Filament, das zur Hälfte aus Sägespänen und Holzabfällen bestand zum 3D-Drucken präsentiert.
Holz steht im Zentrum der (Ausbildung im Salzburger Kuchl, die dortige HTL heißt nicht zufällig Holztechnikum. Alexander Wenger, Paul Wimmer, Manuel Mirocha und Lukas Schöller konzipierten für ein großes Holzunternehmen (Hasslacher Norica Timber) eine Konstruktion für Träger einer Kranbahn. Üblicherweise sind diese aus Stahl.
Kann eine solche Traglasten von mehr als zwölf Tonnen aushalten? Wie müssen diese Träger dimensioniert werden? Wie schaut’s bei einem Brand aus?
An all diesen und noch weiteren Fragen tüftelten die vier Schüler, programmierten auch eine Excel-Liste mit der sogar Nicht-Statiker arbeiten können – UND: Eine solche Hallen-Kranbahn ist um rund zwei Drittel billiger als eine vergleichbare aus Stahl; abgesehen davon, dass sie natürlich aus dem nachwachsenden Rohstoff ökologischer ist.
Max Sauer wohnt nahe der A 21 (Wiener Außenring-Autobahn) womit er bei offenem Fenster oder gar im Garten praktisch nie ohne Verkehrslärm auskommt. Kopfhörer mit Noise Cancellation waren das Vorbild für ihn und seinen Kollegen Felix Malits aus der HTL Mödling für deren Forschungsprojekt.
Nicht aufsetzen, weil sich die beiden oder noch mit anderen vielleicht unterhalten wollen, sondern das Prinzip Lärm durch Gegenschall in gleicher Frequenz zunichte zu machen, müsste doch auch so funktionieren. „Outdoor-Noise-Cancellation: Reduktion von Straßenlärm durch aktiven Gegenschall“ nannten sie ihre Arbeit.
„Was leicht geklungen hat, wurde es dann nicht. Wir haben viel geforscht, aber es ist schwieriger als gedacht. Einen großen brummenden lautstarken LKW kannst du aufnehmen und den entsprechenden Gegenschall erzeugen, aber das Dauerrauschen auf unterschiedlichen Frequenzen ist nicht so leicht zu bekämpfen“, schlussfolgern die beiden gegenüber KiJuKU.at aus ihren umfangreichen Forschungen, um aber gleich nicht ganz resigniert zu enden: „Wir schließen aber nicht aus, dass es doch möglich ist – bei weiterer Forschung.“
Manche der Projektteams haben ziemlich mächtige Konstruktionen in die Ausstellungs- und Veranstaltungshalle in der Brotfabrik (Wien-Favoriten) mitgebracht. Was wie eine Art Abschussrampe am Stand von einem von sieben (!) Projektgruppen aus der HTL am Wiener Rennweg aussieht, ist auch eine solche – für ein drohnenartiges Kleinstflugzeug.
Solche, die in größerer Ausführung Dinge wie unter anderem Medikamente in Gegenden transportieren können, die verkehrsmäßig schlecht bis nicht erschlossen sind, brauchen bisher entweder große, schwere Akkus, um die Energie zum Start zu erreichen oder Startrampen mit Stahlseilzug.
Ben Trumler, Max Zerovnik, Daniel Ezike und Philipp Weissenbach (HTL Rennweg) tüftelten, recherchierten, rechneten, konstruierten am Computer und kamen innerhalb von neun Monaten auf eine neuartige Lösung: Elektro-Magnetismus.
Das Flugzeug wird auf die Rampe gesetzt, auf kurzer Strecke so beschleunigt, dass er abfliegen kann – ob per Fernsteuerung oder schon vorprogrammiert schwebt und fliegt die Maschine in Richtung Ziel.
Das ist aber noch nicht alles, die vier Schüler haben ihre Konstruktion sehr praktikabel gebaut: Die zerlegbaren Schienen der Abschussrampe und alles drum und dran – einschließlich der von ihnen gebauten Steuerung passen in eine Metallkiste, die nur 110 Kilo wiegt. „Wir haben die mit Leichtigkeit hier herein getragen“, erzählen sie im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…
Mehr über „MagLift – Where Innovation Takes Flight“auf der projekteigenen Homepage: maglift.at
Und noch ein Projekt aus der HTL Rennweg (Wien-Landstraße), aus der es rekordmäßige sieben Projekte ins Bundesfinale dieses 38. Durchgangs von Jugend Innovativ geschafft haben, vier sogar aus einer Klasse!
Die Idee zu „SkyScrubber“, einem Roboter für – zugegeben nur große, hohe, gerade -Fensterfronten begann mit Videos über Fensterputzer als einem der gefährlichsten Berufe weltweit, die Stefan Radović im Internet gesehen hatte. Seine drei Kollegen Moritz Dwulit, Alexander Sallans und Enis Feraj griffen mit ihm den Gedanken auf, einen entsprechenden Putz-Roboter zu erfinden – erstaunlich, dass bisher noch nie wer auf diese Idee gekommen ist.
Die vier Jugendlichen stellen nun eine große Metallkiste vor, auf der Vorderfront haben sie eine Rolle aus Mikrofaser eingebaut, über Düsen kommt das Seifen-Wasser-Gemisch auf die Glasfront; in der Kiste ist der Motor, auf dem Deckel Solarpaneele, die für die Versorgung mit dem erforderlichen Strom sorgen.
Die Kiste hat das Quartett so dimensioniert, dass sie genau in die Krankörbe für menschliche Putzkräfte passt.
Wird fortgesetzt um weitere Berichte über die weiteren sechs Kategorien, wenn KiJuKU die jeweils fünf Projekt-Teams getroffen hat.
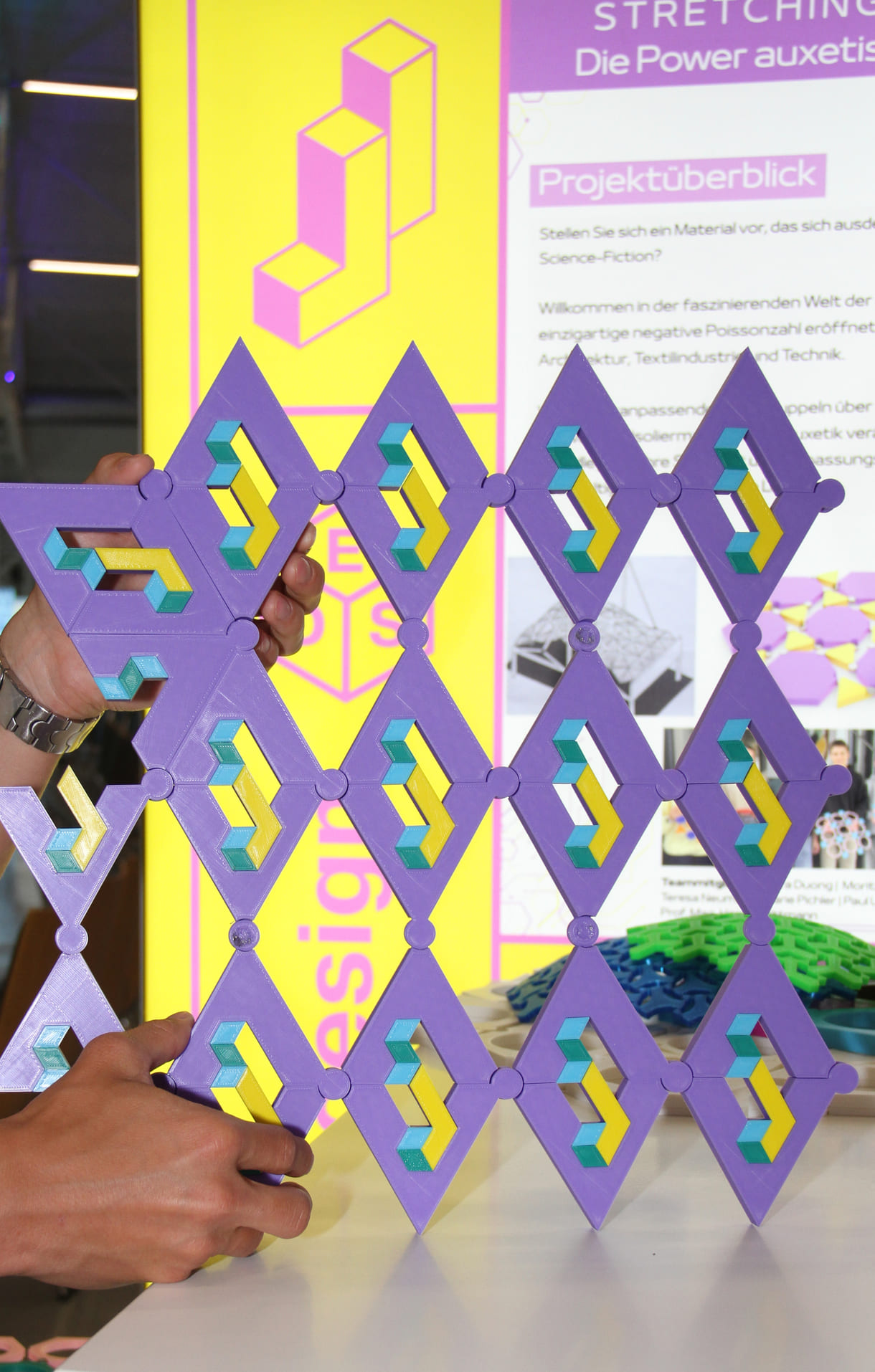
Seit Dienstag der ersten Juni-Woche 2025 präsentieren Jugendliche aus ganz Österreich ihre – teils patentreifen – Erfindungen, Entwicklungen in Hard- und Software, Maschinenbau, Elektrotechnik, wissenschaftliche Erkenntnisse, Lernspiele – digitale und manche kombiniert mit mehr oder minder viel analogem Material und vieles mehr. Zum 38. Mal steigt das Bundesfinale von Jugend Innovativ – auch wenn das deutsche Pendant „Jugend forscht“ vielen in der Öffentlichkeit bekannter ist.
Erstmals findet es in der Expedithalle des Kultur- und Bildungszentrums „Brotfabrik“ in Wien-Favoriten statt. Mehr als 100 Jahre wurde hier Brot gebacken und von hier in die ganze Stadt ausgeliefert – aus der genannte Halle weg. Nun stellen 35 Teams die besten der besten von 440 Projekten mit 1137 beteiligten Schüler:innen drei Tage lang vor – zunächst den Fachjurys, die über die Vergabe von Preisen entscheiden, sowie interessierten Journalist:innen. Am Donnerstag öffnen sich die Türen für alle interessierten Besucher:innen und anschließend steigt – gleich in dieser Halle – die Gala mit Preisverleihung (Summe der Preisgelder: 53.000 Euro), wobei noch beleibter als die Geld- sind die „Reise“-Preise zu internationalen Bewerben und Messen, die vor allem hervorragende Vernetzungsmöglichkeiten mit forschungs- und erfindungsreichen Jugendlichen aus fast der ganzen Welt sind.
Je fünf Projekte schafften es in den sieben Kategorien ins österreichweite Finale: Design (Gestaltung – 42 Projekte starteten), Engineering I (Maschinenbau – 59 Projekte) und II (Elektrotechnik – 78 Projekte), Entrepreneurship (Unternehmertum – 54), ICT & Digital (109) sowie Science (Wissenschaft -27) und nur dem Alphabet nach zuletzt Sustainability (Nachhaltigkeit – 71).
Wie (fast) jedes Jahr wird Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… (bis vor vier Jahren als Kinder-KURIER) praktisch alle Finalprojekte in Text und Fotos vorstellen – der besseren Übersichtlich- und Lesbarkeit aufgeteilt auf sieben Beiträge in den oben schon genannten Kategorien; dazu gesellt sich dieser einleitende Überblicks-Artikel sowie am Ende auch noch ein weiterer mit allen Beiträgen; die alle nach und nach das Licht der Online-Welt erblicken – und dann jeweils hier verlinkt – werden.

Keine zehn Jahre nachdem sie für einen Merkur als beste Schülerin der sechs privaten Handelsakademien der Vienna Business School (VBS, fünf Wiener und ein niederösterreichischer Standort – Mödling) nominiert war, ihn aber nicht bekommen hatte, gewann Rima Suppan bei der jüngsten Preisverleihung (noch im Mai) eins solche gewichtige (5 Kilo) Bronze-Statue als Graduate oft he Year, Absolventin des Jahres.
Mit 1,0 hatte sie in Mödling vor acht Jahren maturiert, urflott an der Wiener WU (Wirtschaftsuni) studiert und sich aufgemacht nach London. Dort gründete sie – gemeinsam mit Morgan Mixon – die Windelfirma Peachies (Pfirsiche). Das neuartige ihres Produkts: Saugfähig wie das des bekannten Markt-Champions, aber ohne schädliche Chemikalien, hochwertige Materialien, die noch dazu komplett abbaubar sind, hergestellt unter Verwendung erneuerbarer Energie, vertrieben als Abo-Modell.
Damit trafen die beiden – mittlerweile ist das Unternehmen auf zehn Mitarbeiter:innen gewachsen – den Nerv jener Eltern, die einerseits auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz achten wollen, dennoch für sich und ihre Babys nicht den Komfort missen wollen, mitten in der Nacht oder auch tagsüber viel öfter Windeln wechseln zu müssen als bei Verwendung weniger ökologischer Produkte.
Gewürdigt wurde ihre Leistung von der neuen Mödlinger Bürgermeisterin Silvia Drechsler. Im Bühnen-Interview mit der Moderatorin (nicht nur dieses Abends), Daniela Zeller meinte die Preisträgerin: „Ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, groß zu träumen und bereit sein, Fehler zu machen“, als Zeller nach einer Botschaft an heutige Schüler:innen fragte. „Aus vielen gescheiterten Ideen kommt vielleicht einmal die erfolgreiche… Fast jeden Tag trifft dich zwei Mal das Hoch und das Tief und du lernst mit der Zeit, diese Wellen zu reiten!“
Erst als Unternehmerin habe sie den Sinn so mancher Inhalte aus Buchhaltung und Kostenrechnung oder einiger praxisnaher Projekte erfahren, meinte die zuvor beschriebene Absolventin des Jahres, Rima Suppan noch.
Im Finanz- und Bankenwesen hat jener Mann – schon neben seinem Studium der Wirtschaftspädagogik und danach – gearbeitet, der in diesem Jahr – unter großem Jubel seiner Schüler:innen – den Merkur als Teacher oft he Year in Empfang nehmen durfte: Bernhard Irschik von der VBS Schönborngasse. Überreicht wurde ihm die Statue von Wiens Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs. Die ihn auch stellvertretend für die sehr vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrer nicht nur dieser Schulen würdigte.
In ihre Laudatio baute sie so manche Zitate von Irschiks Schüler:innen, der Direktorin, eines Kollegen sowie der Mutter einer Schülerin ein. Stellvertretend sei vielleicht der Satz hier veröffentlicht: „Man lernt bei ihm nicht nur Rechnungswesen, man lernt bei ihm viel mehr eine Leidenschaft für etwas zu entwickeln…“
Auf der Bühne meinte der Geehrte, dass schon sein Vater und Großvater Lehrer waren und er jeden Tag voller Freude in der Früh die Klassen betrete. Er wolle aber nicht nur Rechnungswesen, sondern auch Werte vermitteln und er erleben keinen Tag, an dem er unglücklich von der Schule nach Hause gehe.

Bei der Merkur-Gala der der privaten Handelsschulen und -akademien VBS (Vienna Business School) werden neben Top-Projekten immer auch einzelne Jugendliche, aber auch Lehrpersonen und Absolvent:innen ausgezeichnet.
Die besten Schüler:innen sind alles andere als das, was landläufig als „Streber:innen“ tituliert wird. Guter bis ausgezeichneter Schulerfolg ist bei den für den Merkur nominierten Jugendlichen lediglich ein, und gar nicht der ausschlaggebende, Aspekt. Praktisch jede und jeder aus den sechs Schulen (fünf in Wien, eine in Mödling /Niederösterreich) der VBS (Vienna Business School) ist immer auch unterstützende Ansprechperson für Mitschüler:innen, hilft, gibt Nachhilfe usw.
Viele der als „Student of the Year“ Vorgeschlagenen engagieren sich darüber hinaus in Organisationen, Vereinen, betätigen sich sozial, karitativ, kommunikativ, sportlich. Nicht wenige arbeiten neben der Schule.

Und viele wachsen mehrsprachig auf, bringen also noch weitere Sprachen – neben Deutsch und den in der Schule am Stundeplan stehenden – mit, durchbrechen also das in Medien häufig transportierte Narrativ, Kinder bzw. Jugendliche, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, wären DAS Problem.
Zum 28. Mal wurden kürzlich die ziemlich schweren (rund 5 Kilo) Merkur-Statuen an Schüler:innen der VBS (Vienna Business School – private Handelsschulen und -akademien des Fonds der Wiener Kaufmannschaft) vergeben. Über die Preisträger:innen der besten wirtschaftlichen sowie sozialen Projekte hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr schon berichtet. Hier in diesem Beitrag sind die „Students oft he Year“ dran, vorgestellt zu werden. Die beste Lehrperson sowie Graduate oft he Year kommen in einem weiteren Artikel vor den medialen Vorhang – auf der Bühne der Grand Hall im Erste Bank Campus beim Hauptbahnhof waren sie ja schon 😉
Bevor nun die Preisträger:innen – aus Handelsschule und Handelsakademie – vorgestellt werden zunächst die Nominierten:
Die Nominierten: Julian Janda (Akademiestraße), Melek Kılıcı (Hamerlingplatz), Anisa Nur (Schönborngasse), Katja Eibler (Augarten), Mina Petrović (Mödling).
And the Winner is: Arietta Stiblo (VBS Floridsdorf); Laudator: Peter L. Eppinger, Moderator, Kommunikation-Coach und Buch-Autor
Neben kulturellen Aktivitäten in und mit der Schule sowie der Ausbildung zur Ersthelferin, bewies sie in ihrem Pflichtpraktium bei einer Bootsvermietung neben Einsatzbereitschaft auch Führungsqualitäten. Die kinderlosen Betreiber trugen sich sogar mit dem Gedanken, ihr den Betrieb zu übergeben.
Was die Handelsschul-Merkur-Preisträgerin allerdings nach ihrem Abschluss machen wird, das wisse sie noch nicht, vertraute sie nach der Preisverleihung KiJuKU.at an.
Die Nominierten: Selma Jaoski (Hamerlingplatz), die Schönborngasse nominierte – eine Neuheit – ein Trio: Laurenz Köckeis, Philippa Markones, Felix Czech (zwei bei der Freiwilligen Feuerwehr, einer beim Roten Kreuz in NÖ-Gemeinden), Leonie Rachel Mang (Floridsdorf), die fünfsprachige Mariam Tvalchrelidze (Augarten, kam erst mit 15 aus Georgien nach Wien), Anna Plott (Mödling).
Gewonnen hat hier: Christoph Jethan (Akademiestraße), gewürdigt von Erika Geier-Tschernig von der Bäckerei-Kette.
Neben 1,0-Notenschnitt, einigen Marathon-Läufen und Kraftsport, hat er – gemeinsam mit Mitschüler Ronen Kalantar – ein Patent angemeldet. Damit soll Einkaufen im stationären Textil-Einzelhandel für Kund:innen erleichtert werden. Genaueres wollen und dürfen der Preisträger und sein Kompagnon (noch) nicht verraten. Das Patent ist ja erst angemeldet – übrigens selbstständig ohne einschlägige anwaltliche Unterstützung. In der Einreichung für den Merkur als bester HAK-Schüler 2024/25 schreibt Jethan: „Während des Wartens (auf den Patent-Bescheid, Anm. d. Red.) arbeiten wir derzeit an einer Applikation, die den Benutzern die Erstellung persönlicher KI-Bots ermöglichen soll.“

Seit einigen Jahren gibt es eine neue „Kategorie“ bei der Merkur-Preisverleihung, den Publikums-Award. Gegen Ende der Merkur-Überreichungen wird ein QR-Code groß eingeblendet und alle im Saal können aus allen Nominierten – ob Projekte oder Einzelpersonen – eine Stimme für einen weiteren Merkur abgeben. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Handelsschüler Julian Janda. Woraufhin riesiger Jubel im Saal aufbrandete. Er selbst konnte die Statue nicht in Empfang nehmen, weil er zu diesem Zeitpunkt schon zu Hause war – woraufhin Moderatorin Daniela Zeller ihren ehemaligen Kollegen Eppinger auf die Bühne bat, um per Video eine Botschaft an den Preisträger zu senden.
Er selbst beschreibt sich für die Nominierung seiner Schule (Akademiestraße) so: „Ich bin Julian und bin neurodivers – früher hat man das Asperger-Syndrom genannt…. Da ich im Autismus Spektrum bin, funktioniert meine Reizfilterung anders…“ Er müsse sich in einer „normalen Umgebung“ mehr konzentrieren, dafür sei seine Merkfähigkeit besonders ausgeprägt.
Anders als vielleicht aufs Erste nun zu erwarten wäre, sei er aber weniger auf Hilfe von Mitschüler:innen angewiesen, sondern umgekehrt kommen diese mit Fragen auf ihn zu und er helfe dann. Außerdem hat Janda im Selbststudium über eine bekannte App begonnen Italienisch zu lernen.
Für den Schulerhalter, den Fonds der Wiener Kaufmannschaft, würdigte Helmut Schramm den Publikums-Preisträger und freute sich, dies sei ein schönes Zeichen für das was er immer wieder als VBS-Familie benennt – Raum für Vielfalt.

In Österreichs Bildungssystem ist einiges reform-, renovierungs-, manches fast revolutionsbedürftig. Warum aber nicht mehr bei jenen positiven Beispielen aus Schulen, Klassen, von Schüler:innen und Pädagog:innen (noch!) mehr ansetzen, sie verbreiten, von ihnen lernen, um sie zu verbreitern?
Jahr für Jahr sind im Mai und dieses Mal im Juni zwei gute Möglichkeiten, dies zu tun: Vom 3. bis 5. Juni präsentieren Jugendliche die 35 erfindungsreichsten – von 440 gestarteten – Projekte in sechs Kategorien – von Engineering und Science über IST & Digital, Design bis zu Sustainability (Nachhaltigkeit) und Entrepreneurship (Unternehmertum); übrigens zum 38. Mal, wobei sich natürlich im Verlauf der fast vier Jahrzehnte Kategorien verändert haben, digital war zu Beginn logischerweise noch keine ;).
Apropos Unternehmensgeist: Zum 28. Mal wurden noch im Mai wieder die gewichtigen Merkur-Statuen der VBS (Vienna Business School, private Handelsschulen und -akademien in Wien und Mödling, NÖ) an Jugendliche der besten Projekte in den Kategorien Wirtschaft & Innovation einer- sowie soziale Verantwortung andererseits vergeben; auch da gab es im Laufe der Jahre immer wieder Kategorie-Veränderungen. Gleich blieb in all den Jahren, dass einzelne Persönlichkeiten – sowohl unter den Schüler:innen als auch den Pädagog:innen sowie den Absolvent:innen vor den sprichwörtlichen Vorhang geholt wurden.
Die VBS (Träger: Fonds der Wiener Kaufmannschaft) zelebriert diese Preisverleihung alljährlich als festliche Gala der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft von Schüler:innen und ihren Lehrpersonen. Jede der sechs VBS-Standorte nominiert in allen Kategorien ihre Besten – nur bei den Absolvent:innen (Graduate oft he Year) wid seit einigen Jahren lediglich eine einzige Person aus allen von der Jury gewählt.
Und schon diese Nominierten sind eigentlich allesamt Gewinner:innen – ähnlich wie Mitte Mai bei dem mehrsprachigen Redebewerb „Sag’s Multi“, wo alle Finalist:innen zur Abschlussfeier in den großen Festsaal des Wiener Rathauses eingeladen werden, wo dann aus ihrer Mitte die – heuer 30 – Preisträger:innen bekannt gegeben werden.
… das zeigen Namen und Sprachkenntnisse – mitgebrachte und erworbene sind auch viele der nominierten – unter den insgesamt rund 3.800 – Schüler:innen der VBS. Die Preisträger:innen, die jeweils eine der schweren Bronze-Statuen in Empfang nehmen durften, sowie einige andere der Nominierten werden in jeweils eigenen Beiträgen (nach den Kategorien) vorgestellt, die am Ende dieses Artikels verlinkt sind und in „Häppchen“ veröffentlicht werden.
Die Merkur-Statue – neben dem gleichnamigen Planeten ist es auch der Name des römischen für Handel, aber auch Diebe zuständigen Gottes – wurde vor nunmehr rund drei vom Bildhauer Thomas Kosma, einem Schüler Alfred Hrdlickas, geschaffen und wird neuerdings von Thomas Fleissgarten gegossen, der heuer den Künstler beim Besuch der Merkur-Verleihung begleitete (siehe Foto). Traditionell agiert eine Schülerin als „Merkur-Girl“, die der Reihe nach die gewichtigen Trophäen von ihren Podesten hebt, um sie der jeweiligen Laudatorin / dem Laudator auszuhändigen, die /der sie dann an die Preisträger: innen überreicht. Heuer hatte Jasmina Achmatová diese Aufgabe ausgeführt.
Für musikalische Umrahmung und zwischendurch Auflockerung sorgte die Band aus der VBS Floridsdorf: Kathia Mwari-Ngoma, Yakin Kchaou, Daniel Huber, Saida Hosseini unter der Leitung von Julian Steirer (E-Gitarre). Während Bassist Huber seinem Instrument treu blieb, wechselten seine Kolleginnen immer wieder von Schlagzeug zu Keyboard und Mikro für Gesang – siehe und höre auch Video weiter unten verlinkt.

Gerade Verlockungen des Online-Handels – kaufe jetzt, zahle später – noch dazu mit oft scheinbar Billigst-Preisen lassen (nicht nur, aber auch) Jugendliche früh in Schuldenfallen tappen. Es gibt Programme zur Finanzbildung – in Schulen, aber auch von andern Institutionen, wie etwa Wirtschafts- und Gesellschaftsmuseum – aber Fatma Elhamrouni, Sarah-Lee Kuyenov und Gabriel Abramov aus der VBS Augarten haben sich unter dem Titel „Safe Finance“ eine App mit spielerischem Zugang ausgedacht und konzipiert. Dafür schufen sie die Figur Cashy und die virtuelle Stadt „FinanzCity“. Und sie bauten in ihre spielerische Umgebung natürlich auch – gespeist von ihrem schulischen und weiterem angeeigneten Wissen – Lernmaterialien ein.
Dafür bekamen sie – gewürdigt von der führenden „Viora“-Managerin Laura Casanova den Merkur in der Kategorie „Best Economic & Innovative Project“. In der Begründung der Jury, die sie vortrug, hieß es unter anderem: „Das Projekt und die Programmierung der App zeugt nicht nur von einer guten Finanzbildung dank eines dementsprechenden Unterrichts an der Handelsakademie, die die drei Schüler:innen besuchen, sondern auch von einem hohen sozialen Verantwortungsbewusstsein ihren Altersgenossen gegenüber.“
Höchst umfangreich hatten Yannik Bransky, Dominik Lair, Nicolas Ostić und Markus Spörr aus der Hak I, Akademiestraße, längere Zeit (Praktikums-Plätze) im steirischen Murtal recherchiert – rund um Spielberg (Red-Bull-Ring). Bessere Ausnutzung der Location durch mehr Events, aber auch bessere Busverbindungen zum Bahnhof Knittelfeld sowie Setzen auf erneuerbare Energien – Photovoltaik und Biomasse-kraftwerke – sind nur einige der viel(fältig)en Vorschläge, die die vier Schüler an die „Projekt Spielberg GmbH & Co KG“ übermittelten.
Katharina Schmidt, Anastasia Knežević und Emily Gabriel aus der Abschlussklasse der VBS-HAK am Josefstädter Hamerlingplatz hatten für die bekannte Restaurantkette „Neni“ der mindestens ebenso berühmten Familie Molcho an innovativen Marketingstrategien getüftelt. Im Frühjahr 2026 will Neni mit einem Schnell-Imbiss-Service auf Flughäfen, Bahnhöfen usw. starten. Der Mix aus „frischen High-End-Gerichten und schneller Küche“ ist zwar nicht, wie behauptet, „ein neues, in Österreich noch nie dagewesenes Konzept“, „aber doch neu für Neni“, wie die Schülerinnen den Einwand gegen die übertriebene und tatsachenwidrig Anpreisung der Einzigartigkeit (siehe u.a. Bericht „Gesundes, schnelles, schmackhaftes Weltküche-Essen“ auf KiJuKU.at – Link weiter unten) zu relativieren versuchen.

Obwohl natürlich Handelsschulen und -akademien ihren Schwerpunkt auf wirtschaftliche Ausbildung leben und die VBS (Vienna Business School) noch dazu Privatschulen des Fonds der Wiener Kaufmannschaft sind, gibt es durchgängig eine Kategorie, die Projekte mit sozialer Verantwortung Jahr für Jahr vor den Vorhang holt und mit einem der schweren bronzenen Merkur-Statuen auszeichnet. Übrigens, an einem der sechs VBS-Standorte, in der Akademie-Straße in der Wiener Innenstadt gibt es darüber hinaus seit 22 Jahren noch einen eigenen Preis für soziale Projekte, den Amicus-Award – Links zu Berichten über den entsprechenden aktuellen Preis und seine Projekte am Ende dieses Beitrages.

Eines der dort ausgezeichneten Projekte war auch für den Merkur nominiert: Bei „Welle der Hoffnung“ hatten sich Schüler:innen in der Hochwasserhilfe im Herbst des Vorjahres in Niederösterreich tatkräftig mit eigener Hände Arbeit engagiert – siehe Bericht in einem der genannten Links.
„Liebe darf niemals wehtun!“ ist das Motto des aus der VBS nominierten ethischen und sozialen Projekts „SheShield“ von Simav Abbas, Michelle Izchak, Ariadna Moldoveanu, Lina Qehaja und Nilram Taheri. Mit sozialer Prävention, polizeilicher Unterstützung und rechtlicher Beratung wollen sie in Workshops in Schulen organisieren, „um Kindern von klein auf zu vermitteln, dass häusliche Gewalt inakzeptabel ist“.
Die Mödlinger VBS schickte „Give a Hand, Change a Life“ als Nominierte in den Bewerb um den Merkur. Die Klasse 3Plus hatte in den drei Schuljahren schon fünf soziale Projekte organisiert.
Drei andere für den Merkur in der Kategorie „Best Ethical & Social Project“ nominierte Schüler:innen-Gruppen hatten jeweils die Brücke zwischen Jugendlichen und älteren Menschen geschlagen:
Hier hatten die Schüler:innen des neuen Zweiges Social Business einerseits Erklärvideos für alle möglichen Funktionen von Smartphones produziert – sowohl für Android als auch IOS (iPhone). Wie diese via QR-Code jederzeit aufgerufen werden können, aber auch direkte Begegnungen mit Senior:innen samt analoger Erklärungen und Dialog. Bei diesen kamen die Jugendlichen auch drauf, welche Erklär-Videos vielleicht noch fehlten bzw. adaptiert werden müssten.
Dafür nahmen – stellvertretend für die ganze Klasse – Nataža Ristić und Slavko Jovanović – den von der Jury verliehenen Merkur von Nina Brenner, der Referatsleiterin für die kaufmännischen Schulen im Bildungsministerium, entgegen. In ihrer Laudatio wies sie übrigens darauf hin, dass die Jugendlichen ihre Erklärvideos auch mit Plakaten in Kaffeehäusern, Supermärkten, Bäckereien und Ordinationen von Ärzt:innen publik gemacht hatten.

Vier gut einen Meter hohe Gitterkäfige nebeneinander. Darauf mit festem Klebeband fixierte drei Notenpulte. Drei Schauspieler:innen (Markus Rupert, Rita Luksch und Markus Pol) betreten diese Bühne im Theater Spielraum (Wien-Neubau). Sie packen aus einem Netz einen weichen Ball, sechs Kunststoff-Kegel mit kleinen Bällen sowie zwei Kunststoff-Tennisschläger und einen dazugehörige Filzkugel aus und beginnen zu spielen. Die Kegel an der Kante der Käfige in einer Reihe aufgestellt. Die ersten Versuche lassen alle Kegel stehen, erst nach und nach werden immer mehr getroffen. Tennis spielt einer allein mit beiden Schlägern eher gleichsam jonglierend. Der Softball wird bald einmal an die eine oder den anderen im Publikum gespielt. Kommuniziert wird mit Gesten, teils auch Gebärden.
Plötzlich ein schriller Pfiff aus einem Seitengang neben der Bühne. Die Trillerpfeife stoppt das Spiel. Vier Musiker:innen mit Kuhmasken auf dem Kopf (gestaltet von der Künstlerin Burgis Paier; sie gestaltete auch die Bilder der kleinen Ausstellung im Foyer „Die 5 Sinne“)
Mit diesem eben beschriebenen Szenario startete am letzten Mai-Abend 2025 das aktuelle, mittlerweile 26. Internationale visuelle Theater-Festival, das vor mehr als einem ¼-Jahrhundert als Gehörlosentheater-Festival von Arbos (Gesellschaft für Musik und Theater) begonnen hatte. Der Abend (noch einmal am 1. Juni gespielt) „Von der Idylle in den Abgrund“ ist Visuelles Theater mit Musik in Bewegung nach den Schicksalen von Alma und Arnold Rosé mit Zitaten von Johann Sebastian Bach, Gustav Mahlers Polyphonie und Hans Krásas Kinderoper „Brundibár“ (Libretto: Adolf Hoffmeister) für Kammerensemble und Gebärdensprache musikalisch bearbeitet von Werner Raditschnig gespielt von den oben schon genannten Schauspieler:innen und in späteren Szenen zusätzlich von Werner Mössler, einem der wenigen gehörlosen Schauspieler in Österreich, der auch international immer wieder angefragt wird und für die Übersetzung der Texte in Österreichische Gebärdensprache gesorgt hatte. Außerdem ist Markus Pol ein CoDA (Kind gehörloser Eltern).
Produziert und inszeniert wird das Projekt von Herbert Gantschacher, der sich mit dem Thema künstlerisch und musikalisch seit 1978 auseinandersetzt, die österreichische Erstaufführung von Hans Krásas Kinderoper am 8.Mai 1995 produzierte und inszenierte. Die von Krása komponierte Oper (1938) konnte nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch Hitler-Deutschland damals nicht mehr aufgeführt werden. Nach und nach landeten er sowie Kinder eines Waisenhauses, die spielen und singen hätten wollen / sollen, im Konzentrationslager Theresienstadt, wo es unter den Lagerbedingungen letztlich doch zwei Vorstellungen gab. Die Käfige auf der Bühne stellen hier den symbolischen Bezug her.
Alma Rosé war Gustav Mahlers Nichte, der Konzertmeister der Wiener Philharmoniker Arnold Rosé hatte Mahlers Schwester in der Idylle am Wörthersee kennengelernt. Für die Nazis war Mahler der Ahnherr der „Entarteten Musik“. Die Cellistin des Frauenorchesters von Auschwitz‐Birkenau, Anita Lasker‐Wallfisch, hatte Alma Rosés Schicksal als Leiterin des Frauenorchesters treffend charakterisiert: „An der Wiege stand Gustav Mahler, an der Bahre Josef Mengele“. Daher bewegt sich das Projekt zwischen der Idylle des Wörthersees bis zum Abgrund nach Auschwitz‐Birkenau.
Das Festival Visual läuft noch bis 6. Juni im schon genannten Theater Spielraum in der Wiener Kaiserstraße – Links in der Info-Box am Ende des Beitrages.
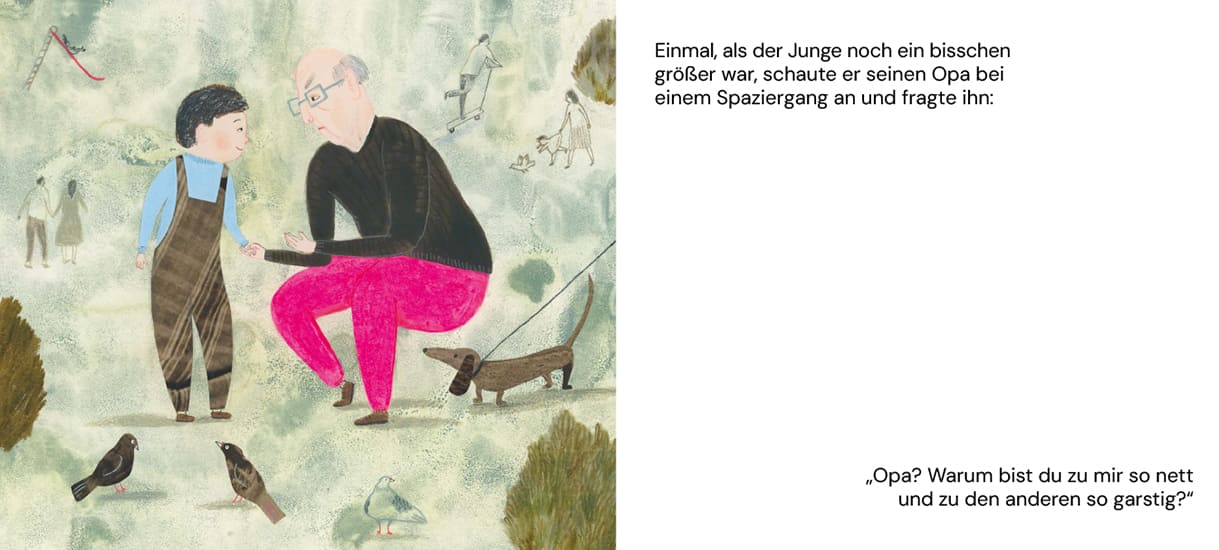
„Opa? Warum bist du zu mir so nett und zu den anderen so garstig?“ fragt der junge Enkel den alten Mann knapp nach der Mitte dieses Bilderbuchs. Mit dem Enkel geht er erst im Kinderwagen, später an der Hand fast täglich spazieren, lächelt, unterhält sich freundlich.
Bis dahin haben wir auf jeder Doppelseite die Hauptfigur ziemlich griesgrämig, grantig und irgendwie schrullig erlebt. Der alte Mann schaut meist finster drein, bringt die Ehefrau zum Weinen, weil er ihr keine Blumen bringt, obwohl sie sich zum Geburtstag Rosen wünscht. Das Badewasser in der Wanne lässt er nicht aus, sondern schöpft es mit Kübeln raus und stellt diese neben die Klomuschel. Er ärgert sich, wenn die Frau ein Joghurt wegschmeißt, wenn das Ablaufdatum einige Tage zurückliegt…
Gut, spätestens ab hier beginnt sich aufzudrängen, warum er das alles macht. Und auch dass die Farbe der Hose in „Der Opa mit der rosa Hose“ nichts mit dem Pride-Month im Juni und dem Regenbogen-Statement für Vielfalt zu tun hat. Er wollte die alte Hose der Frau nur nicht wegwerfen, sondern nähte sie um. Umwelt ist ihm das wichtigste Anliegen. Und als der Enkelsohn älter ist, begründet er seine Handlungen.
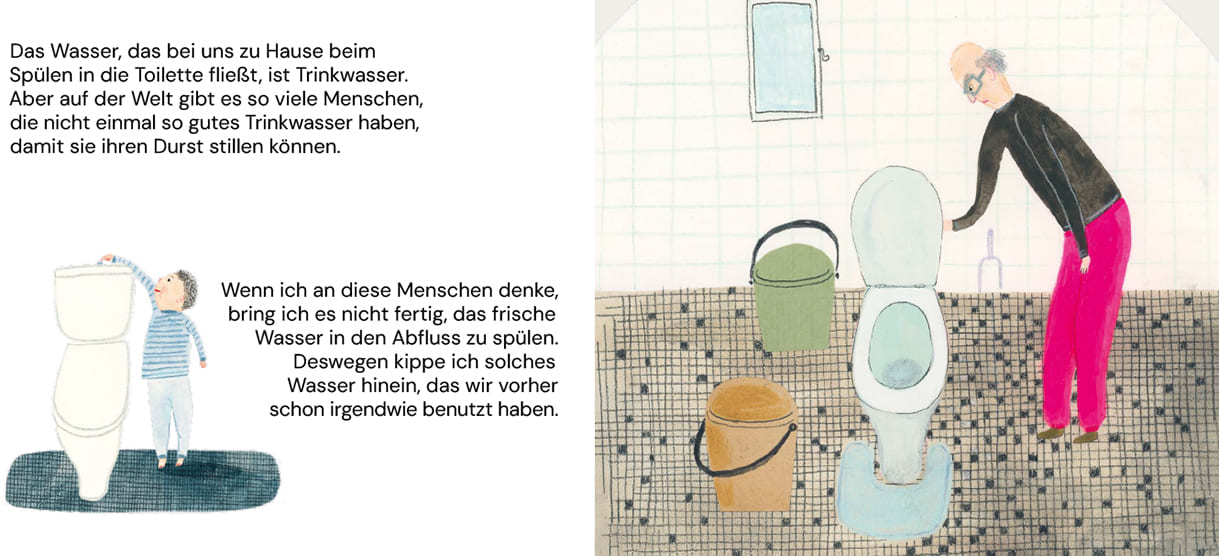
Das versteht der Bub, nicht nachvollziehen kann er allerdings – wie wahrscheinlich auch die meisten Leser:innen, weshalb er nicht dennoch freundlicher und netter zu Mitmenschen ist. Vielleicht könnte er sie dann von seinen Handlungen überzeugen und sie ebenfalls für umweltverträglicheres Verhalten gewinnen?
„Es kommt nicht darauf an was fremde Leute über dich denken. Wichtig ist nur, was der denkt, für den du das alles machst. Dein Enkel.“ So lauten die Schluss-Sätze der Autorin Lucie Hášová Truhelková (Übersetzung aus dem Tschechischen: Mirko Kraetsch), einer preisgekrönten Gesundheits-Journalistin. Und das verstört erst recht, denn immerhin lässt sie zuvor den Enkel sagen, dass es diesen stören würde, „was die anderen Leute dann vielleicht über mich denken, dass ich garstig bin und lächerlich.“
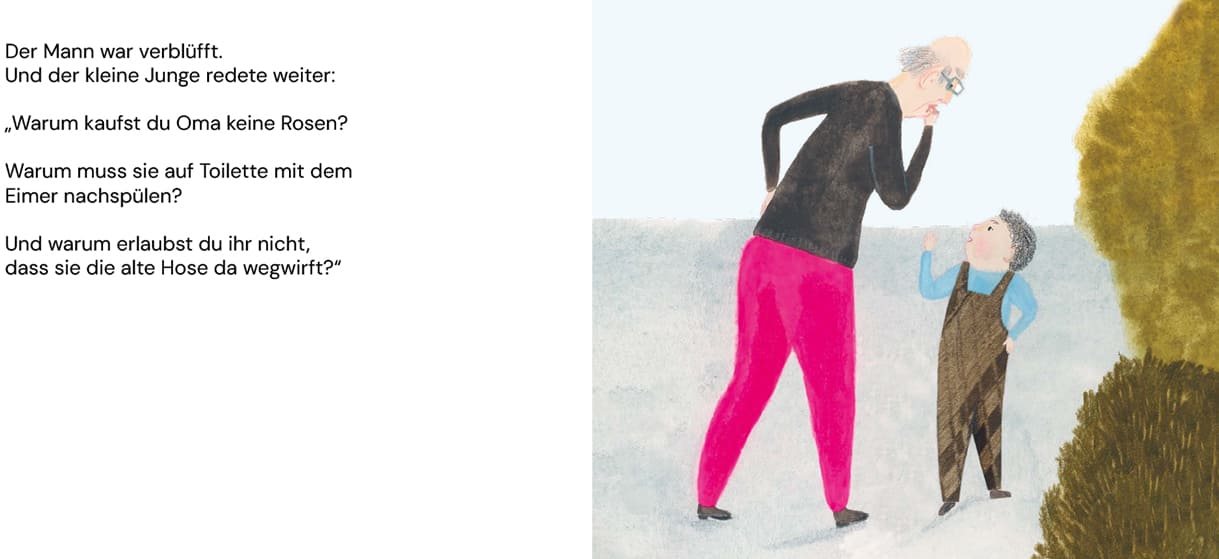
Auch wenn dies eine Art bedingungsloses Plädoyer dafür ist, den eigenen Weg zu gehen, wenn du davon überzeugt bist, so zeigen der Text und Bilder (Andrea Tachezy) zuvor ja einen Mann, dem’s nicht nur egal ist, was andere über ihn denken, er ist zu ihnen ja auch wirklich garstig. Und nie scheint er erklären zu wollen, weshalb er so handelt, um Umwelt zu schützen, Kinderarbeit (Gewand) oder gesundheitsschädliche Arbeiten (Blumen) zu be- und verhindern. Ob das etwas zum Positiven verändern kann?
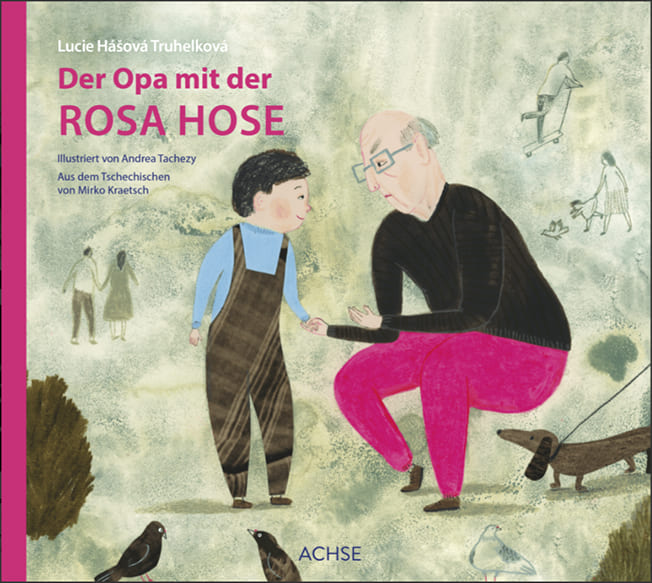
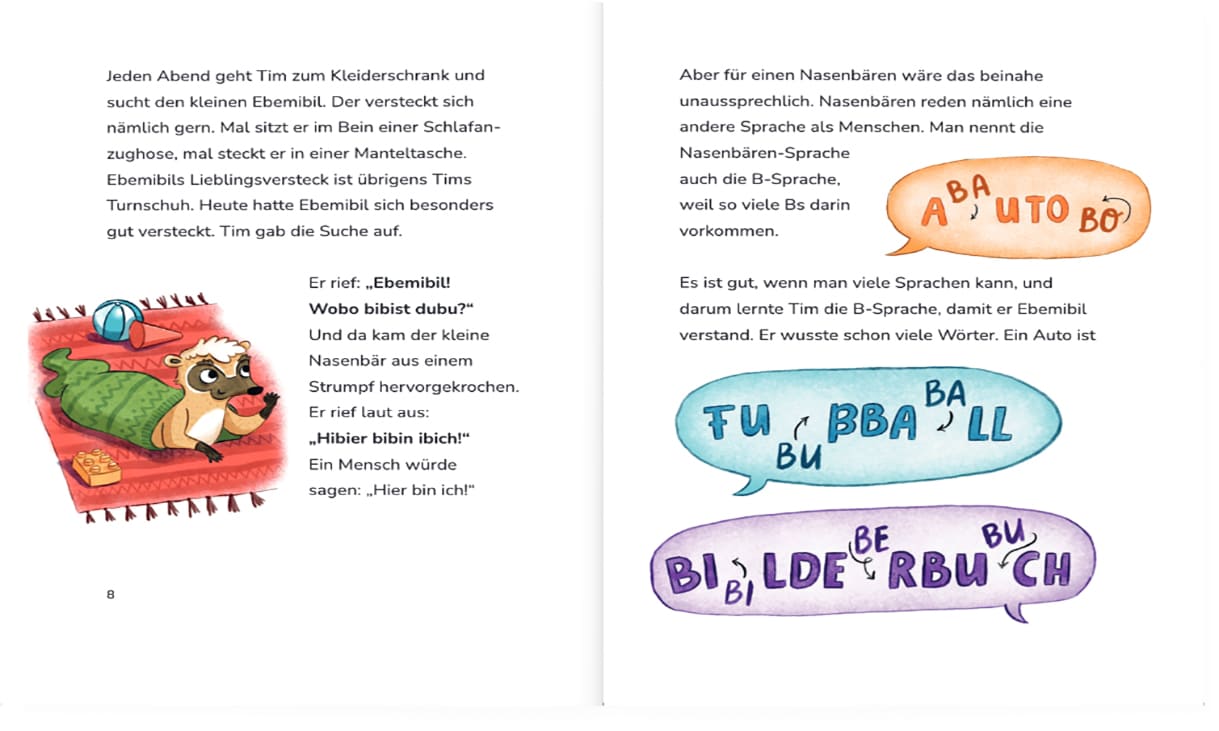
Das Tier, das eines Tages im Kasten von Tim auftaucht ist ein Nasenbär. Der jammert darüber, dass seine Nase zu klein und sein Schwanz zu lang ist.
Nun ja, der Autor Martin Ebbertz – und davon ausgehend auch Illustratorin Wenke Kramp – dürften da wohl offenbar an einen noch sehr jungen Nasenbären gedacht oder sich ihn für die Story zurechtgeschrumpft haben. Denn laut Wikipedia sind diese Tiere gut einen halben Meter und ihr Schwanz nochmals so lang. Passt in keinen Socken, Turnschuh oder in Tims Manteltasche.
Aber abgesehen davon, lebt die knapp 60-seitige, reich bebilderte Geschichte vom abenteuerlustigen Nasenbären, der in die Schule mitkommt, beim Einkaufen Unfug treibt, bei einem kurzen Krankenhausaufenthalt Tim und die jungen Mitpatient:innen aufheitert, von dessen Sprache. „Ebemibil der Nasenbär“ heißt das Buch, das auf dem Cover ein Warnschild aufweist: „Abachtubung Schweber zubu lebeseben“.
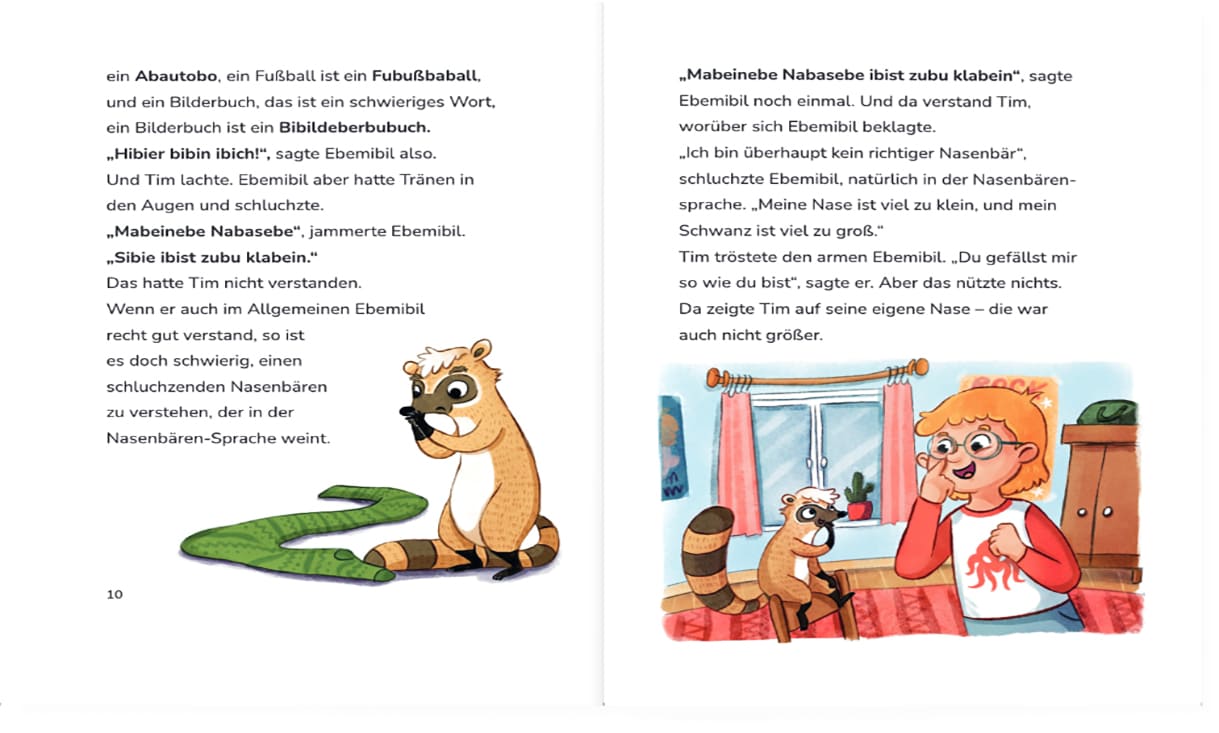
Es handelt sich dabei um die gute alte „Be-Sprache“, die Kinder seit Jahrzehnten – mal mehr, mal weniger – gerne als sogenannte Geheimsprache verwenden. Nach jedem Vokal kommt ein „b“ und dann wird der Vokal wiederholt: abalsobo für also ubund sobo weibeiteber – und so weiter.
Wobei der Autor hier wabeiteber schreiben würde. Denn – anfangs zur Verwirrung – zerlegt er den Zwielaut „ei“ in a+b+ei; offenbar weil das „ei“ eher wie „ai“ als wie e-i ausgesprochen wird.
Unrealistisch wie die Kleinheit des doch weit größeren Nasenbären ist auch, dass Tims Mutter angeblich nichts versteht – die „Be-Sprache“ wird seit Jahrzehnten immer wieder von Kindern verwendet. Dafür wird in diesem Buch so „nebenbei“ ein doch viele – auch schon junge – Jugendliche das Thema Beauty und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper witzig über den Nasenbären Emil, pardon Ebemibil, behandelt. Sowohl tim als auch alle anderen Kindern, denen der Nasenbär begegnet und sein „Schicksal“ der zu kleinen Nase beklagt, finden ihn richtig so wie er ist.
Bis 21. Juni 2025 läuft übrigens noch im kleineren Haus des Theaters der Jugend in Wien das Musical „Mitten im Gesicht“, in dem die Hauptfigur über eine zu große Nase jammert.
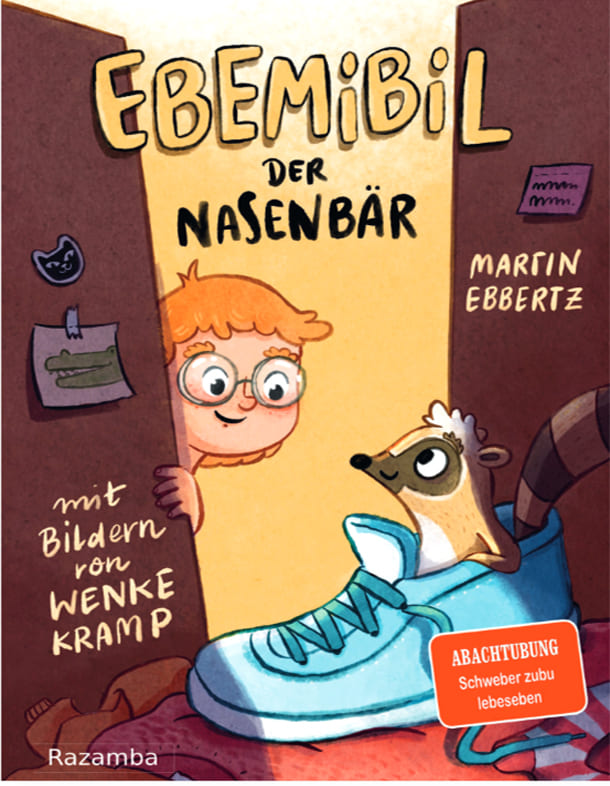

Der Zugang im – vom Publikum aus gesehen – rechten Hintergrund, über den die Schauspieler:innen die Bühne betreten, ist verbarrikadiert. Sieben weiße Sitzwürfel verstopfen ihn. Der erste „Durchbruch“ des Abends: Katharina Farnleitner als Esther „zimmert“ aus den Würfeln ihr Home-Office, ihr Kollege Jonas Deckenbach spielt einen, meist auf zwei Beinen gehenden, Hund. Rent a dog – ein gemieteter Profi. Was wohl dem 20-Minüter der vier Kurzstücke des aktuellen, 17. Nachwuchsbewerbs im Theater Drachengasse, den Titel „Qualitier“ gab (Text, Regie: Sophie Bischoff).

Den Miethund namens Frank brauch die Esther genannte Kopfarbeiterin, um besser, sprich produktiver, werken zu können, ihr Pensum zu erledigen. Doch der hat wie Arbeitskräfte auch Feierabend. Davor aber gibt’s noch Troubles mit einem Laienhund des Nachbarn (Flo Sohn). Und eine Debatte über toxische Mensch-Tier-Beziehungen, Widersprüche zwischen „Hunde wollen ohnehin unterworfen sein“ vs. Emanzipation von (Haus-)Tieren.
Diese erste von vier Kurzproduktionen des Bewerbs verkörpert die Ausschreibung unter dem Titel „Automaten mit Fell“. In der heißt es gleich zu Beginn: „Ob Fell, Federn, Schuppen, ob Schnauze, Schnabel, Sackkiefer, ob herrschaftliche Menagerie oder Tierhortung: Nicht erst seit der Corona-Pandemie nimmt die Haustierpopulation stetig zu. Vom Affenpinscher bis zur Zwergbartagame, vom Koi bis zum Catfluencer erfüllen Haustiere die Funktion eines Statussymbols, eines repräsentativen Ziergegenstands oder schnell verfügbaren Trostautomaten zur emotionalen Wiederherstellung des vereinzelten spätkapitalistischen Subjekts.“
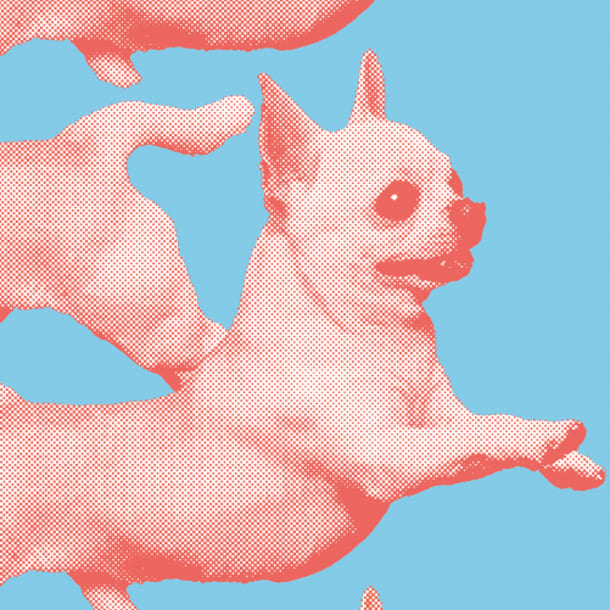
Insgesamt 224 Theatermacher:innen – zwischen 18 und 50 Jahren – hatten für den aktuellen Nachwuchswettbewerb 64 Projekte eingereicht; fast die Hälfte schlugen Sprechtheater-Stücke (47%), knapp weniger (46%) Performance – der Rest verteilte sich auf Live-Hörspiel, Musik- sowie Puppentheater. Aus den Einreichungen wurden in einem mehrstufigen Verfahren die genannten vier Projekte ausgewählt.
Regisseurin Karin Koller stand den Teams als Dramaturgin und Coach zur Verfügung.
Rund zwei Wochen wurden Abend für Abend die rund 20-minütigen Kurz-Versionen oder Szenen gespielt. Am letzten Spieltag (31. Mai) werden nach der Vorstellung die zwei Gewinner:innenprojekte des Wettbewerbs bekannt gegeben, die einerseits aus dem Publikums-Voting (1000 € Preisgeld) und andererseits der Jury-Entscheidung (10.000 €, um daraus eine abendfüllende Produktion weiter zu entwickeln) ermittelt werden.
Den jahrhundertelangen klassischen Zugang (sehr) vieler Menschen zu Tieren stemmt Georg Weislein in der Rolle eines Fleischhauers (da vier von zehn der teilnehmenden Künstler:innen aus Deutschland kommen und gar 53 % dort wohnen, wird er in der Beschreibung „natürlich“ Metzger genannt) in Form von Stoff-Würsten, -Schweinshaxen und so weiter auf die Bühne (Konzept, Text, Dramaturgie, Sound: Sarah Calörtscher; Konzept, Text, Do-Regie: Melanie Durrer; Konzept, Bühne, Kostüm: Veronika Müller-Hauszer; Konzept, Text, Dramaturgie, Co-Regie: Laura Ritzenfeld; der Schauspieler steuerte ebenfalls zu Konzept, Text und Co-Regie bei).
Ausgehend von den Schweine-Teilen werden in „Ich hab dich zum Fressen gern“ die bekannten Themen von zu viel Fett auf menschlichen Rippen, Kalorienzählung, Figurbewusstsein thematisiert.
„Zum Fressen gern“ wird oft ja nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn verwendet, um Zuneigung auszudrücken. Und so sind viele Haustiere ja „des Menschen liebste Freund:innen“. Sind es für die meisten Hund oder Katz, so tummeln sich bei den „Reichen und Schönen“ eher Mini-Ferkel oder Raubkatzen – sicher mit viel Auslauf, dennoch wohl selten artgerecht.
Das was eine Badewanne zu sein scheint, entpuppt sich als Sarg oder Grab. In „Nine Stages of Decay“ (Neun Stadien des Verfalls) sinniert zunächst Florenze Schüssler und später mit ihr Valerie Madeleine Martin über das Jenseits. Oder das Leben im Allgemeinen. Und gibt’s da noch Erinnerungen an das Leben vor dem Tod? „Ich erinnere mich an nichts!“ oder ist es an Nichts?
„Du wurdest als Schauspielerin ausgezeichnet“ – soll der Satz ein fishing für einen der beiden Preise sein? Fällt der Ausbruch von der Bühne – nackt durchs Publikum – auch darunter? Oder ist es eine Anspielung, dass nach dem Tod das sprichwörtliche Hemd keine Taschen hat und daher auch kein Hemd nötig ist? (Konzept, Text: Sunan Gu; Bühne, Kostüm: Feng Li; Konzept, Dramaturgie: Rongji Liao; Musikkomposition, Videoprojektion: Deniz Deli; Konzept, Text, Produktionsleitung,
Lichtdesign, Regie: Nathalie Rosenbaum; die beiden schon genannten Schauspielerinnen haben auch konzeptionell an den Verfalls-Stadien mitgearbeitet.
Deutlich näher am Tier-Mensch-Verhältnis spielt sich die chronologisch vierte Performance des 17. Nachwuchs-Bewerbs-Abends ab (wobei die Reihenfolge sich aus dem bestmöglichen technischen Ablauf ergibt). „Food, Friend or forced Labour“ (Essen, Freunde oder Zwangsarbeit) beginnt nach einem Auftritt der Schauspieler:innen durch den Mittelgang der Publikumsreihen auf der Bühne mit einer vermeintlichen „Sauerei“, weshalb gleich eine große Folie aufgezogen wird: Ausstreuen und verteilen von Erde. Alle drei Schauspieler:innen – Sophie Kirsch, Mila Mila Lyutskanova und Moritz Praxmarer – zeichnen auch für Konzept und Regie verantwortlich.
Mit dem Ausstreuen der Erde beginnen sie Abhandlungen über die Tiere darin – in einer Handvoll frischer Erde sind es mehr als eine Milliarde Lebewesen – von Regenwürmern bis zu Mikroorganismen wie Pilzen. Übrigens, und damit kommen die drei Performer:innen zu unser aller nächsten „Haus“tieren, vielmehr solchen, die in unseren Körpern wohnen – viele davon im Darm. Gedankenspiele über Shit-Transplantationen und die seit vielen Jahren immer wieder gezogenen Parallelen und Vergleichen zwischen Darm und Hirn dürfen nicht fehlen.
Wobei die vielleicht treffendste witzige dazu stammt von de bekannten deutschen Bühnen- und TV-Satirikerinnen, Sarah Bosetti: „Das Gehirn sieht aus wie ein in Kopfform gepresster Dickdarm. Und dann kam mir der Gedanke, dass Gott vielleicht bei einigen Menschen genau diese beiden Dinge … Und dann hat man plötzlich Menschen, die nur Scheiße denken, aber dafür klugscheißen können… wie logisch einem die Welt erscheint, wenn man das im Kopf behält! Beziehungsweise im Darm, je nachdem, zu welcher Sorte man gehört.“


„Ich habe heute einen Fehler gemacht.“ Mit einem solchen Satz betreten die Schülerinnen und Schüler der Reihe nach einen gesprenkelten Stoff-Teppich. Den hatte Fabi aus einer Plakatrollen-Hülle gezogen, die sie mit einem Band über der Schulter mitgebracht hatte. Sie und ihr Kollege Ahmad haben diesen auf dem Boden des Klassenzimmers ausgerollt und ihn „unseren roten Teppich“ genannt.

Alle sagen den Satz weder zerknirscht noch niedergeschlagen, wie es – gerade in einer Schule – vielleicht erwartet würde. Sie wissen: Die Reaktion wird keine demütigende sein. Fröhlich stimmen alle einen Chor an: „Paaaasst schon!“
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… darf wenige Wochen vor Ende des Schuljahres zwei „Fail-Stunden“ einen Lokalaugenschein abstatten. In acht Klassen dreier Wiener Schulen, bzw. hier in der ILB (Integrative Lernwerkstatt Brigittenau – 20. Bezirk) Mehrstufenklassen, die hier seit ewig (gegründet vor mehr als 20 Jahren) „Cluster“ heißen, findet dieses Projekt, finanziert aus der „Mut-Million“, bei der zehn Projekte gefördert werden, die zur psychischen Gesundheit von Schüler:innen beitragen wollen / sollen (mehr dazu in einem eigenen- am Ende verlinkten Beitrag) statt. Fehler machen, etwas, das im Schulsystem (noch?) nicht so üblich ist, ist erlaubt. Ja, sogar wie die eingangs geschilderte Eröffnungs-Szene zeigt, erwünscht.
Es geht in der „Fail“-Stunde – vom englischen Wort für scheitern, misslingen gar versagen – aber natürlich nicht nur ums Feiern von Fehlern, sondern klarerweise um eine der wichtigsten Folgen davon: Lehren, es anders, besser zu machen. Und so steht an diesem Nachmittag des Reporter-Besuchs sogar eine große Herausforderung auf dem Programm.
Der selbe Teppich, der zuvor als „Red Carpet“ für das Lob des Fehlers diente, wird nun zur Challenge für die Schüler:innen. In der ersten Gruppe stellen sich alle auf den länglichen, durchaus schmalen Stoff-Streifen. Und nun gilt es, diesen umzudrehen – ohne sich mit Worten verständigen zu dürfen. In diesem Spiel gilt alles außerhalb des Teppichs als glühende Lava. Es geht also nicht, dass alle runtersteigen, den Stoff umdrehen und sich wieder draufstellen. Stück für Stück wenden, kurz das eine oder andere Bein hoch, draufstellen, einander ausweichen, nur mit Gesten kommunizieren… Und siehe da – die Gruppe schafft’s rasend schnell. Es hat zwar niemand mitgestoppt, aber gefühlt hat’s nicht viel mehr als eine Minute gedauert.
Nicht nur weil die jungen Jugendlichen aus dem „Übergangs-Cluster“ (4. bis 6. Schulstufe) die Aufgabe so flott bewältigt haben, folgt Phase zwei mit einer zusätzlichen Herausforderung: Einige der Schüler:innen, die sich freiwillig melden, kriegen die Augen verbunden. Und dennoch darf wieder nicht gesprochen werden! Klarerweise braucht’s nun doch einiges länger, bis der Teppich nach der neuerlichen Wende nun wieder in der Ausgangsposition da liegt – wobei er auch noch um vier schmale Streifen gekürzt wurde – für die Augenbinden.
Die zweite Gruppe an diesem Nachmittag ist sehr klein, weil die Schüler:innen erst von einem Ausflug in die Au zurückgekommen sind, die etliche doch ermüdet hat. Die verbleibenden wenigen Jugendlichen werden nun ergänzt um eine Lehrerin und die beiden Trainer:innen, die zunächst alle reihum einen Fehler dieses Tages in der Runde vorstellen, um danach das Teppich-Spiel mit einem kleineren, dickeren und gleich mit Augenbinden für Fabi und Ahmad in Angriff nehmen. Eine heftige Challenge auf dem viel engeren zu wendenden und weniger flexiblen Material. Doch auch da gelingt’s – wenngleich mit viel mehr Zeitaufwand und manchen fast ausweglos scheinenden Momenten.
Die Mitwirkenden mit den verbundenen Augen müssen auf die per Berührungen der anderen erbetenen Bewegungen vertrauen können.
Funktioniert aber nicht immer – wie die beiden Trainer:innen in der Runde danach erklären. Es hat auch schon Gruppen gegeben, in denen einige diese spielerische Herausforderung praktisch boykottiert haben und immer wieder absichtlich vom Teppich gestiegen sind – was nach mehreren Versuchen ihre Mitschüler:innen ziemlich frustriert hat. Auch das ist in einer Failstunde möglich, wird dann aber als Fehler nicht gefeiert, sondern dient als Anlass, in der Gruppe ausführlich darüber zu diskutieren, was, warum passiert (ist) und wie damit umgegangen werden könnte.
Fabi (Fabienne Mühlbacher), die Gründerin der „Fail-Stunde“ übermittelt Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die fünf Phasen des Projekts – wenn es ein Schuljahr dauert, es gibt auch ganz kurze Einheiten als Workshops – übrigens auch für Unternehmen.
1. Funtasie – bewusst so geschrieben und kein, wie natürlich auch angenommen werden könnte, positiver Fehler 😉
Spaß & kreativ sein, Improvisationen
2. Ich-Selbst-Stärkung
Beispielsweise durch Talenteshows – aber ohne Wettbewerb
3. Empathie
Theater spielen, in Rollen schlüpfen…
4. Hydra
Fehler-Hurricane, Übungen zu den einzelnen Schritten
5. Risikofreude
Challenges im Team zur Anwendung von allem davor Erlerntem
Das Projekt nimmt – auf seiner Homepage beschreiben – Anleihe bei der greichischen Mythologie einer- und bei Nassim Nicholas Taleb andererseits. Der im Libanon geborene Finanzmathematiker und Wissenschafter (u.a. Professor in London und New York), der bekannt wurde für die Beschäftigung mit höchst unwahrscheinlichen Ereignissen und ihrer Verarbeitung („Schwarze Schwäne“) diente mit seinem Buch „Antifragilität: Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen“ eine Erweiterung dessen, was als Resilienz bekannt ist. Die Fail-Stunde schreibt, dass dieser neue Begriff „unsere Philosophie auf den Punkt bringt“.
„Der Phönix erhebt sich aus der Asche. Man erlebt einen Rückschlag, und steht aber wieder auf – das ist für Taleb Resilienz. Das Schwert des Damokles hängt über ihm und kann ihn durch einen einzigen Schlag vernichten. Alles ist zerstört, nichts wird wieder geboren. Taleb verwendet für dieses Konzept den Begriff „Fragilität“. Als Herkules der Hydra einen Kopf abschlägt, wächst dieser zweifach nach. Diese Idee von sogenannter „Antifragilität“ wollen wir euch in der Failstunde vermitteln: Nach einem Rückschlag steht ihr nicht nur wieder auf, nein: Ihr geht sogar gestärkt, mit neuen Chancen und doppelt so viel Wissen daraus hervor!“

Sophia aus er zweiten Gruppe sowie Lena und Amina aus der ersten Gruppe erzählen in Video-Interviews, die unten verlinkt sind, erzählen mehr und ausführlicher darüber, was die Fail-Stunden (nicht nur) für sie bedeuten und bringen; sogar in dieser Schule, die von Anfang an auf respektvollen, empathischen, offeneren, demokratischeren Umgang miteinander großen Wert legt. Diese, nunmehr das ganze Schuljahr gelaufenen Stunden haben vor allem etwas, das (nicht nur, aber schon sehr) im Schulsystem häufig vorkommt, stark eingeschränkt: „Fehler-Shaming“ wie es Sophia in ihrem Video auf den Punkt bringt.

Wobei anzumerken bleibt, dass viele Lehrer:innen bzw. wie sie in der ILB heißen Lernbegleiter:innen vor allem mit reformpädagogischen Zugängen – seit viiiielen Jahrzehnten – auch zu Fehlern einen offeneren Zugang haben. So gab es schon vor mehr als 30 Jahren in etlichen Volksschulen zwei verschiedene Schreibhefte: In dem einen ging’s geht’s darum, Geschichten zu schreiben OHNE auf Fehler zu achten. Damit soll die Lust am schriftlichen Erzählen gefördert werden, ohne sich beim Schreiben auf das zu beschränken von dem das Kind annimmt zu wissen, wie es richtig buchstabiert wird. Und erst aus den hier gemachten aus Grammatik- und Rechtschreib-Fehlern wird gelernt und dieses dann richtig im zweiten Heft geübt.
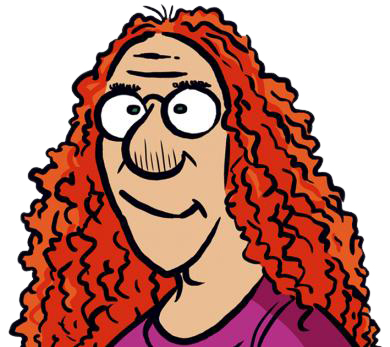
Mit einem Lächeln im Gesicht zeigt sich die 12-jährige Lena im Interview über das nun fast schon das ganze Schuljahr gelaufene Projekt „Fail-Stunde“ ganz überschwänglich euphorisch: Begriffe wie „mega super lustig und spannend“ und noch etliche Lobesworte mehr sagen sie, und ihre Schulkollegin Amina in einem Video-Interview für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… über diese Art Auszeit in der Schule. „Man kann alle Fehler machen und sagen und jeder wird’s akzeptieren“, ist ein weiteres Zitat aus den Aussagen der Schülerinnen.
„Hier haben wir gelernt, dass Fehler-Shaming so wie Body-Shaming nicht in Ordnung ist“, bringt es Sophia, eine weitere Schülerin – gegen Ende eines Lokalaugenscheins von KiJuKU.at in der ILB (Integrative Lernwerkstatt Brigittenau), einer der Schulen, die das Projekt in diesem Schuljahr ins Haus geholt haben (finanziert aus der Mut-Million), auf den Punkt.
Der Reportagen-Besuch – Link zum Bericht weiter unten – fand just rund um die Bekanntgabe neuer Integrationsmaßnahmen der Bundesregierung statt. Dabei hatte die dafür zuständige Ministerin Claudia Plakolm unter anderem verkündet: „Es wird auch Abschlussprüfungen (der Deutschkurse, Anmerkung der Redaktion) geben. Und wenn jemand einen Deutschkurs wiederholen muss, wird es einen Selbstbehalt geben.“
Übrigens, die 30-jährige Politikerin begann vor elf Jahren ein Studium der Wirtschaftspädagogik an der Universität Linz. Ob sie, sollte sie je eine Prüfung versemmelt haben, für eine Wiederholung Strafe zahlen musste? Und wie sie unterrichten würde, wenn sie einmal ihr Studium abschließt und aus der Politik ausscheidet?
Obwohl es – ausgehend von reformpädagogischen Ansätzen – schon seit Jahrzehnten auch im regulären Schulbetrieb immer wieder Pädagog:innen gibt, die Fehler nicht bestrafen, sondern als Ausgangspunkt für Dazu-Lernen betrachten, baut das System stark darauf auf, Fehler hervorzuheben. Allein schon rot anstreichen ist ein Ausdruck dessen.
Gut zweieinhalb Jahrzehnte war es möglich, in der Volksschule zuerst bis zur Mitte der dritten, dann sogar der vierten Klasse ohne Noten nur mit verbaler Beurteilung oder anderen Leistungsfeststellungen – etwa Pensenbüchern, Arbeitsmappen usw. – auszukommen. Unter der Türkis-blauen Regierung (Sebastian Kurz, heinz-Christian Strache) wurden zwangsweise wieder Noten eingeführt. Manche Schulen finden Wege, dies zu umgehen 😉
Schon vor vielen Jahren kam der damalige Universitätsprofessor Rupert Vierlinger (1932 – 2019), der jahrzehntelang an verschiedenen Universitäten zum Thema Leistungsbeurteilungen geforscht hatte, aufgrund empirischer Untersuchungen drauf, dass selbst ein und die selbe Mathe-Schularbeit verschieden benotet wurde. Zusammenfassend stellte er in einem Beitrag für „erziehung heute“ fest: „Die Schüler werden nicht ermuntert, um der Sache willen zu lernen, sondern um der Note willen. Außerdem erfüllt die ständige Sorge um den Rangplatz den Schüler mit Angst, die zu psychosomatischen Störungen und im Extremfall sogar zum Selbstmord führen kann. Darüber hinaus lässt die für die Notenfindung unabdingbare ständige Beobachtung die forschende Grundhaltung verkümmern.“ Daraus schlussfolgerte er pointiert, Ziffernnoten sind „feindliche Agenten im Reich des Lernens“. (Zitat aus Kinder-KURIER, 2018).
Und was sagte der damalige Bildungsminister Heinz Faßmann im November 2018 in einem ZiB2-Interview damit konfrontiert, dass die Forschung Ziffernnoten vor allem in den ersten Schuljahren für kontraproduktiv hält?
Sinngemäß meinte der Minister, der übrigens neben Schulen auch für Wissenschaft und Forschung zuständig war, die Wissenschaft solle sich nicht überall einmischen ;(

Vor rund 1000 Schüler:nnen fanden in der letzten Maiwoche 2025 die Landes-Finali der Schüler:innen-Ligen statt. Bei den Mädchen haben die Kickerinnen aus dem Polgargymnasium eine Art Abo. Ihre Dauer-Gegen-Spielerinnen aus dem Ella-Lingens-Gymnasium mussten sich dieses Mal aber im Semifinale den Spielerinnen der De La Salle Schule im 7-Meter-Schießen nach einem 0:0 geschlagen geben, so sie gegen die Fußballerinnen der Sportmittelschule Wittelsbachstraße um Platz 3 spielten.

Nach neun Minuten im Finale erzielte Lenia Knofl das 1:0, sie sollte in der Folge noch drei Tore schießen. Dazwischen aber erhöhten zunächst Caroline Omerzu und Mia Neuhauser auf 3:0, ehe Knofl mit zwei Toren den 5:0-Pausenstand (gespielt wird zwei Mal 25 Minuten) herstellte, um gleich nach der Pause zum vierten Mal einzunetzen. Omerzu, Kalajdžić, zweimal Lethner erhöhten auf 10:0 ehe Figura den Entstand von 11:0 festmachte.
Bei den Burschen bestritten die Kicker der Sportmittelschulen Wendstattgasse (Favoriten; 10. Bezirk) und Hetzendorf (Meidling; 12. Bezirk) das Finale, das die Favoritner 3:0 gewannen; die Polgargassen-Boys gewannen das „kleine Finale“ um Platz 3 gegen die Kollegen der Sportmittelschule Donaustadt nach einem 0:0 im 7-Meter-Schießen für sich entschieden haben.
Vom 15. bis 18. Juni 2025 finden die Bundesmeisterschaften der Mädchen im Vorarlberger Hohenems und vom 21. bis 25. Juni die der Burschen im oberösterreichischen Obertraun mit allen das Bundesländer-Sieger:innen statt.

Wenn sie vor ihren Auftritten nervös sein sollten, so überspielen die 15 (sehr) jungen Darsteller:innen von „Nein, natürlich nicht“ dies gekonnt. Bis kurz vor Stückbeginn wuseln sie quietschvergnügt durch die Gänge der Kinderkultur im WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) in der Wiener Währinger Straße. Sie, das sind Kinder der Ganztags-Volksschule Neubau (Zieglergasse; 7. Bezirk), die in einem mehrmonatigen nachmittäglichen Freizeitkurs diese Aufführungen erarbeitet und geprobt haben.
Frei nach George Orwells Klassiker „Farm der Tiere“ erheben sich die Tiere gegen die Diktatur der Menschen und nach erfolgter Revolution spielen sich einige von ihnen erst recht wieder zu Herrscher:innen über die anderen auf. Der Autor hatte sein Buch 1945 als Parabel auf einstige Revolutionäre in der Sowjetunion, die sich zu Diktatoren mauserten (Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, vulgo Stalin) gedacht. Die Tiere standen für Menschen, noch nicht für den ausbeuterischen Umgang von Menschen mit Tieren.

Rund um Mauern aus Karton-Boxen agieren Alexandra, Anna, Ariadni, Ava, Ava, Bruno, Doris, Elisa, Florentina, Kyliane, Lorena, Lotti, Marlene, Mei, Mia, Olivia äußerst spielfreudig (Idee, Regie, Leitung: Florian). Immer wieder steigen einige aus den Szenen aus, um sich andere Rollen zu wünschen; oder zu erklären: Wir spielen zwei Bäume… oder – mit Verweis auf Wiedergeburt – nun zwei Büsche.
So manches zitieren die Kinder, deren Spiellust sich auf das Publikum überträgt auf der Bühne direkt aus dem (übersetzten) Original, nicht zuletzt die sieben Gebote: 1. Alles, was auf zwei Beinen geht, ist ein Feind; 2. Alles, was auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund bis zu 6. Kein Tier darf ein anderes Tier töten und schließlich 7. Alle Tiere sind gleich.

Sie verjagen die tyrannische Frau DoktorDoktor vom Hof und freuen sich nun ihrer Freiheit und Selbstbestimmung. Obwohl sie nach wie vor, Menschen als ihre Feinde betrachten, wollen sie sich offenbar auf gefinkelte Art an ihnen rächen: Der Bauernhof wird zur touristischen Attraktion, um der reichste seiner Art zu werden 😉
Die Gleichheit aller Tiere beginnt zu wackeln, als sich eines der Tiere zur Lehrerin als eine Art neuer Herrscherin aufschwingt.

Eingebaut haben die Kinder mit ihrem Regisseur mediale Berichterstattung. Die Moderatorin von ORF 76835 kündigt Live-Einstiege eines Reporter:innen-Teams vom Geschehen in diesem Bauernhof an.
Die ¾-stündige von Spielfreude und -witz der Kinder gekennzeichnete Aufführung ist auch mit fast einem Dutzend Songs untermalt (Liste in der Info-Box). Gegen Ende, wenn „Komet“ von Udo Lindenbergs und Apache 207 erklingt, singen so manche der Kinder im Publikum den Text mit, in dem es unter anderem heißt „Und wenn ich geh, dann so, wie ich gekommen bin / Wie ein Komet, der zweimal einschlägt / Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher geh’n / Dass ich für immer leb, lass uns nochmal aufdreh′n…“

Zum 17. Mal in diesem Jahrhundert kamen junge und jüngste Abgeordnete aus Kinder-Gemeinderäten und -Parlamenten zusammen (im vorigen gab es Anfang der 90er Jahre bereits einige – österreichweite – Kindergipfel in der Steiermark in Mürzsteg). 140 Vertreter:innen der jungen Generation aus 16 Gemeinden und Städten (Bruck an der Mur, Eibiswald, Eisenerz, Feldkirchen bei Graz, Fernitz-Mellach, Gössendorf, Graz, Hart bei Graz, Kapfenberg, Lebring, Raaba-Grambach, Riegersburg, St. Stefan im Rosental, Tillmitsch, Trofaiach, Wildon) diskutierten und arbeiteten – dieses Mal in Wildon – in Workshops und danach im Plenum zum diesjährigen Motto „Aufgepasst! Wir haben’s im Blick! Unsere Sicherheit geht vor“.
Praxisnah rückten Kindergemeinderät:innen und -parlamentarier:innen eines Workshops aus und führten mit Unterstützung der Polizei Radarkontrollen durch. Statt Strafen gab es Zitronen für Raser:innen. Im Gegensatz zur üblichen Praxis in der Realität gab es dafür auch Lob für rücksichtsvolle Autolenker:innen – ihnen überreichten die Kinder Äpfel als lohnenden Dank. Die Polizei sorgte auch für einen sicheren Weg vom Bahnhof zum Veranstaltungsort und stellte sich in einem Radio-Workshop den Fragen der Kinder.

In anderen Workshops ging es ums Wohlbefinden: In Spielen, kreativen Arbeiten mit Ton oder mit Rätseln oder einer Schnitzeljagd wurden viele Bereiche des großen genannten Themas bearbeitet, die Umgebung erkundet, ein Insektenhotel gebaut und in einem Theater-Workshop bot eine Bühne Platz für Szenen zu Zivilcourage.
Kindergipfel, ebenso wie die Gemeinderäte oder Parlamente in den Städten und Orten sind ein konkretes, wichtiges Mittel, um eines der zentralen Kinderrechte (Konvention von der UNO 1989 beschlossen), das nach Mitsprache und Mitbestimmung umzusetzen. Jedes Jahr steht bei den Gipfel-Treffen ein anderes Thema im Zentrum, das sich ebenfalls aus der Kinderrechtskonvention ableitet.
Sicherheit und Schutz – im Straßenverkehr, in der Umwelt und im täglichen Miteinander – waren eben dieses Mal das Thema. Die Kinder setzten sich intensiv mit den Verkehrssicherheit, psychischer Gesundheit und Wohlbefinden sowie einer sicheren und sauberen Umwelt auseinander. Die Kinderrechte auf Gesundheit, Spiel und Freizeit, Schutz vor Gewalt und Beteiligung sowie der im Artikel 3 der Konvention festgehaltene Grundsatz, dass bei allen Entscheidungen, die Kinder betreffen, stets das Kindeswohl an erster Stelle stehen muss, wurden von den Kindern letztlich in neun konkrete Botschaften „übersetzt“.

Diese schrieben die Kinder auf Wolken, die gemeinsam mit bunten Regenschirmen in der Volksschule Wildon angebracht werden. Dies sind die neun Botschaften von denen eine titel dieses Beitrages wurde:
Begleitet und organisiert wurde das steirische Gipfeltreffen von beteiligung.st, der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bürger:innenbeteiligung in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Wildon sowie dem Kindergemeinderat Wildon.

Zwei der mehr als 140 Kinder, die am letzten Mai-Wochenende ihre Gedanken, Ideen, Wünsche, Forderungen und Vorschläge beim 17. Steirischen Kindergipfel einbrachten (Bericht dazu in einem eigenen Beitrag, unten verlinkt), gaben in einer Pause Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ein Interview – am Telefon, weil KiJuKU.at bei anderen Veranstaltungen in Wien unterwegs war.
Sowohl Isabel (12) als auch Lina (13) reisten aus Bruck an der Mur nach Wildon, dem diesmaligen Gipfel-Ort. Sie hatten in ihrer Stadt auch schon einen Kindergipfel. Beide nahmen dieses Jahr bereits zum dritten Mal an der Zusammenkunft von Kindern teil, die sich in ihren jeweiligen Orten, Gemeinden, Städten als Kinder-Gemeinderät:innen oder -Parlamentarier:innen engagieren.

KiJuKU: Wie bist du dazugekommen, Kindergemeinderätin und Teilnehmerin an Kindergipfeln zu werden?
Isabel: Ich hab vor drei Jahren davon gehört und mich dafür interessiert, weil ich ein bisschen was verändern und dabei mithelfen wollte, um die Stadt kinderfreundlicher zu machen.
KiJuKU: Was waren oder sind dabei deine wichtigsten Anliegen, wodurch könnte Bruck an der Mur sich in diese Richtung verändern?
Isabel: Wir haben drei Spielplätz, zwei sind wirklich schön, aber einer ist etwas grau und langweilig.
KiJuKU: Und, konntet ihr da etwas verändern?
Isabel: Wir Kinder haben darauf geschaut, dass Bäume in Töpfen auf diesen Spielplatz kommen.
KiJuKU: Waren nur Spielplätze ein Thema oder auch anderes, um die Stadt kinderfreundlicher zu machen?
Isabel: Wir haben im Kindergemeinderat auch andere Dinge besprochen, ein paar Mal sind auch Politikerinnen und Politiker aus der Stadt zu uns gekommen, um mit uns über unsere Vorschläge zu reden.

KiJuKU: Was waren oder sind andere Themen, die euch wichtig sind?
Isabel: Sehr wichtig ist uns Müll. Es stört uns Kinder, dass viel Mist fast überall herumliegt.
KiJuKU: Gibt es zu wenige Mistkübel?
Isabel: Nein, es gibt fast an jeder Ecke einen Mistkübel, aber vielen Leuten ist das offenbar egal, sie lassen Müll fallen und liegen.
KiJuKU: Was kann dagegen – oder vielmehr für das Gegenteil getan werden?
Isabel: Wir Kinder haben Schriftplakate gemalt, mit denen wir Menschen bitten, ihren Mist in die Kübel zu werfen. Bei manchen hat es auch schon etwas bewirkt.
KiJuKU: Wie viele Kinder machen im Kindergemeinderat mit und wie oft trefft ihr euch?
Isabel: So ungefähr zehn bis 15 Kinder kommen einmal im Monat zusammen.
KiJuKU: Was war / ist dir beim Kindergipfel wichtig?
Isabel: Mir war’s immer wichtig, neue Leute aus den anderen Kindergemeinderäten und -Parlamenten kennen zu lernen und von ihnen über ihre Arbeit zu erfahren.
Im Vorjahr war der Kindergipfel in unserer Stadt und da durften wir ein bissl mitorganisieren.

KiJuKU: Was war bzw. ist dir das wichtigste Anliegen als Kindergemeinderätin?
Lina: In Bruck ist mir besonders wichtig, dass die Stadt ein bisschen grüner wird. Es gibt so viele Straßen und Beton und nicht wirklich viele Pflanzen. Kleine Kinder haben so in ihrer Wohn-Umgebung nicht viel Natur.
KiJuKU: Was schätzt du an den Kindergipfeln?
Lina: Dass ich hier immer die Kinder von den anderen Parlamenten und deren Beweggründe für ihre Aktivitäten oder neue Themen kennenlernen kann.
KiJuKU: Was waren neue Themen für dich?
Lina: Beim ersten Gipfel wo ich dabei war, ging’s vor allem um Umweltverschmutzung und was alle dagegen tun können, um die Natur sauber zu halten.
Beim zweiten ist es vor allem um Verhalten gegenüber Menschen gegangen, auch wenn sie andere Religionen haben oder aus anderen Ländern kommen.
KiJuKU: Aber war das neu, wird das nicht auch in der Schule besprochen?
Lina: Schon, ab und zu reden wir auch in der Schule darüber, aber beim Kindergipfel war viel Neues dabei.
Und heuer reden wir viel über Polizei, Sicherheit, psychische Gesundheit, saubere und sichere Umwelt und Verkehr; unser Motto ist „Aufgepasst, wir haben’s im Blick!“
KiJuKU: Apropos Verkehr, wie schaut’s da in Bruck aus?
Lina: Wir haben keine Zebrastreifen und Ampeln außer bei den Hauptstraßen, aber es ist bei uns relativ sicher, die Autofahrerinnen und Autofahrer passen schon auf Fußgänger auf.

KiJuKU: In welchem Workshop hast du mitgearbeitet?
Lina: Bis jetzt, so wie die Isabel, in der Wohlfühlwerkstatt. Wir haben Zettel geschrieben mit Komplimenten an uns selber. Und die geben wir in Gläser. In diese Wohlfühlgläser können wir irgendwann reingreifen, wenn’s uns nicht so gut geht und einen solchen Zettel rausnehmen und lesen!
Und wir haben an Botschaften gearbeitet – siehe den unten verlinkten Beitrag dazu.
Isabel: Im Vorjahr haben wir unsere Botschaften auf Holzmanschgerln (große hölzerne Figuren, siehe Foto oben) geschrieben, heuer auf Papier-Wolken.

Der Saal wird dunkel – was es bei den nächsten Auftritten, die im Freien stattfinden, natürlich nicht spielt 😉 – aus dem Off ertönt die Stimme von Martin Puntigam, Kabarettist und „ewig“ langer „Blöd“-Frager in der Wissenschafts-Show Science Busters. Wie es denn da zur Bühne gehe, will er wissen, klingt ein wenig verzweifelt. Und taucht auf – nicht in echt, sondern als animierte fast comicartige Figur im Setting eines Computerspiels, irrt er über Treppen – mit nicht ganz leichten Anweisungen von Martin Moder, Molekularbiologe. Mit ihm steigen – bis Mitte November 2025 – die nächsten „Scien Busters for Kids“-Termine. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat die neue Show am letzten Mai-Wochenende im Wiener Stadtsaal besucht.
„Natürlich ist der Wissenschafter dann schon vorher auf der Bühne bevor der Moderator leibhaftig ebendort erscheint. Dieser spielt den „blöden“ Fragensteller, um dem „G‘scheiten“ die Möglichkeit zu einfacher Erklärung zu geben. Dieses Muster – nicht auf Wissenschaft, sondern Politik und andere Themen bezogen, wurde vor mehr als 100 Jahren als Doppelconférence im ungarischen Budapest erfunden. Bald danach wurde es im Wiener Kabarett, vor allem dem „Simpl“, erfolgreich importiert und jahrzehntelang – mit zwangsweiser Unterbrechung in der Nazizeit – gespielt.

Zurück zu den „Wissenschafts-Meistern“. Puntigam knüpft an seinen Irrweg durchs Dunkel an und einer (möglichen) Angst vor Drachen. Moder erklärt, wie sich fast weltweit Legenden von Drachen aus der Kombination von Greifvögeln, Raubtieren und Schlangen gebildet haben. Drachen ist aber nur der „Schuhlöffel“ um zum Thema Feuer zu kommen. Wie könnte denn so ein Wesen überhaupt Feuer speien, ohne sich selbst innerlich zu verbrennen?
So greift Moder zu einem Lötkolben produziert eine Flamme mit rund 2000 Grad Celsius und probiert, ob eine Alufolie dieser standhalten könnte. Gar nicht!
Eine handelsüblich (Baby-)Windel – nicht eine wie jahrhundertelang verwendet nur aus Stoff, die oft gewechselt werden musste, sondern eine sehr saugfähige – ist’s, die dank der Aufnahmemöglichkeit von sehr viel Flüssigkeit eine ganz ordentliche Zeit auch der Flammenhitze standhalten kann. Der Superabsorber (Hydrogel aus vernetzten Polymeren) kann auf das bis zu 1000-fache aufquellen – aus den mit Wasser getränkten kleinen Kügelchen wird in der Hitze viel Wasserdampf. Womit sich auch erklärt, weshalb der Arm des Wissenschafters, der schon davor in Flammen stand, nicht verbrannte 😉
Für viel Heiterkeit sorgen die folgenden Dialoge rund um heiße Luft, die aus Körpern entweicht – mit Sachinformationen, dass eine einzige Kuh täglich bis zu rund 500 Liter Methangas entweichen lässt und 99 Prozent dessen, was bei einem Furz den Po verlässt, nicht stinkt.

Nach ur-heiß wird mit seeeehr kalt experimentiert. Rund 200 Grad kalter Stickstoff, der bei diesen Temperaturen flüssig wird, ergibt beim Ausleeren in der viel wärmeren Luft sehr beeindruckend Nebelwolken.
Senf-Weit-„Speib“- Versuche, eine Flaschenrakete und nicht zuletzt eine Hammerattacke auf Ziegel, die auf einem großen Brett auf Moders Brust, von Puntigam zertrümmert werden und warum das nicht weh tut, sind weitere der beeindruckenden Experimente der knapp mehr als einstündigen immer wieder auch witzigen Wissenschafts-Show, der Science Busters-for-Kids-Performance – die nächsten Termine in der Info-Box unten.

Zurück zum Muster Gscheiter und Blöder: „Frag nicht so blöd!“ gibt es bei den Science Busters nicht. Im Gegenteil. Blöd ist, wer nicht fragt! Lautet ein Motto der Science Busters for Kids, das andere von der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach ausgeborgte Zitat „Wer nichts weiß, muss alles glauben“.
Wobei es schon blöde Fragen gibt: Wenn Erwachsene von Kindern beispielsweise wissen wollen, ob sie Mama oder Papa lieber haben oder wie König Lear im gleichnamigen Shakespeare-Stück seinen drei Töchtern Beweise abnötigt, welche ihn wie stark liebt.
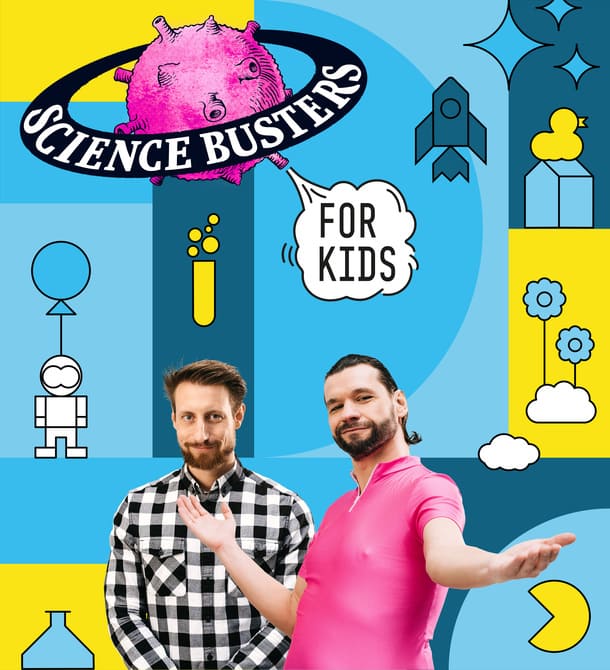

„Nur noch ein bisschen…“ möchte Momentchen im Bett kuscheln – auch wenn das Weckerläuten hier anmutig aus einer Querflöte kommt. „Momentchen“ (Kollektiv „am apparat“) heißt auch das nicht ganz einstündige Stück (ab 6 Jahren), das märchenhaft unterschiedlichen Zeitbegriffe von Kindern und Erwachsenen thematisiert und nun Premiere im Dschungel Wien hatte.

Kinder und Erwachsene leben oft sozusagen in unterschiedlichen Zeit„zonen“. Wochentags in der Früh sollen Kinder in den Turbo-Modus schalten, aufstehen, „tu endlich weiter“ dürfen sie keine verträumten Momente erleben. Wenn sie am Wochenende aber frühmorgens schon putzmunter sind, ist das Eltern nicht immer recht. „Warte, gleich!“, kriegen Kinder meist auch alle Tage und recht häufig zu hören, wenn sie etwas wissen oder erzählen wollen – dann sollen sie auf Ultra-Zeitlupe schalten.
„Momo“, der vor mehr als 50 Jahren von Michael Ende veröffentlichte Roman, Dutzendfach auch als Theaterstück inszeniert und mehrfach verfilmt, ist der Klassiker der Verarbeitung des unterschiedlichen Zeitbegriffs, wo graue Herren den Kindern und allen, die sich auf diese einlassen, Zeit stehlen.

Zurück zu „Momentchen“: Will das Kind, gespielt von Nicholas Hoffman, in der Früh noch länger unter der wohligen Decke bleiben, so würde es später gern den Turbo einschalten und urschnell erwachsen werden – um endlich ein Handy zu kriegen. Was so nicht ganz schlüssig ist, haben doch die meisten Kinder auch schon in jungen Jahren ein solches (Text, Illustrationen: Edwarda Gurrola; Outside Eye = dramaturgische Beratung: Raffaela Gras).
Aber davon abgesehen, beginnt eine wie schon eingangs kurz erwähnt, märchenhafte Geschichte. Momentchen ist mit der Klasse im Haus des Meeres und trifft dort auf ein vom echten Schwanzlurch Axolotl inspiriertes Fantasiewesen namens Axolotta. Und dieses knallgelbe Wesen verschafft Momentchen die zauberhafte Fähigkeit, Zeit zu dehnen oder zu stauchen – je nachdem. Pausen in der Schule werden lang, langweilige Unterrichtsstunden kurz.

Und diese fantasievollen Zeitveränderungen spielen sich auf zwei Ebenen ab. Der schon erwähnte Schauspieler agiert im Wechselspiel mit ausgeschnittenen Pappfiguren in einer kleinen Greenbox, die live von Elina Lautamäki, die auch für die ebenfalls Live-Musik sorgt, bewegt werden. Figuren – seiner Klassenkolleg:innen Ramona, Gino und der Ober-Mobber Billy, aber auch eine alte Frau in der U-Bahn – und Schauspiel ergeben kombiniert groß projizierte Live-Trickfilm-Szenen. Somit sind nicht nur die Trickfilm-Szenen zu erleben, sondern auch ihr Making of: Künstlerische Leitung, Video, Bühne: Jan Machacek; Musik, Programmierung: Oliver Stotz; Licht, Video: Bartek Kubiak; Kostüme: Hanna Hollmann; Bühnenbauten: Wallner Kopp.
Übrigens: Momentchen wünscht sich von Axolotta, die wie all ihre Artgenoss:innen Körperteile nachwachsen lassen kann, ein sozusagen aus seiner Hand wachsendes Mobiltelefon – und kriegt von ihr hingegen ein Herz; was ihn zunächst enttäuscht, aber dann… lässt sich die Hauptfigur natürlich auf dieses Spiel ein – und mit ihr das Publikum – mit einem überraschenden Handy-Auftritt am Ende 😉

„Auf meine Freunde muss ich nicht lange warten. Wenn ich an sie denke, sind sie da. Und – sie sind meistens unsichtbar.“
Das sind die ersten der wenigen Sätze in dem brandneu erschienen Bilderbuch „Solche Freunde“. Ein sehr aufgeweckt und neugierig dreinschauendes junges Kind, das im gesamten Buch namen- und alterslos bleibt, aber von den Zeichnungen her noch gut zwei, drei Jahre braucht, bis es in die Schule gehen kann, spielt mit sehr fantasievollen Freundinnen und Freunden. Die meisten der Spielgefährt:innen sind irgendwie tierisch und würden in anderen Geschichten vielleicht als gefährlich, fruchteinflößend ja fast monströs auf der Bildfläche erscheinen. Wobei die Gesichter dieser „Monster“ Ungefährlichkeit signalisieren.
Die Erwachsenen in diesem Haushalt sind auf der ersten Doppelseite zwei nicht mehr ganz so jung wirkende Menschen – eine Frau und ein Mann, die jeweils an ihrem Computer bzw. Laptop konzentriert beschäftigt sind.
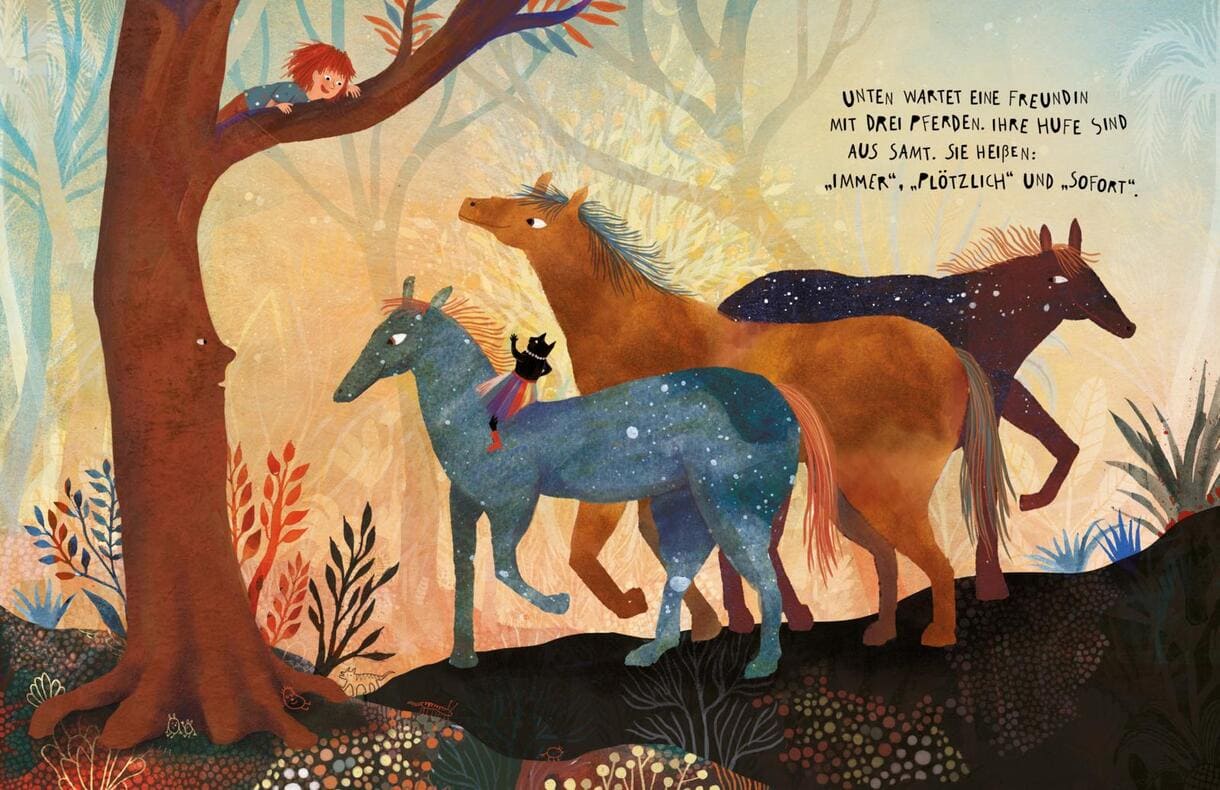
Dieter Böge (Text) und Elsa Klever (Illustration) lassen dich – ob selber lesend oder vorgelesen bekommend und vor allem beim Betrachten der Bilder mit diesem Kind durch unterschiedlichste Welten reisen, sogar in die Tiefen des Meeres. Bunt und fröhlich, aufgeweckt und stets voller Lust auf neue Abenteuer – in einem laufen sogar die Bäume – bewegt sich die Hauptfigur, die sogar fliegen kann. Wolken werden zu einem Segelschiff, es bleibt aber auch eine Doppelseite lang Zeit, einfach auf einem Sofa herumzuknotzen…
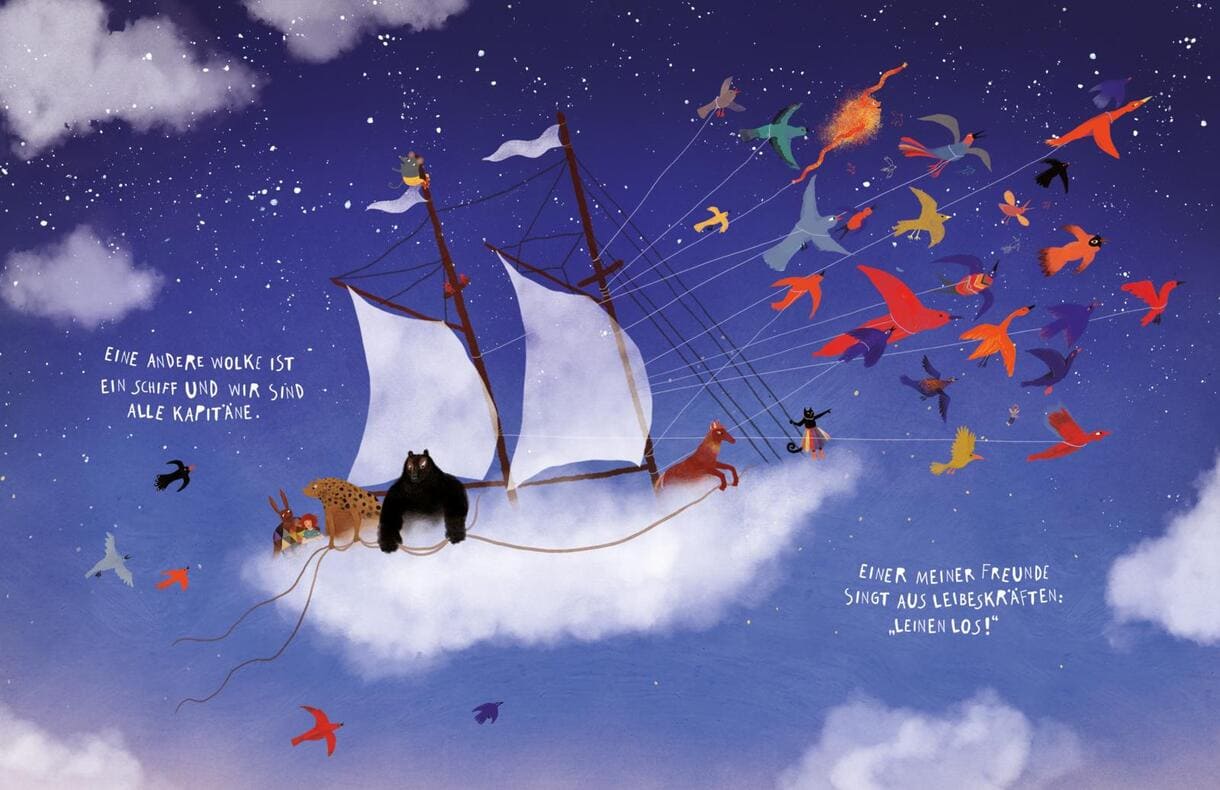
Jahrzentlang behaupteten Psycholog:innen, dass es ein Zeichen von Schwäche wäre, wenn Kinder sich Freund:innen ausdenken. Damit verunsicherten Fachleute Eltern und die wiederum versuchten, ihren Kindern diese Fantasie auszutreiben. Erst vor knapp 30 Jahren begann die Psychologie sich damit neutraler zu beschäftigen. Dabei kamen Expert:innen drauf, keine Spur von Störung oder Fehler, solche Kinder sind meist kreativer, fantasievoller. Nicht selten können sie damit auch Probleme, die sich aus Phasen großer, vielleicht auch verunsichernden Veränderungen ergeben (Übersiedlung, ein Geschwisterkind kündigt sich an…) spielerisch ver- und bearbeiten.
Recht rasch rund um diesen Sichtwechsel veröffentlichte Alan Ayckbourn, bekannter britischer Autor Dutzender komödiantischer Stücke zu ernsten Themen, viele für junges Publikum, sein Stück „Invisible Friends“ (Unsichtbare Freunde; 1989), das vielfach gespielt wurde, unter anderem in einer Version des Theaters der Jugend (Herbst 2008) in Wien (Theater im Zentrum).
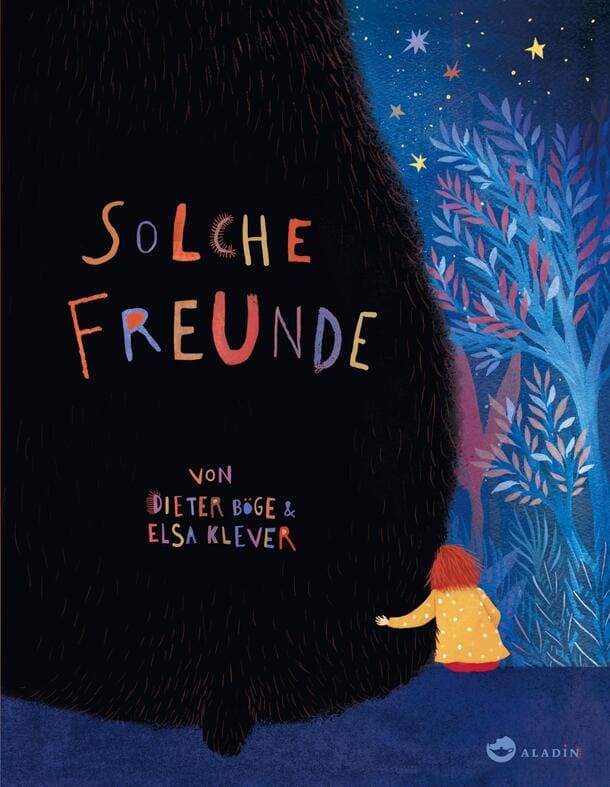

Die Wichtig- und Nützlichkeit von Bäumen und (Ur-)Wäldern – abseits der Verwertung von geschlägertem Holz und gerodeten Flächen – als grüne Lungen für das Weltklima, die Menschheit und beim Eintauchen in einen solchen für einzelne Menschen ist mittlerweile weithin bekannt. Dennoch behalten Wälder noch immer so etwas wie dunkles, fast Unheimliches, was nicht zuletzt aus jahrhundertealten Märchen kommt. Auch wenn das eine oder andere neu erzählt, umgeschrieben, gegen den Strich gebürstet inszeniert wird, kleben uralte Images an der Ansammlung von Bäumen.

Geheimnisvolles und Magisches soll dieser Wald in „Die sieben Wünsche“, das kürzlich vielumjubelte Premiere im großen Haus des Wiener Theaters der Jugend, dem Renaissancetheater hatte, durchaus haben. Das meinte der Autor und Regisseur (Henry Mason) dieses märchenhaften Stücks mit Elementen und Motiven aus gut einem Dutzend verschiedener der Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm im Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… – Link zu diesem Gespräch, in dem er auch erklärt, wie er auf die Story und die Zahl sieben für die Wünsche – es gibt ja etliche magische Zahlen – kam, am Ende des Beitrages.

Nun hier aber zunächst der Plot dieser knapp mehr als zweistündigen (eine Pause) kurzweiligen, spannenden, manchmal ein bisschen gruseligen, märchenhaften Inszenierung voll so mancher Überraschung: Familie Wunsch lebt in einem großzügigen Haus am Waldrand. Dort steht auch die Grundlage für den Wohlstand: Eine Papierfabrik.

Großmutter Adele Wunsch (Uwe Achilles nicht selten wirklich furchteinflößend in den meisten Auftritten), die eigentlich eine Prinzessin war, und darunter leidet, nicht genug weltweit Beachtung zu finden, hat neue Maschinen angeschafft, die statt grauen nun blütenweißen Papiers herstellen können – aus Holz. Also sollen / Müssen Bäume des Waldes dranglauben.
Enkelsohn Hans (Jonas Graber), ein empathischer Freund der Bäume und der in ihnen lebenden Tiere, möchte das gar nicht, seine Schwester Margarete (Anna Katharina Malli) hingegen sehr, sie glaubt an das, was als „Fortschritt“ verkauft wird und eilt mit Axt in den Wald.

Zwischen der tyrannischen Großmutter, dem ängstlichen Großvater Tilo (Frank Engelhardt), der seine Frau sehr liebt und den genannten Kindern gibt es deren Eltern: Walter (Stefan Rosenthal) den Sohn der Alten, der seine Kinder liebt, aber nix gegen seine Mutter sagen oder gar machen will und seine angeheiratete Frau Roswitha (Violetta Zupančič). Die war offenbar als Kind Rotkäppchen, weil sie immer wieder erzählt, dass sie einst von einem Wolf verschluckt worden war und samt der Großmutter, auf die sie im Wolfsbauch fiel, das Tier von innen aufgeschlitzt und sich so befreit hatte.

Als weitere Figur tritt eine im Wald lebende Frau, von allen als Hexe gefürchtet (Maria Fliri, die auch den Familienfotografen und eine Bedienstete im Hause Wunsch spielt) in Erscheinung. Sie versteht die Bäume, ist dabei ihre Sprache zu lernen. Wie und was sie mit der Familie Wunsch zu tun hat, sei hier nicht gespoilert – nicht nur, weil der Autor und Regisseur im Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… gebeten hatte, nicht zu viel zu verraten. Das wäre auch so schon hier nicht passiert. Auch nicht wie die ängstlich gewordene Mutter Roswitha ihren alten Mut (wieder) findet – dies ist übrigens eine wunderbare Szene dank der Kostümverwandlung.

Violetta Zupančič legt hier eine wahrhaft magische Verwandlung hin – nicht zuletzt auch dank einer kostümmäßigen Verwandlung. Kostümbildnerin Anna Katharina Jaritz und die Schneider:innen der Kostümwerkstatt haben hier ein meisterhaftes Kunstwerk aus Stoff geschaffen.
Eine Figur gibt’s darüber hinaus noch: Neben dem Wolf, in dem natürlich ein Schauspieler steckt – über den hier der Mantel des Schweigens gebreitet wird, um die letztlich verblüffende Enthüllung nicht kaputt zu machen, tritt mehrmals ein kleines grünes, wuscheliges Waldwesen, ein Moosmännlein, in Erscheinung – als Puppe, geführt, gespielt und gesprochen von Frank Engelhardt (ansonsten Großvater Tilo Wunsch).

Die Puppe gebaut und das ganze Bühnenbild entworfen hat Rebekah Wild. Die Bäume, die den Wald bilden und von denen die Tyrannin viele schlägern lässt, sind „nur“ stilisiert – als Träger einer Produktionshalle der Papierfabrik. Sie wirken voll als wären sie typische Fabriks-Stahlgerüst-Teile. Sie sind aber in echt aus Holz, vertraute Rebekah Wild dem Reporter an und zeigt sich fasziniert vom Werk der Mitarbeiter:innen der Werkstatt haben dies so perfekt hingekriegt, dass sie, als sie künstliche Blumen befestigen wollte, erst meinte: „Antackern kann ich sie nicht, die Träger sind ja aus Stahl, ach nein, sind ja Holz!“

Natürlich heißen Hans und Margarte nicht zufällig so, manchmal werden sie auch Hänsel und Gretel genannt – und so manche Anspielung ans gleichnamige Märchen kommt vor. Ein anderes – Rotkäppchen – wurde schon genannt. Die Großmutter will – nicht wegen ihres Aussehens, sondern einer besonderen Fähigkeit, die hier sicher nicht verraten wird, sich von einem Spiegel bestätigen lassen, dass sie darin die Beste sei. Zu ihrem Ehemann kam sie, weil dieser sieben Fliegen erschlagen hat und als Held galt. Margarete hilft dem eingeklemmten Moosmännlein nicht, ihr Bruder tut’s schon – ein Motiv, das mindestens an Frau Holle, aber noch etliche andere Märchen erinnert wo solch unterschiedlich empathische Geschwister vorkommen.

Bevor sich alle gegen die Tyrannin zusammenschließen und versuchen den Wald oder viel weniger das, was von ihm noch übrig ist, zu retten, geht die Show noch eine Reihe etlicher Verwicklungen, Windungen und Wendungen. Spannend, manchmal auch reißt’s dich und dann ist wieder etliches zu schmunzeln oder gar lachen dabei. Bei der Premiere gab’s mehrfach Szenen-Applaus im zweiten Teil nach der Pause.
Gedacht und angegeben für Kinder ab sechs Jahren, aber so hin- und mitreißend gespielt und spannend inszeniert, dass „Die sieben Wünsche“ Besucher:innen jedweden Alters darüber anspricht und mitnimmt.
Achja, wie schon einleitend angesprochen, natürlich spielt der Wald als Symbol für die Natur und ihre Schutzwürdigkeit eine zentrale hintergründige Rolle, ohne dies „oberlehrer:innhaft“ mit erhobenem Zeigefinger zu tun.

KiJuKU: Der Ausgangspunkt für „Die sieben Wünsche“ war di Bearbeitung von Märchen, nur der Gebrüder Grimme?
Henry Mason: Ich wollte schon ganz lang was über Grimm’sche Märchen machen.
KiJuKU: Wie hast du dann ausgewählt, welche du einbauen willst, es gibt ja neben vielen weniger bekannten noch mehr sehr bekannte Märchen, als nun in dieser Inszenierung vorkommen?
Henry Mason: Ich hab dann tatsächlich die gesammelten Werke von vorne bis hinten gelesen, wollte bewusst auch die weniger bekannten lesen und ich wollte einen Geschmack kriegen für die Sprache und die Muster wie sie funktionieren.
Dann hatte ich die Grundidee von dieser Familie mit der Fabrik mit diesem Grundkonflikt zwischen Papierfabrik und Zauberwald. Von da ausgehend hab ich überlegt, welche Märchenfiguren können Figuren in dieser Familie entsprechen und welche Dynamiken entstehen dadurch. Dann hat es sich fast aufgedrängt, welche Märchen es sein müssen.
Und ich wusste, dass ich hauptsächlich die bekannteren verwenden will, obwohl Motiv und Muster auch von weniger bekannten Märchen im Stück drinnen sind. Dass zwei Geschwister einem Zauberwesen begegnen, das in Nöten ist und ein Geschwisterteil hilft nicht und geht weiter und das jüngere, empathische Kind hilft – das kommt in mehreren Märchen vor.

KiJuKU: Wie kamst du auf die Idee, dass die Fabrik eine für Papierherstellung ist?
Henry Mason: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich aus der Konfrontation, dass der Wald irgendwie in Gefahr sein muss. Ich wollte den Wald spürbar machen, dass der auch eine Figur in diesem Stück ist, auch wenn der nie spricht oder zumindest für uns nicht hörbar. Bei der Papierfabrik ist’s am unmittelbarsten, dass die Bäume als Rohstoff dafür abgeholt werden.
KiJuKU: Dass es sieben Wünsche sind – kam das aus der vielfach magischen 7 so wie 3, manchmal auch 12; wobei 7 im in Ostasien als Unglückszahl gilt; bei Wünschen im Märchen sind’s meistens drei – waren das zu wenige?
Henry Mason: Ja, aber die sieben haben sich aus der Besetzung ergeben – ich wollte, dass jedes Familienmitglied einen Wunsch hat und ich wollte drei Generationen haben, also doch auch irgendwie 3, aber eben Kinder, Eltern, Großeltern und ein (vermeintlicher) Bösewicht. Außerdem gibt es natürlich auch viele Märchen mit sieben – Schwäne, Raben…
KiJuKU: … und Zwerge bei Schneewittchen…
Henry Mason: … genau. Dann war die Titelfindung schwierig, komplizeirt. Und eines Tages war’s klar, wenn die Familie Wunsch heißt, kann ich „Die sieben Wünsche“ machen.

KiJuKU: Ach, ich dachte, es war umgekehrt, dass die Familie eben Wunsch heißt wegen der 7 Wünsche…
Henry Mason: … ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge das entstanden ist.
KiJUKU: Dass der Wald so eine zentrale Rolle spielt, war von Anfang an klar?
Henry Mason: Das war einer der zentralen Ausgangspunkte neben Grimm’s Märchen und drei Generationen. Ich bin ein halber Neuseeländer, meine Mutter ist Neuseeländerin. Ich war vor 1½ Jahren wieder dort und da gehst du in sehr unberührte Wälder. Diese Stille, diese Unberührtheit und diesen Zauber, den die auch haben, das hat mich sehr berührt und inspiriert. Du merkst halt, wie wahnsinnig schön, aber auch fragil diese Landschaft ist und dennoch, welche Kraft solche Wälder haben. Gleichzeitig kräftig und doch zerbrechlich, das wollt ich irgendwie schreiben.

KiJuKU: Das war auch gut wahninnig schön zu erleben bei „Ich bin der Wald“ vom VRUM Kunst-Kollektiv gemeinsam mit dem Dschungel, einer interaktiven Hörspiel-Tour in einem magischen fast Urwald, ganz in der Nähe der Prater Hauptallee – Link zur Besprechung dessen, weiter unten.
Cool ist ja, dass die Bühnenelemente (Bühne und Puppenbau: Rebekah Wild), die wie Stahlträger der Fabrik aussehen, aus Holz sind.
Dass diese Botschaft über den schützenswerten Wald fast „versteckt“ daher kommt, finde ich auch ganz gelungen.
Henry Mason: Natürlich ist es auch ein ökologisches Stück, ein Thema, das immer wichtiger wird – diese Fragilität der Natur und die menschliche Verantwortung dafür, ohne es vordergründig zu machen. Also nicht mit Zeigefinger, sondern lustvoll und durch diese Märchen. Es wissen’s ja ohnehin (fast) alle, aber du kannst es so ganz anders nehmen, wenn’s charmant gefiltert ist – durch die Märchen und dieses sehr charmante Ensemble.

KiJuKU: Auch diese Verwandlungsfiguren finde ich sehr gut.
Henry Mason: Ja, aber bitte verrat nicht zu viel. Ich wollt eine Geschichte schreiben, die viel mit Geheimnissen und Überraschungen arbeitet. Da hab ich auch bei den Fotos gebeten, dass nicht zu viel schon vorweg verraten wird. Eine Lust bei diesem Stück ist, dass auch manches wie ein Krimi funktioniert.
KiJuKu: Lieber Henry, eine sehr schöne, runde Geschichte geworden und danke für deine Zeit so unmittelbar nach der umjubelten Premiere.
Henry Mason: Gerne!
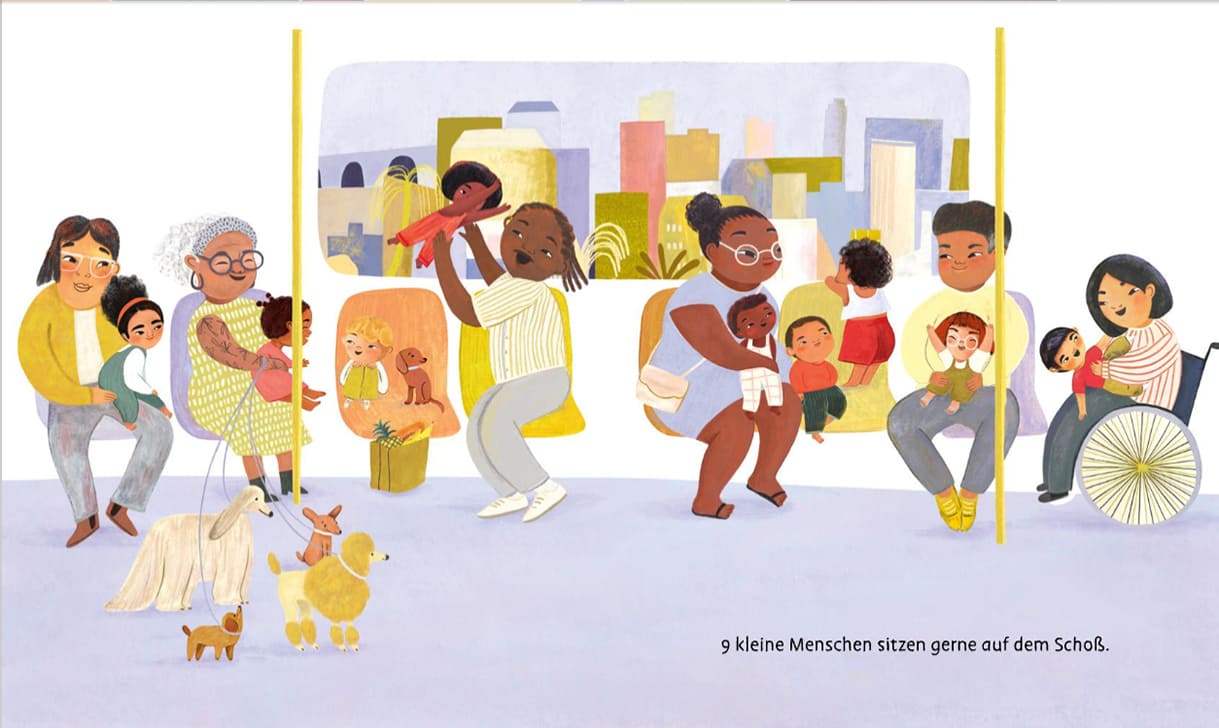
„9 kleine Menschen kommen heute raus.“ Diese sechs Wörter ziert die erste Doppelseite dieses Bilderbuchs. Darüber zu sehen: Neun hochschwangere Frauen.
Einmal umgeblättert – und da liegen sie die neun Neungeborenen – begleitet von der zweiten Reimzeile: „9 kleine Menschen seh’n ziemlich glücklich aus.“
Pro Doppelseite immer eine andere Situation samt der ersten von zwei Zeilen, die sich reimen, nur auf einer der Doppelseiten findet sich das ganze Reimpaar: „9 kleine Menschen sind nicht alle gleich. 9 kleine Menschen sind unterschiedlich rein.“ Samt Bilder – von Martina Stuhlberger – mit großzügigen Zimmern samt Klavier und eher engen Kammern.
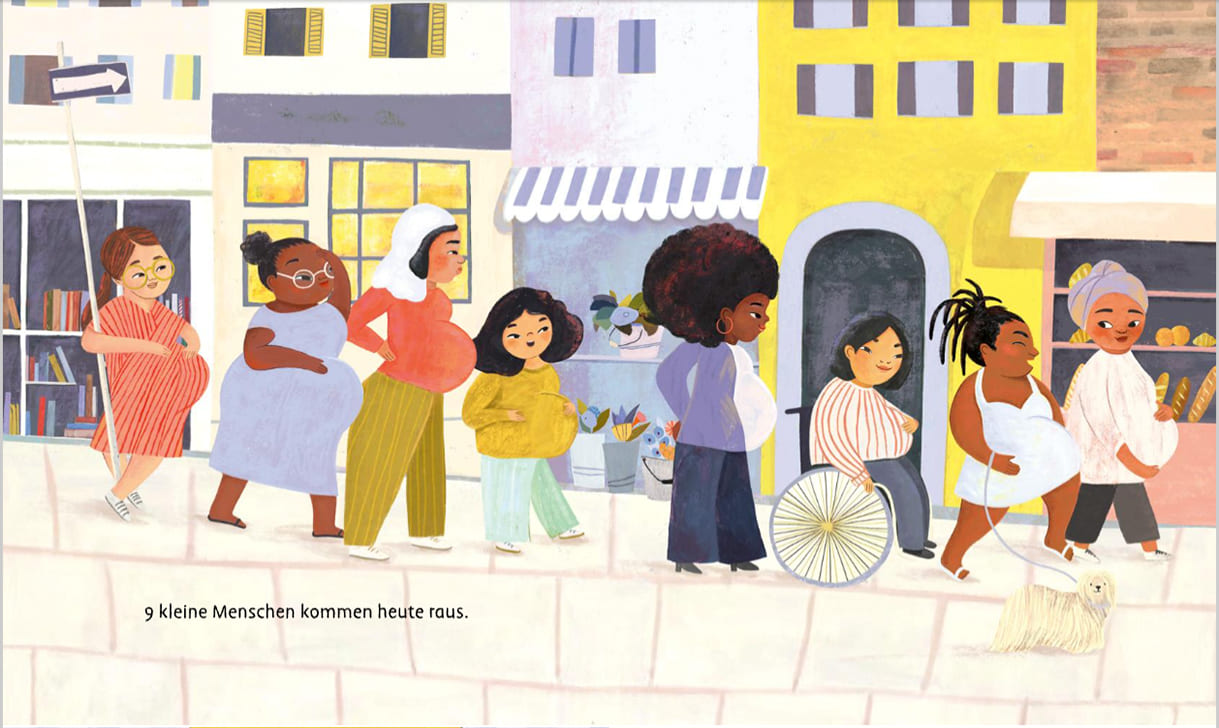
Dennoch strahlen ihre bunt gezeichneten Kindergesichter zumeist Grinser, Lächeln, Lachen oder zufrieden in sich ruhenden Schlaf aus. Im Gegensatz zu den Zehner-Reimen, wo oft nach und nach eine oder einer aus der Runde ausscheidet, bleiben hier alle neun bis zum Schluss beisammen – auch wenn sie – wie gerade erwähnt – aus unterschiedlich vermögenden Familien kommen.
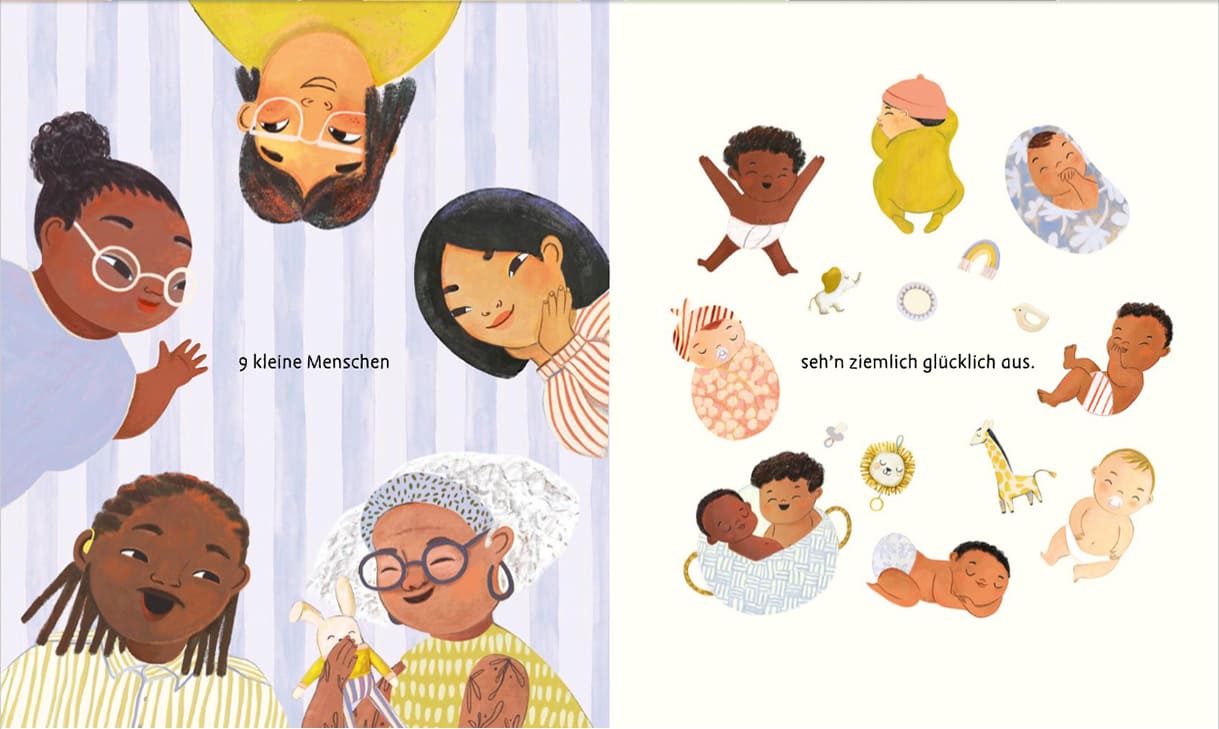
Was die Bilder vermitteln, das in den Reimen gar nicht steckt: Bunte Vielfalt – hell- und dunkelhaarige bzw. häutige Kinder und ihre Familien und auch diese ganz verschieden – Vater-Mutter-Kind, Alleinerzieherin, Mutter-Mutter-Kinder… Und wenn die Kinder in einem Öffi (ob Bim oder Bus was auch immer) auf elterlichen Schößen sitzen, so sind’s nicht nur Mamis, sondern auch Papis oder vielleicht auch eine Oma mit graugewelltem Haar und vier Hunden. Und eine der Mütter sitzt in ihrem Rollstuhl.
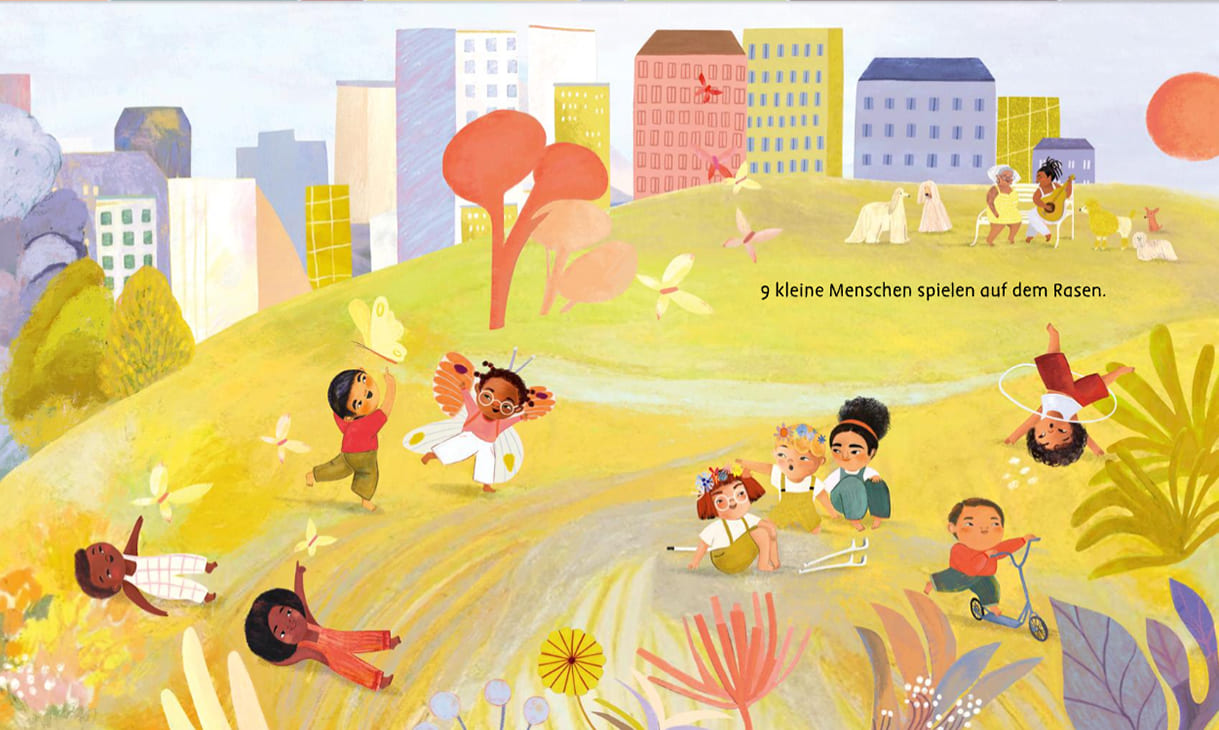
Zehn kleine Fingerlein, Zappelfinger … in vielen Versionen auch Zappelmänner als Kinderreime mit Fingerspielen gibt es etliche. Für trinkwütige Erwachsene ließ sich die Band „Die Toten Hosen“ den Namen bekannter kleiner Schnapsfläschchen einfallen. „Warum müssen es immer zehn sein? Auch wenn ein Kind ein Bein oder neuen Finger hat, ist es doch trotzdem komplett“, zitierte Autorin Regina Feldmann ihre Tochter nachdem diese aus Mutters Regal eines der Bücher mit den Zehner-Reimen rausgefischt hatte. Das schildert sie in einem Nachwort an die „lieben Vor-)lesenden“ und beschreibt, dass der Sager der Tochter Ausgangspunkt für dieses vorliegende Bilderbuch. „9 kleine Menschen ist eine Ode an eine Generation von Kindern, die bereits weiß, dass sie richtig ist genau so, wie sie ist, und an eine Freundschaft, die verbindet.“
In der Hoffnung, dass es die mehreren dieser Generation sein mögen und sie sich ihre Empathie auch im Erwachsenenalter behalten.
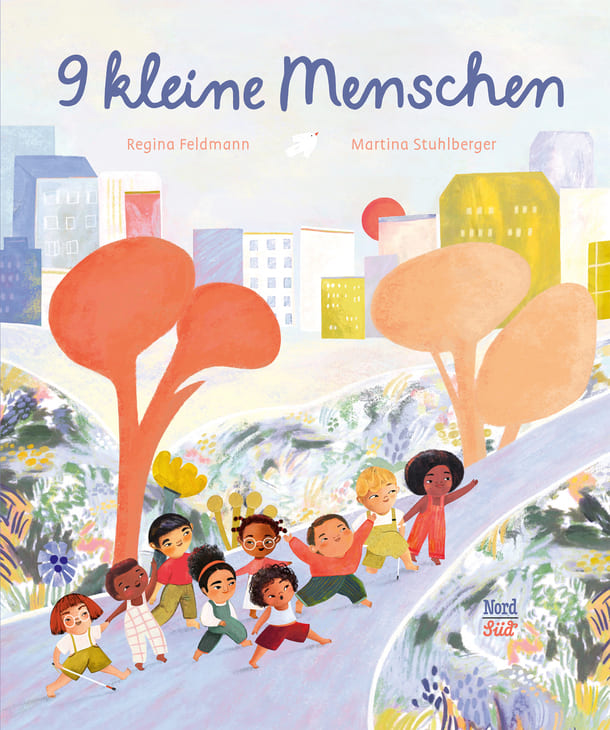

Es gibt offenbar ganz schön viel zu weinen! Rund zwei Wochen lang stand in einem schmalen, zweistöckigen leersteheneden Geschäftslokal die „Tränensaline“ des Kunstprojekts „Wiener Weinen“ – KiJuKU.at hat berichte – Link dazu weiter unten.
Barbara Ungepflegt (Künstlerinnenname!) lud – mit Kolleg:innen – Hanna Hollmann, Marie Vermont, Evamaria Müller, Johanna Leitner und Gäst:innen – Vorbeigehende dazu ein, vor Ort zu weinen, fingen die Tränen auf, sammelten und erhitzten sie, so dass Salz nach dem Verdampfen der Flüssigkeit übrig blieb. Es wurden aber auch Sets zum Mitnehmen ausgegeben, um zu Hause oder wo auch immer zu weinen und die Tränen hierher in die Saline zu bringen.

20 bis 25 Kilo Salz seien so zusammengekommen – meinten die künstlerischen Salinen-Arbeiter:innen. Vielleicht hatte die Performance aber auch noch eine unausgesprochene zweite Ebene: Glauben Menschen alles? Oder hinterfragen sie?
Immerhin würden 20 Kilo Salz aus Tränen – rund 160 Milliliter Tränenflüssigkeit braucht’s für ein Gramm Salz – geschätzte 200.000 Esslöffel Tränen erfordern. Und bis ein Esslöffel voll geweint ist… naja, hieße Daumen mal Pi – wie in Wien grobe Schätzungen mitunter genannt werden – rund eine halbe Million Menschen hätten in diesen beiden Wochen ihre Tränen hier abgeben müssen…
Wie auch immer, jedenfalls gab es viele Gespräche, Nachdenken über Beweinenswertes, aber auch die Erkenntnis, dass Freudentränen genauso salzig sind wie solche über Beklagenswertes. Und die Künstler:innen hoffen, ihre Aktion andernorts wiederholen zu können. So mancher Salzhügel dürfte docj schon zustande gekommen sein 😉

Wie derzeit – noch bis 11. Juni 2025 – in einer Bühnenversion im Krimi-Klassiker „Warte, bis es dunkel ist!“ im Wiener Theater Center Forum so war auch bei „Jetzt!“ im Vestibül des Burgtheaters Audiodeskription für alle Besucher:innen zu hören. Was sich auf der Bühne wie abspielt wird erklärt. So können einerseits blinde bzw. sehschwache Menschen dem Geschehen folgen, andererseits alle anderen dies miterleben. Für Zuschauer:innen, die nicht oder nur schwer hören, wurden die gesprochenen Texte als Schrift an die Wand projiziert.
Simon Couvreur, Billy Edel, Giuliana Enne, Jenny Gschneidner, Felix Elias Hiebl, Yuria Knoll, Christine Krusch, Magdalena Helga Franziska Tichy, Leonie Frühe sowie Lukas Hagenauer, Josefine Merle Häcker, Niels Karlson Hering, Mathea Mierl, Justus Werner Pegler, Elisa Perlick und Leonie Rabl sprachen und spielten Monologe, Dialoge sowie Szenen mit mehreren Personen aus klassischer bis moderner Theaterliteratur – von altgriechischen Dramen nicht zuletzt mit dem blinden Seher Teiresias über Georg Büchner bis zu Thomas Bernhard und Caren Jeß. Letztere wahrscheinlich die Unbekannteste und den Genannten, ist ein 40-jährige deutsche Schriftstellerin, von der Yuria Knoll kurze Passagen aus „Die Katze Eleonore“ über eine Frau, die zur Katze wird und mit ihrem davon faszinierten Therapeuten spricht.
Simon Couvreur, nicht zuletzt von Tanztheater-Auftritten mit „Ich bin O.K“ bekannt ließ bald nach Beginn seine Hände tanzen – was eine Kollegin in Audiodeskriptions-manier poetisch schilderte. Auch jeder Lichtwechsel wurde – im Wechselspiel mit Enrico Zych an den entsprechenden Reglern und Tasten – vorab angesagt.
„Jetzt!“ war die – wie es viele im Publikum bedauerten leider nur zwei Mal – aufgeführte Abschluss-Performance des gleichnamigen ersten inklusiven, großen Projekts in diesem großen wichtigen Theater. Das die ganze Saison gelaufene Projekt vereinte in Zusammenarbeit mit der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) Studierende der Bereiche Schauspiel und Tanz sowie theaterinteressierte und teils auch schon -erfahrene Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen (Rollstuhl, blind, Trisomie 21 / Downsydrom).
Unter der künstlerischen Leitung von Constance Cauers hatten Monika Weiner die Teilnehmer:innen des Projekts in Bewegungstraining sowie Steffi Krautz-Held und Dorothee Hartinger im Rollenunterricht gecoacht. Wobei im Publikumsgespräch manche der Beteiligten davon erzählten, dass die Lehrenden mitunter unterschiedliche, ja gegensätzliche Lehren vermittelten. Woraus die Spieler:innen jedoch dann oft ihre eigenen Versionen entwickeln konnten 😉
„Jetzt!“ ist ein Programm für Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen, die vorhaben, professionell am Theater sowie im Bereich Film und Fernsehen als darstellende:r Künstler:in zu arbeiten. Das Programm wird jeweils für die Dauer einer Spielzeit angeboten und ist eine Initiative des Burgtheaters und der Fakultät Darstellende Kunst der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien.

Die Riesen-Aufmerksamkeit rund um ESC, den Song-Contest – Stichwort JJ und so –, will auch die Initiative „Kinderarbeit stoppen“ nutzen. Zur Melodie des vor 41 Jahren zufällig entstandenen zum Welthit gewordenen Songs der österreichischen Band Opus „Live is Life“ sollen möglichst viele mit einem neuen Text – „Nein heißt nein!“ tanzen, sich dabei filmen (lassen) und es unter #tanzengegenkinderarbeit in sozialen Netzwerken posten, teilen und andere animieren, mitzumachen. Unter dem am Ende des Beitrags zu findenden Link dazu findet sich der gesamte Text sowie Anleitungen zu den Tanzschritten.
Hier noch das Zitat einer der Strophen vom oben genannten Song:
„Nein wir wollen nichts mehr essen,
wofür and‘re niemals ruh‘n!
All die Kinder dieser Erde,
die das alles für uns tun.
Ihre Kindheit zu genießen,
ja das täte ihnen gut.
Zum Lernen in die Schule geh‘n,
wo ist das Problem?
Es muss anders geh‘n!
Nein heißt nein!“
Übrigens: Am 12. Juni ist Aktionstag gegen Kinderarbeit; 2002 gab es erstmals den von der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) den „Welttag gegen Kinderarbeit“.
In Wien findet um fünf vor zwölf, also um 11.55 Uhr ein Tanz-Flashmob mit dem genannten Song im MuseumsQuartier, im Fürstenhof (Kinderinfo / Kindermuseum Zoom, Theaterhaus Dschungel Wien) statt.
Anschließend – bis 19 Uhr – gibt es mehrmals Kinderbuchtheater (Kamishibai) zu Kinderarbeit im Kakaoan- und abbau, Lesungen („Bené, schneller als das schnellste Huhn“), Workshops und mehrmals Tänze.
Ein Tanz-Flashmob steigt am selben Tag auch in Linz – um 14 Uhr auf dem Hauptplatz; mehr Details im Link am Ende des Beitrages.

Ein riesiges, wie auf einer Wäscheleine hängendes, Stofftuch bildet die Projektionsfläche – für Bilder, Zeichnungen und animierte Videos. Auf dunklem Hintergrund sind die Konturen eines riesigen Sportschuhs zu sehen wenn das Publikum den großen Saal im Theaterhaus für junges Publikum, dem Dschungel Wien im MuseumsQuartier betritt. Mit Beginn der Vorstellung, einer der Performances beim Festival der Theaterwerkstätten, taucht auf dieser Leinwand eine Hand mit Stift auf. Nach und nach entsteht – dazwischen mitunter mit Pausen – der Schriftzug „Her mit dem schönen Leben“; bei dem gibt’s Verzögerung – den oder doch dem 😉 und bei Leben werden die Buchstaben immer größer!

Dann ertönt die programmatische Forderung via Lautsprecher von Kinderstimmen – jenen, die auch die Performance entwickelt haben und in verschiedenen Szenen diesem Wunsch, nachgehen und ihn darstellen – in Variationen, denn für jede und jeden kann so ein Ziel ja ganz unterschiedlich ausschauen.
Kilian Biechele, Ava Brandmaier, Lenz Eichenberg, Ela Ergin, Lina Fritz, Victor Griehsler, Linus Hübl-Englerth, Sina Tobias Kananian, Vita Parisini, Alexis Rabay, Theo Saßmann-Ramusch und Lilia Trautendorfer haben im Verlauf von mehreren Monaten unter der künstlerische Leitung von Monika Haberfellner (Hospitanz: Lucas Hofbauer; Tonaufnahmen + Schnitt: Kathrin Wimmer) daran gearbeitet.
Finsternis und Ängste sind – auch (siehe auch „Hopepunks“) – ein Thema, hier dargestellt mit einem imaginären Dachboden, Gespenstern und dem Spiel mit Licht und Schatten mit Hilfe der großen Leinwand. Vor allem aber sind’s mögliche Wunschberufe – von Schlagzeugerin, Rockstar, Kellnerin, Jäger, Polizist:innen, Künstlrin aber eigentlich Kunstdiebin und vielen mehr, gespielt in Verkleidungen und übergroßen Schuhen, die es von der Decke „regnete“ -, die wiederum zu gespielten Szenen führen. Außerem zeigen Videos u.a. eine Tänzerin, die auch Räder an einer Strandpromenade schlägt, Meeresforscher:innen, einen Vulkanexperten, der mit einem Backpulver-„Vulkan“ experimentiert…
Und darin scheinen sich alle so wirklich wohlzufühlen, was schließlich in der Erkenntnis gipfelt: Genau jetzt ist das schöne Leben!

Von einer Art Tribüne aus erobern acht Kinder und sechs Erwachsene den Bühnenraum – einige der Oldies später auch Treppen im Publikumsraum und am Ende holen die Kids immer wieder einzelne Besucher:innen aus den Reihen der Zuschauer:innen – aber dazu später.
„Hopepunks“ ist eine nicht ganz ¾-stündige vielseitige, mal wilde, dann wieder sehr ruhige Performance rund um so manch scheinbar kleine und doch so große Fragen von Kindern – für ihr eigenes Leben aber auch das der gesamten Menschheit.
Nayeli Fox, Mila Frühwald, Fridolin Grabher-Dietlinger, Laura Lima-Oswald, Ellie Nguyen, Hanna Nürnberger, Nahui Ollin Palacios-Brandstetter, Lacin Torkanbouri sowie die erwachsenen Saba Farnoud, Till Frühwald, Volkan Karabulut, Ella Karabulut-Oswald, Eva Isolde Oswald und Günesch Torkanbouri machen sich von einer Tribüne aus einer Art großer, grauer, weicher flacher Bausteine aus auf den Weg, marschieren und wandern durch einen (als Video projizierten) Wald, verwandeln sich per großer, weit ausschwingender Armbewegungen in schwebende Wesen vor dem Hintergrund eingeblendeter Vögel. Ihre Wege führen sie aber noch viel weiter, nicht zuletzt in die unendlichen Weiten des Weltraums mit beeindruckenden Video-Bildern aus fernen Galaxien.
Auf dem Weg der 14 Performer:innen entfernen sich die Erwachsenen bald, ziehen sich in Ecken und auf Stufen zurück, um Papier zu falten. Die Kinder suchen nun nach ihren eigenen Wegen. Vieles läuft ohne Worte. Als es doch zu solchen geht, treten sie einzeln vor ein Mikrophon und äußern zunächst ihre Ängste – vor schlechten Träumen oder ebensolchen Noten, davor, von Freund:innen nicht gemocht zu werden, aber auch davor, dass die Erde so heiß werden könnte, das (menschliches) Leben auf ihr nicht mehr möglich sein würde…
Gegen die Ängste bauen sie aus den schon erwähnten „Bausteinen“ einen befestigten Schutzwall, der sie aber bald in ihrer Ecke einengt – und mit gedichteten Zeilen von einem Hasen sowie einem Bären, die Mut und Hoffnung gegen Ängste verbreiten (nachträgliche Anmerkung: sehr stark angelehnt an das Lied „Keine Angst vor der Angst“, das der deutsche Liedermacher Olli Schulz unter anderem Elmo in der Sesamstraße vorsingt), befreien sie sich aus dem selbst gebauten „Gefängnis“ durch Niederreißen der Mauern, um befreit und ausgelassen aufzuspielen.

Die schauspielerische und immer wieder tänzerische Performance wird die gesamte Zeit live von einem Musik-Trio am Rande der Bühne begleitet: Aria Torkanbouri (Leitung sowie Klavier und Saz), Katarina Milisavljević (Geige und Schamanentrommel), sowie Salar Ghaffarbejouei (Cello und Kamança).
Irgendwann haben erwachsene Mitspieler:innen, die sich zurückgezogen hatten, genügend Kraniche gefaltet, die sie ihren jungen Performance-Kolleg:innen aushändigen. Mit je einem solchen papierenen Vogel – in Japan Symbol der Hoffnung und des Friedens (siehe auch Link zur Besprechung eines Bilderbuchs rund um einen Kranich und die Friedensburg im Burgenland) – holen die Kinder wie schon eingangs erwähnt Zuschauer:innen auf die Bühne zu einem abschließenden gemeinsamen Aus-Schwingen.

Hier die zehn Schüler:innen, die in der Alterskategorie der 7. und 8. Schulstufen von der Jury als Beste der Besten ausgezeichnet wurden – in alphabetischer Reihenfolge (nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen); sowie deren Präsentator:innen und Preis-Überreicherinnen.
Lamar Aburaya (14), BG Neunkirchen (NÖ), Arabisch
„Jede Sprache, die verschwindet, ist ein Verlust für die Menschheit, da sie einen Teil des kollektiven Wissens und der Kultur mit sich trägt.“
Madeleine Karall (13), ZMS (Zweisprachige Mittelschule) Großwarasdorf (Burgenland), Burgenlandkroatisch
„Sprachen sind mehr als Worte, es sind auch Gefühle, die wir empfinden.“
Lavrenty Kolgatin (13), pGRg23 Kollegium Kalksburg (Wien), Russisch
„Träume sind nicht nur Abstraktionen oder Fantasien. Sie sind Möglichkeiten für Wachstum, Veränderung und das Streben nach Zielen.“
Sviat Kolodii (15), Modulare Mittelstufe Aspern MMA (Wien), Ukrainisch
„Ich will nach Hause, zu meinem Vater. Ich möchte in der Wärme meiner Heimat . Aber ich weiß, warum ich hier bin, was mein Ziel ist.“
Amelie Kröpfl (13), AHS Wien West , Englisch
„Wollen Sie das? Wollen Sie dafür verantwortlich sein, dass sich ein anderer Mensch schrecklich fühlt? Wollen sie in einer Welt leben, in der mehr auf das Aussehen als auf den Charakter geachtet wird? Ich denke nicht.“
Theresa Luger (13), BG/BRG Brucknerstraße Wels (OÖ), Englisch
„Wie soll man lernen, wie Gerechtigkeit funktioniert, wenn man nie gerecht behandelt wurde.“
Anna Nemeth (14), MS St. Ursula (Wien), Ungarisch
„Jeder kann träumen, jeder kann an seine Wünsche glauben. Was man dazu braucht, ist nur den Mut zu haben sich etwas Unbekanntem zu stellen, sich anderen Menschen zu öffnen, viele Länder zu besuchen, auch wenn es nur in den Träumen passiert.“
Stephanie Rieger (15), Lycée français de Vienne; Portugiesisch
„Für mich sind Sprachen nicht nur Wörter, sie sind das, was ich bin. Meine fünf Sprachen sind die 5 Finger meiner Hand.“
Isabella Stoll (14), BG Neunkirchen (NÖ), Österreichische Gebärdensprache
„Gebärdensprache ist eine Sprache wie jede andere. Sie ist reich an Ausdrucksmöglichkeiten, tief in der Kultur ihrer Sprecher verankert und sie verdient denselben Respekt und dieselbe Anerkennung wie jede gesprochene Sprache.“
Alexander Unger (13), Schottengymnasium der Benediktiner, Wien, Russisch
„Sprache ist der Schlüssel zur Freundschaft, zu neuen Entdeckungen, zu einer neuen Welt! Es ist nicht nur wichtig, was wir sagen, es ist nicht nur wichtig, was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen.“

Daniella Bari (16), Lycée français de Vienne, Spanisch
„In einer Zeit, in der Kriege vor den Toren Europas wüten, in der Gleichgültigkeit oder Hass gegenüber den Anderen oft noch vorherrschen, sind unsere Sprachen die Waffen des Friedens.“
Maria Gundacker (15), BRG Steyr Michaelerplatz (OÖ), Englisch
„In meinem Leben geht es nicht um die eine Sprache ODER die andere. Sie sind immer im Fluss, sie verändern sich und passen sich an.“
Mia Harrington (15), BG/BRG Purkersdorf (NÖ), Englisch
„Viele Österreicher sind der Meinung, dass wenn ein Elternteil nicht ein geborener Österreicher ist, dass dem Kind dann ein Teil der Kultur fehlt, aber ich finde, dass man dadurch etwas dazubekommt, also sozusagen eine doppelte Kultur hat.“
Henna Islamović (16), BG/BRG Purkersdorf (NÖ), Bosnisch
„Ohne Vielfalt hätten wir nichts. Keine neuen Ideen, keine neuen Perspektiven und keinen Fortschritt. Genau diese Unterschiede treiben uns an, machen uns stärker und helfen uns zu wachsen.“
Naya Okla (17), BHAK Lienz (Tirol), Arabisch
„Liebe Jugendliche, macht aus eurem Leben eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden.“
Helena Paeschke (15), Akademisches Gymnasium Wien, Englisch
„Sprache ist konstant im Wandel, sie entwickelt sich mit uns mit. Wenn sie stagniert, wenn wir uns weigern uns weiterzuentwickeln, stagnieren wir mit eher mit.“
Juliette Schatz (15), Akademisches Gymnasium Wien, Französisch
„Es ist unsere Entscheidung, ob wir uns für Hass oder für Liebe, für Oberflächlichkeiten oder Gemeinsamkeiten entscheiden.“
Selina Senel (16), BHAK Korneuburg (NÖ), Ungarisch
„Ich fühle mich schuldig. Schuldig, weil WIR hier in Europa eine Meinungsfreiheit haben und uns nicht für unsere Mitmenschen einsetzen sondern nur zuschauen.“
Cara Shariat (15), Lycee Français de Vienne, Englisch
„Es ist diese Barbarei, die die Barbarei anderer Kulturen vorgaukeln will, die uns hier, im Herzen Europas und der westlichen Welt, bedroht.“
Ines Soltane (16), G19 Döblinger Gymnasium (Wien), Arabisch
„Wir Menschen können wirklich eigenartig sein: Wir erkennen das Unrecht, sind uns dessen bewusst, und dennoch unternehmen wir nichts oder schweigen sogar im schlimmsten Fall. Aber warum denn schweigen, obwohl WIR eine Veränderung schaffen könnten?“

Jasmin Karner (19), BG/BRG Dreihackengasse (Graz, Steiermark), Englisch
„Wann haben Sie sich das letzte Mal einsam gefühlt? Nicht wenige vermissen einfach das Gefühl, im Arm gehalten zu werden oder miteinander das Leben zu entdecken.“
Katharina Knor (18), BHAK Stegersbach (Burgenland), Englisch
„Ich finde, es ist wirklich an der Zeit, Diversität nicht nur als wirtschaftliches oder politisches Konzept oder als netten Werbegag zu betrachten. Nein, wir müssen anfangen, sie in unser Leben einzubeziehen, und zwar schon im frühen Alter.“
Kiano Loacker (17), HAK/ HASch Feldkirch, Englisch
„Ich kann vielleicht keine interessante Fremdsprache wie Schwedisch, Rumänisch oder Arabisch. Aber ich habe eine Stimme und ich will sie nutzen und ich will, dass ihr eure Stimme nutzt.“
Anouk Lux (16), Modeschule Hallein (Salzburg), Englisch
„Also, lasst uns in Bewegung kommen egal wie unangenehm es erscheinen mag. Lasst uns aufstehen und diesen Gedanken Alleine bin ich besser ändern.“
Lara Mayr (16), KORG Katholisches Oberstufen Realgymnasium) Kettenbrücke (Innsbruck, Tirol), Italienisch
„Niemand sollte sich gezwungen fühlen, seine Identität zu verstecken. Niemand sollte so tun müssen, als wäre er oder sie jemand ganz anderes.“
Fatima Sajad (17), IISS Claudia de Medici (Südtirol, Italien), Urdu
„Warten wir nicht zu lange, um zu verstehen, wie kostbar die Zeit mit den Menschen ist, die wir lieben. Warten wir nicht, um uns zu entschuldigen oder ihnen zu sagen, wie sehr wir sie schätzen. Es wird ein Tag kommen, an dem diese Menschen nicht mehr da sind, und es wird zu spät sein, sich zu entschuldigen oder ich liebe dich zu sagen.“
Elif Sila Saraç (17), BAfEP (Bundesanstalt für Elementarpädagogik) Sacre Coeur Pressbaum (NÖ), Türkisch
„Mehrere Sprachen zu sprechen, bedeutet auch, in zwei Kulturen zu Hause zu sein, und von beiden zu lernen. Beide Sprachen werden nämlich ein Teil der Persönlichkeit und gehen Hand in Hand. Man entwickelt dadurch eine Offenheit, einen Blick für Unterschiede, aber auch für Gemeinsamkeiten.“
Anna Schraufek (16), BG und BRG Geringergasse G11 (Wien), Englisch
„Nehmen Sie uns ernst, denn in meinen Träumen tun Sie das, und diese Träume können zu ihnen fliegen, zu allen Eltern, Lehrern und Lehrerinnen und allen anderen die mir zuhören, uns zu hören, den Jugendlichen, die an Systemüberlastung leiden.“
Sabrina Ye (17), ITE Cesare Battisti (Südtirol, Italien), Chinesisch
„Technologie kann die Stimme kopieren, aber nicht den Herzschlag. Künstliche Intelligenz kann Dialoge simulieren, aber nicht die Seele berühren.“
Hannah Zipfinger (17), Amerlinggymnasium (Wien), Englisch
„Es ist als ständen wie auf einem langen Laufband, das sich rückwärts bewegt. Wenn wir nicht aktiv etwas machen, wenn wir stillstehen, werden wir zurückbefördert.“

„Ich bin groß, deshalb muss ich viel essen“, meint der Bär.
„Ich bin klein und muss noch wachsen“, entgegnet das Wiesel.
So begründen beide, weshalb sie jeweils zwei der drei zubereiteten Pilze kriegen sollten und das für gerecht halten.
Bär und Wiesel leben wie ein Ehepaar oder Geschwister (?) zusammen. Sie scheinen einander offensichtlich sehr zu mögen. Doch immer wieder kommt es zum Streit. Gründe dafür sucht und findet Autor und Illustrator Jörg Mühle für seine Bilderbücher im Alltag (nicht nur) von Kindern.
Ums Teilen geht es in „Zwei für dich, einer für mich“. Bär hat im Wald Pilze gesammelt, drei Stück bringt er eben nach Hause. Wiesel bereitet daraus eine Mahlzeit zu.

Drei Stück – wie sollen die nun aufgeteilt werden? Die ersten Argumente der beiden Hauptfiguren sind schon zu Beginn hier genannt worden. Weitere folgen: Bär hat die Schwammerln gefunden, Wiesel sie hingegen gebraten, gewürzt und angerichtet. „Aber nach meinem Rezept!“, so der Bär, der außerdem darauf pocht, den Tisch gedeckt zu haben…
Der Streit schaukelt sich hoch und …
… der Autor und Illustrator gibt, wenngleich er die Geschichte in Wort und Zeichnung weitererzählt, keine wirkliche Lösung vor. Wie bei seinen interaktiven Lesungen kürzlich beim Kinderliteraturfestival im Wiener Odeon (Link zum Bericht darüber weiter unten) überlässt er dir und dir und … und allen, sich eigene Gedanken zu machen; mit anderen darüber zu diskutieren; eigene, vielleicht auch ganz unterschiedliche Auswege zu finden. Denn auch – konstruktiv – Streiten will gelernt werden.


Ein rundes Konglomerat aus Stacheldraht, ziemlich viel Kunststoff-Zeugs davor und im Hintergrund laufen Videos, teilweise in Schwarz-Weiß. Aus dem Durcheinander in der Bühnenmitte – so viel darf schon gespoilert werden – schält sich eine junge, langhaarige Frau – zunächst mit einer Ganzgesichtsmaske mit aufgemaltem, kräftigem Rufzeichen. Der Strich von der Stirn einschließlich der Nase, der Punkt als Mund.
Ist sie diese Danica Brdar, von der im Ankündigungstext die Rede ist und über die nun eine Stimme aus dem Off (Barbara Angermaier) erzählt? Oder „nur“ eine Projektion für dieses 1993 im kroatischen Karlovac (an die 50.000 Einwohner:innen in ähnlich viele wie St. Pölten, die NÖ-Landeshauptstadt) geborene Mädchen, das stellvertretend steht für alle, die in dieser (Nach-)Kriegs-Zeit im ehemaligen Jugoslawien steht?

Mit einem „Dad, who was in the war“ (einem Vater, der im Krieg war) und einer heranwachsenden jungen Frau, die mehr, die alles wollte – „The Girl Who Wanted It All“ heißt die beeindruckende, vielseitige, berührende und doch nie pathetische oder tränendrüsen-drückende Performance von Kasija Vrbanac Strelkin. Sie spielt, tanzt, turnt auf der Bühne, spielt zudem Gitarre und schmeißt mit fast einem Dutzend Barbie-Puppen, die für Figuren aus der Erzählung stehen, mitunter um sich.
Immer wieder wechselt sie sich in der Erzählung mit der Off-Stimme ab, wenn sie in die jeweilige Szene eintaucht, agiert. Die Off-Stimme ist nicht nur verbindende Erzähl-, sondern auch Stimme der Gedanken der Protagonistin. Und sie nennt die beiden erwähnten Sätze als adjektive Zuschreibungen bei praktisch jeder Erwähnung sowohl des Mädchens als auch des Vaters – vielleicht ein bisschen zu oft.

Ivan Strelkin hat aus echten, wahren Geschichten und Personen, die die Performerin erlebt hat oder kennt eine dichterisch freie Story geschrieben und inszeniert.
Von Nachwirkungen des Krieges, Träumen, Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten dieser Danica, Enttäuschungen, die sie in der Begegnung mit männlichen Freunden erlebt, von anderen, die frühzeitig die Erde verlassen haben und von einigen Hunden als viel treueren Weggefährten.
Mit 18 Jahren – so der Ankündigungstext – geht Danica nach Wien zum Studium und kehrt erst zehn Jahre später zum ersten Besuch in die alte Heimat zurück. Darum kreisen viele der mit sparsamen Worten und umso intensiverer, oft sehr körperlicher Darstellung gespielten Szenen. Wobei dieser Teil des Plots später wieder relativiert wird – war sie überhaupt je weg?

Zwischen da und dort pendelt auch unausgesprochen die gute, intensive Stunde – einerseits kommen die kleinen Episoden mit so großen Gefühlen einem bekannt vor und gleichzeitig schwingt auch eine Distanz mit – wie ein Blick auf doch nicht ganz Vertrautes, Nahes und doch Fremdes…

Vielfalt ist nicht nur ein Schlagwort – sie war am Freitag (16. Mai 2025) vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag hör-, sicht-, spür- und erlebbar im großen, prunkvollen Festsaal des Wiener Rathauses. Es war wieder „Sag’s Multi“-Time. Der mehrsprachige Redebewerb fand seinen 16. Abschluss (wieder) hier.
397 Jugendliche aus allen neun österreichischen Bundesländern und dazu noch dem italienischen zweisprachigen Südtirol hatten in diesem Schuljahr aus AHS, BHS und MS (allgemein- und berufsbildenden höheren sowie Mittelschulen) teilgenommen. Neben Lob, Anerkennung von Politik, Wirtschaft und Interessensvertretungen für die vielseitigen Redetalente – alle eingeladenen hatten es ins Finale geschafft und sind somit Gewinner:innen – gab es traditionell noch spezielle Auszeichnungen für Preisträger:innen, die Besten der Besten. Die von der Jury dafür Auserkorenen wussten davon im Vorfeld noch nichts und waren jeweils mehr oder minder sehr überrascht. Sie alle werden in den nächsten Tagen hier in weiteren Beiträgen vorgestellt.
Bei der Preisverleihung von Sag’s Multi reden immer aber nicht nur Erwachsene über die Jugendlichen, sondern stellvertretend für alle Teilnehmer:innen halten einige ihre Reden hier auf der Bühne hinter dem hölzernen Podium noch einmal (in gekürzter Version).
Da saßen nun gleich in einer der schräg gestellten ersten Reihen Sviat Kolodii, Alexander Unger, Naya Okla, Anna Schraufek und Henna Islamović nebeneinander. Sie – und dazu noch Fatima Sajad (die bei ihrer Klasse aus Bozen (Italien) saß – wussten, dass sie im Laufe der Veranstaltung diese Bühne betreten und zu ihren Mit-Sag’s-Multianer:innen sowie deren Begleiter:innen (stolze Eltern, Geschwister, Freund:innen und Mitschüler:innen) und nicht zuletzt einem viel größeren Publikum im Live-Stream (kann auch nach-gesehen werden) sprechen werden. Der eine oder andere Blick in die ausgedruckte Rede, aber kaum Nervosität, eher Vorfreude darauf, dass eben noch viel mehr zuhören, was sie jeweils zu sagen haben.
Hier in diesem Bericht – weitere werden in den kommenden Tagen noch folgen – finden sich hier einerseits Zitate aus den Reden der sechs genannten Jugendlichen sowie Links zu eigenen Beiträgen mit der jeweils gesamten Rede, um diese bewegenden, tiefschürfenden Gedanken junger Menschen lesen zu können – in den kommenden Tagen folgen noch Video-Ausschnitte dazu, um auch die jeweils zweite Sprache neben Deutsch auch hören zu können. Die Reihenfolge hier ist – anders als zuvor nicht alphabetisch, sondern nach dem Alter.

Der Jüngste (und auch Kleinste, er sah nur knapp über das Redepult in den großen Saal) war der 13-jährige Alexander Unger, Schüler des Schottengymnasium der Benediktiner, Wien. Auf Deutsch und Russisch, das er ab dem fünften Lebensjahr gelernt hat, um mit seiner Oma in deren Sprache reden zu können. Bald danach lernte er auch Schach und tritt bei Turnieren und Meisterschaften an.
Unter anderem sagte er: „Sprache ist mehr als nur Wörter. Sie ist Musik, Melodie, Rhythmus. … Jede Sprache singt ihr eigenes Lied! Sprache ist der Schlüssel zur Freundschaft, zu neuen Entdeckungen, zu einer neuen Welt! Es ist wichtig nicht nur, was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen.“

Schon vor ihm sprach als jugendlicher Eröffnungsredner sozusagen sein Sitznachbar in der ersten Reihe, Sviatoslav Kolodii (15) aus der Modularen Mittelstufe Aspern (Wien) auf Ukrainisch. So wunderbar kann eben Weltoffenheit, Mehrsprachigkeit und Vielfalt sein – übrigens nur wenige später wurden zwei Stock tiefer auf dem Platz vor dem Wiener Rathaus die Festwochen unter dem Motto „Republik der Liebe“ eröffnet 😉
Er hatte seine Rede in Gedichtform verfasst, unter anderem heißt es darin – Link zum vollständigen Gedicht unten:
„Aber das ist nicht nur jetzt passiert,
Wir hatten nicht nur jetzt mit diesem Land Krieg.
Und all diese Jahre gab es Menschen,
die von ihrer Heimat weggezogen sind.
Sie haben ihre Häuser verlassen,
ihr Volk, ihre Freunde, ihren Ort.
Sie haben fast nichts mitgebracht,
nur ein paar Sachen und ein Passport.
Und ich habe mir gedacht
Ich werde niemals mein Land verlassen
aber jetzt lebe ich in zwei Ländern
Und ich will so die Dinge mal zulassen.“

„Damals saßen wir alle an einem Tisch – egal, welcher Name und welches Religionsbekenntnis auf unseren Papieren stand. Doch was wäre, wenn wir noch immer, zusammen – als Familie an diesem Tisch sitzen würden? Nicht getrennt durch Vorurteile und Hass, sondern durch unsere Menschlichkeit und Liebe vereint?“, erinnerte die 16-jährige Henna Islamović aus dem niederösterreichischen BG/BRG Purkersdorf auf Bosnisch und Deutsch, um so fortzusetzen: „Jelena sitzt heute in Graz, Marina in Linz, und ich, Henna, stehe hier vor euch. Wenn wir drei auf dieser Bühne stünden, könntet ihr uns nicht unterscheiden. Serbin, Kroatin, Bošnjakin. – Wir sind eins.“

Anna Schraufek (16), aus dem (Real-)Gymnasium Geringergasse in Wien-Simmering schilderte in eine anschauliche Geschichte – unter Verwendung von Englisch als erlernter Sprache – verpackt widersprüchliche Parallelwelten: Hier die Schüler:innen im Lern- und Schulstress, da die Erwachsenen, deren Ansprüchen Jugendliche nie zu genügen zu scheinen. „Also, an alle Erwachsenen da draußen, glauben Sie mir, wenn ich sage: Es ist nicht einfach und wir sind nicht die Besten – Nein – das kann nicht wahr sein, wir sind die Besten, wir sind die einzige junge Generation, die es gibt und wir arbeiten jeden Tag hart daran zurechtzukommen, zu wachsen und uns zu entwickeln, in einer Welt in der niemand Antworten auf gegenwärtige sowie zukünftige Probleme hat. Wir versuchen die Zukunft zu verändern, aber auch die Perspektiven der Erwachsenen, die nicht einmal die Hälfte darüber wissen, was in unserem Leben passiert.
Deswegen appelliere ich an Sie alle: Hören Sie zu, wenn Ihr Kind Ihnen etwas zu sagen hat. Hören Sie zu, wenn Schüler und Schülerinnen um eine spätere Abgabe bitten. Hören Sie zu! Zeigen Sie Verständnis!“

„Liebe Jugendliche lest nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern erstellt euch auch eine eigene. Denkt daran: Das Leben ist euer Leben, und die Geschichte ist eure Geschichte. Versucht es, probiert es aus, macht Fehler und scheitert, aber gebt niemals auf!… Jeden Morgen habt ihr zwei Möglichkeiten: Drückt die Schlummertaste und bleibt bequem, träumt weiter, oder wacht auf, betet und lasst eure Träume Wirklichkeit werden.
Unsere Träume können nicht von allein fliegen und wahr werden. Wir sind es, die sie zum Fliegen bringen, mit unserem Streben, unserem Mut und unserem Lernen.
Kein Ziel ist unerreichbar, wenn wir den Mut haben, es anzustreben“, vermittelte in einer mitreißenden Art mit Humor grundiert die 17-jährige Naya Okla, die darauf hinwies, dass sie ursprünglich aus Syrien kommt, von der BHAK im Osttiroler Lienz – auf Arabisch und natürlich Deutsch, das alle Teilnehmer:innen immer mit einer anderen Sprache (ob aus der Familie mitgebracht oder erlernt) im Bewerb verwenden (müssen).

Die 17-jäherige Fatima Sajad aus Der IISS Claudia de Medici in Bozen (Südtirol, Italien) schilderte was schwere Erkrankungen ihrer Mutter in der Familie auslösten – vor allem aber auch das Bewusstmachen, dass dies Anlass war, daran zu denken, geliebte Menschen im Umfeld im Hier und Jetzt zu schätzen – auf Urdu (und natürlich Deutsch): „Es gibt Menschen, die würden alles dafür geben, auch nur eine Stunde mehr mit ihrer Mutter oder ihrem Vater oder einem anderen geliebten Menschen verbringen zu dürfen.
Wir wissen nicht, was morgen passiert. Also bitte: Lernt, jeden Moment zu schätzen, den wir mit denen verbringen, die wir lieben, bevor es zu spät ist. Denn keiner von uns ist für immer da.“

Ganz ehrlich!? Haben Sie sich heute Morgen im Spiegel angeschaut? So richtig hingeschaut? Ihre Haare, Ihre Augen, Ihre Haut – vielleicht sogar ein wenig darüber nachgedacht, wer Sie sind? Wer Sie wirklich sind? Vermutlich nicht, denn warum auch? Es ist doch selbstverständlich, dass Sie so sind, wie Sie sind.
Aber jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor: Was, wenn wir alle genau gleich wären? Wenn es auf dieser Welt nur 1:1-Kopien von euch selber gäbe? Ihre Haare, Ihre Augen, sogar Ihre Gedanken – alles ein Spiegelbild von jemandem anderen.

Stellen Sie sich vor, alle würden das Gleiche mögen, das Gleiche denken und das Gleiche essen – jeden einzelnen Tag. Das würde bedeuten, es gäbe weder Baklava noch Pizza, und vor allem keine Ćevape. Ich mein, ist doch absurd, oder? Klingt das nach einer besseren Welt? Oder eher nach einer Welt, die schrecklich leer und langweilig ist?
Liebe Zuhörer, mein Name ist Henna Islamović, ich bin 16 Jahre alt und besuche derzeit die 6te Klasse des Bundesrealgymnasiums in Purkersdorf. Heute spreche ich in der Hoffnung, Menschen zu erreichen und ihre Herzen zu berühren, um ihnen zu zeigen, dass Vielfalt unsere größte Stärke ist – aber nur wenn wir die Mut haben, sie anzunehmen.

Unsere Welt lebt von ihrer Vielfalt, sie atmet Vielfalt und doch behandeln wir sie oft, als wäre sie ein Problem. Fremdes wird skeptisch angesehen, Anderssein wird ausgegrenzt. Aber ehrlich gesagt: Was bleibt uns übrig, wenn alle gleich sind?
Jeden Tag, wirklich jeden einzelnen Tag, enttäuscht mich das. Ganz ehrlich – warum, warum halten wir nicht zusammen? Wie oft müssen wir noch fallen, bis wir endlich begreifen, dass wir stärker sind, wenn wir eins sind?
Diese falsche Denkweise zerstört. Sie grenzt aus. Sie schwächt uns – als Gesellschaft, als Menschen. Dadurch entsteht Diskriminierung, Ausgrenzung und eine verdorbene Gesellschaft, die es wagt, Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder ihrer Religion zu verurteilen.

Warum sehen wir Unterschiede nicht als Stärke, Chance oder Reichtum – sondern als Bedrohung? Statt sie zu feiern, fürchten wir sie. Sind wir wirklich so verschlossen, dass wir nicht erkennen, dass uns gerade diese Unterschiede stärker, gerechter und besser als Gesellschaft machen?
Ich möchte euch mal eine ganz persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen. Meine Eltern kommen aus Jugoslawien, genauer gesagt aus Bosnien. Sie sind hierher geflüchtet, genauso wie die Mutter von Jelena und der Vater von Marina.

In der Zeit Jugoslawiens, unter Titos Führung, lebten wir alle zusammen wie eine große Familie, ohne den Hass und die Probleme, die uns heute trennen. Es war eine Zeit, in der Unterschiede nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung wahrgenommen wurden. Und heute, wenn wir zurückblicken, erscheint es fast absurd: Wie kann es sein, dass wir, sobald sich die Politik ändert, all diese Herausforderungen nicht mehr überwinden können?
Damals saßen wir alle an einem Tisch – egal, welcher Name und welches Religionsbekenntnis auf unseren Papieren stand. Doch was wäre, wenn wir noch immer, zusammen – als Familie an diesem Tisch sitzen würden? Nicht getrennt durch Vorurteile und Hass, sondern durch unsere Menschlichkeit und Liebe vereint?

Jelena sitzt heute in Graz, Marina in Linz, und ich, Henna, stehe hier vor euch. Wenn wir drei auf dieser Bühne stünden, könntet ihr uns nicht unterscheiden. Serbin, Kroatin, Bošnjakin. – Wir sind eins.
Liebe Zuhörer, am Anfang habe ich euch gefragt, ob ihr euch heute Morgen im Spiegel angeschaut habt. Jetzt möchte ich euch bitten, nicht nur in diesen Spiegel zu blicken. Blickt nicht nur auf euch selbst, sucht nicht nur nach euch selbst in anderen, sondern blickt auf die Welt um euch herum. Lasst uns die Vielfalt, die uns umgibt, nicht als Belastung oder Bedrohung sehen, sondern als das, was sie wirklich ist: eine Bereicherung!

Lassen Sie mich Ihr Spiegel sein! Schauen Sie mich an! Ich bin ich und wir sind wir.
Es spielt keine Rolle, was ich bin, wer ich bin oder woher ich komme. Was zählt, ist unsere Geschichte, die uns alle einzigartig macht.
Lasst uns die Veränderung sein, die diese Welt so dringend braucht!
Lassen wir nicht zu, dass unsere Unterschiede uns trennen!
Lassen wir sie uns verbinden, nicht spalten!
Lasst uns die Vielfalt leben und lieben! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!!

Hallo, ich bin Sviat, ein Junge aus der Ukraine,
aus dem Land der Schwarzerde, der Freiheit und der Schönheit,
Ein Land der Berge, des Viburnums und der Natur,
Ein Land von Menschen, die für große Veränderungen bereit sind.
Aber unser Land ist in Gefahr,
unser Volk ist in Not,
die Russen, unsere erbitterten Feinde.
versuchen, uns alles zu nehmen, was wir bewahrt haben.
(Übersetzung von Ukrainisch)

Aber das ist nicht nur jetzt passiert,
Wir hatten nicht nur jetzt mit diesem Land Krieg.
Und all diese Jahre gab es Menschen,
die von ihrer Heimat weggezogen sind.
Sie haben ihre Häuser verlassen,
ihr Volk, ihre Freunde, ihren Ort.
Sie haben fast nichts mitgebracht,
nur ein paar Sachen und ein Passport.

Und ich habe mir gedacht
Ich werde niemals mein Land verlassen
aber jetzt lebe ich in zwei Ländern
Und ich will so die Dinge mal zulassen.
(Original auf Deutsch)
Da ist noch eine Bewegung in mir,
eine Bewegung zu meinem Land, meiner Erde
Ich will nach Hause, zu meinem Vater,
Ich möchte in der Wärme meiner Heimat sein.

Aber ich weiß, warum ich hier bin,
Was mein Ziel ist,
Hier zu studieren, im schönen Wien,
mit dem Ziel, die Entwicklung meines Landes voranzutreiben.
(Übersetzung von Ukrainisch)
Aber ich verstehe ein Ding nicht
Warum soll ich mich eigentlich von meinem Land wegbewegen?
Warum können wir, als Menschen
nicht einfach zusammenleben?

Es gibt Krankheiten, für die wir Medizin brauchen,
es gibt Menschen, die Nahrung brauchen.
Doch das Geld, das wir dafür benötigen,
verwenden wir, um Menschen zu töten.
Und warum bewegen wir uns in diese Richtung
Warum können wir nicht einfach in Frieden leben?
Ich will in meiner Zukunft nicht kämpfen.
Warum sollte überhaupt jemand kämpfen?
Wenn wir alle die Welt genießen können,
den Frieden genießen können.

Aber leider ist es nicht so,
leider bewegen wir uns nicht in die richtige Richtung.
Leider gibt es noch Familien,
die ihre Väter nicht mehr sehen können,
nur weil unsere Feinde einfach streiten wollen.
Ich will, dass mein Land in die Bewegung wie Wien geht
In die Richtung modern, und nicht den Krieg bewegt
Aber nicht nur mein Land soll in die Richtung gehen
Sondern auch alle Länder, die nur Krieg sehen
(Original auf Deutsch)

Aber das ist nicht einfach, nicht so schnell.
Dazu müssen wir unsere Feinde frei lassen.
Wir müssen ihre Sünden für unsere Freunde vergeben
Für die Brüder, die in unserem Heimatland gefallen sind
Für unser Volk, das sie ermordet haben
Für unsere Vorfahren, die ihren Körper für die Freiheit gaben.
Um unseren Wohlstand ein Stück näher zu kommen,
müssen wir, die Menschheit, diese Schritte tun
Und dann können wir ohne Krieg leben
Ohne dieses Monster auf unserem Land.
(Übersetzung von Ukrainisch)

Ich glaube, wir schaffen es,
wir schaffen es, ohne Kriege und Streit zu leben.
Wir schaffen, mehr unsere Erde zu verstehen
Und mehr in die Richtung für ihre Hilfe zu bewegen.
Lasst uns mehr die Meere von Plastik schützen
Lasst uns Zusammenhalt stärken und fühlen
Lasst uns überlegen
Ob wir als Menschheit mit diesen Kriegen wirklich in eine glückliche Zukunft gehen.
(Original auf Deutsch)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Naya Okla, ich bin 17 Jahre alt und komme ursprünglich aus Syrien. Momentan besuche ich die Bundeshandelsakademie Lienz, wo ich daran arbeite, meine Träume wahr werden zu lassen.
Die Realität des Lebens hält uns manchmal davon ab, unsere Träume zu verfolgen. Aber ich möchte euch junge Menschen ermutigen: Macht weiter! Auch wenn ihr Angst habt oder euch allein fühlt, gebt nicht auf! Jede Herausforderung ist eine Gelegenheit, zu wachsen. Und unabhängig von den Ergebnissen, der Unterschied zwischen „Ich wünschte, ich hätte es versucht“ und „Zumindest habe ich es versucht“, ist schön und würdig.

Als wir nach Österreich kamen, dachte ich, es sei das Ende, und ich könnte meine Träume nicht verwirklichen. Ich sprach die gleiche Sprache nicht, kannte die Menschen nicht, hatte keine Freunde und befürchtete, in der Schule schlecht abzuschneiden.
Doch heute stehe ich hier und verwirkliche einen meiner großen Träume. Es war nie das Ende, sondern der Beginn eines neuen Kapitels in meinem Leben, ein Kapitel, in dem ich meine größten Ziele erreiche. Einer dieser Träume was es, in die HAK zu kommen. Als ich noch in der Volksschule war, habe ich mir fest vorgenommen, in diese Schule zu kommen. Heute bin ich stolz, dass ich es geschafft habe, meinen Traum zu verwirklichen und die HAK zu besuchen. Ich bin nicht nur stolz, sondern auch dankbar für all die Herausforderungen, die mich stärker gemacht haben, und die Unterstützung, die mir geholfen hat, meinen Traum zu verwirklichen.

Ein besonderes Dankeschön geht an meine große Schwester Aya und an meine Eltern, danke, dass ihr immer an mich geglaubt und mich auf meinem Weg begleitet habt.
Liebe Jugendliche lest nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern erstellt euch auch eine eigene.
Denkt daran: „Das Leben ist euer Leben, und die Geschichte ist eure Geschichte. Versucht es, probiert es aus, macht Fehler und scheitert, aber gebt niemals auf!“

Zum Schluss möchte ich noch sagen: Jeden Morgen habt ihr zwei Möglichkeiten: Drückt die Schlummertaste und bleibt bequem, träumt weiter, oder wacht auf, betet und lasst eure Träume Wirklichkeit werden.
Unsere Träume können nicht von allein fliegen und wahr werden. Wir sind es, die sie zum Fliegen bringen, mit unserem Streben, unserem Mut und unserem Lernen.
Kein Ziel ist unerreichbar, wenn wir den Mut haben, es anzustreben.
Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass es uns allen gelingt, unsere Träume zu verwirklichen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen