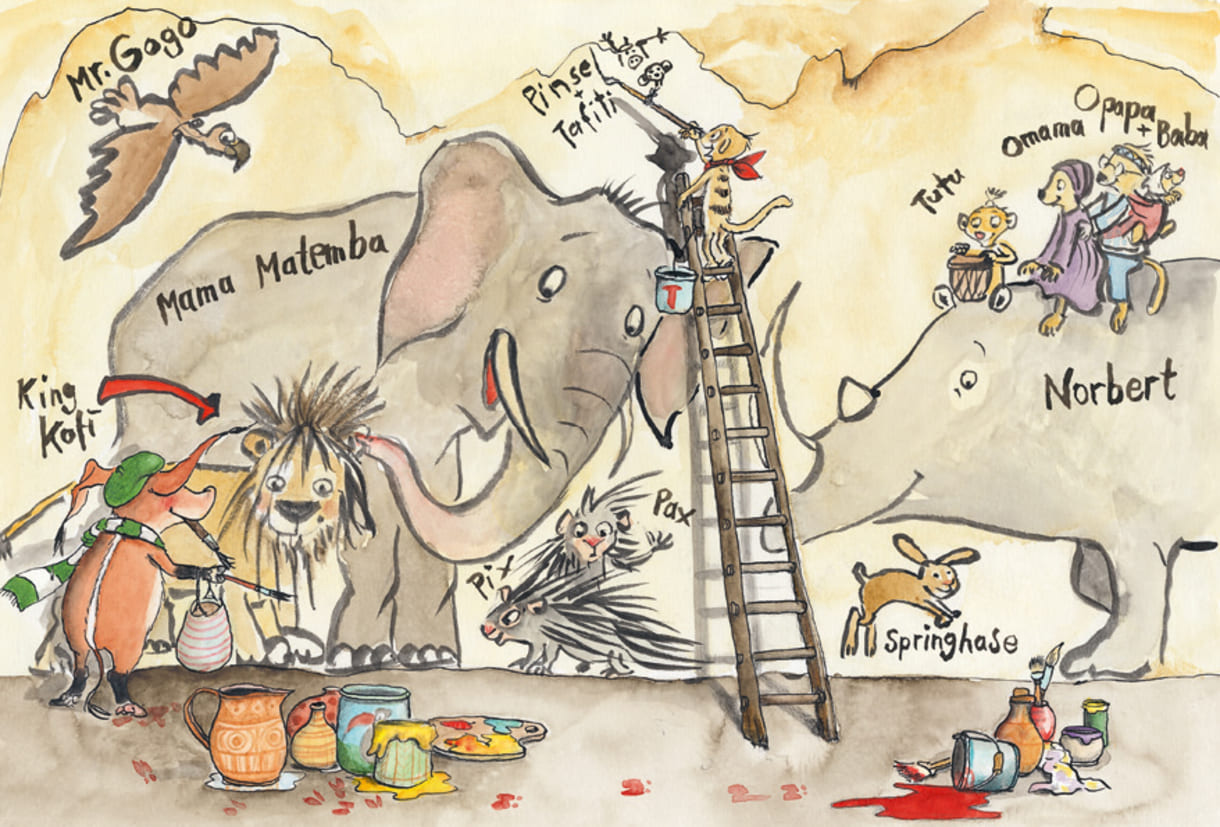
Bevor’s hier demnächst und das noch dazu ausführlich um den großen Kinoauftritt von Erdmännchen Tafiti und seiner abenteuerlichen Reise durch die Wüste – vor allem mit seinem Lebensfreund Pinsel, seines Zeichens ein Pinselohrschwein – geht, noch schnell eine Besprechung des jüngsten regulären Bandes (Nummer 23) aus dieser Reihe von den beiden Julias Boehme (Autorin) und Ginsbach (Illustratorin).
„Erdmännchen in Gefahr“ passt ziemlich gut zum Filmabenteuer „Tafiti – Ab durch die Wüste“. Doch hier sind es vor allem Verwandte des Titelhelden, die sich manchmal in Gefahr begeben, viel öfter aber solche wittern, auch wenn Tafiti himself dann stets klärend eingreift. Die vermeintlich gefährlichen Tiere sind dann allesamt Freundinnen und Freunde des Erdmännchen-Helden.
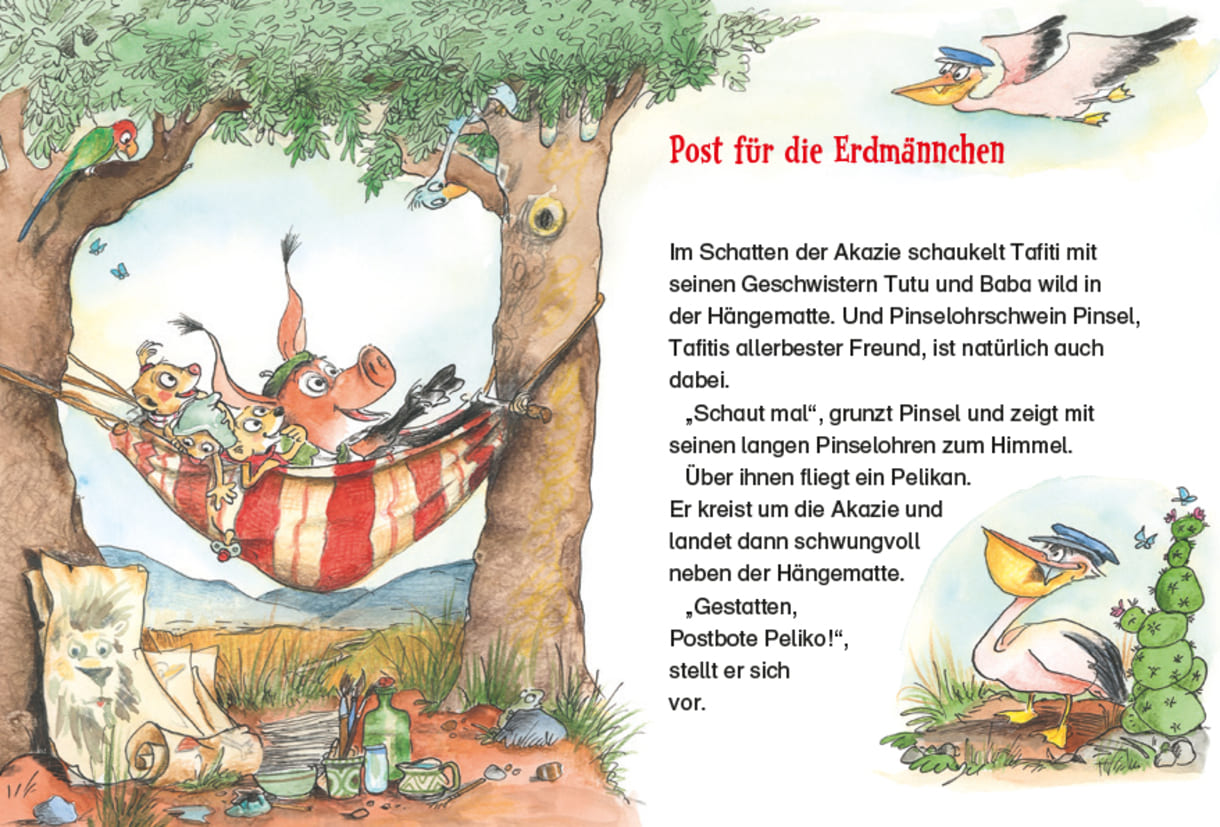
Der Kontakt zu den weitschichtig Verwandten, die weit weg auf einer Art Insel leben, kam über einen von einem Pelikan, der dank seines Schnabels als Postler arbeitet, zugestellten Breifes zustande. Und nun wandern Zula und Jabari in Richtung Tafitis Familie. Alles halten sie für Löwen und damit lebensbedrohlich. Doch einmal ist es ein Vogel Strauß, dann wieder sind es Elefanten. Doch dann taucht wirklich King Kofi der Löwe auf.
Natürlich werden alle Abenteuer glücklich überstanden, so viel darf doch verraten werden, ohne die Spannung des wieder licht lesbaren und reich illustrierten Buches zu zerstören.
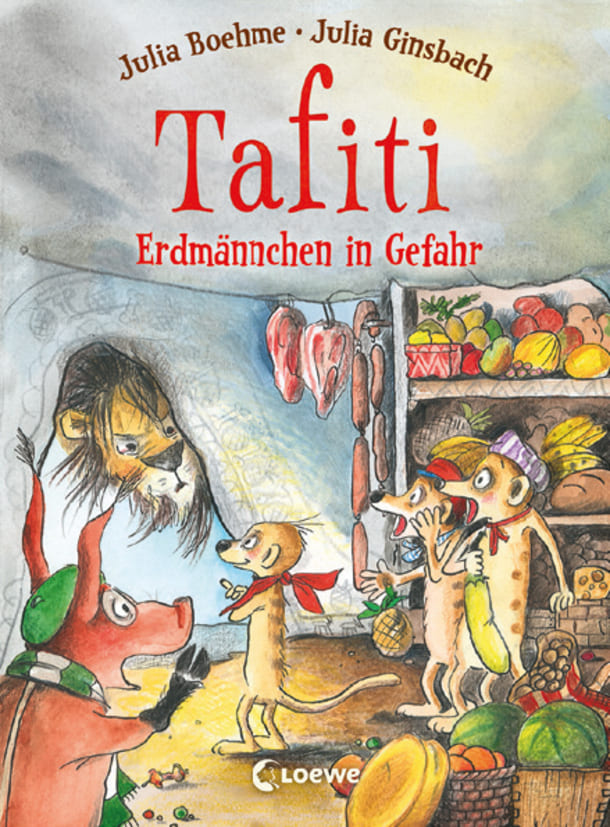
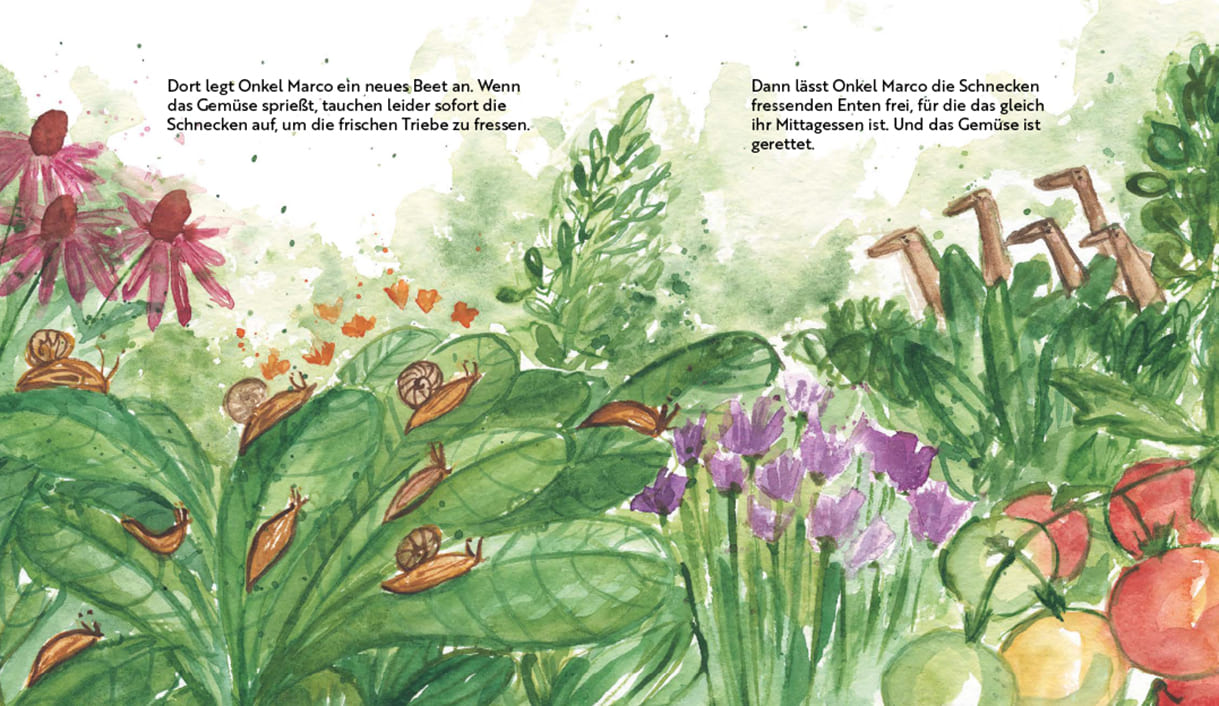
Was im Titel vielleicht ein wenig seltsam wirkt „Pizzasoßen-Beet“, beginnt mit der möglicherweise großspurig wirkenden Ansage der Titelheldin „Ich bin Minka und mein Plan ist, die Welt zu retten“.
Minka ist ein Kind, hat aufgeschnappt, dass die Erde in Gefahr ist und „wenn kein Wunder passiert, ist das Ende nah“.
Aber statt in Ohnmacht zu verfallen oder nur große Reden zu halten, will dieses Mädchen was tun. Und lernt vom Onkel Marco und dessen aufs Erste eher verwildert ausschauenden Garten, dass es ganz gut ist, nicht nur eine Sorte zu pflanzen, sondern verschiedene miteinander. Und das ganz absichtlich, obwohl Tante Olga behauptet, Marco sei nur zu faul und wo ihm Samen aus der Hand fallen, dort wächst dann eben dies und das, kreuz und quer.
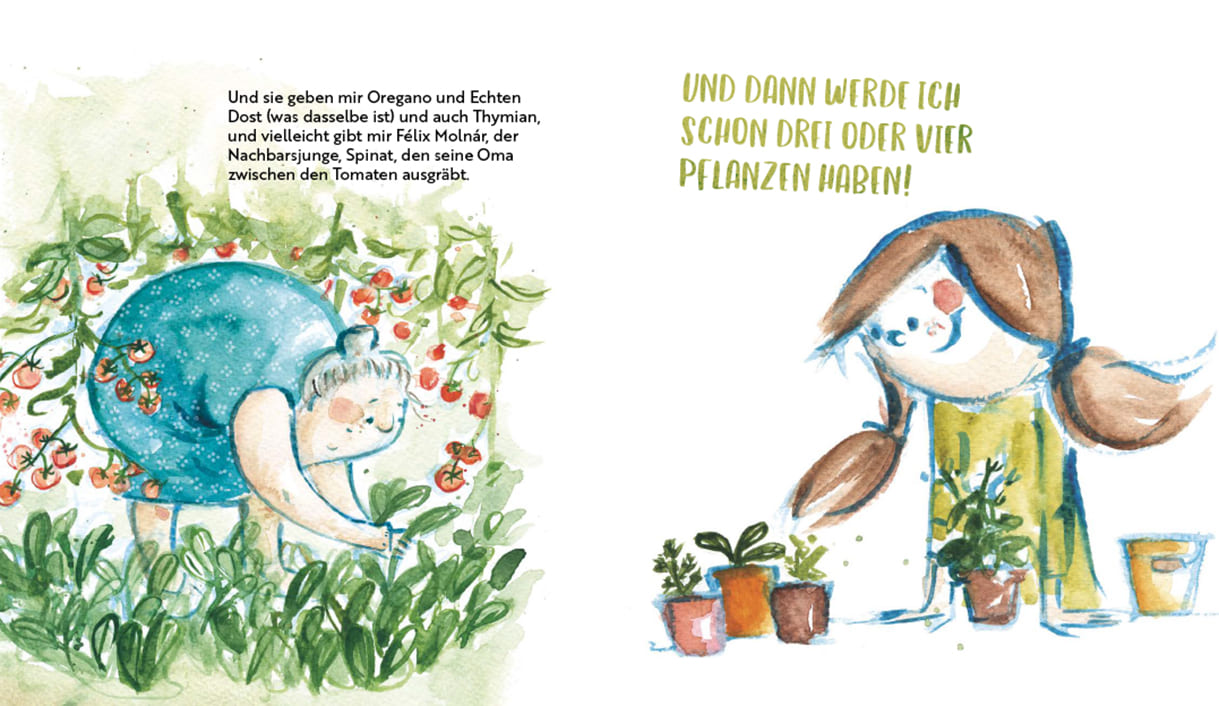
„Wenn zum Beispiel ein kleiner Käfer, sagen wir, die Tomate auffressen will, dann traut er sich nicht in ihre Nähe, weil er es hasst, dass der Knoblauch so stinkt“, erklärt der Marco seiner Nichte Minka.
Und von da ausgehend erklärt sich nach und nach auch der Großteil des Buchtitels „Minka, Onkel Marco & das Pizzasoßen-Beet“ – fast alles, was für eine Soße auf dieser beliebten Speise mit Teigunterlage gebraucht wird, bis hin zu den Gewürzen, lässt der Onkel eben in einem Beet neben- und miteinander sprießen. Benötigt keine chemischen Mittel zur Schädlingsbekämpfung, verhindert Weltreisen der Lebensmittel – und trägt so ein bisschen zur Rettung des Planeten bei.
Das nicht einfache Thema Biodiversität – verschiedene Pflanzen statt Mono-Kulturen – und dazu noch der Einsatz Schnecken fressender Enten, Käfer pickender Hühner – wird so in einer einfach daherkommenden Geschichte super und in ziemlich einfachen Sätzen erklärt.
Das reich, teils im Stil von Kinderzeichnungen bebilderte Buch von Írisz Agócs, die auch den Text auf Ungarisch verfasst hat (Übersetzung: Eva Zador) ist im Rahmen des von der Europäischen Union (EU) geförderten Projekts „Nachbarschaft schaffen, Brücken bauen durch Übersetzungen“ erschienen.
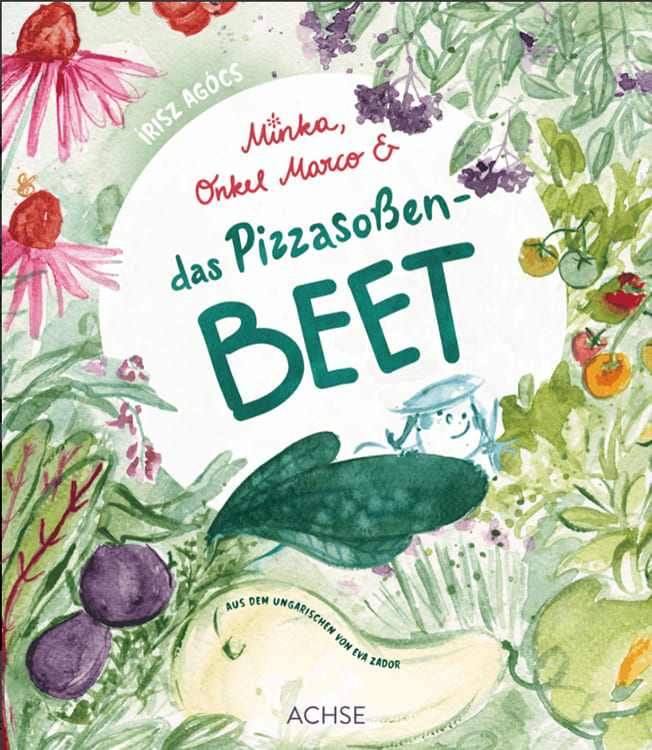
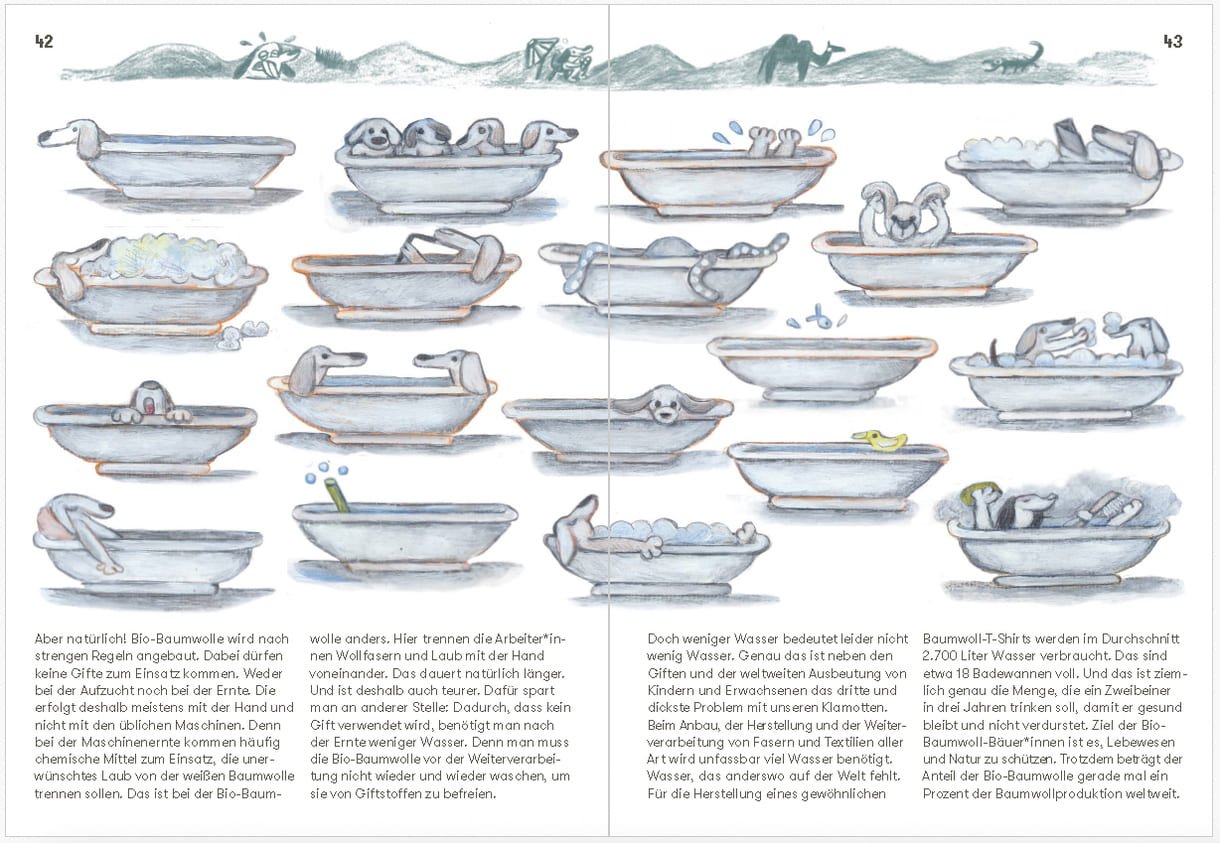
Das Titelbild und vor allem der Untertitel zeigen und sagen klar, worum‘s geht: Viiiiele Schuhe und einige Klamotten und Kappen mit Brillen und „Hunde-)Klappohren an und rund um einen Hund. „Wie weit wir für unsere Kleidung gehen“ – wobei eigentlich genau anders rum – wie weit Kleidung für uns geht – und dann letztlich aber doch wieder die erste Variante, aber dazu später.
„Hunderunde“ – so der Haupttitel – ist ein mit Humor gewürztes stark bebildertes Sachbuch rund um unsere Kleidung, wie und wo sie unter welchen Bedingungen hergestellt wird – Stichwort Kinderarbeit, noch dazu schlecht bezahlt und urarge Arbeitsbedingungen -, Verschwendung – weil oft viel gekauft und wenig getragen wird -, Natur- und Kunststoff-Fasern.
So manches, das oft mit nüchternen Zahlen abgehandelt wird, zeigt dieses Buch recht anschaulich. Die Doppelseite 42 / 43 ist mit 18 Badewannen und darinnen plantschenden oder entspannd liegenden Hunden gefüllt und illustriert: „Für die Herstellung eines gewöhnlichen Baumwoll-T-Shirts werden im Durchschnitt 2700 Liter Wasser verbraucht. Das sind 18 Badewannen voll. Und das ist ziemlich genau die Menge, die ein Zweibeiner in drei Jahren trinken soll, damit er gesund bleibt und nicht verdurstet.“ (siehe Bild ganz oben)
Aber auch eine Geschichte der Kleidung – vorwiegend europäischer, Kleidungsvorschriften und -Normen und vieles mehr wird oft „so nebenbei“ verklickert.
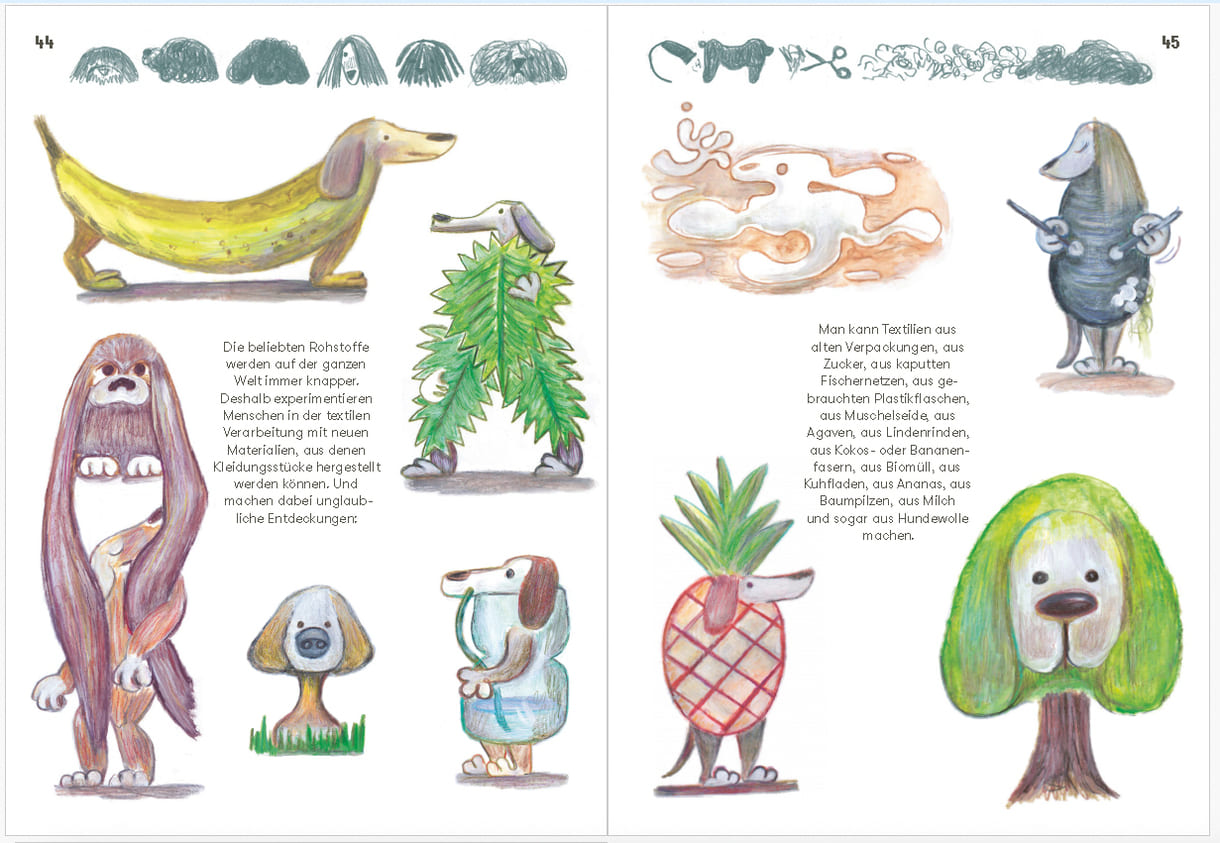
Die bekannte Autorin Frauke Angel hat den Text verfasst, Nadine Prange rund um und anhand vieler Hunde die Bilder, teils im Stile von – professionell angefertigten – Kinderzeichnungen beigesteuert. Idee und Konzept kommt von einer Initiative namens lokaltextil, namentlich von Eva Howitz und Lena Seik. Das Quartett wollte mit dem Buch aber nicht Käuferinnen und Käufern oder Kindern, die sich Kleidung wünsche, schlechtes Gewissen einreden, sondern neben der Sachinformation darüber wie (ultra) fast fashion funktioniert, Alternativen von Reparieren, tauschen und ähnliches entgegenstellen und dies sehr oft auch humorvoll. Ergänzend zum Buch gibt’s von der genannten Initiative auch eine Website mit weiterführendem Wissenswerten – Link in der Buch-Info-Box.
Und die vier hinterfragen sich am End auch teilweise selbst. Die vorletzten vier Seiten sind einer Art Chat-Diskussion untereinander gewidmet, die so beginnt:
„Nadine Prange: Na, jetzt sind wir alle zwar schlauer.
Frauke Angel: Aber auch verzweifelter. Was kann ich alleine schon ausrichten?…“
Und mit einem hoffnungsfrohen Zukunftsbild mit „Repair-Café“ und „Tauschladen“ endet.
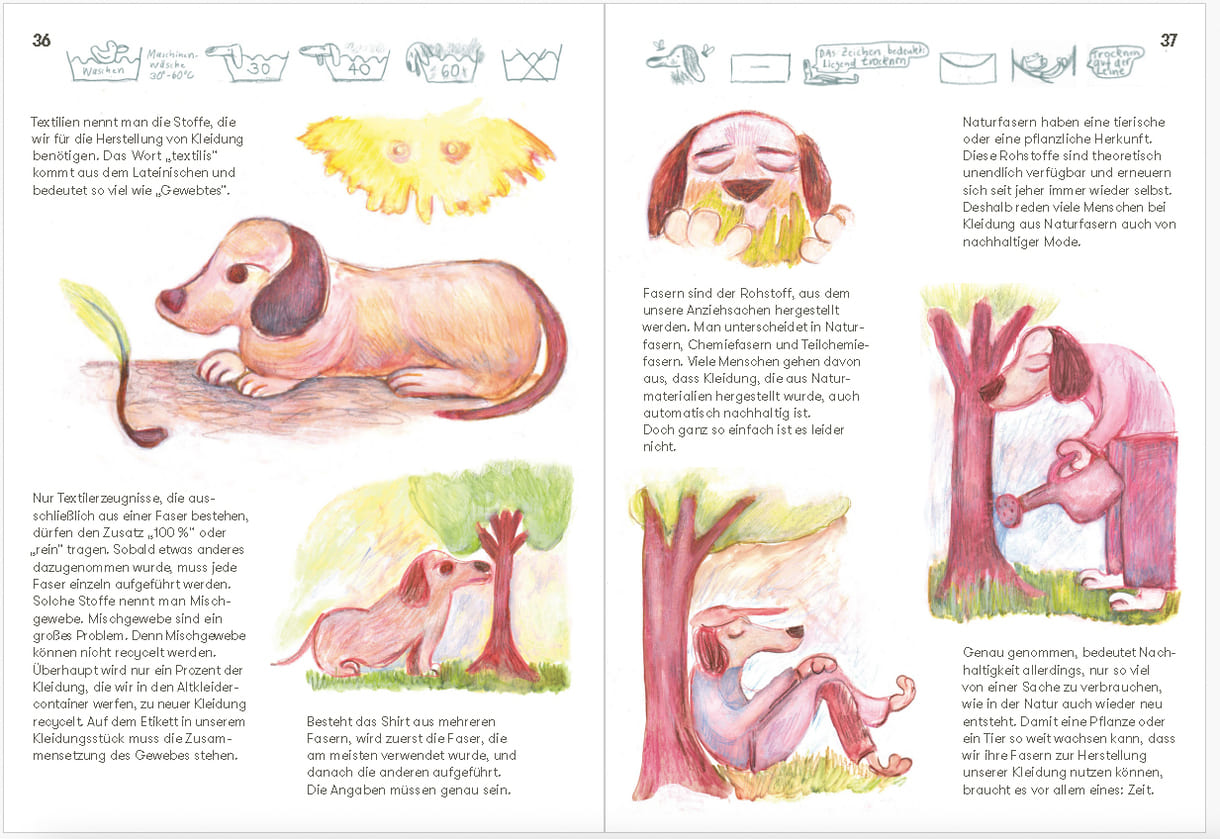
Bleibt immer noch die Frage, warum gerade „Hunderunde“. Nun, Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vermutetet zunächst wegen des Plädoyers für Kreislaufwirtschaft schlicht den Reim Runde – Hunde als Grund und fragte bei der Autorin nach. Und prompt kam via Social Media-Netzwerk die Antwort: „Nein: „eine Hunderunde drehen“ beschreibt ja etwas wie den Spaziergang um die eigene Haustür. Da wollten wir ansetzen. Wir vier Macherinnen kommen alle aus Sachsen und unser Bundesland hat eine krasse Textilindustrie. Umso krasser, dass auch hier (wie überall) der Fast-Fashion-Weg konsumiert wird. Wir könnten es anders machen. Außerdem der Untertitel: Wie weit gehen wir für unsere Klamotten? Reale Wege (z.B. nach Asien) als auch moralische Kompromisse ein? Und dann natürlich unsere liebenswerten Protagonist*innen: alles Hunde. Da kann man mitfühlen und kein Mensch fühlt sich auf den Schlips getreten. Und wir hatten auch einen echten Hund als Begleiter, einen Dackel namens Rudi. Wir haben uns von seinem Schnüffeln inspirieren lassen!“
Übrigens, in Österreich hieß eine von Christine Nöstlinger inspirierte und von vielen ihrer Geschichten getragene Radiosendung für Kinder im ORF nach Rudi, dem rasenden Radiohund (2003 bis 2024), „Hörfunksendung für Kinder, Damen, Herren und Welpen“.
Zurück zur „Runde“ – Es wandern also nicht nur (Teile) unserer Kleidung rund um den Erdball, das Buch stellt damit auch die Frage, wie weit wir beim Einkaufen von Klamotten, Schuhen usw. gehen wollen – auch wie weit weg von eigenen Grundsätzen, wenn wir über Umweltschutz einer- und Kinderrechten andererseits reden…
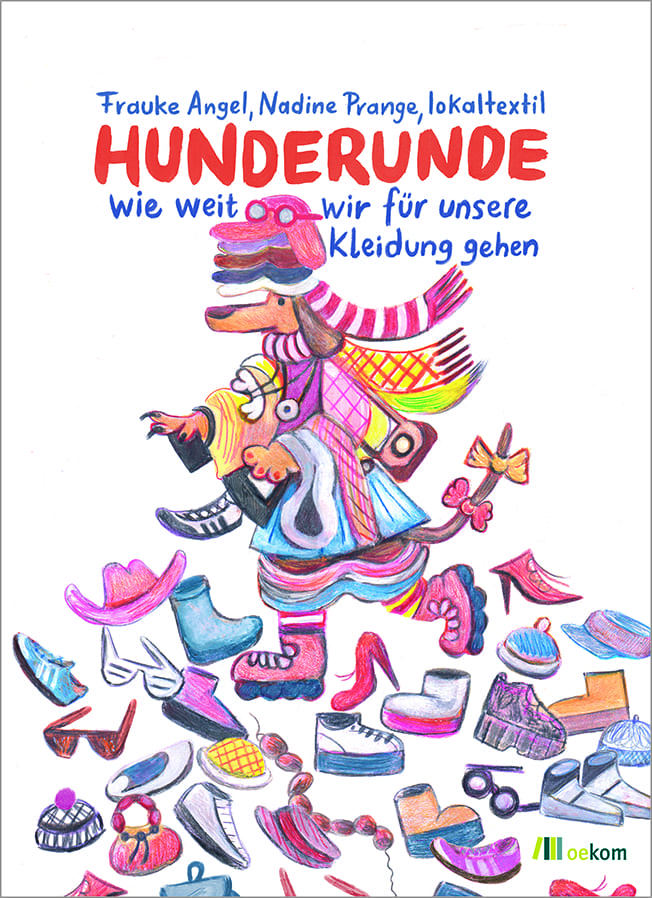
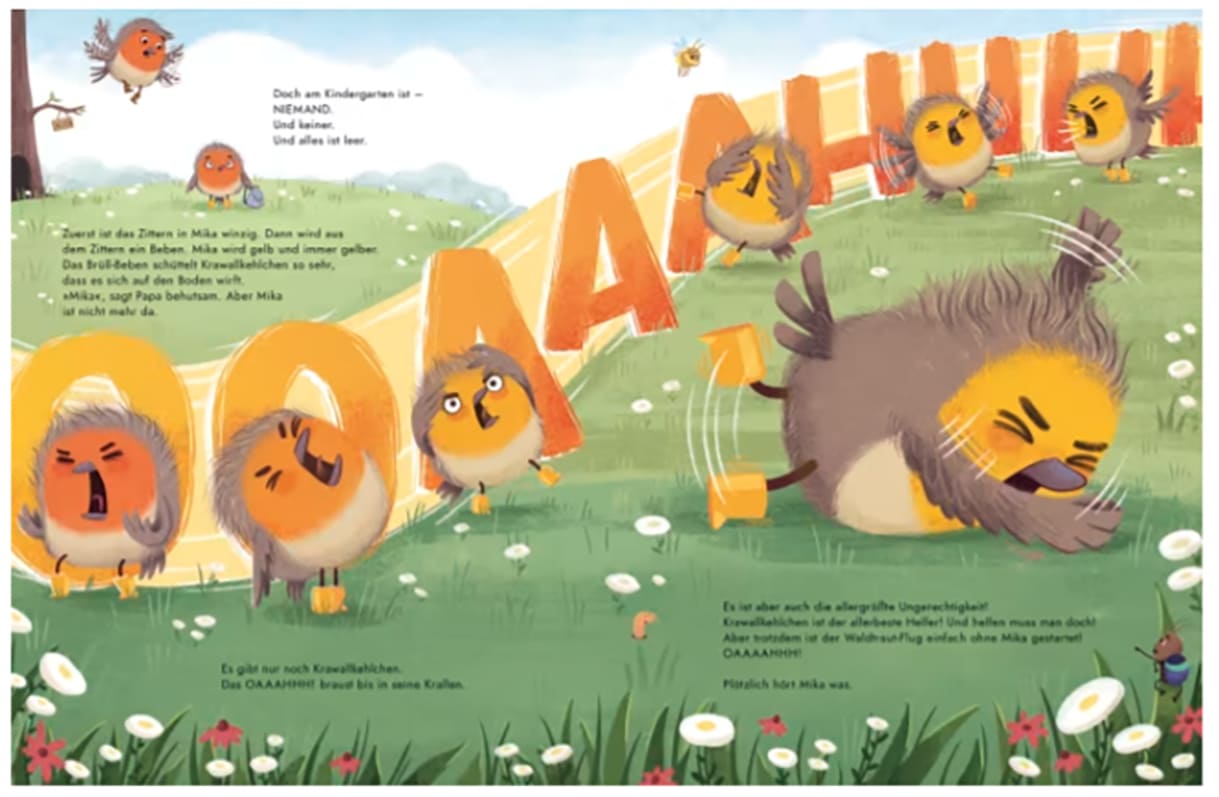
Lärm und Krawall – das können nicht nur Maschinen, Fahrzeuge usw. machen, das schafft auch die Natur. Denk nur beispielsweise an einen Wasserfall, an den Wind, wenn er pfeift… Dad können natürlich auch Lebewesen erzeugen. Von Tiergeräuschen bis zu deiner Stimme. Vieles davon kann aus deiner Khle kommen.
Vielleicht war das die Grundidee für Madlen Ottenschläger, ein Rot„kehlchen“ zur Titelfigur einer Bilderbuch-Serie zu machen. Mika, so heißt das Vogelkind. Und anhand ihres Beispiels geht’s nicht nur um äußerlichen Lärm, sondern noch viel stärker um innere Aufwühlung. Um Gefühle, die Mika zu ihrem Glück auch rauslässt, und da ordentlich mit Krach Ärger, Wut und Zorn Luft macht.
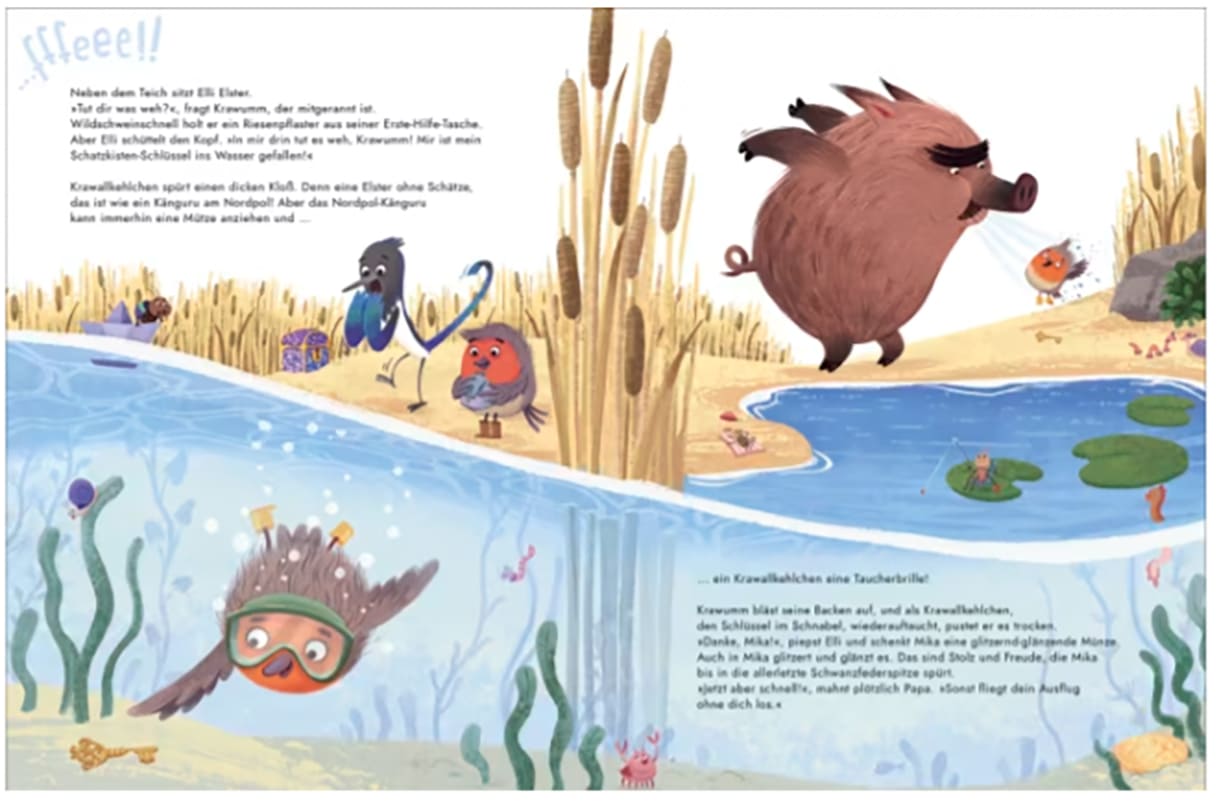
Genauso kann Mika aber auch mit Freude Krawall machen.
Am Ende des Buchs – und als eigener Download auf der Website des Verlags – gibt’s ein „Gefühlsrad“ mit der „Anleitung“: „Jedes Gefühl ist ok – Das Gefühlsrad hilft, Gefühle zu benennen und darüber zu sprechen…“
Die Illustrationen, die fantasievolle Elemente des Textes in Bilder, die teils digital geezichnet scheinen, umsetzt, steuert Ramona Wultschner bei.
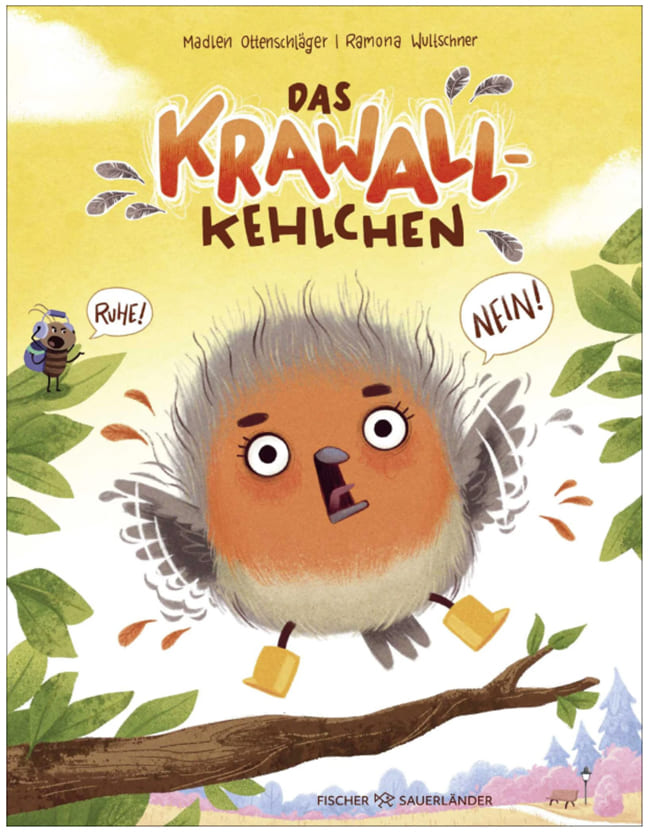

Ein Teil des Rathauses ist eine Woche von Montag bis Freitag (18. bis 22. August 2025) zu einer Kinderstadt umgebaut worden: Unter dem Namen „Wienopolis“, organisiert von Wienxtra, konnten sich Kinder zwischen 8 und 13 Jahren in verschiedenen Berufen ausprobieren und eine Stadt ganz nach ihrem Geschmack gestalten.
Beim Eingang musste ich mich bei der „Stadtinfo“ melden, um als Praktikantin bei Kijuku ein „unbefristetes Visum“ zu beantragen. Erwachsene haben normalerweise nur ein befristetes Visum, das nach einer halben Stunde wieder abläuft. Beim Anblick meines Visums hat ein Wienopolis-Bürger, der als Reifenwechsel-Champion (mehr dazu im Beitrag „handfeste Arbeit an Gleisen…“, am Ende des Beitrages verlinkt) bekanntist, voller Erstaunen reagiert. Der Arkadenhof und auch Räume im Rathaus sind in unterschiedliche Bereiche eingeteilt und umgestaltet worden – wie zum Beispiel Kreativwerkstatt, Gasthaus, Post etc. – und geleitet werden diese von erwachsenen Personen, die sich aber sehr bedeckt halten und den Kindern „im Hintergrund“ helfen.

Zuallererst habe ich den „Medien und Presse“ Bereich aufgesucht und dort gleich zwei Jungjournalist*innen kennengelernt. Ein Jungreporter hat ein Interview mit Peter Hacker (Stadtrat im „großen“ Wien) geführt und auf meine Frage, ob er den nervös gewesen sei, hat er nur selbstbewusst den Kopf geschüttelt. Später bei einem Interview von ihm und dem Vizebürgermeister, der sich als Kandidat für den Bürgermeisterposten in Wienopolis aufgestellt hat, habe ich gemerkt, wie er professionelle und auch sehr kritische Fragen stellt.
Sie diskutierten potentielle Reformen in der Stadt, wie zum Beispiel, ob man reiche BürgerInnen besteuern sollte, welche Löhne überhaupt angemessen seien und die Wichtigkeit des Themas „Sport“. So möchte der Vizebürgermeister mehr Bewegung in das Leben aller Bürger*innen integrieren und aus diesem Grund Fußball-Turniere organisieren. Der Reporter hat mir erzählt, dass er zwar irgendwann wahrscheinlich einen „technischen Beruf“ ausüben werde, da seine ganze Familie in dem Bereich arbeite, aber meiner Meinung nach könnte er einmal wirklich Journalist werden. Vielleicht Sportreporter, lachte er.

Am Nachmittag stand die Wahl des/r Bürgermeister/in an und vor dem Wahllokal hat sich schon eine lange Schlang gebildet. Ich habe ein paar der Bürger und Bürgerinnen gefragt, warum sie denn Wählen gehen würden. Während eine Wählerin euphorisch „weil es Spaß mache“ ausrief, meinte eine andere entschlossen, dass sie sich für eine gerechtere Regierung einsetzen möchte. In der Schlange habe ich auch eine Kandidatin selbst angetroffen, die direkt vor dem Wahllokal Flyer verteilt und energisch für sich selbst geworben hat.
Die „Erwachsenenwelt“ wird in „Wienopolis“ auf spielerische Art nachgeahmt, aber wer von ihr genug hat, kann sich wie manche Kinder auch in den Ruhebereich zurückziehen – denn sie ist auch in der Realität oft sehr erschöpfend!
Stefanie Kadlec

Am Wochenende begann der erste Stopp des Stationentheaters von „Arbos – Gesellschaf für Musik und Theater“ auf der Sella Prevala, dem früheren südwestlichsten Pass Kärntens.
Ab dem 6. September 2025 gibt es dann Vorstellungen mit Direktübertragungen im Internet, wobei die Vorstellungen am 6. September und 18. Oktober 2025 auch in Zusammenarbeit mit der Kulturhauptstadt Europas, Nova Gorica / Gorizia 2025 stattfinden. Am 21. November wird dann mit Dževad Karahasans „Privileg Sterben“ gespielt am Klagenfurter Hauptbahnhof abgeschlossen.
Szenen gegen Krieg und für Frieden, immer wieder auch in Gebärdensprache sind zu erleben. Details in der ausführlichen Info-Box.
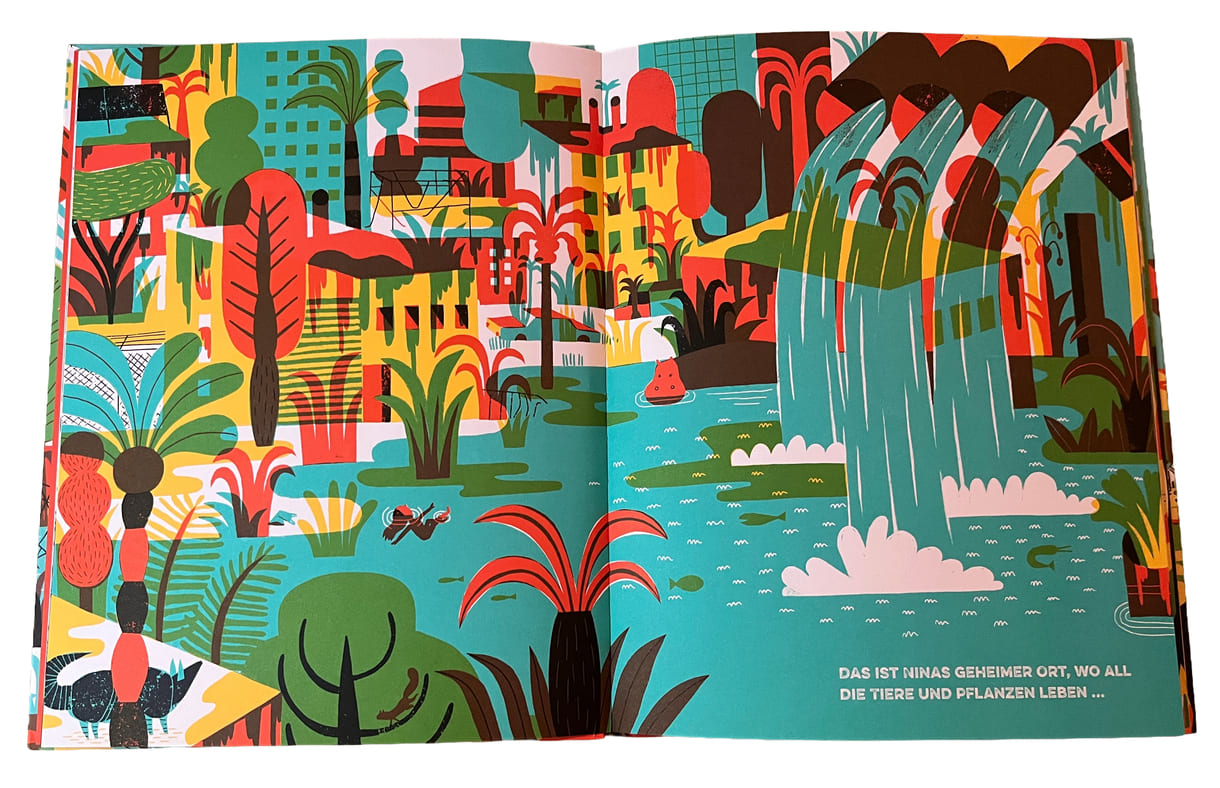
In einem kunterbunten Mix aus städtischen (Hoch-)Häusern und üppig wuchernder Pflanzen lässt der Autor und Illustrator Joan Negrescolor aus Barcelona (Übersetzung: Katja Alves) das Mädchen Nina auf (wilde) Tiere treffen. Sie kennt sie alle ist sozusagen auf Du und Du mit ihnen, liest ihnen Geschichten vor und erzählt andere. Weiß aus genauer Beobachtung auch die Vorlieben – die Schlange steht auf Gedichte, Flamingos auf Märchen und Sagen. „Die Affen mögen Geschichten. Die in einer anderen Welt spielen: Abenteuerliche Mondreisen. Weltraumfahrten und Begegnungen mit Außerirdischen.“

Dementsprechend schlüpft einer der Affen mit seinem Kopf in ein TV-Gerät, ein anderer blickt mit einem Teleskop in die Ferne…
„Die Stadt der Tiere“ ist ein (Großstadt-)Dschungel als Collage aus stark geometrisch angehauchten zu einem kreativ-chaotischen Mix zusammenmontiert. Selbst fantasievoll, regt das Buch über die kurzen Sätze und dem Vielen, das in den Illustrationen zu entdecken ist, zum Weiterspinnen der jeweils kurz angerissenen Szenen an.


Wien hatte – eine Arbeitswoche lang – nicht nur ein neues, zusätzliches Ortsschild. Es lag noch dazu mitten in der Stadt. Im Arkadenhof des Rathauses und lautete Wienopolis. Regelmäßige Leser:innen dieser Seite wissen, so heißt nach 22 Jahren die Kinderstadt, vormals „Rein ins Rathaus“ – Bericht über Neuerungen in einem der Beiträge darüber und immer wieder in den vor Ort von Kindern befüllten Tageszeitung (alle gesammelt als Flip-Book zum Durchblättern ebenfalls am Ende hier verlinkt).
Und in dieser Kindestadt gibt es auch einen Hauptplatz für den am ersten Tag ein Name gesucht, aus den sechs Vorschlägen am zweiten Tag abgestimmt wurde. Der heißt, bzw. hieß – am Freitag ging Wienopolis 2025 zu Ende, aber 2026 findet’s wieder statt: City Square – mit verschiedenen, bunten, handgemalten Schildern.
Zu Ende ging die Kinderstadt in diesem Jahr übrigens nicht wie all die Jahre zuvor mit dem berühmten „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon zu spät“ und dem sogenannten „Pferderennspiel“, einem gemeinsamen Kreisspiel, sondern mit einer Party mit Disco-Tänzen und angehaucht akrobatischen Bewegungsspielen – samt dem verkleideten Holli, dem Maskottchen des Wiener Ferienspiels.
Aber schon viele Stunden davor lieferten einige Kinder eine akrobatische Bühnen-Show samt mitreißender Moderation. Sowohl zur Party als auch zur Bühnenshow kurze Videos unten verlinkt.
Auf dem Nachhause-Weg von Wienopolis bei Wien Mitte auf das Landstraßenfest getroffen – und siehe da: Auch hier gibt’s ein neues Platz-Schild, benannt nach dem aktuellen Bezirksvorsteher. Seltsam, üblicherweise werden Plätze oder Straßen nur nach toten Personen benannt.


Damit mehr Jobs für die Kinderstadt zur Verfügung stehen, wurde die Höchst-Arbeitszeit in Wienopolis am Donnerstag auf zwei Stunden begrenzt. Der Regen führte auch dazu, dass beispielsweise das Smoothie-Rad verlegt werden musste – in den Teil des Arkadenhofes im Wiener Rathaus, der mit einem Faltdach geschützt wird.
Und: Am Donnerstag gewann Lino zum vierten Mal – und damit jeden bisherigen Tag – den Autoreifen-Wechsel-Wettbewerb der Wiener Linien. 82 Sekunden brauchte er beim ersten, 50 beim zweiten, 48 beim dritten und nun gar nur mehr 40 Sekunden beim vierten Mal.
Der 12-Jährige ließ sich danach sogar im Wellness-Bereich ein recht großes Tattoo der Wiener Linien auf die linke Wange malen. Vier Muttern müssen aufgeschraubt, der Reifen von der Wagenachse gehoben werden. Er muss den Boden berühren und danach wieder befestigt werden. Die 40 Sekunden sind auch für die Profis von den Wiener Linien eine Herausforderung.

Motivation, um täglich einen neuen Rekord aufzustellen, sei für ihn gewesen, damit in die Zeitung zu kommen, gesteht der Schnell-Schrauber Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Diese Internetplattform betreut auch di Station der Kinderstadt-Zeitung, die täglich erscheint.
In der Station der Wiener Linien in der Nähe des Verkehrsgartens in einem großen Raum bei den Arkadenhof-Gängen liegen auch Schienen – ein Stück U-Bahn- sowie ein Stück Straßenbahn-Gleise neben der Vorrichtung, in der eine Wagen-Achse mit zwei Autoreifen hängt. Eine weitere Aktivität hier ist eine Metallkiste mit verschieden großen und dicken Schrauben und Muttern. Der Deckel mit Scharnier gehoben, reinschauen dürfen, Deckel zu und über ein Loch in der Seitenwand müssen dann mit einer Hand nur mit Greifen ohne zu sehen die richtigen Muttern auf die fixierten Schrauben bzw. andere Schrauben in die Löchter gedreht werden. Das findet die neunjährige Asil, die KiJuKU dabei fotografieren darf – und wo für Fotos ausnahmsweise der Deckel wieder aufgemacht wird – „sehr cool“.
Zuvor hatte sie schon eine Fixierung bei einer Koppelung von U-Bahn-Waggons (die älteren, „Silberpfeile“ genannt) gelockert und wieder festgezogen.
Mit Feuereifer, hin und wieder angestrengter Mine aber voller Lust lockern und fixieren wiederum Nora (9), Carolin (8) und Felix (ebenfalls 8) Muttern bei den beiden Gleisstücken mit Hilfe von langen „Ratschen“, die damit eine größere Hebelwirkung erzielen. „Schön und lustig“, sagen die beiden Mädchen zwischendurch auf die Frag, wie sie den doch großen körperlichen Einsatz hier finden. Dabei sind solche Aktivitäten für die beiden neu. Felix hat zwar Zugang zu einer Werkstatt, „aber da fehlt immer was, Schrauben oder Holz“.
Mit mindestens ebenso viel Freude betreuen Jessi, Owen, Valentino, Adelisa, Vesna, Daniel, Markus, Raphael, Eray, Lilly, Bojana und Noel diese technischen Stationen. Sie alle sind Lehrlinge im ersten oder zweiten Jahr ihrer Ausbildungen in Gleisbau, KFZ-Mechanik. Einige Lehrlings-Ausbildner:innen helfen ebenfalls mit. Wobei etwa Anna Grbić schon ein Jahr nach dem Abschluss ihrer Lehre bereits jüngere Kolleg:innen ausbildet. „Ich hab in der 6. Klasse das Gymnasium abgebrochen, mich im Internet nach einer Lehre umgeschaut, ich wollte irgendwas Handfestes tun. Zuerst wollte ich Betontechnik machen, aber da war keine Stelle frei, dann hab ich Gleisbau gelernt.“ Und sie lächelt strahlend bei der Schilderung, wie ihr das taugt.
„Ich bin eine Nachteule“, verrät Jessi dem Reporter, warum sie sich für die Lehre als Gleisbauabeiterin beworben hat. „Ich bin in der Nacht gern draußen und kann nicht ruhig sitzen.“ Die Arbeit mit den Kindern hier – sie ist wie andere ihrer Kolleg:innen schon das zweite Jahr in der Kinderstadt – „mag ich sehr, mir gefällt, wie sie sich für diese handwerklichen, doch anstrengenden Tätigkeiten begeistern“.
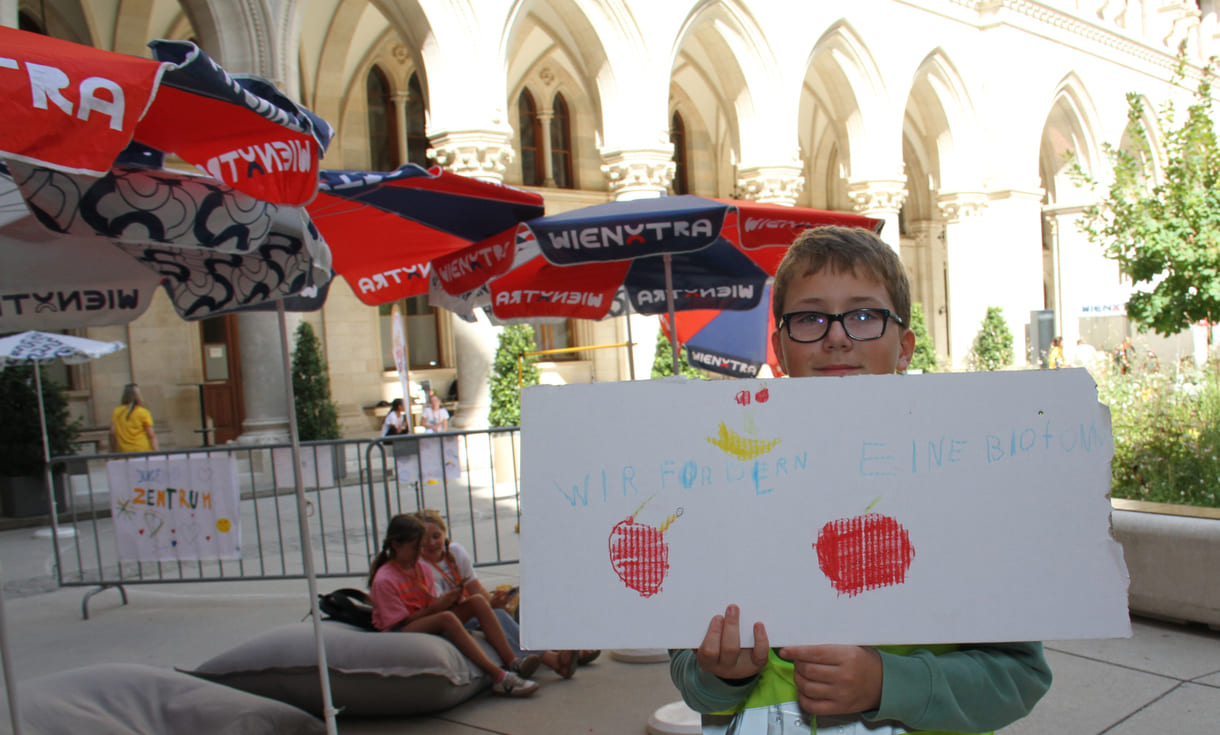
Von allen Ecken und Enden tauchte am Mittwoch, dem dritten Tag der Kinderstadt im Wiener Rathaus (Wienopolis, neuer Name 2025), die Forderung nach Bio-Tonnen auf. In der Stadt achten die Kinder, die bei der der Station Müllabfuhr arbeiten, auf Mülltrennung. Ein Junge lief sogar mit einem selbstgeschriebenen Plakat und der Forderung nach einer Bio-Tonne durch die Stadt. In der Redaktion der Tageszeitung verfassten drei Jung-Reporter Beiträge dazu. Einer befragt die Station, weil es so schien, als gäbe es doch schon eine. Die sei aber nur für Küchenabfälle, womit sich die 48er nicht zufrieden zeigt.
Preise in der Gastro und im Shop bzw. auch für Veranstaltungs-Tickets waren auch ein mehrfach für die Tagezeitung – Link zu einem Durchblätter-PDF der Ausgabe unten am Ende des Beitrages – beschriebenes Problem; Popcorn sei sogar teurer als Pizza, klagte ein Reporter.
Da mancherorts sogar Wasser verkauft wurde, beschloss die Bürger:innen-Versammlung – Regierung und alle interessierten Kinder von Wienopolis ein Gesetz: Wasser muss gratis sein!
Beschlossen wurde außerdem, dass ab Donnerstag jedes Kind zu den 3 Holli-Cent Startgeld zusätzlich einen Holli-Cent bekommt.
Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, verabschiedeten die Versammlungs-Teilnehmer:innen auch noch, dass Rad- und Scooter-fahren nur mehr im Bereich des Verkehrsgartens erlaubt ist und nicht im ganzen Hof oder gar in der Halle.
Der Mittwoch war – traditionell – auch vom Besuch des Bürgermeisters von ganz Wien gekennzeichnet. Eine Runde von Jung-Reporter:innen pilgert immer in dessen Büro, stellt dort Fragen, wird auch von Reporter:innen erwachsener Medien dabei gefilmt, fotografiert und interviewt. Und anschließend kommt das Stadt-Oberhaupt in die Kinderstadt. Hier wurde er von der amtierenden Wienopolis-Bürgermeisterin Theresa begleitet. Für den KiJuKU-Fotografen ging er sogar in die Knie, um halbwegs auf Augenhöhe zu sein.
Auf die Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, wann es endlich auch in der Stadt Wien eine Bürgermeisterin gäbe, meinte er spontan: „Na, jederzeit!“
Die Nachfrage, ob seine Partei beim nächsten Mal eine Frau an die Spitze stelle? „Jetzt bin ich ja erst vor ein paar Wochen gewählt worden, bis zur nächsten Wahl ist noch viel Zeit!“
Die Kinderstadt bietet im Arkadenhof etliches an Bewegungsmöglichkeiten an, unter anderem können Smoothies er-radelt werden. Das Stand-Rad kurbelt einen Obstmixer an!
Ach ja, wie überall, schwirren auch in der Kinderstadt alle möglichen Gerüchte umher, von Skandalen ist hin und wieder in Gesprächen und sogar in anonymen Infos an die Medien die Rede und Schreibe. Die Kinderstadtzeitung – von KiJuKU betrieben – geht damit um, wie immer: Gerüchte selbst werden nie veröffentlicht. Wenn sich eine Jungreporterin oder ein -reporter findet, der recherchiert und der jeweiligen Sache auf den Grund geht, kann daraus natürlich ein Beitrag werden – mit dem was sich als echt erweist – oder auch als Lüge entlarvt wird.
Das war’s vorerst für heute, Fortsetzungen folgen!

Aufruf, das Wahlrecht zu nutzen, das alle Bürgerinnen und Bürger der Kinderstadt im Rathaus haben – zierten titel- und letzte Seite der zweiten Ausgabe der Kinderstadt-Tageszeitung. Drei Kinder – 10 bis 12 Jahren schrieben den „Aufmacher“, wie Zeitungen ihre Schlagzeile und Hauptgeschichte nennen dazu. Sie argumentierten das wichtige Recht, über die Politik der Kinderstadt – täglich wird eine neue Regierung gewählt – mitzubestimmen.

Ansonsten kursierten Gerüchte, die Stadt würde bankrott gehen, weil die Arbeitszeit verkürzt bei gleichem Lohn und außerdem am ersten Tag beschlossen wurde, das bei der Bank angelegte Geld werde verzinst. Diese Zinsen von 2 Holli-Cent (Währung der Kinderstadt, die seit heuer „Wienopolis“ statt wie bisher „Rein ins Rathaus“ heißt) wurden bei der Bürger:innen-Versammlung am Dienstag auf Vorschlag der gewählten Regierung auf die Hälfte, also ein Holli Cent gesenkt. An der Bürger:innen-Versammlung können alle interessierten Kinder ihrer eigenen Stadt teilnehmen.
Großes Ärgernis für viele Kinder ist, dass viele Eltern oder andere Erwachsene die Kinderstadt immer wieder überlaufen und sich nicht in dem für sie vorgesehenen eigenen „Elterngarten“ im Arkadenhof aufhalten. Darüber verfassten mehrere Jung-Journalist:innen Beiträge für die Zeitung. Und die beiden 12-jährigen Emma und Chiara präsentierten ein wunderschön gebasteltes buntes Schild „Keine Eltern“. Was allerdings auch noch nicht die erwünschte Wirkung zeigte. Dabei gibt es ab heuer die Regel, dass Erwachsene ein Visum brauchen – und dieses ist nur eine halbe Stunde gültig!
Vielleicht sollte sich wer in der Kinderstadt überlegen, die achtjährige Hannah durchgehen zu lassen und darauf hinzuweisen. Sie schaffte es mit ihrer kräftigen Stimme mitten in der doch von einem gewissen Lärmpegel erfüllten Volkshalle vielfach lauauauautstark auf ein Bingo-Spiel am Nachmittag (siehe und höre Video am Ende des Beitrages!) hinzuweisen! 😉

Am Montag ging’s dann, mit wenigen Minuten Verspätung, knapp nach 10 Uhr endlich los. Viele Kinder hatten sich schon für die diesjährige Kinderstadt im Wiener Rathaus angelmeldet. Und jene, die schon in Vorjahren da waren, hatten gleich beim Empfang des Startgeldes gemerkt, die Scheine schauen neue aus.
In der Start-, oder Willkommens-Zeitung konnten sie in der Wartezeit auch die wichtigsten der Neuerungen lesen und sehen. Aus der im Vorjahr am Freitag, dem letzten Tag, gewählten Kinderstadt-Regierung waren sieben der damals gewählten acht Kinder gekommen, um ihre Ämter bis zur neuen Wahl Montagnachmittag auszuüben.
Verstärkt wurden Zara, Hannah, Leander, Mia, Luan, Charlotte und Mauro durch zwei Kinder aus der Planungswerkstatt. Mamadou und Nicolas hatten gemeinsam mit rund fünf Dutzend anderen Kindern diese Neuerungen mitbeschlossen. Die beiden zeigen sich mit dem dabei gewählten Namen Wienopolis alles andere als glücklich, verraten sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Aber es war eben die Mehrheit dafür“, räumen sie ein – und zeigen für die Kameras alte und neue Holli-Cent-Scheine – eine weitere der Änderungen. „Da haben wir alle Entwürfe gezeichnet und aus allen dann sind dann die neuen Geldscheine entstanden.“
„Und die Hinweis- und Wegweiser-Schilder haben wir auch alle in der Planungswerkstatt geschrieben“ – gut sichtbare mit großen Buchstaben handgemalte Kartons.
KiJuKU darf auch wieder die Zeitungs-Station betreuen, bei der Kinder Beiträge verfassen, die am Ende, in der Nacht zur nächsten Tageszeitungs-Ausgabe ausgedruckt werden – die am ersten Tag entstandene achtseitige Zeitung ist unten am Ende des Beitrages zum Durchblättern als PDF zu lesen.
Unter anderem gibt es Artikel über die Wichtigkeit der Arbeit von Müll-Sammler:innen, die sich auch um die Trennung in Papier-, Rest- und Plastikmüll kümmern. Zwei, die diesen Job ausübten, Annika und Rafael waren auch bei der Redaktion unterwegs und wurden da natürlich auch gleich befragt. „Hier in der Kinderstadt ist’s eh nicht so arg wie auf den Straßen, aber ich finde es wichtig, den Müll aufzuheben – dafür gibt es Greifarme an Stangen – und auch richtig zu trennen“, findet Annika viel Sinn in ihrer Arbeit. Ihr Kollege meint hingegen: „Ich mach einfach so mit!“
In eine auch wichtige Arbeit stürzte sich der achtjährige Oliver. Kaum ist er erkennbar, „verkleidet“ in Schutzmantel, Überzieher über die Schuhe und dünne Kunststoff-handschuhe. „Ich bin Hygiene-Kontrollor“, erklärt er seinen Job und zeigt wie er unter anderem im Gasthaus mit einem Messgerät die Temperatur von Lebensmitteln in Kühlschränken aber auch Obst auf den Anrichte-Tischen. „Stimmt alles, aber es ist gut, dass es kontrolliert wird“, sagt er genauso ernst wie er seine Kontrollen verrichtet.
Spannendes Detail am Rande der Wahl: Luan wurde mit den meisten Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Und das obwohl seine Wahlwerbung irgendwie verloren gegangen ist und der darüber klarerweise sehr traurig war, weil viele seiner Konkurrent*innen ziemlich viel an Werbemitteln unter die Bürger:innen brachten!
Übrigens wurde gleich am ersten Tag beschlossen, dass die Mindestarbeitszeit von einer halben Stunde halbiert wurde. Für die ¼ Stunde gibt es den gleichen Lohn wie davor fürs Doppelte: 3 Holli-Cent, einer davon wird als Steuer vom Finanzamt abgezogen, also zwei Holli-Cent. Die Änderung baut auf einer Umfrage des Statistik-Amtes auf, wonach eine relative Mehrheit mit den Löhnen unzufrieden waren.

Heuschrecken – Insekten mit einem ähnlich schlechten Ruf wie Wölfe. Immer, wenn sie in Geschichten erwähnt werden, sind sie die Bösen. Was nicht selten auf realen Kahlfraß ganzer Ernten und Landstriche zurückgeht, wenngleich manche ihrer Arten schon ausgestorben oder davon bedroht sind, in die „ewigen Jagdgründe“ einzugehen. Neben echten Berichten halten sich vor allem aber auch Geschichten darüber – von einer der zehn biblischen Plagen im Alten Testament (die auf einen realen Kahlfraß zurückging der schon in einer frühen ägyptischen Grabmalerei verewigt war) über Südamerika bei den Azteken, Südafrika, Europa (im Mittelalter wurden 400 Attacken geschätzt), Australien, Asien…
Die bekannte serbische, in Schweden als Kind von Diplomat:innen geborene, Dramatikerin Biljana Srbljanović schrieb „Heuschrecken sind wirklich entzückende Insekten, friedlich – aber manchmal, so aus keinem erkennbaren Grund, entscheiden sie sich, eine Gruppe zu bilden, richten enormen Schaden an. In einer halben Stunde können sie ein riesiges Feld zerstören. Das war für mich eine Metapher für die Menschen, die ich in dem Stück behandele. Als Einzelpersonen sind sie liebenswert, aber wehe sie treten in einer Gruppe auf.“
Ihr episodenartiges Stück über so manch menschliche Abgründe heißt daher „Skakavci“ (Heuschrecken). Im Text – vor 20 Jahren uraufgeführt und mit Preisen bedacht -, inszeniert vom Jugendtheater „Stanislavski“ im Frühjahr 2025 im Theater am Werk, kommen „Heuschrecken“ als Wort und Bild nur drei Mal (und nicht wie ursprünglich irrtümlich hier stand zwei Mal) vor. Aber schon beim ersten Mal, als Nadežda (Stefanija Budak), die Visagistin im TV, die auch Lippenlesen beherrscht für den Starmoderator Maks (Jovan Spasojević) geheime Gespräche anderer übersetzen soll, nennt sie diese „ekelhaften Leute“ eben Heuschrecken und später meint sie noch über den alten Simić (Žorž Bakoš-Dodek) im grünen Mantel, dass er aussehe wie eine Heuschrecke.
„Einmal waren meine Kinder verdammt stolz auf mich. Einmal. In Sutomore, am Meer. Bei einem Einfall von Heuschrecken. Der ganze Strand hat uns offen ins Gesicht gelacht. Aber ich hab sie mit Füßen, Händen und dem Stock zerquetscht. Und meine Kinder verteidigt“, sagt Herr Jović – das ist die zweite Erwähnung der titelgebenden Insekten. Das ihm seine Kinder aber später alles andere als danken, wobei – ob er sich an seine Heldentat erinnert oder sie nur erfindet – das bleibt in der Schilderung auch offen;)
Ansonsten spielt sich nicht viel an Verteidigung ab, eher kämpfen alle Figuren des Stücks gegeneinander, offen oder versteckt.
Und doch kommen die aneinander gereihten, nur durch kurze Blacks getrennten Szenen (Regie: Marina Margo; Assistenz: Sandra Bajić) immer wieder auch mit einer gewissen Leichtigkeit daher, einem Schuss Überhöhung. So dass sie aber nicht selten Zuschauer:innen an reale Szenen aus dem eigenen oder dem Umfeld erinnern – und vielleicht ein wenig Innehalten auslösen. Gespielt wurde übrigens auf Serbisch mit deutscher Untertitelung (Übersetzung: Irmgard Kanwar).
Wobei die fast archetypischen Charaktere nicht nur gegeneinander kämpfen, die meisten sind auch gekennzeichnet von einer großen Unzufriedenheit mit sich selbst, einer großen Leere.
Auch wenn andere Stücke von Biljana Srbljanović schon in Wien gespielt wurden, Heuschrecken war erstmals zu sehen, noch dazu in Originalsprache; Übrigens ist Skakavci auch der Name eines kleinen Dorfes im Westen Serbiens 275 Einwohner:innen laut Wikipedia nach der Volkszählung von 2002) sowie einer Band mit „goßer Jugo-nostalgie“.
Regisseurin Marina Margo hat aber nicht nur den Theatertext von Biljana Srbljanović zum szenischen Miterleben erweckt, sondern noch so manche Zitate aus bzw. Anspielungen an Filme/n und deren Musik (Almodóvar, Baraka – der Tod kann tanzen) sowie Gemälde/n (u.a. Zar Iwan, der Schreckliche mit seinem Sohn, von Ilja Jefimowitsch Repin; Tod und das Mädchen von Marianne Stokes; Vereinigung der Seelen von Max Svabinsky) eingebaut, wie sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… verriet. Ähnliches gilt auch für die von ihr ausgewählte Musik – einerseits Untermalung, andererseits hin und wieder eigenständiges Theaterelement sowie das Licht (Design: Ivan Ljubisavljević).
„Die Szene, in der Fredi seinen Vater badet, ist musikalisch mit Vertigo verbunden – durch die authentischen Rottöne und die Musik. Assoziativ verweist sie auf den Moment, in dem die Tragödie spürbar näher rückt, unausweichlich scheint. Es ist, als würde sich ein Schicksal abzeichnen, das nicht mehr aufgehalten werden kann – woraufhin Fredi in Tränen ausbricht“, beschrieb sie gegenüber KiJuKU.at und „die Partyszene mit „Ne me quitte pas“ ist ein persönlicher Liebesbrief an Pedro Almodóvar. Ein visuelles Filmzitat schafft eine subtile Verbindung zur emotionalen Welt seines Films „Law of Desire“ (Gesetz der Begierde). Das Lied fungiert als poetischer Kommentar zum inneren Zustand der Figur“, so Marina Margo.
„Alle Helden sind sehr alt, insbesondere die jüngsten“ – so beschreibt die serbische Erfolgsautorin Biljana Srbljanovic die Figuren in Skakavci / Heuschrecken, zitiert die Regisseurin die Thaterautorin. „Einige der Protagonisten sind so jung und schön, dass man nicht glauben kann, welche Abgründe in ihnen stecken.“
Und überraschenderweise spielen zwei ziemlich junge Spieler:innen mit, die erst 14-jährige Lara Mraković schlüpft zwar in die Rolle der jungen Tochter von Dada und Milan, aber letzterer, ein Mitt-30er, wird immerhin vom erst 17-jährigen Marko Dimitrijević gespielt.

Wie in der Stückbeschreibung von „Skakavci“ (Heuschrecken) geschildert sind auch die jungen Figuren dieses Dramas schon recht alt. Zwei (sehr) junge Darsteller:innen spielen mit. Der erst 17-jährige Milan: Marko Dimitrijević schlüpft in die Rolle des Mitt-30ers Milan, Lara Mraković (14) immerhin in die seiner und von Dadas Tochter, die allerdings auch schon ein wenig altklug gezeichnet ist. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… traf die jungen Schauspieler:innen nach der Premiere, Marko nur ganz kurz, er wurde von KiJuKU schon mehrfach interviewt – Links am Ende des Beitrages.
KiJuKU: Lara, wie war das als doch viel Jüngere in diesem Ensemble von lauter Erwachsenen, Marko ist ja auch schon fast ein solcher, als 14-Jährige zu spielen?
Lara Mraković: Ich muss gestehen, ich hab mich fast nie wie 14 gefühlt.
KiJuKU: War es anstrengend, in diesem Stück von mehr oder weniger lauter kaputten Typen zu spielen?Lara Mraković: Es war schon nicht ganz so einfach, aber ich hab es ernst genommen und war sehr angespannt. Aber zum Ausgleich haben wir immer wieder hinter der Bühne auch einiges zu lachen gehabt. Und das Team hat mich immer gleichwertig wie alle anderen behandelt.
KiJuKU: War das deine Premiere?
Lara Mraković: Es war schon mein zweites Projekt mit dem Jugendtheater Stanislavski, außerdem hab ich schon früher in der Schule Theater gespielt. Aber dieses Stück hier war dann doch noch einmal eine ganz andere Aufgabe – so viel mehr und so viel ernster und noch dazu auf Serbisch.

KiJuKU: Nun zu dir, Marko: Du bist 17 und spielst einen gut doppelt so alten Mann, war das schwer?
Marko Dimitrijević: Wir haben mehrere Monate jedes Wochenende intensiv geprobt, das mit dem Alter war nicht so schwer. Die wirkliche Herausforderung war, jemanden zu spielen, der vom Charakter her das Gegenteil von mir ist.

Mit einem der druckfrischen Exemplare der zweiten Auflage von „Die Komödienschildkröte“ – in kräftiger leuchtenden Farben und mit einigen Korrekturen – wartete Autor Patrick Kwasi Addai, in festlichem Anzug aus seiner ersten Heimat Ghana, im Backstage-Bereich der 21. Afrika-Tage. Die Musiker:innen stimmten ihre Instrumente, klärten einiges mit der Technik. Die Lead-Sängerin und Songwriterin Nkulee Dube aus dem südafrikanischen Johannesburg warf sich in ihr buntes Festgewand, stimmte sich ein, videotelefonierte mit ihrer Schwester – und freute sich mehr als kräftig lächelnd über das Geschenk des Autors.
Auch wenn das Buch auf Deutsch geschrieben ist. Die Schildkröten mit Flaggen aus allen Ecken und Enden der Welt, die Addais Botschaft – alle Nationen sind willkommen – bildlich vermitteln, sprechen für sich. One People – Different Colours – dieser Spruch in mehreren Sprachen am Beginn des Buches verdeutlicht die Botschaft noch einmal. Und dieser Spruch, so hatte Addai in einem KiJuKU-Interview rund um die Buchbesprechung hier ergänzt, „ist ein Song des südafrikanischen Reggae-Sängers Lucky Philip Dube (1964 – 2007). Sein erstes Album ist damals noch unter dem Apartheid-Regime (eine Minderheit von Weißen herrschten, die große Mehrheit der Schwarzen hatte praktisch keine Rechte) verboten worden. 2007 wurde er in Johannesburg vor den Augen seiner Kinder erschossen. Ihm widme ich das Buch – mit diesem Spruch aus einem seiner bekannten Nummern.“
Und vor einigen Jahren traf Addai die Musikerin bei den Afrika-Tagen, versprach ihr, eines seiner nächsten Bücher ihrem Vater zu widmen, sagte er damals im Interview. Und nun war’s so weit, und Nkulee Dube sollte das Papier gewordene Versprechen in Händen halten können. Die Seite mit der Widmung für Lucky hielt Addai in die Handykamera der Künstlerin, so dass auch Nkulees Schwester im Video-Telefonat sie sehen konnte. Ein starker emotionaler Moment des Trios, den KiJuKU somit miterleben durfte.
Obwohl wenige Minuten vor ihrem Auftritt auf der Bühne, strahlte die Mitt-30erin, die schon etliche Auszeichnungen für ihr Schaffen erhalten hatte, alles andere als Stress aus, nahm sich Zeit, das Buch ein bisschen durchzublättern und für Fotos zu posieren.
Doch dann musste sie schon – noch hinter der Bühne – das Mikro testen, damit die Lautstärke gut reguliert werden konnte. Sie ist weltbekannt vor allem dafür, Reggae mit (Ethno-)Soul und Jazz zu einer vielfältigen Einheit zu verbinden. Und das begeisterte das Publikum, ja riss es richtig mit und brachte so manche fast zwangsläufig zum Tanzen vor der Bühne.
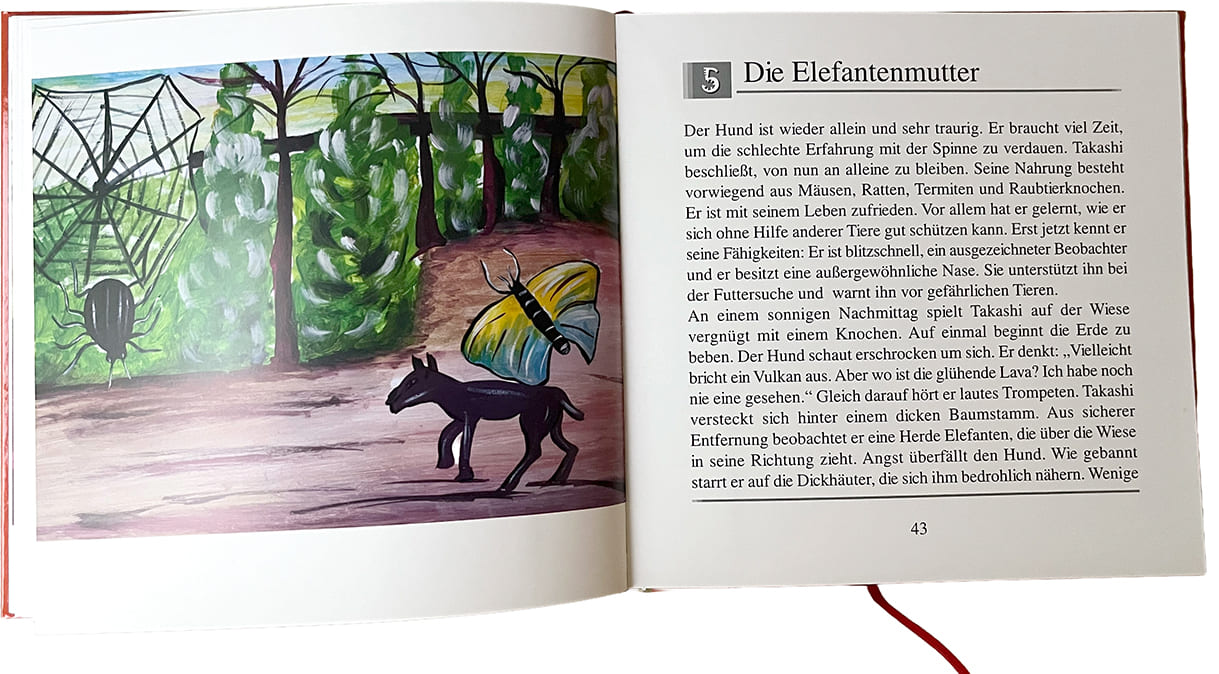
„See wonye Prako Nawoye Kraman“ – dieser Satz kommt aus der Sprache Twi des Volkes der Ashanti in Ghana. Patrik Kwasi Addai aus dem oberösterreichischen Leonding, der die ersten 19 Jahre seines Lebens vor allem in Kumasi, der zweitgrößten Stadt dieses westafrikanischen Landes aufgewachsen ist, baut mehrere Sätze aus seiner Erstsprache in das stark bebilderte Buch „Ich habe den Menschen gerne, sagte der Hund – Takashis Abenteuer mit dem Zweibeiner“ ein.
Der zitierte Satz nimmt schon viel von der Erzählung vorweg – aber das tut auch schon der Buchtitel, insofern ist es kein wirkliches Spoilern. Ach ja, übersetzt auf Deutsch bedeutet der Satz zu Beginn dieser Buchbesprechung: „Er ist nämlich kein Schwein, sondern ein Hund.“
Der Kern des Buches ist eine kurze Erzählung, in der ein Hund einen Freund sucht. Der Autor hat, wie er Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… verrät, „darum herum eine große Geschichte ausgedacht, in die ich meine Philosophie hinein verpackt habe“.
Und so ist der Hund hier ein Tier, das erstmals auf Menschen trifft und diese wiederum bis dahin gar nicht wussten, dass es existiert. Diesen Hund nannte der Autor Takashi. Was zunächst eher wie ein Name aus dem Japanischen wirkt, kommt auch aus Twi und bedeutet so viel wie „jemand, der mit einem gewissen Willen etwas erreicht“, erklärt Addai dem Journalisten, der danach fragte.
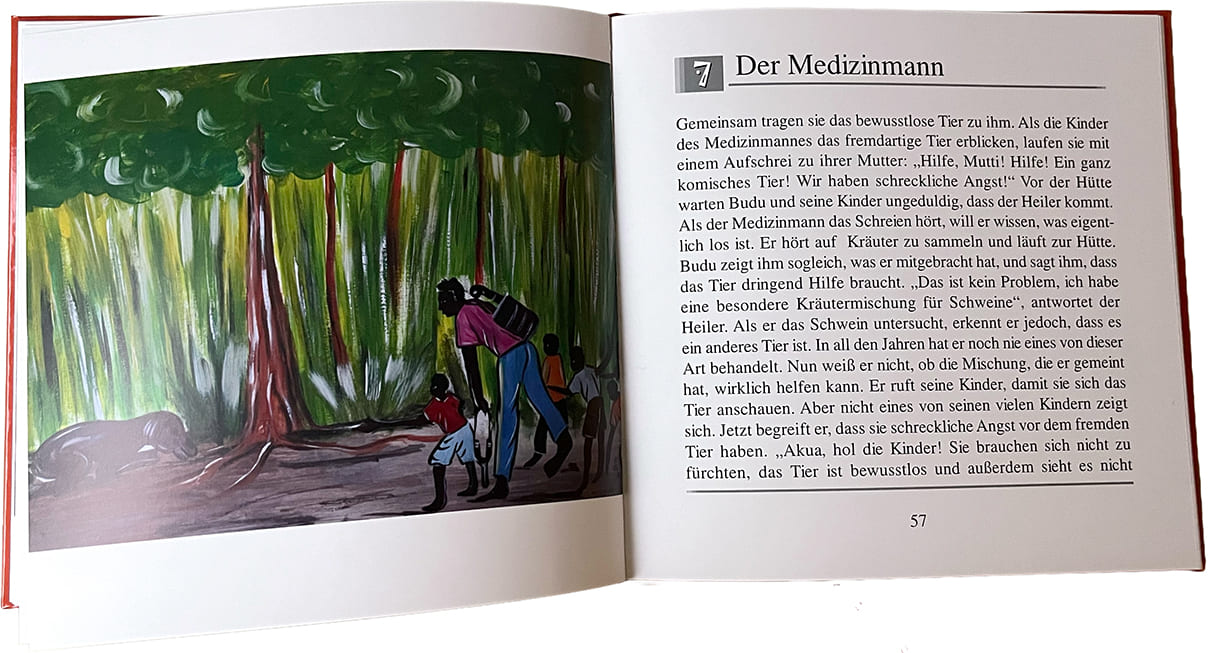
Takashi, der zunächst wild im Urwald lebt, ist anfangs ein einsamer Hund – ohne Familie, ohne Freunde. Und so beschließt er, sich welche zu suchen. Weil er sich selber klein und schwach ist, will er einen starken Freund. Im ersten Versuch landet er bei einem Krokodil. Und weil dieses verwundert ist, dass der Hund gerade ihn zum Freund haben will, kommt es zu dieser Verbindung.
Klar, so einfach kann’s nicht sein, die Freundschaft zerbricht, und Takshi muss weiter suchen. Löwe ist der Zweitversuch. Wieder nur für kurze Zeit. „Ich erlebe nur schmerzvolle Enttäuschungen“, lässt der Autor seinen Titelhelden sinnieren und fragen: „Hat es überhaupt einen Sinn, einen Freund zu haben? Oder hätte ich doch besser bei meiner Familie bleiben sollen? Aber wo ist meine Familie? Ich habe sie seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen.“
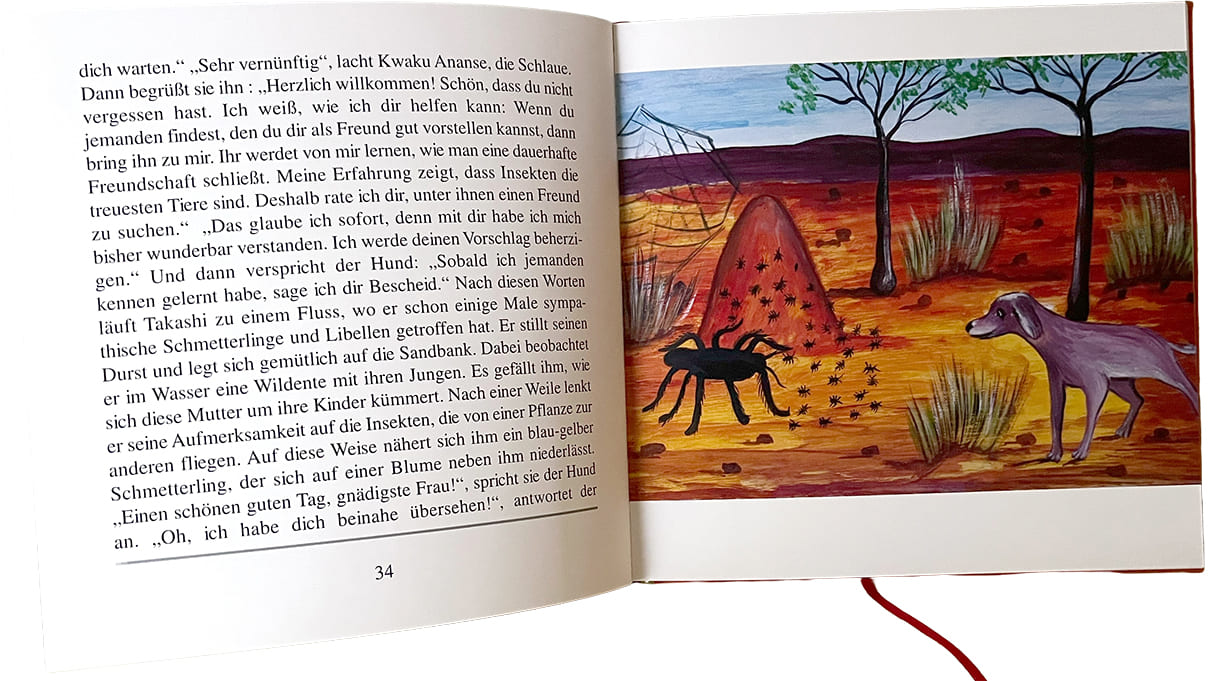
Da erinnert sich der Hund an Großmutters Erzählungen von der schlauen Spinne Ananse. Und diese Begegnung wird zu einer längeren, sich über etliche Seiten erstreckenden Freundschaft.
Die Geschichte wird übrigens immer wieder durch gemalte Bilder von Momo Agbo bereichert.
Zu vermuten und ziemlich klar, dass auch das nicht auf Dauer gut geht. Besser und geborgener fühlt Takashi sich bei der nächsten Station, den Elefanten. Aber irgendwann muss es doch zur Begegnung mit den Menschen kommen 😉
Und siehe da, aus dem Dorf Nahutu finden Menschenkinder im Urwald den schwer verletzten Hund, meinen zunächst, es sei ein sehr dürres Schwein – womit auch der Zusammenhang mit dem Zitat am Beginn dieses Textes klar wird. Budu, der Vater dieser Kinder, kann alle Tiersprachen der Welt und so…
… nein, noch nicht ganz, auch da gibt’s noch Hindernisse – aber die seien nicht verraten, ein wenig Spannung soll schon bleiben.
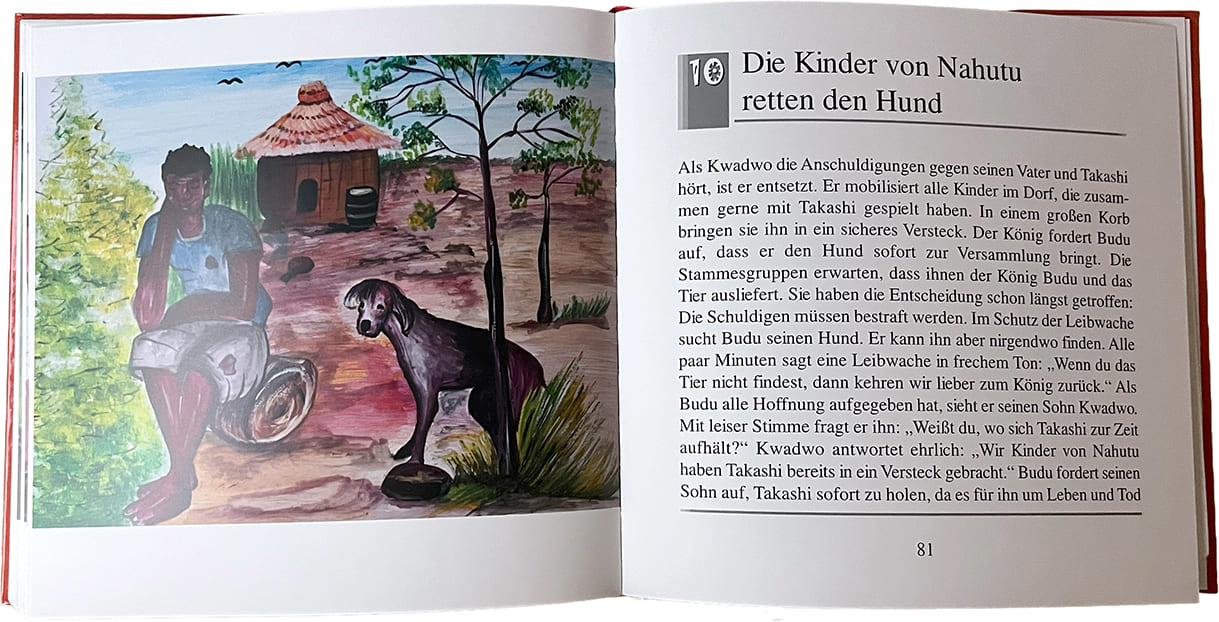
Wobei, spannend sind auch die jeweils beginnenden Freundschaften mit den Tieren – und noch mehr die Gründe für das jeweilige Zerbrechen derselben. In jeder dieser einzelnen Begegnungen – sowohl bei der beginnenden, als auch bei der endenden Freundschaft – hat Addai ein seiner (nicht nur aus Ghana) mitgebrachten Lebensweisheiten verpackt. „Ich will mit dem Buch zeigen, dass jede und jeder wenigstens einen Freund oder eine Freundin finden kann, auch wenn die Suche lange dauert!“, so der Autor am Rande einer seiner performativen Mitmach-Erzählungen bei den aktuellen (2025) Afrika-Tagen auf der Wiener Donauinsel.
Verpackt ist übrigens auch die Weisheit, wie viel es bringt, andere Sprachen zu lernen. Das lässt Addai den Tiersprachen-Kenner Budu seinen Kindern erklären: „Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich die Tiersprache akzentfrei beherrschte. Wenn ihr euch interessiert, könnt ihr euch auch schon bald mit Takashi unterhalten. Aber das Problem ist: Wir Menschen erwarten, dass die Tiere unsere Sprache verstehen. Umgekehrt wäre es auch schön. Die Grammatik ist vielleicht etwas ungewohnt, aber dafür gibt es beim Wortschatz keine dicken Wörterbücher.“
Medase! (= Danke auf Twi)
kinderbuchautor-als-schul-hebamme-in-ghana <— damals noch im KiKu, Vorläufer von KiJuKU
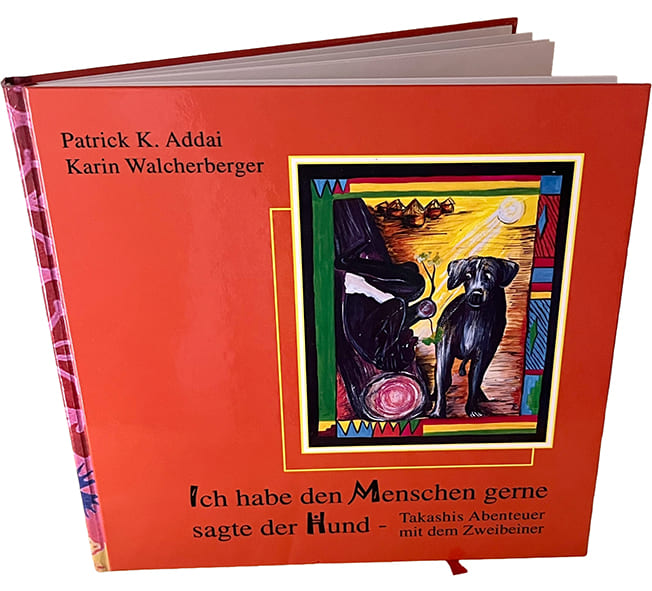

Traditionell regieren Kinder seit mehr als 20 Jahren (Start war 2003) im Wiener Rathaus in der Volkshalle und einem Teil des Arkadenhofes. Dieser wird heuer noch größer. Hier üben sie alle Jobs aus, kandidieren für die tägliche Wahl, bei der Bürgermeister oder Bürgermeisterin und Stadträt:innen gekürt werden.
„Rein ins Rathaus“ hieß dieses Demokratie- und Wirtschafts-Rollenspiel bis zum Vorjahr, für 2025 gibt’s einige Änderungen. Rund fünf Dutzend Kinder haben ab Herbst des Vorjahres an Neuerungen getüftelt. Das nach außen auffälligste: Der Name ist neu, die Kinderstadt heißt nun Wienopolis. Die Holli-Cent-Scheine – die Währung der Kinderstadt – wurden neu gestaltet und es gibt nun auch einen 2-Holli-Cent-Schein.
Für altes Geld – Kinder, die schon in früheren Jahren bei „Rein ins Rathaus“ waren – gibt es einen Wechselkurs 3:1, maximal 30 alte für 10 neue HolliCent; wer mehr hat, kann es auf ein Bankkonto legen, mit begrenzter Abhebung – 30 HolliCent pro Tag, sozusagen eine Art Reichen-Steuer.
Um kandidieren zu können, mussten Kinder bis voriges Jahr Ehrenbürger:innen werden; die Voraussetzung dafür: in drei verschiedenen Jobs gearbeitet und zwei Studien absolviert zu haben.
Dies wurde auch geändert – von den schon genannten rund 60 Kindern in insgesamt sieben Workshops seit Oktober 2024: Wer nun kandidieren will, brauch zwei Ausbildungen – als Stadtkenner:innen sowie zur Streitschlichtung. Überhaupt gibt es nun mehr Ausbildungen, aber auch mehr Kulinarisches im Gasthaus, ebenfalls mehr an Veranstaltungen.
Damit die Kinderstadt noch mehr in Kinderhänden liegt, wurden – wie auch in anderen Kinderstädten – die Besuchszeit von Erwachsenen begrenzt: Ein Visum, auf eine halbe Stunde begrenzt. Dafür gibt es für sie einen „Elterngarten“: Bereich mit WLAN und Kaffee im Arkadenhof.
Andere Erwachsene, die die Stationen betreuen und Kinder bei ihren Aktivitäten unterstützen, haben Mitte dieser Woche alle Stationen aufgebaut; Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… betreut – wie schon in den Vorjahren und davor als Kinder-KURIER – die Kinderstadt-Tageszeitung. Und hat wie auch seit vielen Jahren die Willkommens-Ausgabe mit Stadtplan, Verfassung und wichtigsten Neuerungen als Basis-Information gestaltet – Link zu dieser Ausgabe unten.
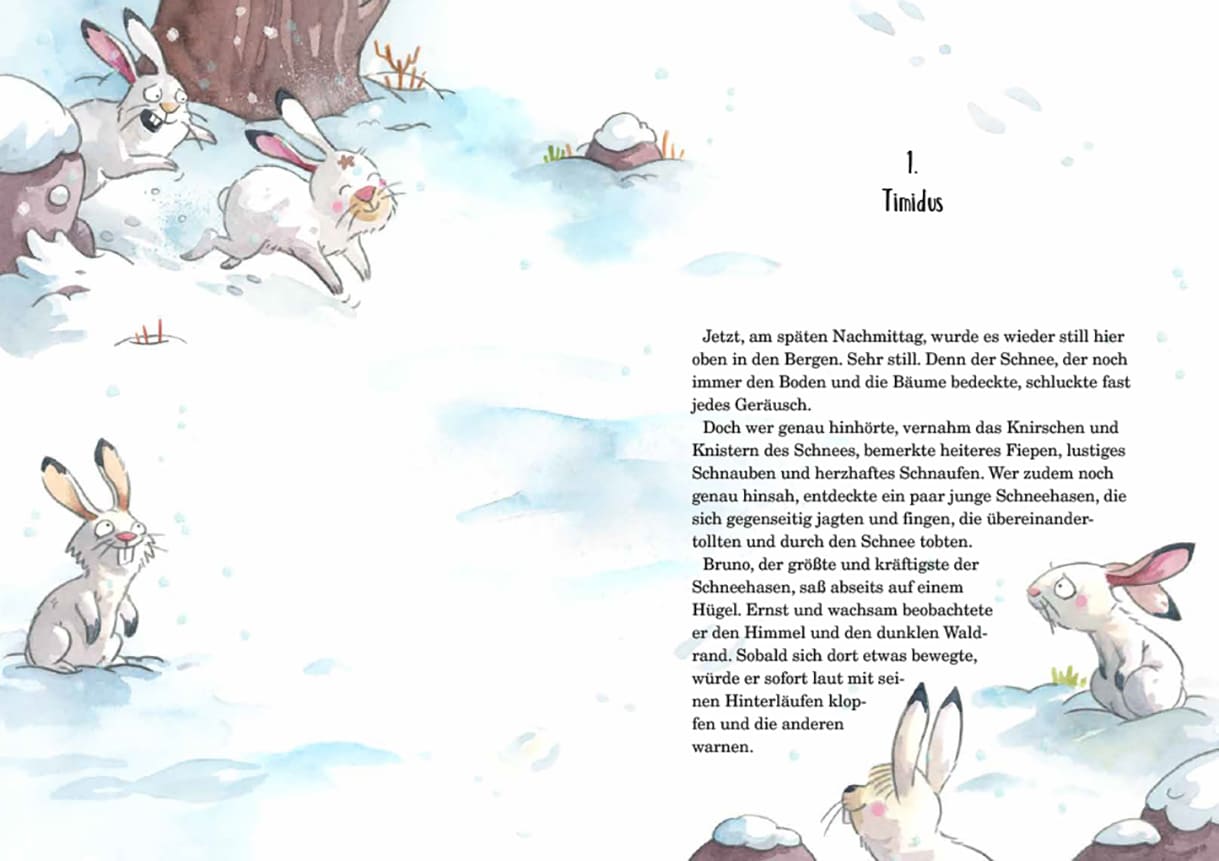
Die Geschichte spielt zwar auf versschneiten Berghängen und Wäldern, aber kürzlich ist das rund 100-seitige Buch aus dem Vorjahr nun auch als Hörbuch erschienen; auch wenn mit Elias Emken eine einzige Person die komplette Geschichte liest bzw. erzählt, scheint es phasenweise ein mehrstimmige Hör-Erlebnis. Und die Jahreszeit tut nichts zur Sache.
Am Anfang steht ein Streit unter Schneehasen. Das heißt nur einer, der kleine, neugierige, mutig Timidus probiert mit einem großen stück Baumrinde „Schneerutschen“, was dem Chef der Hasengruppe namens Bruno so gar nicht gefällt. Das mache nur Feinde auf die Kolonie der im Schnee getarnten Langohren aufmerksam.
„Dein Rufen war aber eigentlich viel lauter als mein Rutschen“, lässt Autor Michael Engler den Helden des Buches sagen; Barbara Scholz lässt Timidus wie auf einem Skateboard über Hügel flitzen.
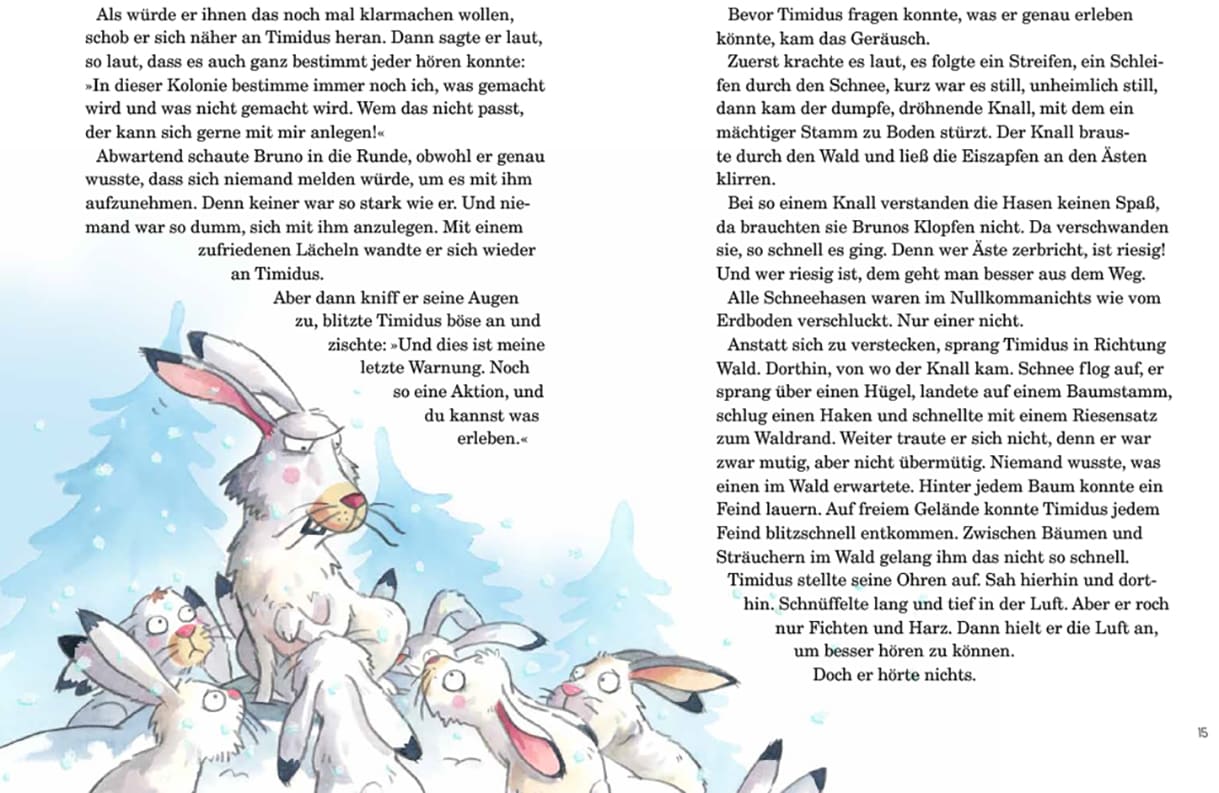
Als das aufgeweckte Hasenkind dann noch wissen will, der da im Wald Krach macht und einen Baum umknickt, verbannt der Oberhase Timidus. Keine oder keiner seiner Freund:innen steht im bei. „Ein kleiner Hase, ganz allein in der Wildnis. Wie soll das gehen?“, fragte er. Da wurde es still. So still, dass man beinahe die Schneeflocken fallen hören konnte.“ Diese vier kurzen Sätze beschreiben das nun einsetzende Gefühl des Ausgestoßen-Seins, der drohenden und dann beginnenden Einsamkeit.
Timidus findet eine eigene Höhle – und kommt drauf, nun keppelt niemand mehr mit ihm, er kann tun und lassen, was er will. „Niemand!“, rief er laut und froh. „Keiner kann über mich bestimmen!“
So kann er seiner Natur, dem neugierigen Erkunden, nachkommen. Unter anderem checkt er: Es gibt nicht nur Hasen und deren mögliche Feinde, sondern noch ganz schön viel andere Tiere – am Boden und in der Luft.
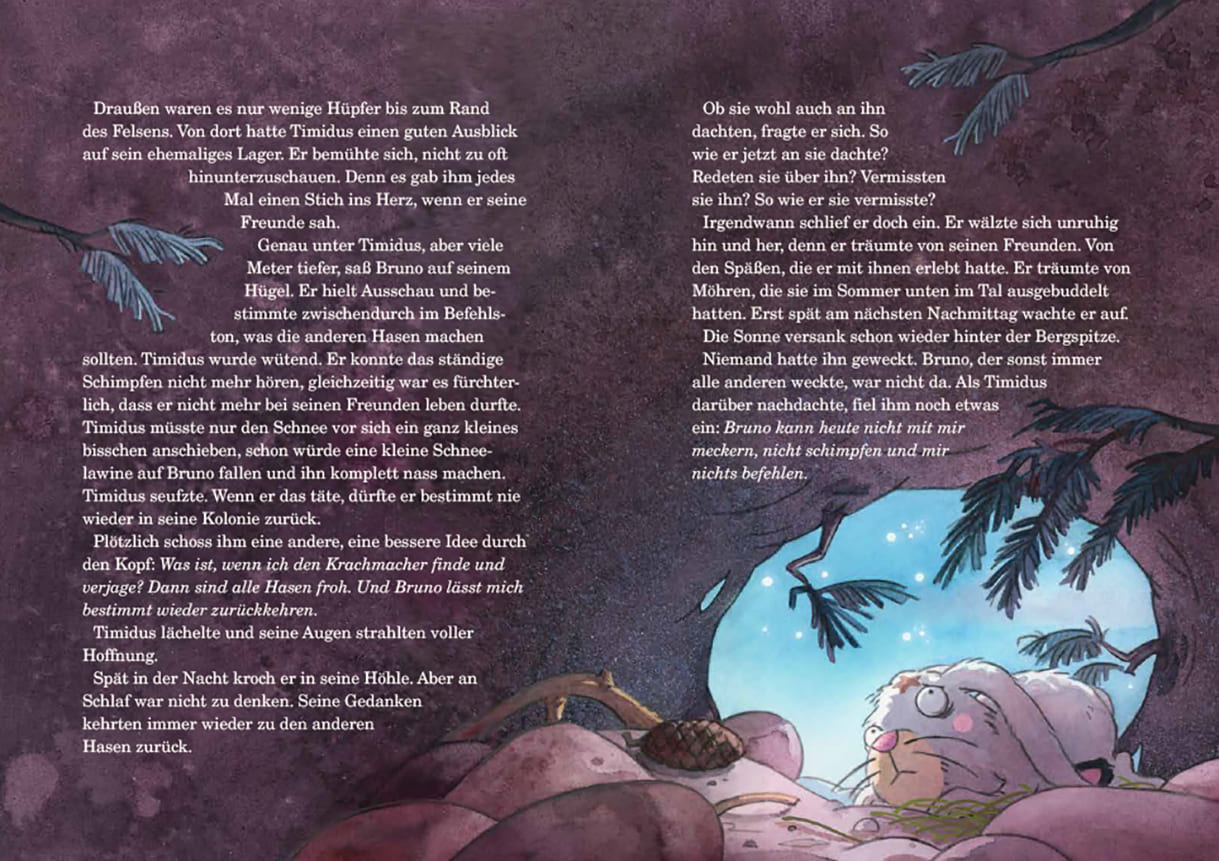
Aber allein ist er trotzdem. Bleibt es natürlich nicht, immerhin heißt das Buch ja „Die größte Freundschaftsgeschichte der Welt“ – und auch wenn fast jede Seite, manche sogar sehr üppig illustriert ist, das kann’s für 100 Seiten ja nicht gewesen sein.
Ohne allzu viel zu verraten, findet Timidus schon bald neue Freund:innen – andere Tiere, sogar solche, die ihm sein bisheriges Leben unter der Fuchtel von Bruno als Feinde genannt worden waren. Wer das sind, das sei hier sicher nicht gespoilert – nur so viel noch: Auch diese Tiere wurden aus ihren Familien bzw. Herden verstoßen, weil sie nicht so ticken wie ihre Artgnoss:innen. Der mehrmals bei näheren Begegnungen fallende Satz dazu: „So passen wir doch sehr gut zusammen…“.
Die Gemeinsamkeit der Außenseiter:innen ist dann dennoch nicht immer einfach, schweißt aber so zusammen, dass bald auch der Wunsch, doch zu seiner Kolonie zurückkehren zu können, verblasst. Immerhin Freund:innen können sich die unterschiedlichen Tiere aussuchen, im Gegensatz zur Familie, in die sie hineingeboren wurden und die sie verstoßen hat.
Und das macht Mut für alle Ausgestoßenen und stärkt die Lust, auch scheinbare Feind:innen kennen zu lernen.

Wenn’s nicht zu heiß ist, dann laden auch Kamele und Pony Kinder zum Rund-Ritt durchs Gelände der – mittlerweile 21. – Afrika-Tage auf der Wiener Donauinsel ein. Ausgangs-Station ist gleich nach dem Eingang (zwischen U6-Stationen Neu Donau und Handelskai).
Dutzende Zelte bieten – wie immer – einerseits Kleidsames und andererseits vor allem Schmuck aus unterschiedlichsten Ländern Afrikas an – bei manchen Stationen auch Informationen über die jeweiligen Staaten, Kulturen und bei wieder anderen Zelten traditionelles Essen der verschiedenen Ecken und Enden dieses Kontinents. Auf der großen Bühne liefern allabendlich andere Künstler:innen vor allem Musik. Fashion-Shows von Designer:innen runden das Programm ab.
Für Kinder gibt es einerseits Trommel-Workshops – solche auch für Erwachsene – und auch schon traditionell Malen, Zeichnen und Basteln, in diesem Jahr mit einer für die Afrika-Tage neuen Organisation, der „Mondwerkstatt“.
Ob Adler, Huhn, Schildkröte oder auch ganz wilde Tiere – sie werden durch die Erzählkunst von Patrick Addai, spürbar lebendig – ohne Angst vor ihnen haben zu müssen. Immer wieder trommelt er dazwischen, bezieht die Kinder, die gespannt lauschen, mit ein. Mit ihm scheinen sie sich in die Lüfte zu heben, aber auch wieder am Boden zu landen.
Der Oberösterreicher, der nicht ganz seine ersten zwei Jahrzehnte in Ghana aufgewachsen ist, schöpft für seine Bücher aus Märchen, Erzählungen und (Lebens-)Weisheiten seiner ersten Heimat, die er in spannende Geschichten, stets mit Botschaften, verpackt. In diesem Jahr will er vor allem sein neues Buch über den 250. Geburtstag einer Schildkröte, die aus diesem Anlass Artgenoss:innen aus allen Ländern der Welt einlädt, lebendig werden lassen – KiJuKU hat darüber berichtet und den Autor interviewt, Links am Ende des Beitrages.
Die zweite, korrigierte Auflage wollte er am Dienstag aus Linz holen, die Druckerei hat ihn versetzt, so kam er zu spät nach Wien – doch eine Fangemeinde an Kindern, die ihn und seine Art kennen und lieben, waaaaartete- und durfte sich dafür aussuchen, welche seiner Geschichten er an diesem Tag er performen sollte. Woraus sich ein bunter Mix an Tieren ergab, die Menschen Schlaues mit auf den (Lebens-)Weg geben.
kinderbuchautor-als-schul-hebamme-in-ghana <— noch im Kinder-KURIER

Im Jahr nach dem 30er-Jubiläum quollen die analogen und digitalen Postfächer der Wiener Jugendzentren mit kreativen Einsendungen von Mode-Designs noch mehr über als sonst. Sind es üblicherweise knapp mehr als 2000 Einsendungen von Kindern und Jugendlichen (4 bis 21 Jahre), so waren es im 31. Jahr des größten Mode-Nachwuchsbewerbs sogar 2800 Entwürfe. Aus diesem Berg – viele Entwürfe übrigens nicht nur Zeichnungen, sondern auch Collagen mit aufgeklebten Teilen – muss eine Jury jeweils rund 60 Entwürfe, die auch real geschneidert werden, darunter sind natürlich auch die der jeweils drei Preisträger:innen in den drei Altersgruppen (in drei Altersgruppen: 4 – 10, 11 – 15, 16 – 21 Jahre).
Phase 2 ist wohl die aufwändigste: Zwei Monate lang verwandelt sich das Jugendzentrum am Simmeringer Muhrhoferweg (J.A.M.) unter der Volksschule Hoefftgasse in die Schneiderwerkstatt. „Möglichst getreu am eingesandten Entwurf soll das Kostüm liegen – und das ist immer wieder eine Herausforderung“, wie die neue Co-Leiterin des gesamten Projekts, Bernadett Skoda Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… beim Werkstattbesuch erzählt. (Der Erfinder und jahrzehntelange Leiter Leo Oswald zieht sich schrittweise in die Pension zurück.) Sie, die vor allem für Theater, Film und Fernsehen Kostüm-Ausstattungen macht und sich oft selbst kreative Outfits schneidert, hatte schon vor rund eineinhalb Jahrzehnten drei Mal die Kids-in-Fashion-Werkstatt (mit-)geleitet.
Eine der Jung-Designerinnen, Mira Breunhölder ist für ein Interview in die Werkstatt gekommen – und steht gleich nach dem Eingang vor einem Kleiderständer, auf dem ihr Design schon einigermaßen Gestalt angenommen hat. Es ist übrigens nur einer ihrer Einsendungen. „Ich hab sehr viele Entwürfe gezeichnet“, vertraut sie dem Journalisten an. „Und ich hab nicht nur gezeichnet, sondern manches auch geklebt, zum Beispiel da viele grüne und lila Krepp-Papier-Fleckerln. Die hab ich einzeln aufgepickt – das Kleid ist sehr cool geworden“, strahlt sie über den doch großen Gleichklang mit ihrem Entwurf.
„Ein bisschen überrascht war ich schon, als ich erfahren habe, dass einer meiner Entwürfe genommen worden ist.“
Und sie darf mit Pinsel und Farbe noch weiter Hand an einige der schon fix montierten Teile anlegen, was sie freudig in Angriff nimmt und ausführt. Daneben verrät sie noch, „Ich zeichne überhaupt sehr gerne.“
Auf die Frage, ob sie sich beim Gestalten der Kostüm-Designs vielleicht das eine oder andere Mal überlegt habe, das Kleidungsstück selber anzuziehen, meint die Zehnjährige: „Schon manches Mal, aber eher, dass andere Leute das anziehen könnten.“
Was übrigens definitiv im konkreten Fall passieren wird. Am 4. Oktober 2025 steigt die 31. Kids-in-Fashion-Gala, wo junge Models die 63 umgesetzten kreativen, ausgefallenen Outfits am Laufsteg vorführen werden – bis 5. September können sich 14- bis 23-Jährige dafür bewerben – siehe Info-Box am Ende des Beitrages.
Zurück zum Umsetzungs-Prozess: Das was wie versteiftes Krepp-Papier wirkt und sich so steif angreift, „ist Baumwollstoff, den haben wir mit Holzleim und Farbe dick und mehrfach bestrichen und dabei gekreppt“, schildert Bernadett Skoda dem neugierigen Reporter. Und wischt die Bedenken, dass das dann doch für jene Person, die das tragen darf / muss, sehr kratzen dürfte, beiseite: Wir haben das alles auf ein weiches Unterkleid genäht!“
Da eine weitere angesagte Interviewpartnerin leider dann doch nicht aufgetaucht ist, schaut und hört sich Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… – zu zweit – noch ein bisschen in der Werkstatt um. An einem Kleiderständer hängt ein Kostüm, zur Hälfte Schachbrett, dahinter steht eine schwarze Styropor-Figur, scheint ein König zu sein. „Der kommt auf die rechte Schulter. Und als Ausgleich auf die linke eine rote Kugel“, zeigt die schon zitierte Bernadett Skoda vor.
Im Raum neben dem Kleid der Jung-Designerin, die zum Interview gekommen ist, häkelt Natalie mit ihren Fingern einen gelben Woll-Schlauch. „Der soll sich dann am Ärmel eines Oberteils entlang schlängeln“, erklärt die Mode-Fachschülerin, die hier ihre 160 erforderlichen Praxis-Stunden für die Abschlussprüfung im dritten Jahr absolviert. Ihre Kollegin Dina schneidet gold-glitzernde Quadrate aus einer Moosgummi-Platte. „Die kommen auf ein Kleid“ – und die spontane Reaktion von KiJuKU beim Blick auf den entsprechenden Entwurf „erinnert ein wenig an Klimt“, kommentieren Werkstattleiterin und Projekt-Co-Leiterin: „Wir haben das intern auch schon Klimt-Kleid“ genannt.
Altes Zeitungspapier ist offenbar bei jungen kreativen Mode-Designer:innen auch recht beliebt als Material für eigene Entwürfe – und bei der Jury 😉 Gab es im Vorjahr eine zeitungs-Latzhose, so kramt Bernadett Skoda aus einem der vollgeräumten Ecken ein enges, stark tailliertes Kleid hervor, dessen äußerste Schicht – entsprechend der eingesandten Collage aus solchem besteht.
Mit den zwei schon genannten Praktikantinnen – von insgesamt zehn Modeschüler:innen – sowie einer der drei diesjährigen Werkstätten-Leiterinnen, Alice Petra Schanowsky, die übrigens nun als Schneidermeisterin nochmals die Uni besuchen wird, und zwar die Pädagogische Hochschule, um Lehrerin für Schnittzeichnen und Werkstatt an einer Modeschule zu werden, hat Stefanie Kadlec, die seit einiger Zeit journalistische Praxis-Erfahrung bei KiJuKU führt drei kurze Interviews geführt, die hier unten am Ende dieses Beitrages verlinkt sind.

KiJuKU: Was ist die „Kids in Fashion“ Werkstatt genau?
Alice Petra Schanowsky: Das hier ist eigentlich ein Jugendzentrum. Wir besiedeln es für zwei Monate und wandeln es in eine Nähwerkstätte um. Das Jugendzentrum bringt uns die Schnellnäher, das Bügeleisen und das Overlock (spezielle Nähmaschine). Wir nähen hier an die 63 Kostüme. Es arbeiten drei Schneidermeisterinnen und alles entsteht in zwei Monaten unter Mithilfe von unseren fleißigen PraktikantInnen. Heuer sind es zehn PraktikantInnen. Die Arbeit macht wahnsinnig Spaß. Es ist sehr erfüllend und kreativ. Ein toller Prozess und jedes Mal wieder spannend, wenn man eine Kinderzeichnung hat und dann nach zwei oder drei Tagen das fertige Teil sieht.
KiJuKU: Es dauert cirka zwei, drei Tage bis ein Kostüm fertiggestellt wird?
Alice Petra Schanowsky: Es gibt auch schnellere, aber normalerweise zwei bis drei Tage.

KiJuKU: Du bist ehemalige Modeschülerin und jetzt arbeitest du als Schneidermeisterin?
Alice Petra Schanowsky: Ich bin Damen- und Herrenschneidermeisterin. Ich habe nach der Modeschule, einer Fachschule, jeweils eine einjährige Meisterklasse besucht, zuerst für Damen und dann Herren, das ist bei uns im Handwerk getrennt. Die Damen und Herren haben jeweils eine eigene Verarbeitung. Mir hat beides gefallen, deswegen habe ich beides gemacht.
KiJuKU: Was gefällt dir an deinem Beruf besonders gut?
Alice Petra Schanowsky: Dass man selber etwas schaffen kann und am Ende des Tages ein Ergebnis sieht. Das ist wahnsinnig erfüllend und sehr zufriedenstellend. Dass ich mit meinen Händen etwas schaffen kann, ist, was mich an dem Beruf so glücklich macht.
Stefanie Kadlec

KiJuKU: Wie gefällt dir die Arbeit hier in der Werkstatt?
Natalie: Es ist entspannt. Wir basteln und nähen viel. Ich habe schon viel Spaß. Es gibt einfach nicht so viel Druck und ich arbeite nach Lust und Laune. Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich es sagen, dann mache ich etwas anderes.
KiJuKU: Was gehört zu deinen Aufgaben? Was musst du hier alles machen?
Natalie: Nähen und basteln. Das war’s eigentlich und hin und wieder auch aufräumen.
KiJuKU: Möchtest du das irgendwann auch beruflich machen oder ist es für dich eher nur so ein Hobby?
Natalie: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich würde das schon auch beruflich machen, denn es macht schon sehr viel Spaß.
KiJuKU: Entwirfst du auch selbst Mode?
Natalie: Ja, für die Modeschule meistens oder die anderen Kleidungsstücke, die wir in der Werkstätte produzieren, aber sonst außerhalb nicht.
KiJuKU: Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?
Natalie: Es kommt immer auf den Tag drauf an, aber so 2000er gefällt mir persönlich am besten.
KiJuKU: Was hast du sonst noch so für Hobbys?
Natalie: Ich zeichne, nähe und gehe viel raus mit Freunden.
Stefanie Kadlec

KiJuKU: Welche Schule besuchst du und in welchem Jahrgang bist du?
Dina: Die Modeschule in der Herbstrasse. Jetzt komme ich in die dritte Klasse, ich habe dann die Abschlussprüfung und bin fertig.
KiJuKU: Wie ist die Arbeit in der „Kids in Fashion“-Werkstätte für dich?
Dina: Es macht schon Spaß und ist nicht zu schwer. Ich habe es mir härter vorgestellt, aber ist es nicht.
KiJuKU: Möchtest du es irgendwann beruflich machen?
Dina: Nein. Es macht zwar Spaß, aber es ist nicht so mein‘s. Ich habe während der Schulzeit gemerkt, dass ich beruflich was anderes machen will.
KiJuKU: Was hast du sonst für Hobbys und Interessen?
Dina: Ich spiele Videospiele auf meiner Playstation, gehe in der Natur spazieren, höre Musik und koche gerne. Style ist mir wichtig, denn ich mag Klamotten sehr. Das ist jetzt nicht wirklich mein Style, denn hier mache ich mich nicht schick, weil ich eh schmutzig werde. Man muss sich auch gut bewegen können.
KiJuKU: Also Mode ist schon wichtig für dich?
Dina: Ja, schon!
Stefanie Kadlec

Wie schaut ein „Summ“ aus? Gut, meistens ist bei der Illustration dieses Geräusch eine Biene zu sehen. Bei „Platsch“ oft ein Wassertropfen. In Comics führen Geräusche seit „ewig“ ein bildhaftes Eigenlieben – meist in Form unterschiedlicher Sprechblasen, -sterne oder als zackige Schrift.
Aber was ist „Kraaks“ und wie schaut das aus? Oder „Schlürf“, „Drönn“, und noch viele andere mehr. Das Bilderbuch „Was macht Krakks?“ gibt vielen Geräuschen zunächst einmal ein Eigenleben. Die Geschichte der Hauptfigur – wie sich Eis anhört, wenn es zerbricht, und zwar winterliches Eis – wird von Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels fantasievoll erzählt. Dieses Krakks erfährt, dass es auch im Sommer Eis gibt – und zwar buntes in so ziemlich allen Farben. Weshalb es dieses unbedingt sehen, hören und erleben will.
Nikolai Renger hat diesen Geräuschen, die zu Figuren wurden, bildhafte Gestalt verliehen – und das ist mitunter ziemlich schräg 😉


Plötzlich stand da eine alte Kiste mit Schloss unter den Bäumen, zwischen denen Oscar Löcher grub. Ach, was stellte er sich an Schätzen vor, die er da drinnen finden würde. Und wie groß war seine Enttäuschung, als er endlich mit allem möglichen Werkzeug das Schloss geöffnet hatte.
Buchstaben, nichts als Buchstaben. Noch dazu solche, die sich zu komischen Wörtern gebildet hatten. „Quietschgelb“ war das erste, das er zu fassen bekam. Ach was, dachte er sich offenbar, knüllte es zusammen und schmiss es durch die Gegend. Hoppla, was war denn das? Einen Moment später galoppierte ein ziemlich aufgebrachter, quietschgelber Igel an Oscar vorbei“.

Doch nicht so öd, was diese Wörter konnten. Oscar begann so manches auszuprobieren und fand seinen Spaß daran, ein Vogelhäuschen pompös, einen Baum haarig zu „zaubern“. Die Magie verwandelte auch sein Verhältnis zu diesen „Zaubermitteln“. Als die Schatztruhe leer war, begann er nach eigenen zu suchen – durch genaues Beobachten, Zuhören, Riechen, Fühlen…
Dieses Bilderbuch namens „Der Wortschatz“ von Rebecca Gugger und Simon Röthlisberger das auch mindestens ebenso ein Bild-, Gedanken-, Fantasie-Schatz ist, gibt es nun in acht verschiedenen zweisprachigen Versionen: mit Englisch, Französisch, Italienisch, Kurdisch (Kurmancî – in lateinischer Schrift), Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch. Einzig und allein, die grafisch gestalteten ursprünglichen Wörter wie das oben erwähnte Quietschgelb oder andere, die direkt in den Bildern eingebaut ist, blieben / bleiben auf Deutsch.

Und weil für jene, die die entsprechenden Sprachen nicht (so gut) können, natürlich nicht mit dem Entziffern der Buchstaben getan ist, bietet der Verlag die ganzen Geschichten jeweils auch als Hörbücher zum Download an – mit einem im Buch abgedruckten Code.
Für mögliche weitere Sprachen, aber auch mit so manchen Anregungen aus dem 54-seitigen pädagogischen Begleitmaterial mit Rätseln und Anregungen für eigene Wortspiele, gibt es noch eine „Bilderbuchkino“-Version ohne den Erzähltext – um darüber zu reden, sich eigenes zusammen zu fantasieren oder es gegebenenfalls in viele weitere Sprachen zu übersetzen.
Mehrsprachigkeit ist ein Schatz – dieses Motto steht seit eineinhalb Jahrzehnten über dem Redebewerb „Sag’s Multi!“. An dem können Jugendliche aller österreichischen Schulen – ab der 7. Schulstufe (2. Klasse Mittelschule oder AHS) bis zum Ende der Schulzeit – also 12. bzw. 13. Stufe (AHS oder BHS), aber auch der Berufsschulen mit jeweils Deutsch UND einer anderen Sprache, egal ob mitgebrachte oder erlernte, teilnehmen.

„Wenn jedes vierte Kind am Ende der Grundschulzeit nicht lesen und schreiben kann, dann ist es an uns, den Erwachsenen, Lust an Buchstaben und am Lesen zu machen. „Der Wortschatz“ ist ein wort- und bildreiches Buch, das genau diese Lust am Lesen fördert und weckt. Unsere beiden Jungs hatten mit dem Buch und an der Kraft der Sprache ihre wahre Freude“, wird Dr. Jörg Maas, Geschäftsführer der deutschen Stiftung Lesen, vom Nord Süd Verlag (die mehrsprachigen Versionen: Edition Bilibri) zitiert.
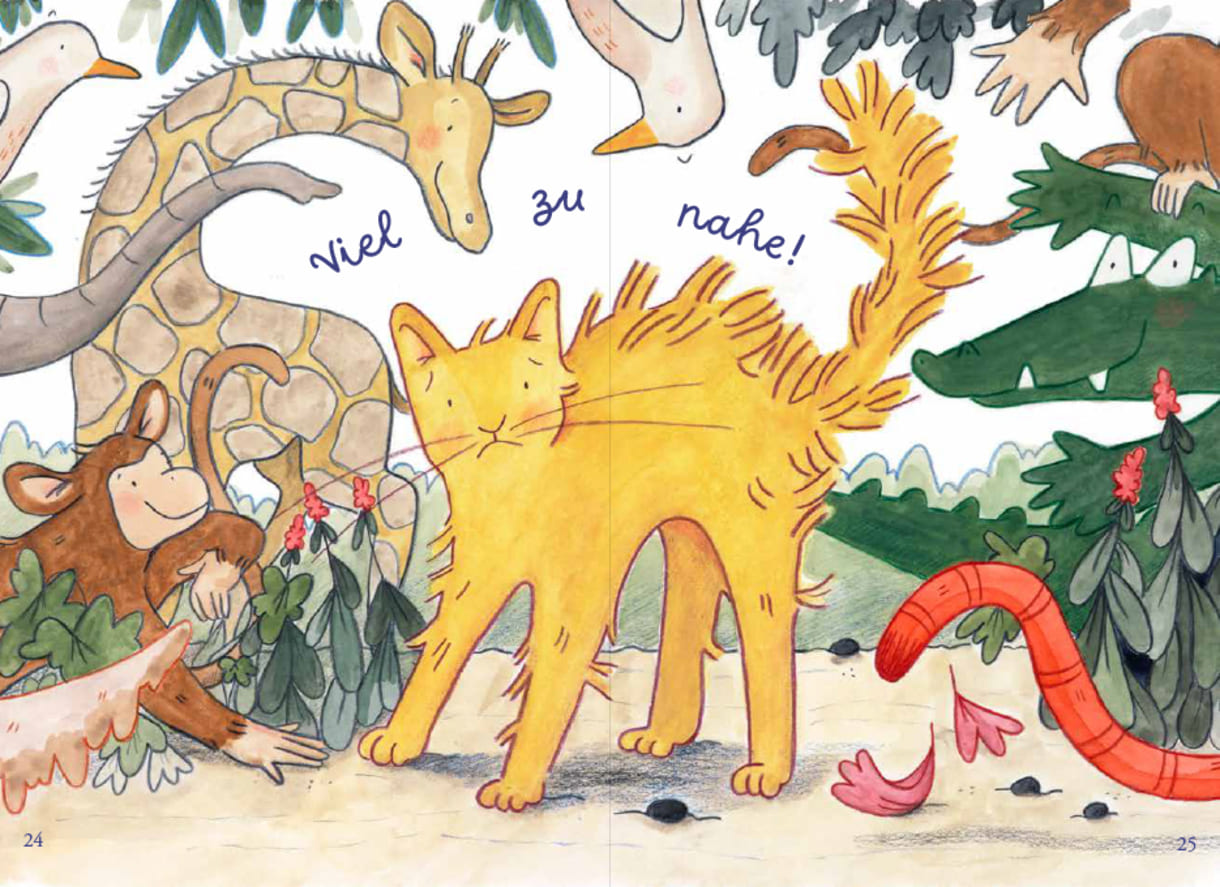
Die löwengelbe Katze Koko schleicht sich nächtens auf den Spielplatz. Klettert, rutsch, springt und hat Spaß. „Koko ganz allein. Juhuuu!“ Der Jubelruf zwar gedruckt, aber in Handschrift-Art. Unter tags verkrümelt sie sich als die Tierkindergruppe den Spielplatz stürmt. Das Gewurrl ist nichts für Koko. Auch wenn sie das nicht so wirklich äußern kann, sie fühlt sich nur nicht wohl, wenn ihr andere zu nah ans Fell rücken.
Da tanzt eine blaue Katze an, die offenbar genau das selbe Gefühl hat, aber einfach sagt: „Nicht so nahe!“ Dieser Ausruf gab dem Bilderbuch von Ulrike Schmitzer mit bunten Zeichnungen von Antonia Autischer den Titel.

Dieses Bedürfnis nicht bedrängt zu werden, kennst du vielleicht. Jede und jeder braucht eigen Grenzen, die eben durchaus unterschiedlich sein können. Gut, wenn du es nicht nur spürst, sondern den anderen auch sagen oder zeigen kannst, dass sie deine Privatsphäre respektieren sollen.
Und Koko absentiert sich ja nicht schlechthin, wenn ihr danach ist, kommt sie dem einen oder anderen der Tierkinder auch durchaus nahe – so dieses das möchte 😉

Manche der Doppelseiten sind fast wie Wimmelbilder – und verleitet dich dazu, genau zu schauen, auch auf kleine Details zu achten – dann findest du sicher auch zwei kleine, im Text niemals erwähnte, Tiere, die auf jener Doppelseite abgebildet sind, bevor die Geschichte beginnt. Und zum Buch gibt es noch zwei Ausschneidebögen mit einem Tierbilder-Memory – wobei die Bildpaare nie ganz gleich sind, was noch einmal zum genaueren Schauen verleitet.


Nestroy – der Name dieses Theaterdichters steht seit 200 Jahren für satirisches (gesellschafts-)politisches Theater mit (leider) zeitlosen Themen. Seine vor allem in den Couplets (Gesangseinlagen) eingebauten Seitenhiebe mit tagesaktuellen Bezügen zu seiner Zeit animier(t)en Inszenierungen natürlich dazu, solche Anspielungen den zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten anzupassen.
Manche der Nestroy’schen Stücke sind fast Dauerbrenner, etwa jener Klassiker gegen Vorurteile „Der Talisman“ – denn ob Menschen wie die zentrale Figur darin Titus Feuerfuchs seiner roten Haare wegen oder aufgrund von Hautfarbe, Religion, Herkunft, Aussehen oder warum auch immer diskriminiert werden – die Struktur ist dieselbe. Oder wie Nestroy es in einem Halbsatz im Talisman auf den Punkt gebracht hat: „So kopflos urteilt die Welt über die Köpf’“.

Es gibt aber auch eine Reihe von Stücken, die kaum bekannt sind. Heuer standen etwa bei den Nestroy Spielen in Schwechat „Die Zauberreise in die Ritterzeit“ auf dem Programm (Motto: „Früher war alles besser!“). Und das Utopia Theater, das seit mehr als einem halben Jahrzehnt vor allem in Höfen von Gemeindebauten oder Parks und täglich woanders fürs Publikum kostenlos spielt, tourt in diesem Sommer mit „Lady & Schneider“.
Hier hatte Nestroy – wie auch für ein paar andere Stücke – sich beim französischen Autor Eugène Sues bedient, im Konkreten bei dessen Fortsetzungsroman „Les Mystères de Paris“ (Die Geheimnisse von Paris; 1842 bis 1843 in der Pariser Tageszeitung „Le Journal des débats“). Im Vordergrund steht eine Intrigengeschichte des jungen Adeligen Paul gegen seinen nur wenig Minuten älteren Zwillingsbruder Friedrich (Christopher Korkisch spielt beide – lediglich durch anderes Sakko bzw. aufgeklebtem Schnurrbart zu unterscheiden). Wenn dessen Hochzeit mit Lady Bridewell (Tina Haller) platzt, würde der Vater den Älteren enterben, der Jüngere käme zum Zug.

Paul und der Sekretär der Baronin Adele Kargenhausen (Pauls Braut, die hier nur erwähnt wird) namens Fuchs (Bernhardt Jammernegg) suchen nach einer Falle. Und finden die Gelegenheit in der Vorstadt-Schneiderei von Meister Restl (Thomas Bauer), seiner Tochter Lina (Barbara Edinger) und deren Bräutigam und Restl-Nachfolger Hyginus Heugeign (Andreas P. Seidl). Mit einem aufreizenden Kleid „verkleidet“ will die Baronesse beim Ball des Grafen Hohenstein dem Friedrich den Kopf verdrehen – dessen Hochzeit somit platzen lassen und …
Bei just derselben Schneiderei lässt sich allerdings nun die Lady und designierte Friedrich-Braut ebenfalls ihre Ball-Garderobe (Kostüme: Stefanie Elias) anfertigen.
Ist diese Ausgangsstory schon kompliziert genug – mit von der Partie ist in dieser Inszenierung im Gegensatz zur Baronesse die Vertraute der Lady Bridewill, Miss Kemble (Natalie J. Obernigg), so wird’s noch verwickelter, weil zwischendurch noch Lina das Kleid probieren soll und Friedrich bei anderer Gelegenheit Gefallen an Lina, im Stück oft Linerl genannt, gefunden hat.

Die intrigante Verwechslungskomödie ist aber nur der vordergründige für so manche Situationskomik und damit etliche Lacher Anlass gebende Plot. Im Zentrum hingegen stehen die politischen Ambitionen des jungen Schneiders – wobei politisch? Überzeugung? Keine. Oder jedwede beliebige. Einzig und allein: Er will an die Spitze, „koste, was es wolle“. Übrigens nannte Nestroy sein Stück ursprünglich „Der Mann an der Spitze“ – und er spielte bei der Uraufführung selber den Hyginus Heugeign (Februar 1849, Carltheater). Damals hieß es im Text „Sie müssen mich noch wo an die Spitze stellen, sey’s Bewegung oder Clubb, liberal, legitim, conservativ, radical, oligarchisch oder gar kanarchisch, das is mir alle eins, nur Spitze!“

Wie schon das eben eingestreute Zitat davon, dass es wurscht ist, was es kostet, streut das tapfere „Spitzen“-Schneiderlein ein Zitat nach dem anderen aus der heimischen Polit-Debatte der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart ein – „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“, „was woar mei Leistung?!“, „es gibt kein Weiter wie bisher!“ gleichzeitig stilisiert er sich auch auf zum „Ich bin das Volk!“. (Bühnenfassung und Regie: Peter W. Hochegger; Komposition und Couplets: Helmut Strobl). In den hochrangigen Auftrag geheimnist er gleich seine eigenen Aufstiegs-Chancen hinein.
Da alle Aufführungen im Freien – mit so manchem Umgebungslärm, beim Besuch von KiJuKU im Eiselsberghof am Bacherplatz in Margareten (5. Bezirk) flogen alle paar Minuten Flugzeuge relativ niedrig über das Geschehen, ist die Mikro-Verstärkung, die live von Martin Hornig gesteuert wird, umso wichtiger. Auf- und Abgänge auf die Bühne und den Platz davor, auf dem einiges vom Geschehen spielt, geht nicht selten zwischen den Publikumsreihen. Eine sogenannte vierte Wand gibt es bei dieser Spielweise nie.
Und trotz der verworrenen Intrigen plus den „Spitzen“-Wünschen der Zentralfigur gelingt es dem Ensemble dem Publikum übersichtliche, fast hautnahe humorvolle 1½ Stunden zu verschaffen.
Zu einem Interview mit der Darstellerin der Schneiderstochter Lina, Barbara Edinger, die erstmals bei einem Utopia-Stück mitspielt, geht es in einem eigenen Beitrag.

KiJuKU: Ich habe schon die letzten Jahre immer wieder beim Theater im Gemeindebau zugeschaut und habe dich jetzt zum ersten Mal gesehen. Das heißt, meine erste Frage ist: Bist du neu beim Utopia Theater?
Barbara Edinger: Genau, dieses Stück, Lady und Schneider, ist das erste Stück, das ich mit dem Utopia Theater gemeinsam mache.
KiJuKU: Und wie ist das erste Mal für dich?
Barbara Edinger: Ich finde die Arbeitsweise sehr angenehm. Wir haben im Gegensatz zu anderen Produktionen, die ich davor schon gemacht habe, ein bisschen eine längere Probenvorlaufzeit, was aber auch das Erarbeiten etwas entspannter macht. Soweit ich weiß, sind drei Leute neu in dem Ensemble oder arbeiten zumindest zum ersten Mal mit dem Regisseur Peter Hochegger zusammen. Wir haben uns alle sehr gut zusammengefunden. Der Peter hat die Leute, mit denen er arbeitet, sehr gut ausgewählt. Zwischen uns ist eine sehr familiäre und amikale Atmosphäre, das macht natürlich auch die Arbeit viel schöner.

KiJuKU: Ich hätte deine Figur, Lina, die Tochter des Schneiders Restl, anfangs vor allem als sehr gutmütig beschrieben. Sie wird Teil einer Intrige, um ihren Liebsten zu retten. Am Schluss lässt sie ihn dann jedoch stehen und das Ende ist auch eher offen. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dir und deiner Figur? Wie siehst du deine Figur eigentlich?
Barbara Edinger: Ja, das würde ich schon sagen. Sie ist schon eine, die mit beiden Füßen am Boden steht, und ist im Gegensatz zu ihrem Zukünftigen – wobei der Vater doch noch mehr in der Schneiderei arbeitet – eine, die anpackt. Lina lässt sich nicht viel anschaffen, sondern macht es von alleine, und ist auch eine wichtige Figur. Sie lässt sich ja nicht bewusst auf eine Intrige ein, sondern sie weiß nur, sie muss da irgendwas machen, aber es kommt ihr mit der Zeit ein bisschen dubios vor. Mit der Vermutung liegt sie ja dann auch richtig, also ist sie nicht auf den Kopf gefallen.
KiJuKU: Ich finde sie ist eine sehr liebenswürdige Figur, denn sie möchte ihren Zukünftigen retten…
Barbara Edinger: Das schon, aber nachdem er mit seinen Politisierungen immer wieder das Weiterleben des Geschäftes, ihre Lebensaufgabe, das, was sie selber gerne machen will, aufs Spiel setzt, ist das Fass irgendwann übergelaufen. Eine Parallele ist, dass ich auch eine bin, die sich nicht so schnell etwas sagen lässt. Ich bin gutmütig, bis ich es nicht mehr bin und so schätze ich sie auch ein.

KiJuKU: Das Stück hat viele Bezüge zu aktueller Politik und Gegenwart. Was nimmst du dir persönlich aus dem Stück mit, was ist für dich die Kernbotschaft?
Barbara Edinger: Das eigene Wahlmotiv zu hinterfragen. Gehe ich wählen einfach nur aus Protest oder gehe ich nicht wählen einfach nur aus Protest? Wo habe ich Mitsprachrecht? Ich war in einer Stadt Wien-Werbung, wo sie die Bürgerinnen und Bürger anhalten, sich auch zu engagieren. Von der Stadt Wien aus über ein Magistrat hat man die Möglichkeit, sich mitzuengagieren und mitzureden. Viele Leute wollen zwar, dass sich was ändert, tun aber nichts. Jeder hat eine andere Lebenssituation, wenn ich es energiemäßig einfach nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht, aber man hat zumindest die Möglichkeit. Das ist auch etwas, was das Stück sehr gut auf den Punkt bringt: Es gibt Möglichkeiten. Man darf nicht zu utopisch werden – das ist lustig, weil wir im Utopia Theater sind – aber man kann sich auch einsetzen und darf es nicht nur den anderen überlassen.
KiJuKU: Im Stück wird immer die „vierte Wand“ durchbrochen, also es gibt einen sehr starken Publikumsbezug. Bei deiner Figur kommt es auch vor, bei anderen Figuren ist es mir noch häufiger aufgefallen. Ich frage mich, ist das eigentlich schwierig?
Barbara Edinger: Ich finde es in dem Zusammenhang überhaupt nicht schwierig, wobei es kommt natürlich immer auch aufs Publikum an. Es gibt Leute, die sich mehr darauf einlassen können als andere, das habe ich im Kindertheater auch schon mitbekommen. Aber an und für sich eigentlich gar nicht, sondern im Gegenteil, mich animiert es dann noch viel mehr, den Kontakt mit dem Publikum zu suchen. Ich finde das eigentlich sehr angenehm, weil man sich durch das Aufbrechen der vierten Wand Schwung mitnehmen kann.
KiJuKU: Hast du noch ein paar Abschlussworte?
Barbara Edinger: Das Theater im Gemeindebau ist ein Gratisprogramm, das von den Bezirken gefördert wird. Es ist lustig, regt auch ein bisschen zum Nachdenken an, aber man kann sich auch zurücklehnen und die Vorstellung einfach genießen.
Stefanie Kadlec

Unterm Zeltdach des Wiener Roten Kreuzes vor dem Wiener Stephansdom können Interessierte lernen, einen Friedenskranich aus Papier zu falten. Links und rechts daneben versammeln sich Menschen und hören Reden zu, holen sich Sticker, Flugblätter oder Broschüren an verschiedenen Info-Tischen. Dazwischen kniet ein japanischer buddhistischer Mönch vor Schreckensbilder aus Hiroshima 1945. Neben ihm hält ein junger Mann ein senkrechtes Banner mit japanischen Schriftzeichen – Namu Myoho Renge Kyo wäre das im lateinischen Alphabet. „Das ist ein Friedensmantra“ erklärt er dem Journalisten.
6. August 2025 – 80 Jahre zuvor hatte die Besatzung eines US-Bombers die erste Atombombe auf bewohntes Gebiet abgeworfen, die japanische Stadt Hiroshima. 100.000 Todesopfer – fast alles Zivilist:innen – starben unmittelbar, nochmals so viele in den Folgemonaten – und all die nächsten Jahre an Folgeerkrankungen.
Viele verschiedene Vereine und Organisationen, die sich für Frieden engagieren, hatten zur Gedenkveranstaltung auf dem Wiener Stephansplatz am frühen Abend eingeladen, verteilten ihre Info-Materialien, hielten Transparente und Banner und eine Reihe von Reden mit unterschiedlichsten Aspekten – vom generell humanitären über mögliche noch viel krassere Folgen für Mensch, Tier und Umwelt, sollte es zu einem neuerlichen Einsatz von Atomwaffen kommen. Angesprochen wurde mehrfach auch, dass Phasen der Abrüstung aktuell gegenteiliges, nämlich Aufrüstung allüberall stattfindet. Eine junge Japanerin schilderte, Enkelin einer Überlebenden des zweiten Atombombenabwurfs – drei Tage später, 9. August 1945, auf Nagasaki zu sein.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte ein Grußbotschaft geschickt, in der er ebenfalls auf die erhöhte Gefahr angesichts der Weltlage hinweist und den Teilnehmer:innen für ihr Engagement dankt.
Nach etwa zwei Stunden formierte sich ein Demonstrationszug, der den Weg durch die Kärntnerstraße zum Karlsplatz nahm – einige trugen papierene Laternen, die in den Teich vor der Karlskirche gesetzt werden sollten. Tōrō nagashi ist eine japanische Zeremonie, bei der solche Laternen aufs Wasser gesetzt werden um der Toten zu gedenken.
„Obwohl viele Jahre vergangen sind, bleiben die beiden Städte lebendige Mahnmale für die schrecklichen Gräuel, die Atomwaffen angerichtet haben“, schrieb Papst Leo XiV. anlässlich der Gedenktage an Hiroshima und Nagasaki.
In Wien findet am 9. August ab 20 Uhr für die Opfer von Nagasaki ein Gedenken in der Buddhistischen Friedenspagode (1020, Hafenzufahrtsstraße F) statt.

„Es ist schön, wenn Fremde einmal zu Besuch kommen“, freut sich Gottfried, der seit drei Jahren im Kolping-Haus „Gemeinsam leben“ in der Leopoldstadt (2. Bezirk in Wien) wohnt. Die Freude angesichts der Kinder die rund um ihn und Johann, der sich auch für ein kurzes Interview bereit erklärt hat, ist ihm anzusehen.
Kinder aus Rumänien und der Türkei hatten zuvor – natürlich nicht nur für diese beiden – gesungen und getanzt – Kinder- und traditionelle Lieder aus ihren beiden Ländern, aber auch aktuelle Pop-Songs und einen Balletttanz. Die beiden Gruppen waren Teil jener rund 500 Kinder aus 20 Ländern vor allem Zentral- und Osteuropas, die für zwei Wochen in vier verschiedenen Camps in Österreich verbracht haben (Wien, Kärnten und zwei in Salzburg). Ihre Eltern arbeiten in den verschiedenen Ländern in einer der Niederlassungen der internationalen Versicherungsgruppe VIG (Wiener Städtische) und können sich mit einer kreativen Arbeit für die Teilnahme bewerben. In den ersten Jahren – heuer fanden die 13. Camps statt – waren dies Zeichnungen, seit einigen Jahren sind es Fotos – jeweils zu einem (großen) Jahresthema, heuer „Was bedeutet Freundschaft für mich“.
An einem Tag der beiden Wochen setzen die Camp-Kinder soziale Aktivitäten, in Wien bereiten sie traditionellerweise Auftritte für ein Senior:innen-Heim vor. Mit sieben Kindern aus den genannten beiden Ländern, die vor den älteren Menschen aufgetreten sind, führte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Interviews – die in eigenen Beiträgen unten verlinkt sind.
Zurück zu den beiden Senioren: Gottfried genoss die Abwechslung und – vermittelt über Dolmetscher:innen – auch die Unterhaltung mit den jungen Gäst:innen. „Wir haben zwar sonst auch immer wieder Veranstaltungen hier, aber im Sommer keine“, ergänzt Johann, der erst seit zwei Jahren hier lebt.
Natürlich wollte KiJuKU auch von den beiden wissen, was für sie Freundschaft bedeutet. „Sich mit jemandem gut und gern über alles austauschen können“, bringt Gottfried das für ihn Wesentliche auf den Punkt.
„Wenn ich mich auf wen wirklich verlassen kann“, fasst Johann das zusammen, was „für mich Freunde ausmacht“.

KiJuKU: Ist das dein erstes VIG-Camp?
Carla: Ich bin zum ersten Mal in Wien, aber im Vorjahr war ich schon beim VIG-Camp, aber in einem der Bundesländer. Und ich kenne schon mehr als die Hälfte der Kinder im Camp.
KiJuKU: Was hast du als Fotomotiv für Freundschaft gewählt? Und musstest du dafür lang überlegen oder war sofort die Idee da?
Carla: Mir ist es leicht gefallen, ich musste nicht lange überlegen.
KiJuKU: Und was war das Foto (zum Zeitpunkt der Interviews kannte ich die Fotos noch nicht)?
Carla: Ich hab ein Foto genommen, wo ich mit meiner Schulklasse drauf bin, aber nicht so eines, wie es sie oft gibt.

KiJuKU: Das heißt, du fühlst dich sehr wohl in deiner Klasse?
Carla: Ja, und es ist ein Bild von der Feier meines Geburtstages.

David: Ich bin zum zweiten Mal beim Kids-Camp, aber im Vorjahr auch – wie Carla – in einem der Bundesländer-Camps.
KiJuKU: Was war dein Bild, deine Idee zu Freundschaft?
David: Mein Cousin und ich.
KiJuKU: Dein Cousin ist sozusagen dein bester Freund?
David: Ja.
KiJuKU: Und was macht ihr zusammen?
David: Ich hab einen Apfel geteilt und ihm die Hälfte gegeben.

KiJuKU: Was macht ihr sonst gerne miteinander?
David: Wir spielen gerne Fußball und sind oft auch online miteinander verbunden.

KiJuKU: Bist du das erste Mal beim VIG-Camp?
Maia: Ja, das erste Mal. Ich war zwar schon mit meinen Eltern in einigen Ländern, aber bin jetzt zum ersten Mal ohne Eltern weg.
KiJuKU: Wie war das für dich?
Maia: Es war nicht so einfach, wir alle brauchen unsere Eltern und da mussten wir zuerst einmal Freundschaften schließen.
KiJuKU: War das einfach?
Maia: Ja, sehr.
KiJuKU: Was war deine Foto-Idee, um Freundschaft auszudrücken?
Maia: Ich und Katzen.

KiJuKU: Du hast Katzen?
Maia: Nein, aber ich hätte gern welche.
KiJuKU: Gibt es Katzen im Camp?
Maia: Ich glaub nicht – und nach einer Mini-Pause lächelnd: Aber ich bin eine Katze: Miau, miau!!

KiJuKU: Bist du schon eine VIG-Camp-Erprobte oder ist’s für dich eine Premiere?
Ecrin: Für mich ist es das erste Mal, dass ich ohne meine Eltern weg bin, aber ich hab Spaß.
KiJuKU: Gleich von Anfang an?
Ecrin: Ich hab ganz zu Beginn schon meine Eltern vermisst, und ich vermisse türkisches Essen.
KiJuKU: Was ist das Wichtigste für dich, wenn du an Freundschaft denkst?
Ecrin: Wenn ich wem vertrauen kann und mir vorstelle, das geht für immer, das ganze Leben.

KiJuKU: Wie hast du diese Idee foto-mäßig umgesetzt?
Ecrin: Ich hab ein Foto von zwei befreundeten Mädchen und einem Hund gemacht – Freundin und Hund machen für mich Freundschaft aus.

KiJuKU: Bist du das erste Mal im VIG-Camp?
Emir: Ich bin hier zum ersten Mal in einem anderen Land und zum ersten Mal weg von den Eltern.
KiJuKU: War es schwer sich daran zu gewöhnen?
Emir: Am Anfang war’s schwierig, aber ich konnte bald damit umgehen.
KiJuKU: Natürlich auch an dich die Frage zum Thema und deinem Beitrag.
Emir: Freundschaft bedeutet Liebe für mich, die enge Verbindung zu Freunden und Freundinnen und viele miteinander reden.

Was war deine Foto-Idee dazu?
Emir: Ich hab drei Fotos genommen, eines mein bester Freund und ich noch Babys waren, dann eines, wo wir auch noch sehr klein waren und ein größeres, das ungefähr von jetzt stammt, also von der Zeit, als wir uns bewerben konnten.

KiJuKU: Ist Österreich dein erster Auslands-Aufenthalt?
Deniz: Es ist nicht das erste Mal, dass ich in einem anderen Land bin. In England war ich schon drei oder vier Mal.
KiJuKU: Mit deinen Eltern?
Deniz: Ja, mit meinen Eltern.
KiJuKU: Ist es hier das erste Mal ohne Eltern?
Deniz: In einem anderen Land, ja.
KiJuKU: Wie war da der erste Tag oder gar die erste Nacht?
Deniz: Die erste Nacht war nicht das Problem, aber mit der Zeit ist mir ein bisschen langweilig geworden.
KiJuKU: Freundschaft bedeutet für dich was?
Deniz: Dass ich jemandem vertrauen kann.
KiJuKU: Wie hast du das in einem Foto umgesetzt?
Deniz: Ich hab ein Foto genommen, wo ich mit meinem Freund in einem Boot war.

KiJuKU: Warst du auch schon öfter im VIG-Camp?
Edi: Nein, für mich ist es das erste Mal
KiJuKU: Ist es auch das erste Mal Urlaub ohne Eltern?
Edi: Ja.
KiJuKU: Wie war diese Umstellung für dich?
Edi: Medium, es war ganz am Anfang hart, von meinen Eltern getrennt zu sein, aber jetzt geht’s gut.KiJuKU: Freundschaft bedeutet für dich was – bzw. welches Foto hast du dafür gemacht?
Edi: Meine Schwester und ich beim Schach-Spielen.
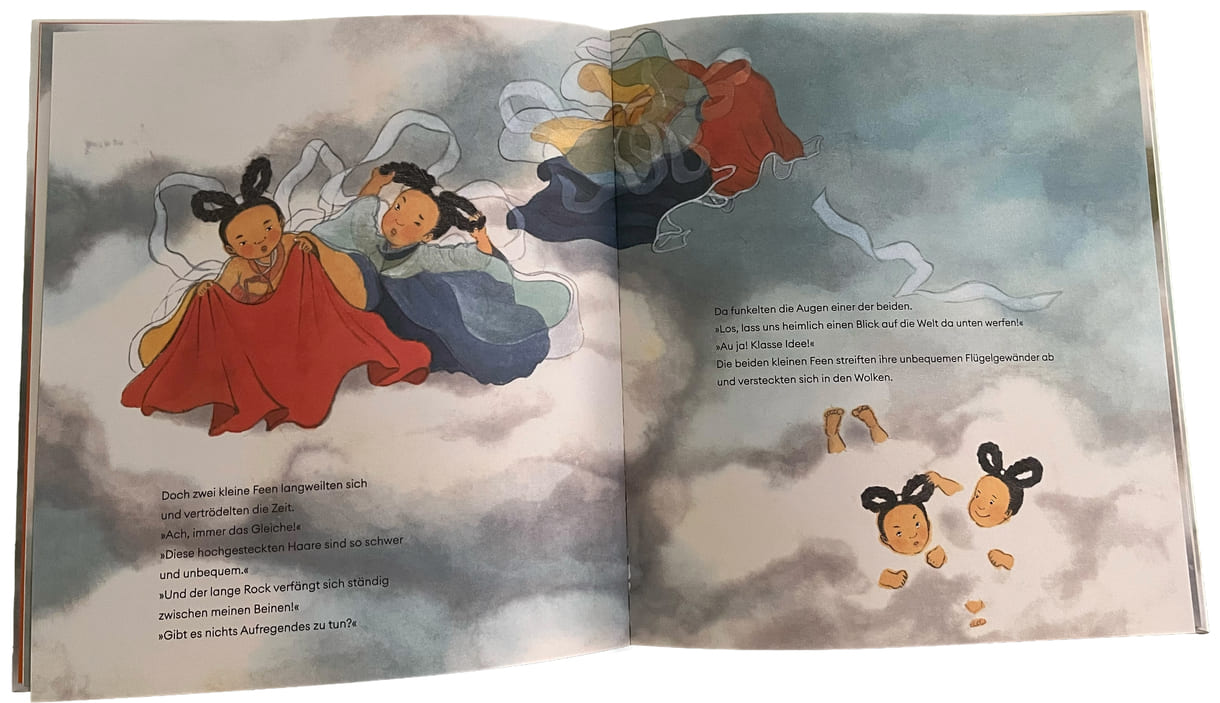
Dank der noch größeren Aufmerksamkeit als Literatur-Nobelpreisträgerin wurde auch das erste und (bisher) einzige Kinderbuch von Han Kang aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt und erscheint Mitte August 2025; das Original wurde erstmals vor fast 20 Jahren, 2007, veröffentlicht. In einer fantasievoll poetisch geschriebenen (Übersetzung: Ki-Hyang Lee) und von Jin Tae Ram fast magisch-märchenhaft illustrierten Geschichte erzählt die Autorin von „Donnerfee und Blitzfee“.
Die beiden sind aufgeweckte neugierige junge Feen, die sich in ihrem Umfeld hoch droben im Himmel ziemlich langweilen beim Weben von Wolken. Sie wollen wissen, was sich da unten auf der Erde abspielt. Doch bevor sie sich dahin aufmachen können, werden die Ausreißerinnen gestellt und „zur höchsten Stelle des Wolkenreichs“ gebracht.
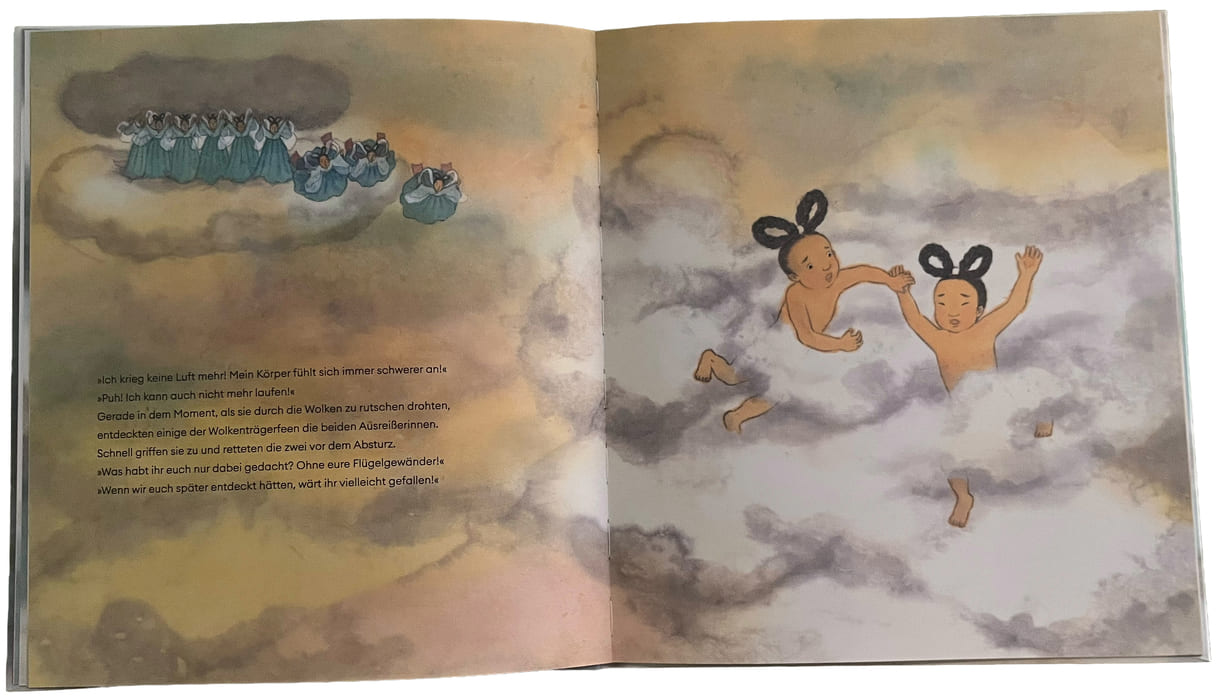
Und dann passiert vielleicht Überaschendes: Die alte, weise Fee schimpft nicht, sondern lässt ihnen bequemere Feengewänder schneidern, mit denen sie sich besser bewegen und auch die Welt erkunden können. Allerdings müssen sie davor ganz schön Wolken spinnen. Das begreifen sie nun als Herausforderung und machen sich intensiv ans Werk.
Und sie gibt ihnen für die Reise nach unten einen kleinen Silberzacken sowie eine Trommel mit Schlegel mit auf den Weg. Und – genau! So entstanden das, was die Namen der beiden Feen und der Titel des Buches ergibt 😉
Han Kang widmet das Bilderbuch „Für Kinder, die Angst vor Blitz und Donner haben; für Kinder, die keine Angst davor haben; und für Sebyuk“ (ihr Sohn).
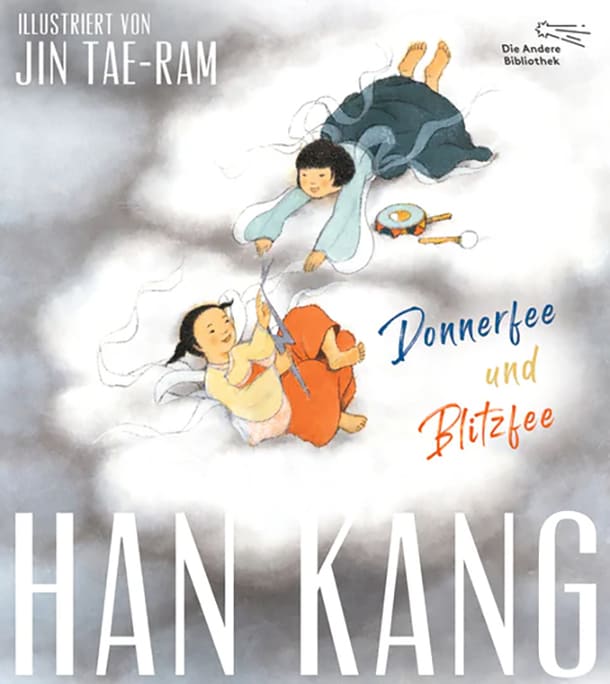

Wenige Tage bevor sie die US-Atombomben-Abwürfe auf die japanischen Städte Hirohima und Nagasaki – heuer zum 80. Mal – jähren (6. bzw. 9. August) verwandelt das „Please Peace-Festival den Sobieski-Platz in Wien-Alsergrund zu einem bunten kulturellen Friedensfest. 2025 fand es am Sonntag, 3. August, statt, zum vierten Mal.
Der Erfinder, Initiator und Organisator dieses Friedensfestes, Musical-Darsteller und Schöpfer einiger klassischer Märchen und anderer Geschichten als Kinder-Musik-Theater, Gernot Kranner, schilderte auf der kleinen Bühne auch wie es dazu kam. „Als der Überfall der russischen Armee auf das Nachbarland Ukraine am 24. Februar 2022 begann, bin ich mit diesem selbstgebastelten Friedensplakat in mehreren Sprachen – Deutsch, Englisch, Russische und Ukrainisch – vor die Botschaften von Russland, der Ukraine und der USA gewandert – niemand ist mitgekommen.“ Aus dem anfänglichen Frust, allein gelassen worden zu sein, entwickelte er die Idee eines ganztägigen Festen auf einem öffentlichen Platz mit Auftritten unterschiedlichster Künstler:innen und vor allem auch junger – noch nicht bekannter – Talente.
Er selbst spielte mit Hand-Puppen die weltberühmte Geschichte „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint Exupéry mit immer wieder eingestreuten eigenen Liedern in einer Art alter Fliegermontur.
Danach war die Bühne frei für junge Talente, vor allem musikalische. Carina Huber sang Musical-Songs.
Tamara Ebner (13) sang Mozarts „Gold von den Sternen“.
Kiara Placzek (17) begleitete ihren Gesang gleich selber am Klavier.
Die gar erst 12-jährige Amelie Ricca schlug ganz andere Töne an und gab wie eine jahrzehntelange Entertainerin bekannte Schlager zum Besten – mit Gängen in die Publikumsreihen und Animation zum Mitsingen.
Nevio Cermak (14) wusste bis kurz vor seinem Auftritt noch nicht, welche seiner Kompositionen er spielen würde. „Ich spiele dann, was mir gerade einfällt“ – und es war etwas Neues, somit einer Uraufführung. Später spielte er seine erste Komposition „Frieden für die Welt“.
Jaromir Rektenwald spielte Gitarre und sang eigene Songs – auf Deutsch.
Lucia Anima bracht ebenfalls eigene englischsprachige Songs mit, begleitete sich selber am Klavier.
Rebecca Richter und Jakob Pinter sangen Duette aber auch solistisch – Musical-Nummern.
Ganz anderes performte der junge Schauspieler Mathias Rauth. Er präsentierte Auszüge aus „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ von Christian Dietrich Grabbe.
Zwei Frauen der Bauchtanzgruppe Mahasin führten eben solche auf.
Und das war bei Weitem noch nicht alles, aber alles, was Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… in mehreren Stunden erlebte, insgesamt traten gut vier Dutzend Künstlerinnen und Künstler auf.
Nein, nicht ganz: Zwei sehr junge Besucherinnen, Rebecca und Maja wollten auch einmal auf die Bühne – und so überließ Gernot Kranner, der auch durch den Tag führte, den beiden Mädchen kurz auch das Mikrophon.
Rund um den Platz gab’s noch Verkaufsstände – von ungesüßtem Kakao samt Wissen über die Wirkungen dieser Bohne über Marmeladen bist zu einem Buch, das die Autorin und Illustratorin selber anpries. Außerdem tauchten zwei Radler:innen mit Friedenszeichen und -taube als neonfärbige Wimpel an langen Stangen auf.
Und ein Solo-Friedenskämpfer mit schwarzen Luftballons mit aufgedruckten weißen Tauben: Der 87-jährige Werner Oskar Jilge, gelernter Schuhmacher, später in der Werbung tätig, dann Auftritte bei Theaterproduktionen und dem Opernball, und nun vor allem Friedensaktivist.

Obwohl schon vor zwei Jahren vom Parlament einstimmig beschlossen, seit dem Vorjahr dann offiziell als Gedenktag durch die damalige Bundesregierung eingeführt, bleibt das wirkliche Gedenken am 2. August an die Nacht vom 2. auf den 3. August 1944, in der im Vernichtunslager Auschwitz mehr als 4000 Rom:nja und Sinti:zze ermordet wurden, zivilgesellschaftlichen Organisationen der Volksgruppe der überlassen.
Wie im Vorjahr legten für das offizielle Österreich – heuer einen Tag vor dem Gedenktag – Vertreter des österreichischen Parlaments – gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Volksgruppenbeirates und seinem Stellvertreter Kränze in der Krypta im äußeren Burgtor nieder.
Und so gedachten wieder, auf Initiative von HÖR (Hochschüler*innenschaft) Österreichischer Roma und Romnja und Romano Centro, in Reden und musikalischen Beiträgen sowie mit vielen Sonnenblumen und Kerzen der Ermordeten am Ceija-Stojka-Platz in Wien-Neubau vor der Kirche Altlerchenfeld. Die 2013 verstorbene Frau, die drei Konzentrationslager mit Müh und Not überlebt hatte, war die erste die das Schweigen über die Verbrechen an ihrer Volksgruppe in Bildern, Gedichten, Erlebnisberichten brach. Und gut zwei Jahrzehnte lang in Schulen ging und fuhr, um als Zeitzeugin darüber aufzuklären bzw. viele Workshops auch vor allem im siebenten Bezirk, im Amerlinghaus abhielt.
Aber auch im elften Jahr dieser Veranstaltung – das Europäische Parlament hatte schon bzw. erst 2015 den 2. August zum Gedenktag erklärt – ging es nicht „nur“ um historisches Erinnern daran, dass rund eine halbe Million Angehöriger dieser Volksgruppen im Porajmos (Pendant zur Shoah an Jüd:innen) vernichtet wurden. Der schon jahrhundertelang davor vorhanden und auch nach dem Faschismus nachwirkende Rassismus ist Thema der Reden vor allem junger Aktivist:innen. Und so stellten der aktuelle Präsident Santino Stojka, Urenkel von Ceija, und die Vizepräsidentin Pia Thomasberger auch den Zusammenhang mit anderen diskriminierten Gruppen her – sowie die Solidarität mit den Antifaschist:innen, die in der für die slowenische Volksgruppe bedeutendsten Gedenkstätte, dem Peršmanhof in Železna Kapla / Bad Eisenkappel (Kärnten / Koroška), erst Tage davor von Polizeieinheiten überfallen wurden.
Nuna Stojka, Schweigertochter von Ceija, die sie 22 Jahre bei ihren Schulbesuchen begleitet hatte, las aus einem der Bücher der Pionierin der Aufklärungsarbeit, „Wir leben im Verborgenen“ über die grauenvollen Lebensumstände im KZ. Sie schloss ihre Rede – traditionell mit dem Spruch „Amentsa khetane, sam zurale!“ – Wir gemeinsam, nur gemeinsam sind wir stark!“
Sladjana Mirković, erste Präsidentin der HÖR, drückte nicht nur ihre Trauer angesichts des Gedenkens aus, sondern auch ihre Enttäuschung und Wut – darüber, dass es das Jahr für Jahr von Politiker:innen versprochene zentrale Mahn- bzw. Denkmal an den Porajmos und die rund 90 Prozent österreichischer Angehöriger der Volksgruppe, die ermordet wurden, NOCH IMMER NICHT gibt. Enttäuscht ist sie auch „darüber, dass Österreich seine antiziganistische und rassistische Tradition selbstbewusst weiterlebt und eine der meistverfolgten Minderheiten Europas künstlich spaltet und gegeneinander ausspielt, indem es uns in autochthon und allochthon, in inländisch und ausländisch teilt.“
Die vielen Sonnenblumen bei der alljährlichen Gedenkveranstaltung basieren übrigens auf dem in einem Gedicht ausgedrückten Gedanken Ceija Stojkas:
die sonnenblume ist die blume des rom.
sie gibt nahrung, sie ist leben.
und die frauen schmücken sich mit ihr.
sie hat die farbe der sonne.
als kinder haben wir im frühling ihre zarten,
gelben blätter gegessen und im herbst ihre kerne.
sie war wichtig für den rom.
wichtiger als die rose,
weil die rose uns zum weinen bringt.
aber die sonnenblume bringt uns zum lachen.
Ceija Stojka (1933 – 2013), veröffentlicht in „Die Morgendämmerung der Worte. Moderner Poesie-Atlas der Roma und Sinti. (Die Andere Bibliothek)
Musikalisch gab es in diesem Jahr eine beeindruckende Erweiterung. Neben traditionellen Roma-Liedern der Gruppe Amentsa Ketane, trat das Coriolanus Ensemble, ein Kammerorchester, mit Kompositionen von Adrian C. Gaspar auf. Der dies auch als praktisches Gegenbeispiel zum gängigen Klischeebild verstehen will.
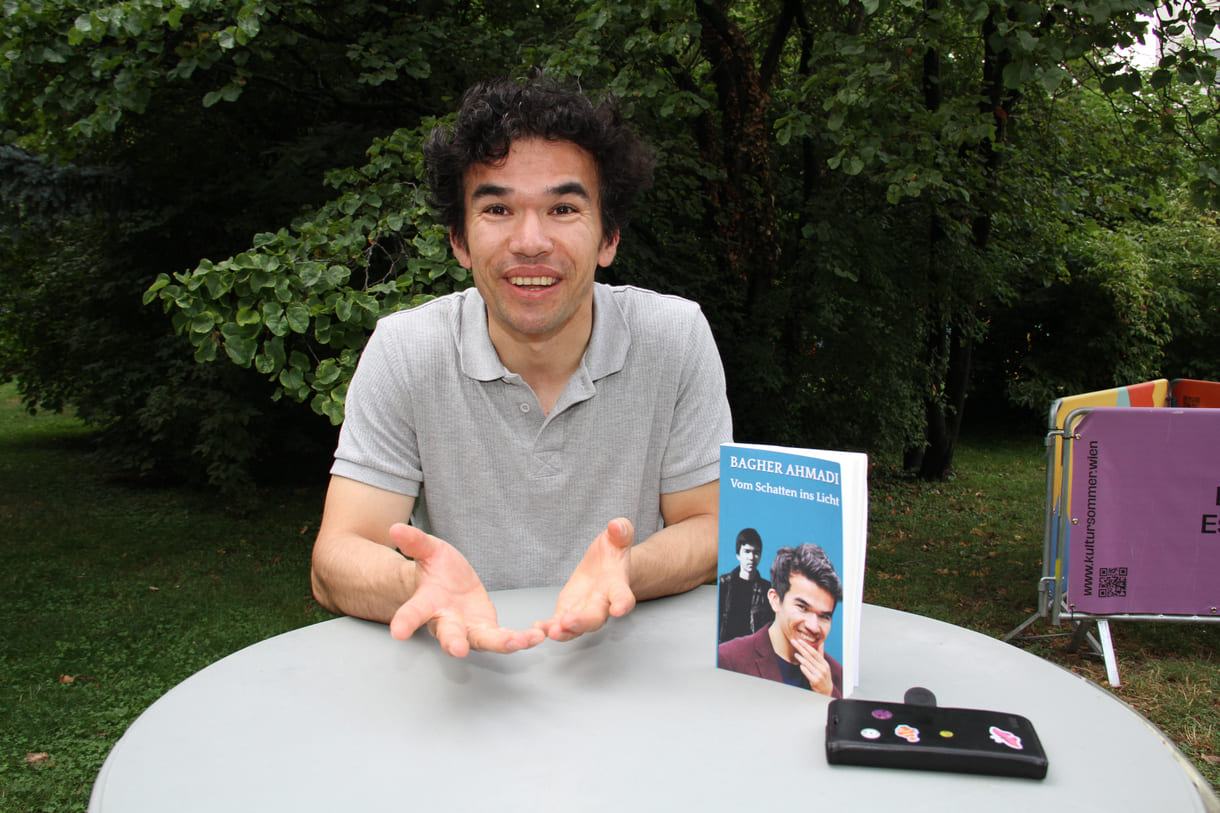
KiJuKU: Zuerst einmal, danke, modhsa kheram, khili mamnoon, sepaz, mersi für dein Buch und das Hörbuch.
Bagher Ahmadi: Ja, gerne, khoish mi khonam
KiJuKU: Einen Teil deiner Lebensgeschichte kannte ich schon aus Erzählungen und aus früheren schriftlichen Versionen, in die ich hin und wieder reingelesen habe, aber die jetzige Version ist sehr dicht und flüssig zu lesen geworden. Wann hast du begonnen, deine Geschichte aufzuschreiben?Bagher Ahmadi: Ich hatte das schon ein Jahrzehnt lang vor, habe immer wieder Notizen gemacht – am Handy. Aber so richtig hingesetzt, um zu schreiben, hab ich 2020 bei Corona, als wir alle im Lockdown waren.
KiJuKU: Weil du da viel Zeit hattest und nirgends – weder in Theatern noch für Filme spielen konntest?
Bagher Ahmadi: Klar, ich hab dann rechts schnell so circa 20 Seiten geschrieben, hauptsächlich über die Kindheit in Afghanistan. Dann hab ich irgendwie nicht weitergemacht, ich war nicht sicher über die Struktur des Buchs. Ich hatte ja zunächst einfach drauflos geschrieben.
Beim Tippen war ich zu langsam, in Gedanken war ich viel schneller. Dann hab ich mir gedacht, ich warte, ich möchte zuerst mehr über Schreiben auch von Drehbüchern lernen. Und ich hab begonnen Tippen zu üben.
Erst zwei Jahre später – da hatte ich schon viele Bücher gelesen, um mehr übers Erzählen von Geschichten zu erfahren, bevor ich schreibe – hab ich richtig viel geschrieben. Innerhalb von wenigen Wochen hab ich 45.000 Wörter geschrieben. Aber ich bin am Schluss ein wenig depressiv geworden.
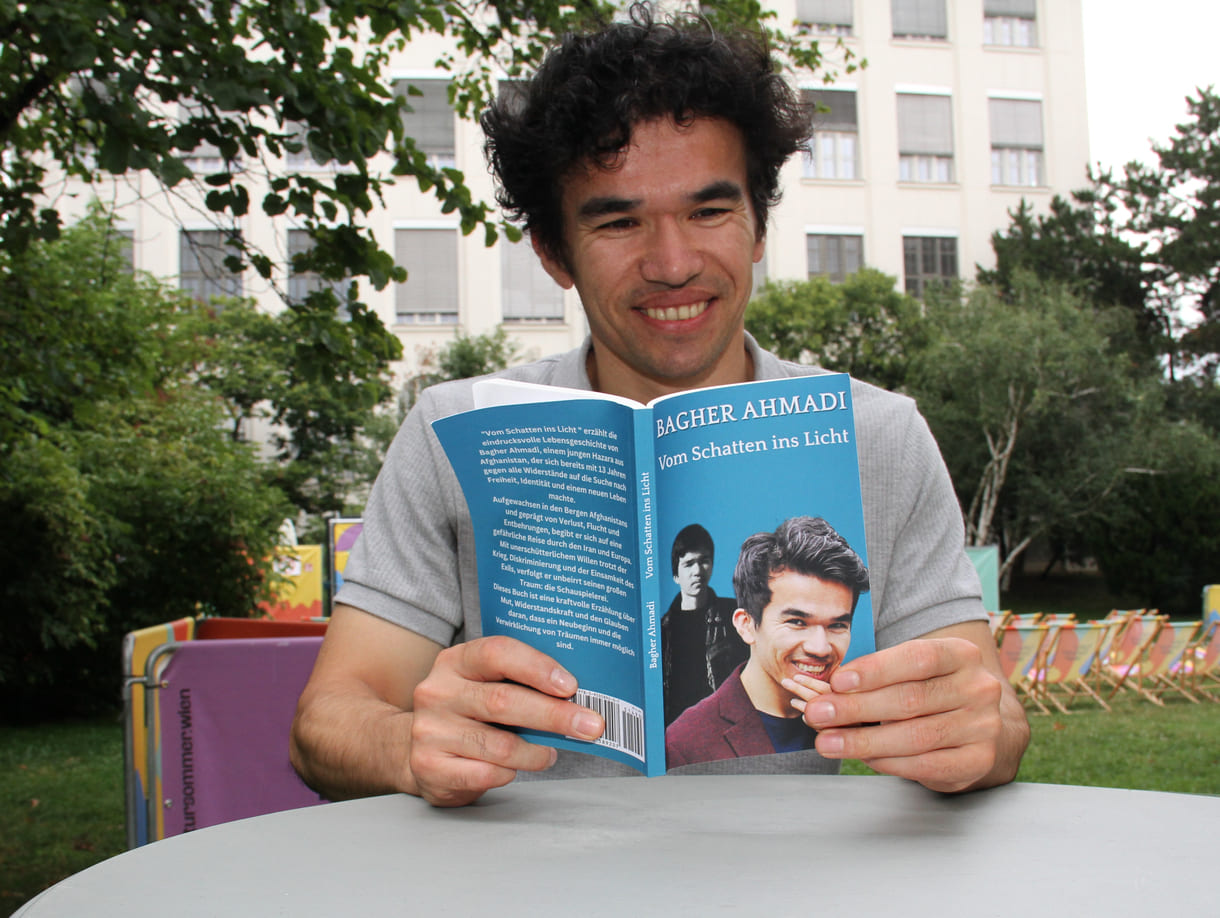
KiJuKU: Wegen deiner eigenen Geschichte, wo du dich in deiner Familie gar nicht wohlfühlen konntest? Und obwohl du genau das erreicht hast, was du wolltest – Schauspieler werden.
Bagher Ahmadi: Ja, genau, ich weiß nicht mehr, warum das so war. Ich hab dann erst später wieder am Text gearbeitet und ihn an ein paar Leute geschickt und um Feedback gebeten. Und wieder zwei Jahre später, 2024 also letztes Jahr, hab ich dann wieder daran geschrieben. Diess Mal hab ich es ernst genommen, in der Hoffnung, dass ein Verlag das veröffentlicht. Es waren schon Verlage interessiert, haben aber gemeint, sie glauben nicht, dass sich das gut verkaufen lässt. Da hab ich mir dann gedacht, das ist mir egal, dann geb ich das selber heraus. Davor hab ich es noch einmal überarbeitet und verfeinert.
KiJuKU: Hast du immer auf Deutsch geschrieben, oder fallweise auch auf Englisch oder Dari/Farsi?Bagher Ahmadi: Als ich mich hingesetzt hatte, hauptsächlich auf Deutsch, aber Notizen hatte ich auf Deutsch und Englisch und teilweise auch auf Farsi. Das aber nur mit Stift auf Papier, am Handy kann ich nur in lateinischen Buchstaben schreiben.
KiJuKU: Hattest du von all deinen Stationen die Erinnerungen noch so präsent, die Notizen haben ausgereicht?
Bagher Ahmadi: Ich war so erstaunt, schon bei den ersten 20 Seiten, wie detailliert ich mich an die einzelnen Stationen erinnern konnte. Ich hatte befürchtet, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern könnte, ich vergesse zum Beispiel schnell Namen. Aber als ich begonnen habe zu schreiben, konnte ich mich so detailliert an alles erinnern.
Ich hab extra fürs Schreiben von dem Buch das Zehnfinger-System gelernt, damit die Gedanken schneller getippt werden können. Trotzdem war ich im Kopf immer viel schneller als beim Schreiben.
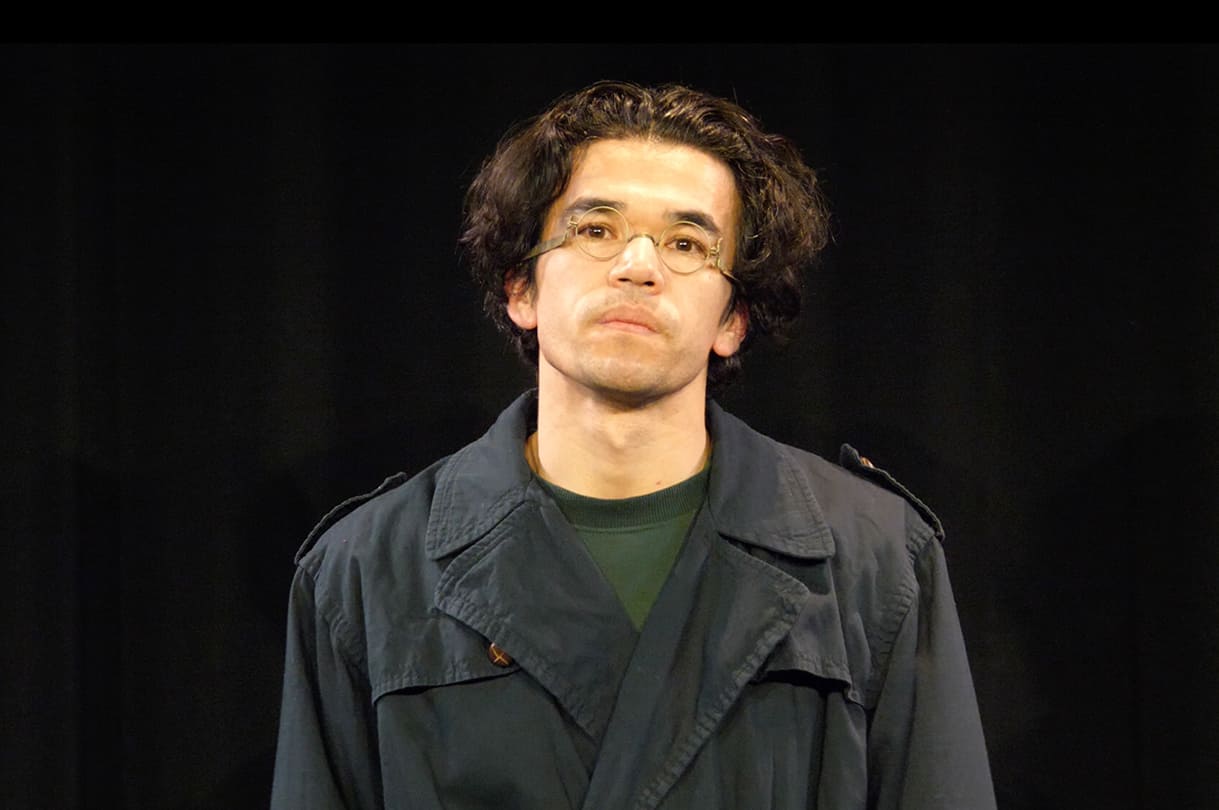
KiJuKU: Hast du einmal probiert, den Text zu sprechen, mittlerweile funktioniert die Übersetzung ins Geschriebene mit Diktierfunktionen halbwegs brauchbar?
Bagher Ahmadi: Nein, beim Schreiben kann ich doch besser die Gedanken ordnen. Es ist mir auch oft lieber, eine eMail zu schreiben als etwas zu sagen, weil ich beim Reden mitunter auf Sachen vergesse sie zu erwähnen. Obwohl ich Schauspieler bin, kann ich mich schriftlich oft besser ausdrücken.
KiJuKU: Du beschreibst im Buch ja auch einige peinliche Situationen, hast du überlegt, die wegzulassen?
Bagher Ahmadi: Ja, einerseits gab es schon die Überlegung, manches wegzulassen, aber irgendwie dachte ich, diese Begebenheiten erzählen auch etwas über mich und die Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Und es wird damit ja noch authentischer und realistischer.
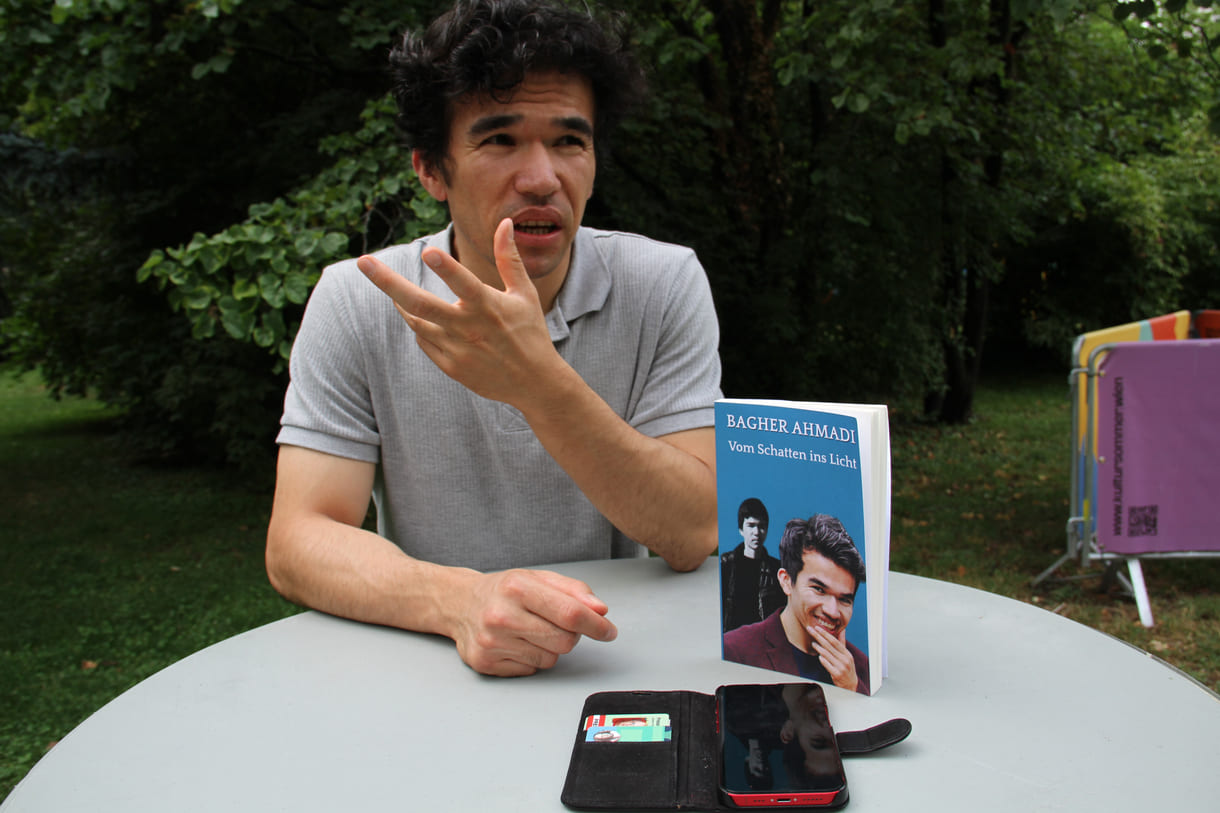
KiJuKU: Gibt es aber andere Geschichten, die du tatsächlich weggelassen hast?
Bagher Ahmadi: Ja, für den besseren Lesefluss hab ich schon einiges wieder weggestrichen.
KiJuKU: Hast du noch Kontakt zu deiner Familie in Afghanistan oder zu den Arbeitskollegen in der Glasfabrik oder der Schneiderei im Iran?
Bagher Ahmadi: Zu den Arbeitskollegen kaum, Kontakt zur Familie hab ich erst später aufgenommen. Es ist eine komische Beziehung, ich denke oft an sie, aber ich vermisse sie nicht, ich bin ja weggegangen, weil es nicht so schön war.
Erst beim Schreiben sind mir auch wieder viele Situationen eingefallen, wie arg vor allem die Stiefmutter zu mir war.

KiJuKU: Hast du vor, das Buch, das du ja auch schon auf Englisch übersetzt und veröffentlicht hast, auch auf Dari/Farsi zu übersetzen und es deiner Familie zu schicken?
Bagher Ahmadi: Nein, ich hab kurz gedacht, meinem Vater das Buch auf Deutsch zu schicken, weil er es nicht lesen kann.
Eines der 100 Bücher, die ich gelesen habe, bevor ich zu schreiben begonnen habe, war „Die Elenden“ von Victor Hugo (1862). Da kommt eine Frauenfigur, Fantine, vor, die wie ein Stück Sch… behandelt hat, das hat mich sehr daran erinnert, wie meine Stiefmutter mich behandelt hat.
Beim Schreiben ist das alles wieder sehr lebendig geworden, das war teilweise wie eine Tortur, wenn man schwer verletzt auf eigene Wunden drückt. Aber es war teilweise auch wieder gut, weil ich vieler dieser Sachen be- und verarbeiten konnte.
KiJuKU: Klingt fast wie eine Therapie, oder?
Bagher Ahmadi: Ja, genau. Am Anfang hat’s wehgetan, aber dann war’s gut. Manches Mal, wenn wir telefonieren, fragt mich mein Vater, warum ich weggegangen bin und ich denk mir, warum kommst du selber nicht drauf.
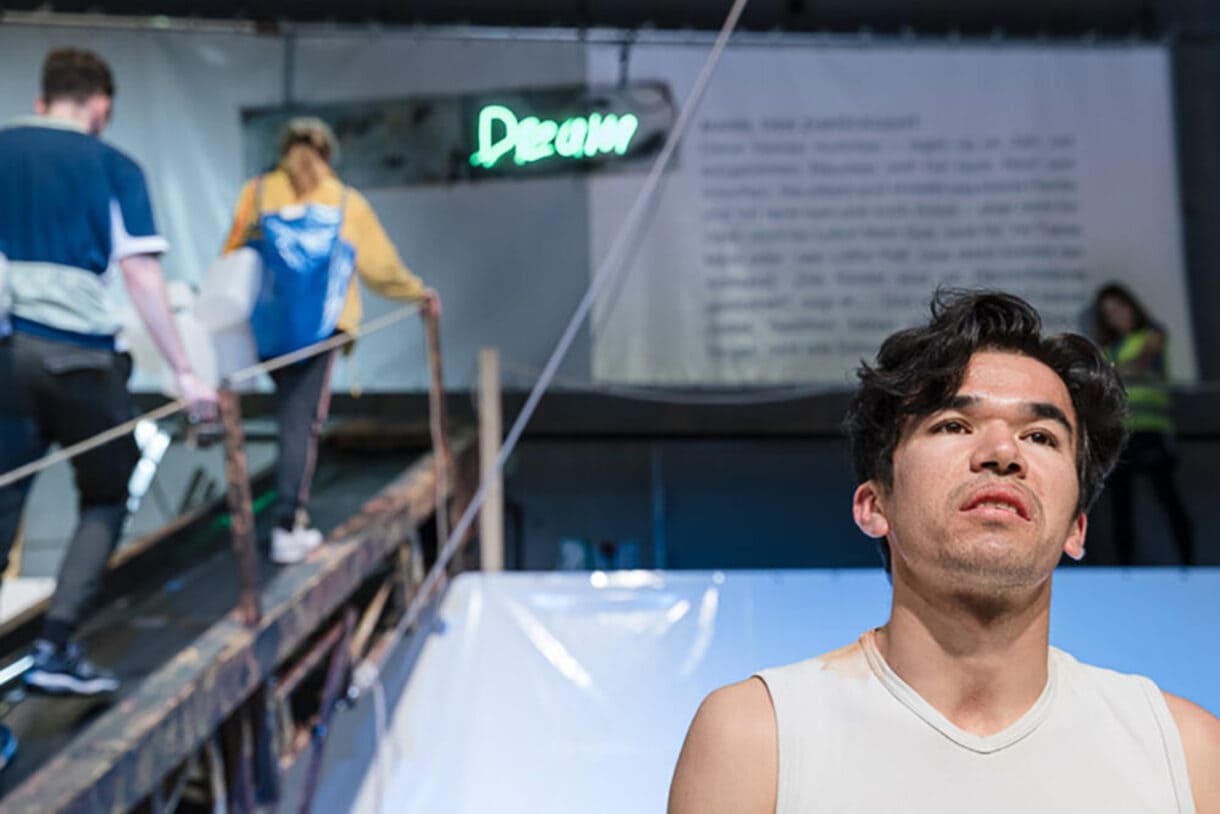
KiJuKU: Im Buch schreibst du, dass der erste Job nachdem du die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hast, ein Dreh in Italien war, wo hattest du noch in anderen Ländern Engagements?
Bagher Ahmadi: Nicht der erste, aber der erste im Ausland. Ja, als Stunt-Double in Spanien für eine Netflix-Serie und immer wieder auch in Deutschland.
KiJuKU: Mit „Draußen vor der Tür“ warst du ja nach dem Akzent-Studio auch in einer Schule, jetzt hier beim Kultursommer, warst du sonst noch wo mit diesem Solostück?
Bagher Ahmadi: Ja, in Litschau in einer Schule, dann noch in der Brunnenpassage und am 14. November spiele ich noch im Gymnasium Dachsberg in Oberösterreich.

KiJuKU: Das ist ja deine ehemalige Schule!
Bagher Ahmadi: Und wo ich auch zum ersten Mal auf der Bühne war. Das wird irgendwie krass, der Direktor freut sich auch schon sehr, obwohl er schon in Pension ist, organisiert er das.
Das wird was ganz Besonderes auch für mich, ich spiel am Vormittag in der Schule und am Abend eine öffentliche Veranstaltung.
KiJuKU: Dein Buch, deine Geschichte liest sich echt filmreif, hast du auch an einen Film gedacht?Bagher Ahmadi: Ich hab das Buch an eine Filmproduzentin geschickt, die hat auch gefragt, ob ich daran interessiert wäre. Ja, voll hab ich ihr gesagt. Wir treffen uns übernächste Woche. Da hat sie das Buch dann hoffentlich schon gelesen. Sie hatte auch die Idee, dass ich den Hauptdarsteller spiele, aber in vielen Stationen war ich ja noch Kind oder Jugendlicher, mittlerweile bin ich ja schon fast 30.
KiJuKU: Dankeschön, thank’s, modsha kheram, khili mamnoon, sepaz, mersi, tasakkor.
Bagher Ahmadi: Ja auch vielen Dank, khoish mi khonam.
Bagher Ahmadi beim mehrsprachigen Redebewerb „Sag’s Multi!“ <- noch im KiKu

„Alerta, alerta antifascista!“ hallte Donnerstag am frühen Abend oft durch die Wiener Herrengasse. Vor und rund um den dort gelegenen Amtssitz des Innenministeriums gab es kaum ein Durchkommen. Hunderte Menschen aller Altersgruppen hatten sich zum Protest gegen den unfassbaren Polizei-Einsatz am Sonntag gegen ein antifaschistisches Bildungscamp beim Peršmanhof im zweisprachigen Gebiet von Kärnten / Koroška versammelt. Die kurzfristig auf die Beine gestellte Demonstration war vor allem von auf Kartons handgeschriebenen Losungen gekennzeichnet.
Auf einem wurde dabei auf die unsägliche historische Parallele hingewiesen. Der Peršmanhof wurde ja deswegen zu einer Gedenkstätte und einem Museum, weil – noch in den letzten Tages des zweiten Weltkriegs eine Nazi-Polizei-Einheit dort elf Zivilist:innen, darunter sieben Kinder ermordete. Und im 80. Jahr nach Kriegsende, dem 70. Jahr mit dem Staatsvertrag, riss dieser überfallsartige Polizei-Einsatz tiefe Wunden bei Nachkommen der Ermordeten auf.
Zudem ist gerade dem Widerstand der Kärntner slowenischen Partisan:innen ein Gutteil des Verdienstes um den Staatsvertrag zu verdanken. In der sogenannten Moskauer Deklaration (1943 – USA, Großbritannien und Sowjetunion) hieß es zum einen, dass Österreich „von deutscher Herrschaft befreit werden soll“. Andererseits: „Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann, und dass anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedachtnahme darauf, wieviel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen haben wird, unvermeidlich sein wird.“
Kleinere gedruckte Plakate von SOS Balkanroute verkündeten „Wir alle sind der Peršmanhof“ bzw. in slowenischer Sprache: Vsi * Vse smo Peršmanhof“. Im Gegensatz zur Polizeieinheit, die das Camp stürmte, als würde es sich um Terrorist:innen handeln, die – auch in Video- und TV-Beiträgen deutlich artikulierten, dass sie nicht Slowenisch könnten, wurden praktisch alle Reden bei der Kundgebung entweder gleich zweisprachig gehalten oder in die jeweils andere der beiden nach dem Staatsvertrag gleichberechtigten Sprachen übersetzt. Die eben erwähnten Losungen dokumentierten auf den Punkt gebracht, dass dies keine lokale oder regionale Angelegenheit ist, wenn Antifaschismus, eines der „angeblichen“ Fundamente der zeiten Republik gestürmt wird – noch dazu auf dem Gelände einer Gedenkstätte, die mahnen soll, dass Faschismus „nie wieder!“ an die Macht kommen dürfe.
Von jungen Gedenkdiener:innen über einen Chor der slowenischen Studierenden bis zu einem älteren Vertreter des KZ-Verbandes Wien ergriffen das Wort. Aber auch eine russisch Aktivistin, die wegen ihrer Kriegsgegnerschaft flüchten musste trat ans Mikrophon und brachte mit Englisch eine vierte Sprache (Deutsch, Slowenisch, italienische Parolen, die im antifaschistischen Kampf gegen die Mussolini-Diktatur vor 100 Jahren) ins Spiel. Die Polizeiaktion habe gerade dann stattgefunden, als sie – und eine Kollegin aus der Ukraine und eine weitere aus Belarus ihren Beitrag den Camp-Teilnehmer:innen vorstellen wollte. Sie konnte es überhaupt nicht packen, dass ein Vorgehen von Uniformierten im demokratischen Österreich sie so bitter erinnerte an Umstände in ihrer ersten Heimat, vor denen sie davon ennen musste.
In einem Plakat und mehrfach in Reden wurde auch Bezug genommen auf das Interview des stellvertretenden Kärntner Polizeikommandanten in der ZiB2 vom Vorabend. Persönliche Entschuldigung bei einem Nachfahren, aber alles ganz richtig gemacht und normaler Einsatz…
Mehrfach ertönten auch Sprech-Chöre „Hoch die Partisan:innen“ und gegen Ende der Kundgebung vor dem Sitz des für die Polizei zuständigen Innenministeriums wurde das der Partisanin Jelka gewidmete Lied der Gruppe „Schmetterlinge“ aus der „Proletenpassion“ (Texte: Heinz R. Unger). „Drei rote Pfiffe“ von vielen Teilnehmer:innen gesungen.
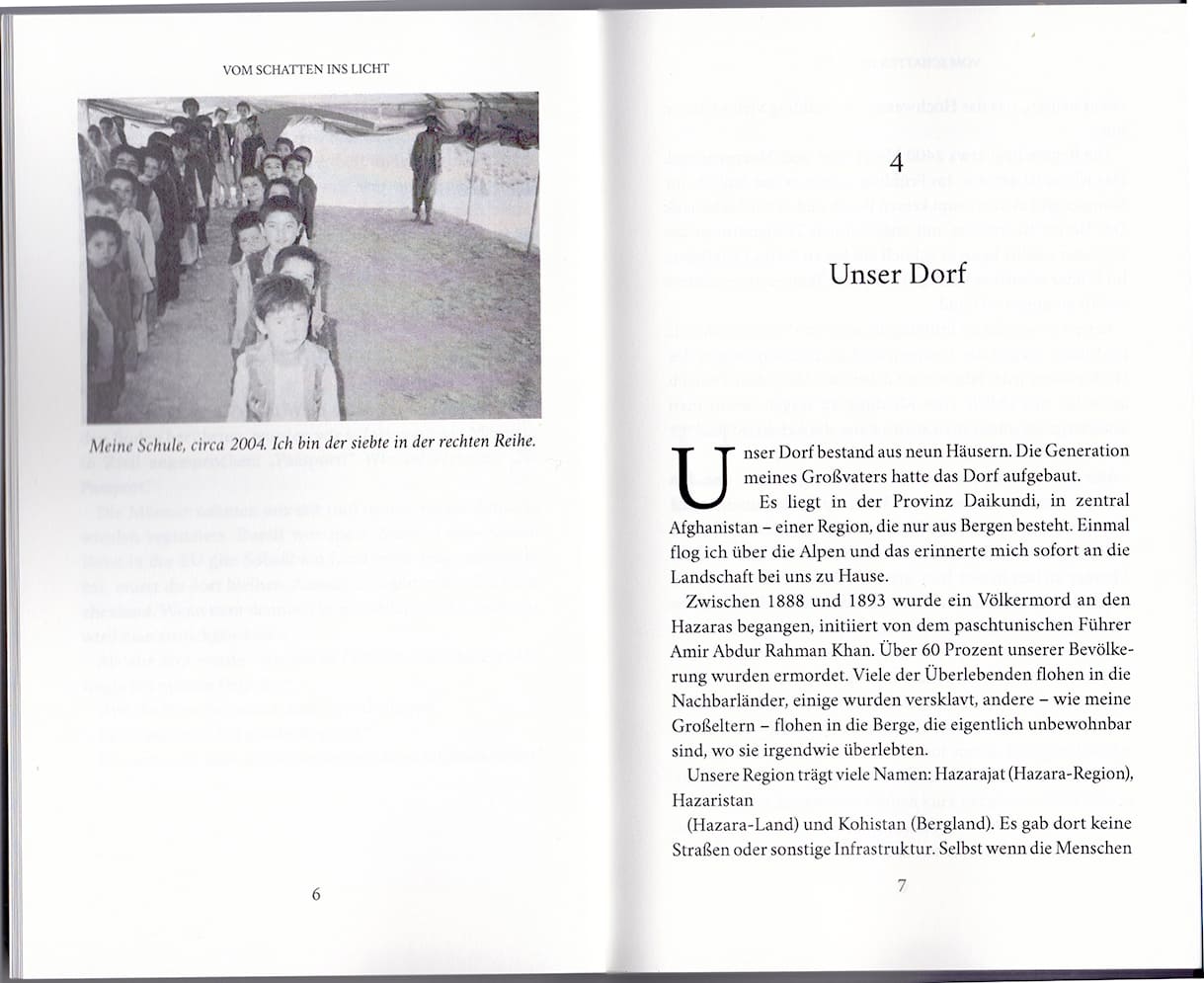
Filmreife, abenteuerliche 145 Seiten bzw. 2 ¾ Stunden als Hörbuch erwarten dich in „Vom Schatten ins Licht“. Und: Alles nicht ausgedacht, erfunden, sondern echt und real erlebt. Vom Autor selbst, einem jungen Schauspieler – auf Theaterbühnen und in Filmen.
Bagher Ahmadi ist Schauspieler. Jüngst spielte er seine Solo-Version des Bühnenklassikers „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert mit Switchen in alle Rollen beim Kultursommer Wien im Währinger Park. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat von der Premiere Ende Februar im Theater Akzent / Studio berichtet und auch von seinen Rollen in John Steinbecks „Früchte des Zorns“ im Werk X, als „Kleines Gespenst“ im Landestheater Niederösterreich usw. – Links unten am Ende dieses Beitrages.
Seine Liebe gehört aber mehr dem Film – er spielte schon in einer Tatort-Folge und anderen TV-Serien, aber auch schon in Italien und Spanien – unter anderem als Stunt-Double. Denn Bagher Ahmadi hat neben der Schauspiel-Ausbildung an der Wiener MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) auch eine Stunt-Ausbildung absolviert.
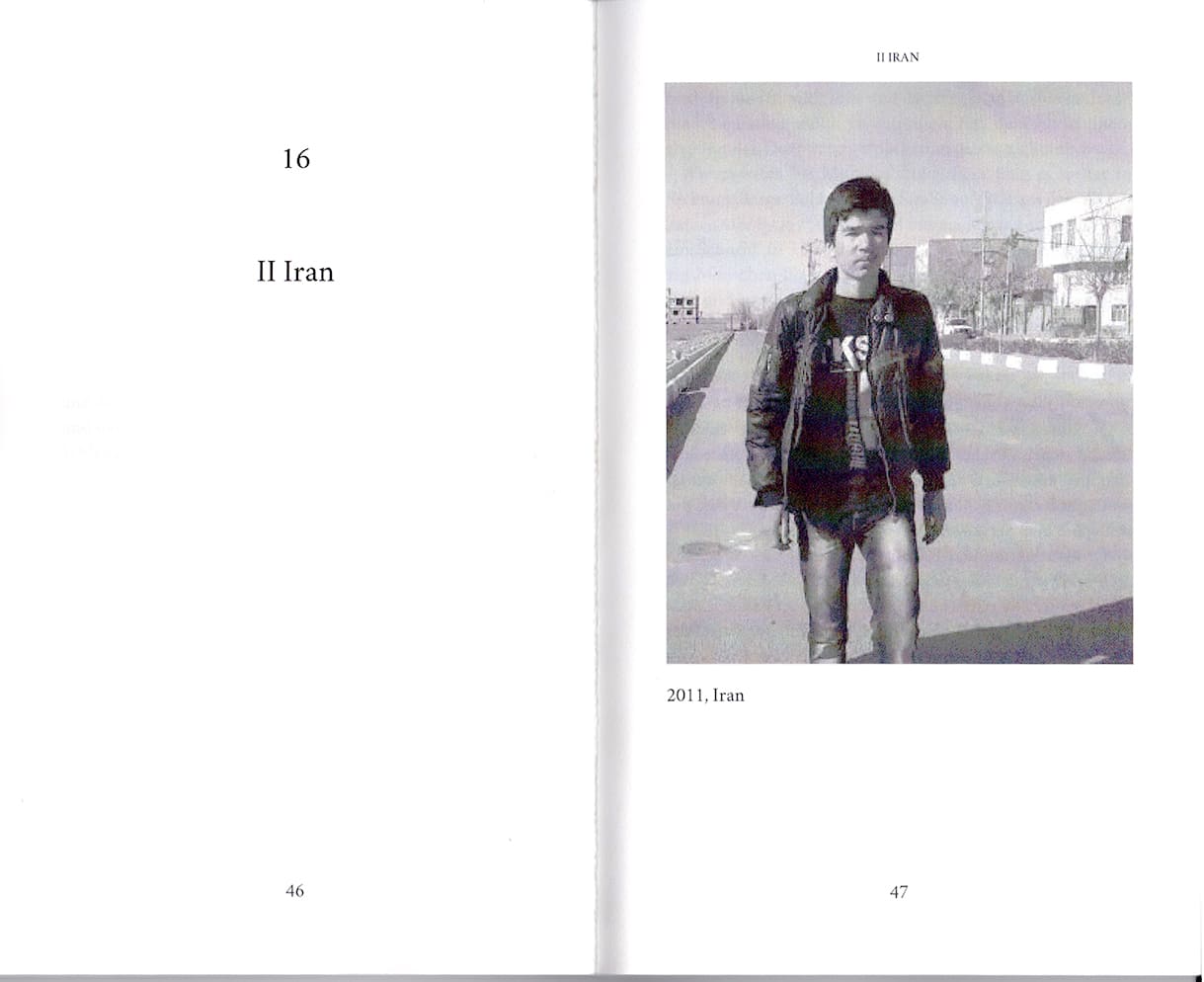
„Ich war circa neun Jahre alt, als ich zum ersten Mal einen Film bei unseren Nachbarn sah. Selber hatten wir keinen Fernseher. Meine Stiefmutter verbot mir, Filme zu sehen, aber manchmal schlich ich mich trotzdem heimlich aus dem Haus, um bei den Nachbarn Filme zu schauen. Meistens waren es Bollywood-Filme. Besonders die Hauptdarsteller faszinierten mich. So etwas wollte ich unbedingt machen. Aber ich hatte keinen Plan, wie und wo.
Ich dachte auch lange nicht mehr daran, bis ich im Iran war.
Durch meine Begeisterung für BruceLee wurde das Ganze für mich greifbarer und konkreter. Ich wollte, so wie er, Kampfsport machen und in Actionfilmen spielen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer und stärker wurde mein Wunsch“, schreibt Ahmadi in Kapitle 22 von 45; das 46. Kapitel ist Danksagungen an Menschen gewidmet, die ihm auf seinem Weg geholfen haben.
„Auf Englisch würde ich sagen: I was born in Afghanistan, but I was made in Austria.“ – Geboren in Afghanistan zu dem geworden, was er ist und auch schon früh – noch in seiner ersten Heimat werden wollte, wurde er in Österreich. Apropos Englisch – er selbst hat sein Buch, das er auf Deutsch geschrieben hat, auch auf Englisch übersetzt – und so ist es ebenfalls im Eigenverlag veröffentlicht via Amazone erhältlich.
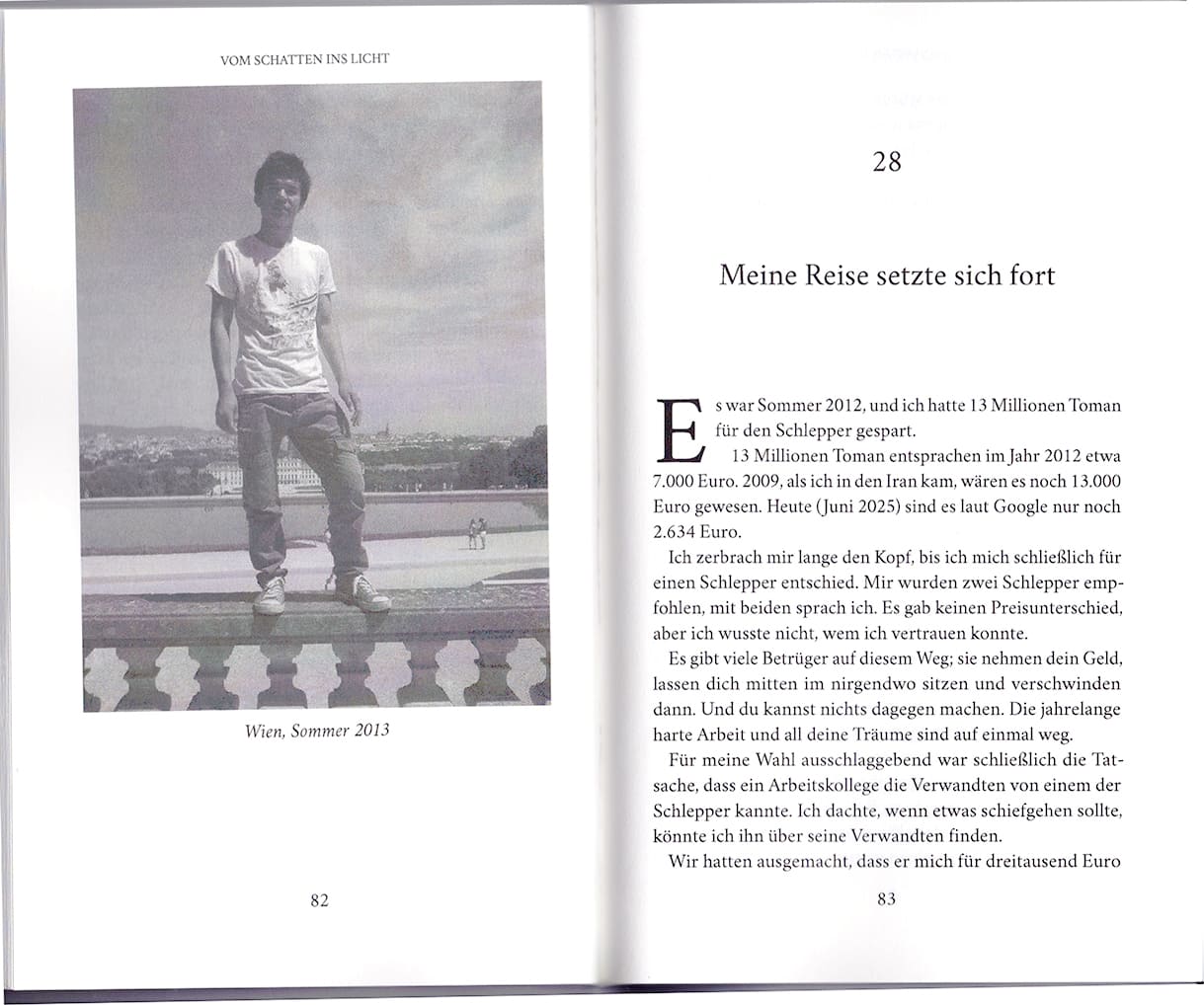
„Die ersten 13 Jahre meines Lebens fühlten sich an wie ein dunkles Loch. Ich lebte wie ein Roboter, ein Sklave, der die Befehle meiner Stiefmutter und meines Vaters ausführte“, schreibt der Autor schon im zweiten Absatz des Vorworts und begründet damit auch den Buchtitel als passend. Um dann hoffnungsfroh fortzufahren: „An dem Tag, an dem ich entschied, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wurde ich wiedergeboren. Ich erkannte, dass ich mich bewegen und neu anfangen konnte. Eine Tür öffnete sich, und dahinter leuchteten unzählige Sterne, denen ich bis heute folge.“
So einfach wie sich das auf der ersten Seite liest, war’s dann doch nicht. Flucht vom ersten Zuhause, das Ahmadi dann in mehreren Kapiteln ausführlich beschreibt, was und wie ihn weggetrieben hat. Dabei verwebt er die persönlichen Erfahrungen mit der Schilderung des Lebens in einem afghanischen Dorf, baut aber auch die Verfolgung seiner Volksgruppe – er ist Angehöriger der Hazara – sowie einiges aus der Geschichte ein.
Gefährliche Wege – zu Fuß und in klapprigen Bussen, Ungewissheiten mit Schleppern, die in anderen zeiten und an anderen Grenzen Fluchthelfer genannt wurden, Gewalterfahrungen auf der Flucht, denn Schlepper sind kein Reisebüro. Harte Arbeit als einer der vielen afghanischen Underdogs in rechtlosem, illegalem Zustand im Iran in einer Glasfabrik, in einer Schneiderei. Mühsame erste Schauspielerfahrungen im Iran.
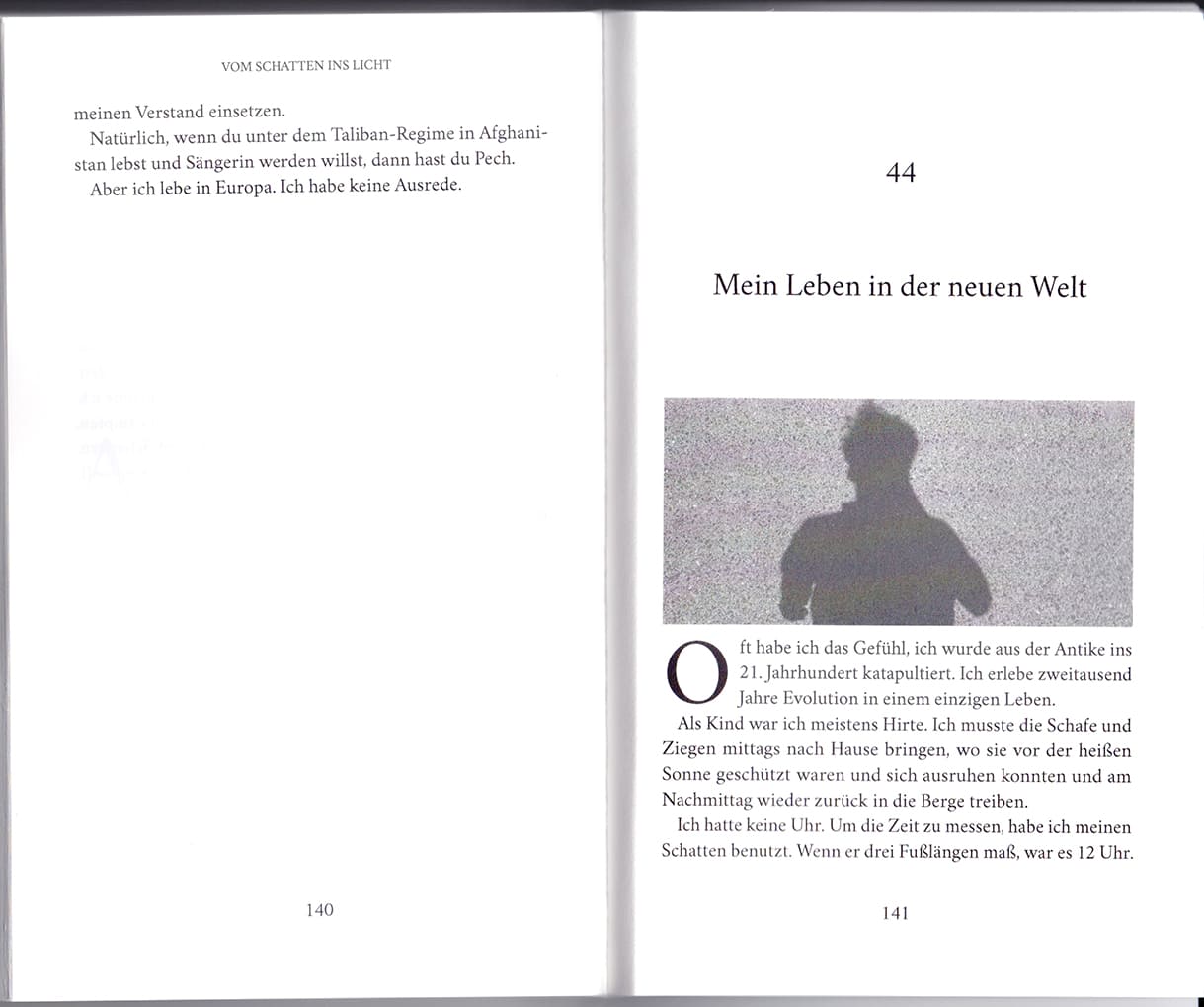
Möglichst sparsam leben, um Geld für die Weiter-Flucht in den Westen zusammenzukriegen, das er – mittlerweile 16 Jahre geworden – im Jahr 2012 in Angriff nahm: Türkei, Meer, Schlauchboot, das kippt und alle ins Wasser fallen… In letzter Minute gerettet.
Das darauffolgende Kapitel widmet der Autor sechs vorherigen Situationen seines jungen Lebens, in denen er jeweils fast gestorben wäre. Und das ist nicht fiktiv, sondern echt überlebt.
Irgendwann in Österreich gelandet, von dem er zuvor keinen Begriff hatte – und dann doch hierblieb, vom Großlager Traiskirchen in ein Flüchtlingsheim im oberösterreichischen Gallspach und intensives Deutsch-Lernen und schon 2016 erfolgreicher Teilnehmer des mehrsprachigen Redebewerbs „Sag’s Multi!“. Der Kinder-KURIER, Vorläufer von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zitierte ihn damals mit „Wer Zäune baut, sperrt sich letztlich selber ein!“
Und bald auch erste Schauspielerfahrungen in Österreich, die Ausbildung und … Ziel erreicht.

Insofern ist Bagher Ahmadis Buch – ideal ist die Kombination, Teile zu lesen und andere zu hören, immerhin hat er ja eine ausgebildete Schauspielstimme und die macht manches – dann nochmals lebendiger als der Text ohnehin schon ist – nicht nur die (Über-)Lebensgeschichte eines jungen Mannes, der eine abenteuerliche Flucht hinter sich hat. Sondern auch Mut machend für alle, die es viel weniger dramatisch haben, aber einen Traum haben und sich von dem auch nicht abbringen lassen (wollen).
Sein Buch ist übrigens die mindestens dritte Version, die er geschrieben hat, KiJuKU durfte in frühere schon reinlesen, die jetzige ist ein sehr gelungenes, rundes Werk – vielleicht ärgern sich Verlage, denen er das Buch angeboten hat und die es aus Angst, nicht genug davon zu verkaufen, nicht veröffentlichten.
Ibrahim-und-moses, Volkstheater in den Bezirken <- damals noch im Kinder-KURIER
Bagher Ahmadi beim mehrsprachigen Redebewerb Sag’s Multi! <- ebenfalls noch im KiKu

Überraschung Nummer 1 bei der am Dienstag im APA-Zentrum (Austria Presse Agentur) in Wien vorgestellten Umfrage der Bawag (ausgeführt von Demox Research) unter 1000 repräsentativ ausgewählten Menschen über 16 Jahre in ganz Österreich: Fast die Hälfte liebt von den Jahreszeiten den Sommer am meisten, aber nur fünf (in Ziffern 5!) von 100 oder im Rahmen der Studie also 50 Befragte, finden den Winter am besten. Vielleicht liegt’s auch daran, dass ohnehin Schnee oft eine Mangelerscheinung ist – zu Gründen wurde nicht gefragt.
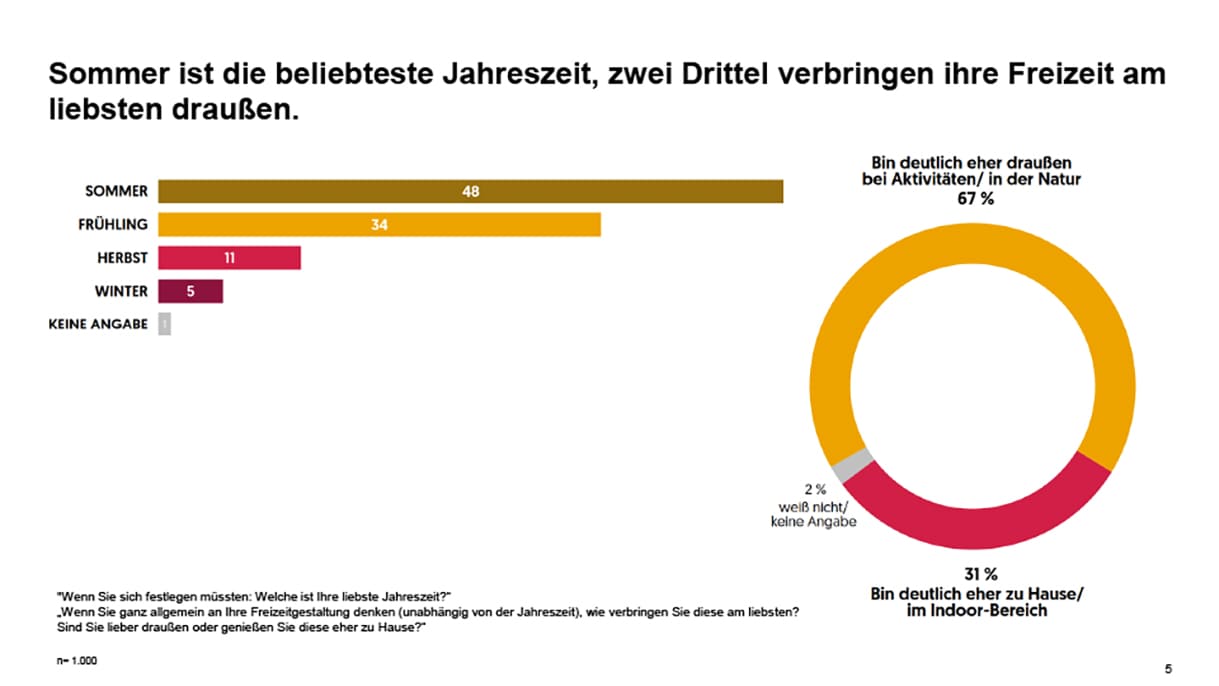
UND: Sogar knapp mehr als zwei Drittel verbringen ihre Freizeit mit Aktivitäten lieber draußen in der Natur – so die Antwort auf die Frage: „Wenn Sie ganz allgemein an Ihre Freizeitgestaltung denken (unabhängig von der Jahreszeit), wie verbringen Sie diese am liebsten? Sind Sie lieber draußen oder genießen Sie diese eher zu Hause?“

Von den Aktivitäten lieben – da natürlich Mehrfach-Nennungen möglich – mehr als 40 Prozent Schwimmen, knapp gefolgt von Wandern bzw. Trekking, weit abgeschlagen Ski fahren und Snow Boarden (19 %), dann aber schon Fitness-Studio (16) und das noch vor Fußball spielen (13 %) und das wiederum überraschend gleichauf mit Tanzen…

Das veranlasste KiJuKU zur skeptischen Frage, ob da nicht vielleicht so manches an sozial erwünschten Antworten dabei wäre, was gekontert wurde damit, dass „Die Fragestellungen ja sehr offen waren“, wie der für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständige führende Bawag-Funktionär Werner Rodax (Head of DACH Enterprise Sales der Bawag) meinte.
Dass Kinder, die wohl so manches anders gewichtet hätten, nicht befragt worden sind, sei am Design der Umfrage gelegen, wurde auf die entsprechende Frage geantwortet.
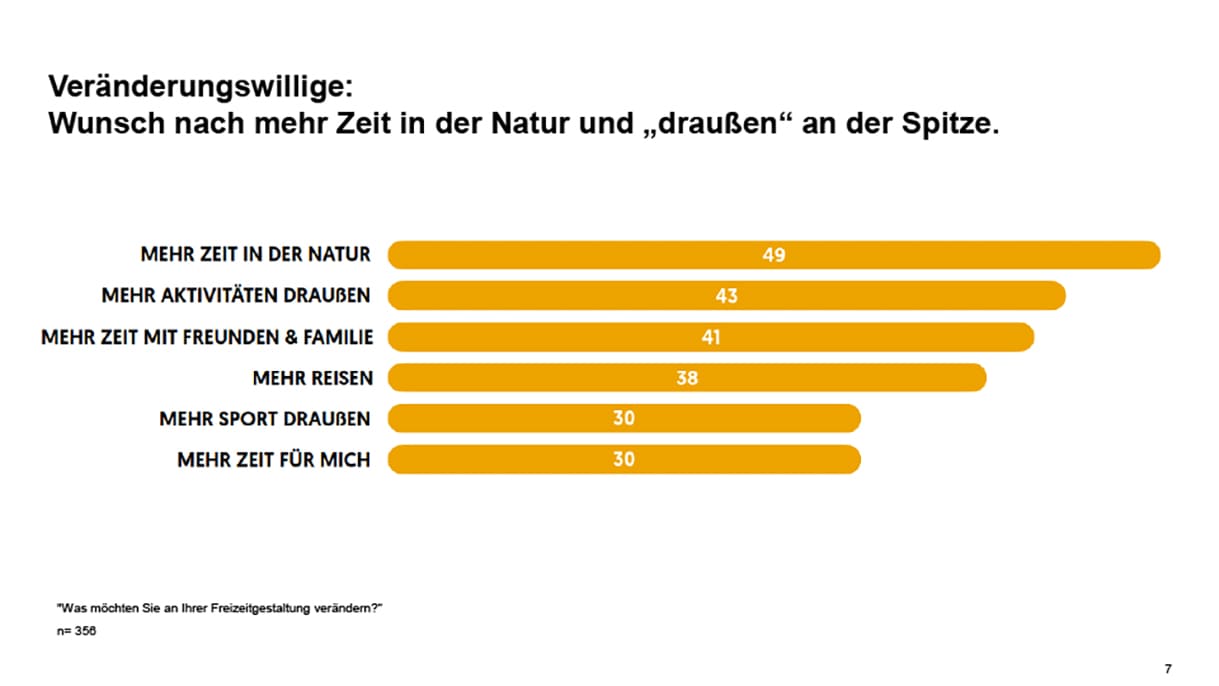
Mit dem eigenen Freizeitverhalten zeigten sich in der Umfrage 32 % sehr und weitere 53 Prozent zufrieden, bei den Älteren (60+) sogar fast neun von zehn (88 %), ein Drittel insgesamt möchte jedoch „an meiner Freizeitgestaltung eher etwas verändern“. Auf die Nachfrage von Demox Research – zwischen 15. Und 20. Mai 2025 – gab fast die Hälfte (49%) der damit 356 Befragten (jene, die etwas verändern wollen) an „mehr Zeit in der Natur“, „mehr Aktivitäten draußen“ (43%) sowie „mehr Zeit mit Freunden und Familie (41%) und unter anderem noch mehr Reisen, mehr Sport draußen sowie „mehr Zeit für mich“ (30 Prozent).
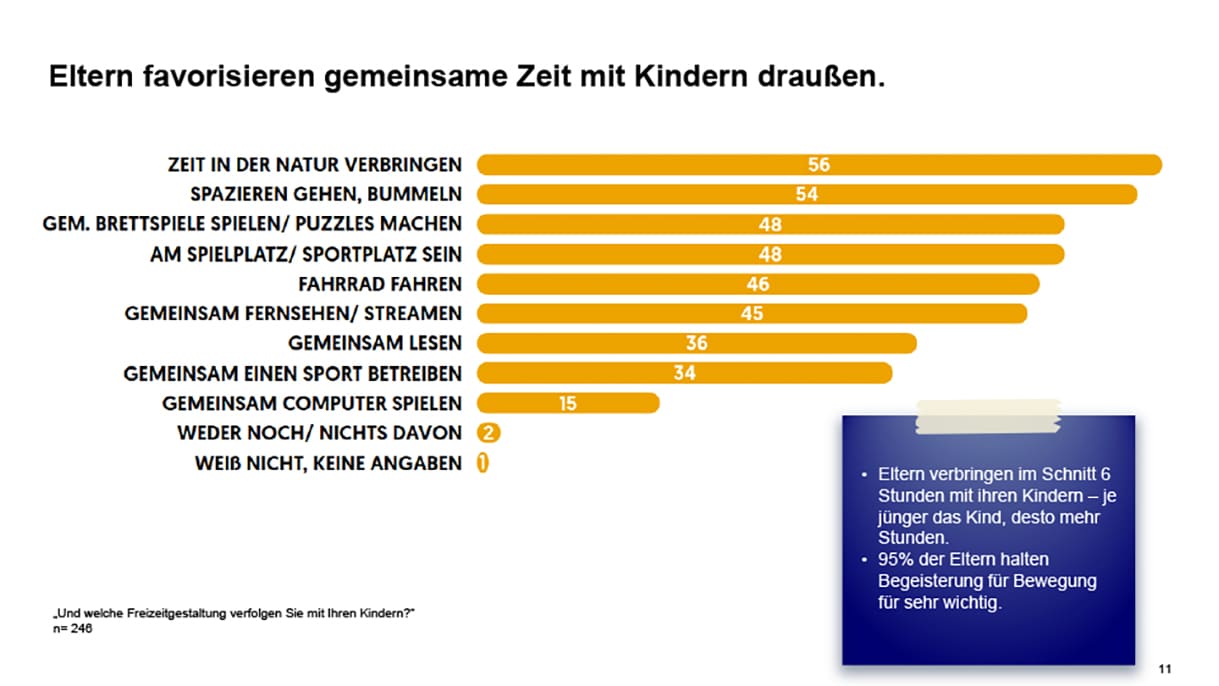
Ungefähr ein Viertel der insgesamt 1000 Menschen der Umfrage sind Eltern oder für Kinder zuständig. 246 Menschen bekamen die Frage: „Und welche Freizeitgestaltung verfolgen Sie mit Ihren Kindern?“
Mehr als die Hälfte gab an: „Zeit in der Natur verbringen“ (56%), „spazieren gehen, bummeln (54%). Knapp dahinter landeten „gemeinsam Brettspiele spielen bzw. Puzzles machen“ (48% – gleichauf mit „am Spiel- bzw. Sportplatz sein“, Fahrrad fahren (46%), „gemeinsam Fernsehen /streamen“ (45%), miteinander lesen (36%), Sport betreiben (34%) und sogar 15% gaben an, „gemeinsam Computer spielen“. Bei einer weiteren Frage gaben 43 sehr und weitere 37 eher – also insgesamt 80 Prozent aller 1000 Befragten an, „das Wissen zu Tieren und Pflanzen bei Kindern ist nicht ausreichend vorhanden und sollte ausgebaut werden“. Nochmals 8 % mehr – und damit fast neun von zehn – „sind dafür, Kindern Zusammenhänge von Natur und Umweltkreisläufen zu vermitteln“. Und rund ¾ fordern Maßnahmen gegen Klimawandel (71%) und Artensterben (73%).
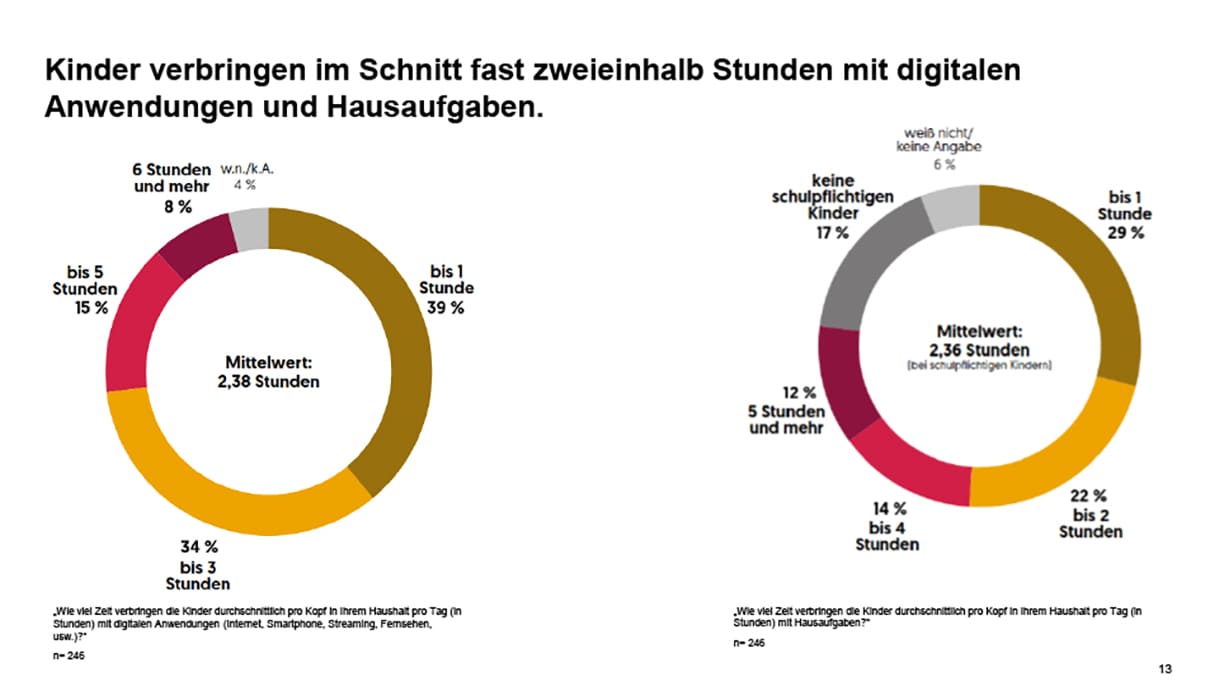
Betreuungspflichtige wurden auch gefragt, wie viele Stunden Kinder täglich mit „digitalen Anwendungen (Internet, Smartphone, Streaming, Fernsehen usw. verbringen. Das Ergebnis von 2,38 Stunden im Durchschnitt – 39 % bis eine Stunde, ein Drittel bis 3, 15 Prozent bis 5 Stunden und weitere 8 % bis 6 Stunden deckt sich aber wenig mit anderen Untersuchungen.
„Die vorgestellten HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)-Daten zeigen, dass sich fast ein Viertel der 11- bis 17-Jährigen täglich mindestens fünf Stunden mit ihrem Handy beschäftigt …“, zog bereits 2018, also vor sieben Jahren, eine Studie im Auftrag des damaligen Sozial-, Gesundheits-, Pflege- und Konsumentenschutz-Ministeriums ihr Fazit. („Nutzung von Smartphones und sozialen Medien durch österreichische Schülerinnen und Schüler“; BMSGPK; 2020 veröffentlicht).
Auch wenn Kinder für die Untersuchung nicht befragt wurden, orten Vertreter:innen zweier Organisationen, die vom Auftraggeber der Studie, der Bawag, partnerschaftlich (finanziell) unterstützt werden, und die viel (auch) mit Kindern zu tun haben, in einigen Punkten Gleichklang: Auch Kindern ist Natur und Umwelt sowie Bewegung und Aktivität im Freien ein großes Anliegen – so Clemens Matt, Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins mit 25.000 ehrenamtlichen bzw. freiwilligen Mitarbeiter:innen und vielen Berg-begeisterten Kindern und Jugendlichen und Betreiber von mehr als 200 Kletterhallen.

Karoline Iber, Geschäftsführerin des Kinderbüros der Uni Wien und Initiatorin der Kinderuni Wien, deren 23. Durchgang erst Ende der Vorwoche mit den Sponsionen abgeschlossen wurde, konkretisierte, was aus den Erfahrungen wichtig in Sachen Umweltbildung ist: „Sie wirkt dann, wenn wir Erwachsenen zuhören, Kinder mitreden und mitgestalten und das, was die Kinder einbringen auf uns wirken lassen. Und wenn Kinder Natur erfahren und erleben können. Auch Umweltbildung funktioniere nie ohne Demokratie.“
Außerdem – darüber hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon berichtet, hatten Kinder zur Verbesserung der Kinderuni unter anderem vorgeschlagen „Mehr Bewegung und wichtige Themen“. Was konkret nicht zuletzt mit der Friedens-Radfahrt von der Kinderuni Wismar (Norddeutschland) bis Wien – und hier mit Begleitung vom Donaukanal (bei der Spittelauer Lände mit dem DOCK – das Ganzjahresprogramm der Kinderuni Wien) bis zum Uni-Campus (einstiges Altes AKH) gipfelte.
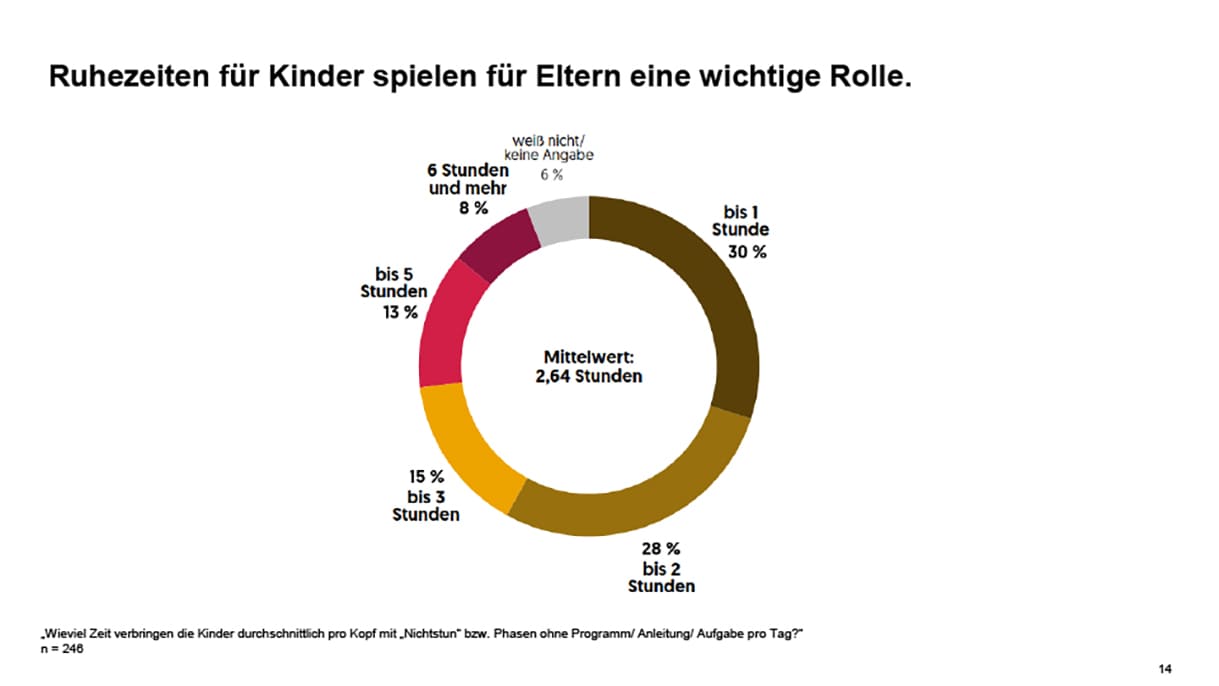
Ein anderes Ergebnis der Studie konnte die Kinderuni-Wien-Gründerin nur deutlich auch für Kinder unterstreichen. Von den 246 Umfrage-Teilnehmer:innen mit Kindern wurde auch nach Ruhezeiten „mit Nichtstun bzw. Phasen ohne Programm / Anleitung / Aufgabe“ erhoben. Im Durchschnitt gaben sie 2,64 Stunden täglich für ihre Kinder an. „Und das ist etwas, das fordern auch Kinder recht stark – das war vor zehn Jahren noch nicht so“, meinte sie zu KiJuKU. Davor verwies sie noch darauf, dass die Kinderuni Wien in diesem Jahr das in der UNO-Konvention für Kinder verankerte Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung zu einem Schwerpunkt gemacht hatte.
„Was hindert Sie, abgesehen von der Zeit, am ehesten daran Ihre Freizeitgestaltung zu verändern?“, wurden jene 356 Menschen gefragt, die an ihrer eigenen etwas ändern wollten. Vier von zehn (39%) nannten „finanzielle Gründe“ gefolgt von „Einschränkungen durch Arbeit und Beruf“ (38%) sowie Betreuungs- bzw. Sorgfaltspflichten gegenüber Familie / Partnern / Kindern (21 Prozent).
Gerade da sei eben Wandern als einer weit oben im Ranking stehendes Freizeitvergnügen als kostenlos – allerdings abgesehen von Anreisen – ideal, weil auch gesund für Körper und Geist stieg der Alpenvereins-Vertreter in seinen Beitrag ein. Seine Organisation sei zuständig dafür, runter anderem und 50.000 km2 Wander- und Kletterwege sowie von Schutzhütten instand zu halten. Hier helfe die Bawag, indem sie die Re-Zertifizierung von Schutzhütten unterstützt, das heißt viele der Hütten wurden und werden auf nachhaltigen Betrieb – weg von Diesel-Generatoren und anderes – umgestellt. Die entsprechend danach verliehenen Umweltgütezeichen müssten aber immer wieder überprüft werden.
Die Kinderuni Wien war und ist von Anfang an kostenlos – und in Zusammenarbeit mit WienExtra und dessen Angeboten wie Ferienspiel (siehe obigen Link zum Eröffnungsfest). „Gratis ist aber nicht genug“, so Karoline Iber. Es geht auch darum Kindern aus „bildungsfernen Schichten“ Zugänge zu ermögochen und schaffen – unter anderem mit Tagestickets, wo Kinder aus ihren Einrichtungen abgeholt und zu Lehrveranstaltungen gebracht werden, oder durch Kinderuni on Tour in Park in nicht zentral gelegenen Bezirken zu erreichen. Ein UniClub unterstützt Jugendliche vor allem mit Fluchthintergrund als „First Generation“ auf dem Weg zur Matura. Seit 2019 werden einige solche Projekte von der Bawag unterstützt, die heuer erstmals Hauptsponsor der Kinderuni Wien wurde, nachdem der vormalige langjährige Sponsor A1 relativ kurzfristig abgesprungen war.
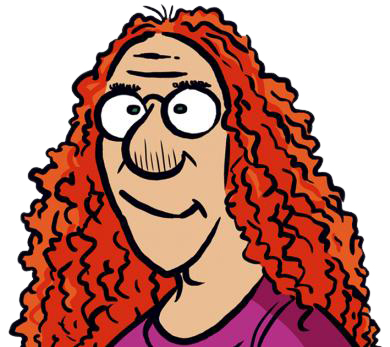
So viel Aktualität hatte sich das Team von teatro auf und rund um die Bühne des Musicals „Sophie Scholl – Die Weiße Rose“ sicher nicht gewünscht. (Derzeit noch im Stadttheater Mödling, im November in Wien im Vindobona – Link zur Stückbesprechung unten am Ende dieses Beitrages.)
Am Samstag (26. Juli 2025) marschierten – unter Polizeischutz – in Wien 200 junge Rechtsextreme – bis hinein in eine Parlamentspartei – durch die Wiener Innenstadt. Und tags darauf stürmte eine Polizeieinheit dafür in Kärnten ein Camp von vor allem jungen Antifaschist:innen auf dem Gelände der Gedenkstätte Peršmanhof. Dort hatten – in den letzten Tage den zweiten Weltkrieges – faschistische Einheiten (SS-Polizeiregiment 13) elf Menschen, darunter sieben Kinder ermordet. Ein Verbrechen, das übrigens in der bald folgenden Zeit der demokratischen zweiten Republik nie Konsequenzen für die Mörder hatte.
Erst 1965 fand die erste Gedenkfeier am Peršmanhof statt, bei der eine slowenischsprachige Gedenktafel angebracht wurde. Ab den 1980er Jahren gab es jährliche Gedenkveranstaltungen am 25. April – dem Tag des Massakers an den elf Zivilist:innen. Der Verband der Kärntner Partisanen machte einen Teil des wiedererrichteten Wohnhauses zu einem Museum, das Geschichte und den Widerstand der Kärntner Slowen:innen in der Nazi-Zeit zeigte. Außerdem wurde vor dem Hof ein antifaschistisches Denkmal errichtet.
Am Wochenende campierten Menschen vor dem Museum, um sich über die Geschichte ausführlich zu informieren. Und dann stürmt ein Polizeitrupp diese Versammlung, als würden sie Terrorist:innen dingfest machen wollen. In mehreren Medien-Interviews sagte einer der Einsatzleiter, ein in der Nähe wohnender Mitarbeiter des Verfassungsschutzes hätte die Aktion initiiert.
Deshalb ruft ein Bündnis mehrere Organisationen – KZ-Verband Wien, Initiative Minderheiten, Kulturrat und SOS Balkanroute – diese Woche – am 31. Juli, 17 bis 18.30Uhr, Minoritenplatz – zu einer Kundgebung vor dem Innenministerium – oberste Behörde der Polizei und des Verfassungsschutzes – auf.
Razzia am Peršmanhof, gehts noch?!
Wir haben Fragen! Wir sind wütend!
Wir sind solidarisch mit dem Društvo/Verein Peršman, Partisan_innenverband und Klub der slowenischen Studierenden in Wien!
Napad na Peršmanovo domačijo, ste znoreli?!
Imamo vprašanja! Jezni smo!
Solidarni smo z Društvom/Verein Peršman, z Zvezo Koroških Partizanov in Klubom Slovenskih Študentk*Študentov na Dunaju!
Der Verfassungsschutz sollte Demokratie in Österreich schützen, oder? Eine der Lehren aus Sophie Scholl und der Weißen Rose müsste wohl sein: Demokratie, Freiheit schon dann zu verteidigen, bevor es zu spät ist und solche Kräfte an der Macht sind, die Menschen, die Widerstand leisten kriminalisieren oder gar wie bei den Geschwistern Scholl und ihren Mitstreiter:innen – oder am 25. April 1946 am Peršmanhof umbringen.
31. Juli 2025
17 bis 18.30 Uhr
vor dem Innenministerium: 1010, Herrengasse 7
kz-verband-wien.at -> persman

Musical – viele lieben diese Theaterform mit Musik. Andere verbinden dieses Bühnen-Genre mit „seichter“ Unterhaltung. Dass auch mit viel Schwung, Tanz und Gesang sehr ernste Themen verhandelt werden können, zeigen gute Produktionen immer wieder. So hat die Gruppe teatro – die seit mehr als ¼ Jahrhundert talentierte Kinder, Jugendliche und erwachsene Profis zu beindruckenden Produktionen zusammenbringt – schon vor mehr als zwei Jahren mit „Anne Frank“ überzeugend die Geschichte des durch ihre Tagebücher weltbekannt gewordenen Mädchens gespielt, die als heranwachsende Teenager mit ihrer Familie in Amsterdam in einem engen Versteck ausharren musste, um der Verfolgung von JüdInnen durch die Nazis, die auch die Niederlande besetzt hatten, zu entgehen. Und dann doch verraten wurde und in einem Konzentrationslager zu Tode kam.

In diesem Jahr läuft – derzeit noch im Stadttheater Mödling, seit mehr als zehn Jahren Stammhaus der großen teatro-Sommer-Produktionen, sowie im November im Wiener Vindobona – „Sophie Scholl – Die Weiße Rose“.
Das Musical (Idee, Bühnenbild und teilweise Musik: Intendant Norberto Bertassi, Buch: Norbert Holoubek und Regie – erstmals – Rita Sereinig) sparen die auch die Vorgeschichte der vielleicht bekanntesten Widerstandsgruppe junger Menschen gegen das Nazi-Regime nicht aus. Sowohl Sophie, die erst spät zur „Weißen Rose“ dazustieß, als auch ihr Bruder Hans waren anfangs ziemlich begeisterte Anhänger:innen von Hitler, den Nationalsozialisten und übernahmen sogar führende Funktionen in der HJ (Hitlerjugend) und dem BDM (Bund Deutscher Mädchen). Zum Leidwesen vor allem ihres demokratisch gesinnten Vaters.
Da auch diesen Stationen von Sophie, Hans und ihren damaligen Gesinnungsgenoss:innen Szenen gewidmet sind, werden auch diese schwungvoll getanzt (Choreografie: Katharina Strohmayer) und gesungen (Musik neben Bertassi: Walter Lochmann, der auch das Orchester leitet und die Lieder arrangierte). Und das führt – zumindest bei der Premiere – dazu, dass das Publikum mit Szenen-Applaus reagiert. Was nicht nur den Rezensenten schon einigermaßen irritierte. Klar, große Leistung, aber …!
Ausgespart wird in der teatro-Version übrigens – entgegen vielen anderen Darstellungen ob auf Bühnen, in Filmen, in Büchern über „Die Weiße Rose“ auch nicht – dass Hans zumindest auch phasenweise eine homosexuelle intensive Beziehung hatte. Dafür wurde er erstmals von den Nazis angeklagt, aber dann doch freigesprochen.
Der zunehmende Konflikt der Protagonist:innen zum Krieg einerseits – Sophies Freund musste in Russland an der Front kämpfen – einerseits und die erwachende Liebe zu Gedankenfreiheit andererseits, ist in dem bunten Szenenbogen schön nachvollziehbar. Kalte Schauer laufen über den Rücken, wenn Originalbilder mit Reden der Nazi-Bonzen eingeblendet – mit nachgesprochenem Ton – eingeblendet werden.
Natürlich kann das tödliche Ende – ein kaltherzig-gruselig agierender Blutrichter Roland Freisler (führender Kopf des Holocaust), echt Angst machend gespielt von Jakob Riegler, der die Ermordung der ersten Mitglieder der Weißen Rose, neben Hans und Sophie Scholl noch Christoph Probst anordnet nicht fehlen. Aber auch deren Stärke – und doch mit Tränen (Anna Fleischhacker), mit der sie – ihrer neuen Überzeugung treu – in den Tod gehen.
Doch damit endet das Musical nicht, sondern mit einem Epilog des gesamten Ensembles, das gegen Angst und Passivität ansingt und tanzt und Mut machen will, allen Rückschlägen zum Trotz für Freiheit und Frieden einzutreten. Und sei es nur mit zunächst kleinen, aber doch wenigstens ersten Schritten.
Auch wenn es Hauptfiguren gibt, auch dieses Musical lebt von einer starken Ensemble-Leistung – auch der Musiker:innen, die stets hinter der Bühne live spielen. Wenngleich vielleicht doch die beiden recht jungen – und damit nah am Alter der echten Scholls – Darsteller:innen Anna Fleischhacker (23) als Sophie (die mit 22 sterben musste) und David Mannhart (gar erst 20) als Hans (mit 25 getötet) eine spezielle Erwähnung verdienen. Noch dazu wo – wie im Bericht über „Mogli – Das Dschungelbuch“ schon geschrieben – die beiden auch noch parallel, an den Samstagen sogar knapp hintereinander, dort noch die Rollen von Bagheera und Shir Khan verkörpern.
Übrigens: Intendant und teatro-„Vater“ Norberto Bertassi schreibt im Programmheft, dass er in Wien-Donaustadt seit eineinhalb Jahrzehnten in der Sophie-Schollgasse wohnt und sich seit damals sein Wunsch, diese vorbildliche Widerstandskämpferin zur Heldin eines Muscials zu machen, verstärkt habe. Und – nicht nur – er bedauert, dass Scholls Geschichte leider heute (wieder) wichtiger geworden und nicht „nur“ eine historische ist.
von-sophie-scholl-bis-zum-hier-jetzt <- damals noch im Kinder-KURIER
eigene-karriere-oder-zivilcourage <- ebenfalls KiKu
ueber-die-jahrhunderte-hinweg-zur-eigenen-meinung-stehen <- im KiKu
da-muesste-man-doch-endlich-einmal-etwas-sagen <- im KiKu
die-weisse-rose- 2018 im Theater der Jugend in Wien <- im Kinder-KURIER
unterrichtsmaterial zum film-sophie-scholl-die-letzten-tage
instagram -> chbinsophiescholl

„Ich muß oft laut vor mich hin lesen, um den Sinn der Worte zu erfassen, und dann liegen sie unbeweglich in mir, ohne daß ich sie könnte mir zu eigen machen. (…)“, schreibt Sophie Scholl in einem Brief am 5. Juni 1941 an ihre Freundin Lisa Remppis.
Fast vier Dutzend Mal kommt das Wort Lesen auf den rund 130 Seiten vor, die von Barbara Ellermeier aus Tagebucheintragungen und Briefen DER Symbolfigur der Münchner Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ gegen die faschistische Diktatur, zusammengestellt wurden. Die Originaltexte aus der Zeit zwischen 10. April1941 und 26. Dezember 1942 gewähren Einblicke in das Leben der jungen Frau. Die war – wie auch ihr ebenfalls am 22. Februar 1943 von den Nazis ermordeter Bruder Hans – zunächst überzeugte und führende Anhängerin der Hitlerjugend bzw. des BDM (Bundes Deutscher Mädchen) – zum Leidwesen des demokratisch gesinnten Vaters. Erst nach und nach wandten sich die beiden gegen das Unterdrücker-Regime – nicht nur innerlich.

Ein Element im Sinneswandel war für Sophie Scholl auch die Lektüre vieler Bücher. Und so gab die Historikerin Ellermeier dem Band auch den Titel: „Sophie Scholl – Lesen ist Freiheit!“
Neben den Texten aus Händen und Hirn der Sophie Scholl sind in diesem schmalen Büchlein auch Dutzende Zeichnungen von ihr – aus dem Nachlass ihrer überlebenden Schwester Inge Aicher-Scholl im Institut für Zeitgeschichte München – veröffentlicht, viele davon erstmals.
Übrigens: Die Gruppe teatro, die seit mehr als ¼ Jahrhundert engagierte, inhaltsreiche Stücke mit talentierten Kindern und Jugendliche gemeinsam mit Profis als Musicals auf Bühnen bringt, spielt derzeit noch im Stadttheater Mödling und dann im November im Wiener Vindobona „Sophie Scholl – Die Weiße Rose“ in einer berührenden, bewegenden, bewegten Version – Stückbesprechung unten verlinkt.
* Aus dem Brief von Sophie an den jüngsten Bruder Werner vom 17. August 1941


„Ich bin zwar gefallen, aber unter all dem Dreck hab ich diesen Glitzerstein entdeckt“, frohlockt der Bär, der mit einem jungen Buben unterwegs durch den fantasievollen Wald ist. Dies ist das erste „Abenteuer“ des Bilderbuchs „Glück oder Pech“ mit dem Untertitel „Wer kann das schon sagen?“
Sozusagen eine neue Version des klassischen Märchens aus der Sammlung der Brüder Grimm hat sich Ian De Haes textlich und zeichnerisch einfallen lassen (Übersetzung aus dem Französischen: Bernd Stratthaus).

Natürlich geht auch der Glitzerstein wieder verloren, doch…
… egal was passiert, selbst als Diebe ihnen Säcke voller Gold stehlen, die beiden muntern einander gegenseitig auf, weil sich aus dem Pech dann immer doch ein Glück ergibt – oft eine Frage von Perspektivenwechsel.
Dass der Bär eher wie ein Erdapfel (Kartoffel) mit Gliedmaßen und Ohren aussieht, könnte – bei entsprechender Interpretation – auch als gezeichnetes Plädoyer gegen Body-Shaming verstanden werden. Die ständige Wiederholung des Buchtitels samt Untertitel auf jeder zweiten Doppelseite hingegen nervt, vertraut nicht darauf, dass Kinder den Sinn und Zweck der kleinen und doch so großen Abenteuer sicher ohnehin verstehen – ohne ihn jedes Mal „aufs Aug zu drücken“!
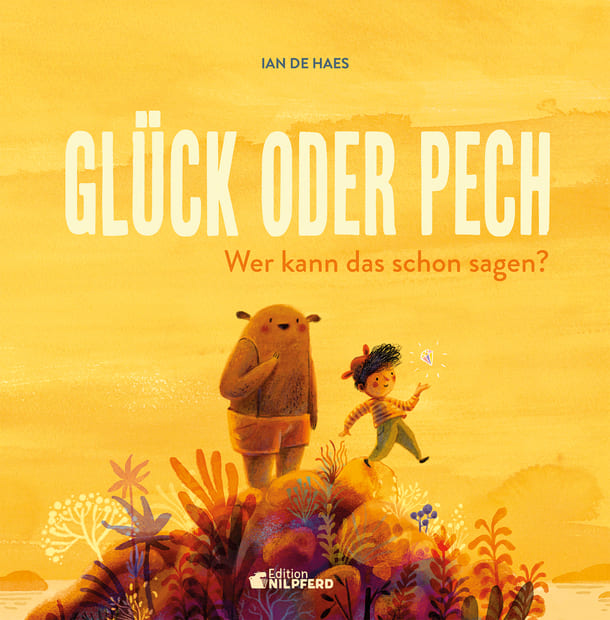

In einem fast paradiesisch wirkenden großen Garten mit Hügel und in diesem eine Höhle vor dem kleinen Schloss Haagberg im niederösterreichischen Neuhofen, spielt jedes Jahr die Laienspielgruppe „Ostarrichi-(Jugend-)Theater“. Immer wieder drehen sich die Stücke um Religion und Glauben, beispielsweise „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing, „Karol – Das Leben von Papst Johannes Paul II“, „Jedermann“ nach Hugo von Hofmannsthal.
In der besagten Höhle, vor der sich die Bühne vor dem Hügel „entfaltet“ steht eine Statue von Sankt Nepomuk. Im Schloss selbst – zumindest im Erdgeschoß gegenüber dem Klo – steht eine Art glanzvoller kleiner Altar, auf dem Büchertisch liegen „heilige“ Schriften.

In diesem Jahr (2025) wurde die Frömmigkeit mit einem kräftigen Schuss Humor selbstironisch auf die Schaufel genommen. „Don Camillo“, einer der beiden Protagonisten der in Italien in den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg angesiedelten und beliebten Buchserie, die in ihrer auch deutschsprachigen Verfilmung vor Jahrzehnten sehr bekannt war, ist doch ein eher schlitzohriger Pfarrer, der mitunter sogar Jesus Christus überlisten will. Was ihm so manchen Ordnungsruf von ganz oben einbringt.

Dafür ist sein Gegenspieler Peppone, der kommunistische Bürgermeister des kleinen fiktiven Städtchens Bosaccio in der nördlichen Ebene rund um den bekannten Fluss Po, irgendwie doch gott-gläubig. Er besteht sogar darauf, den neugeborenen Sohn taufen zu lassen. Was dem Pfarrer widerstrebt, weil der Bürgermeister auf dem Namen Lenin für sein Kind besteht, dem Kampfnamen des Revolutionärs und ersten Regierungs-Chef der Sowjetunion und zuvor Russlands.
Der Wickel rund um die Taufe und den Kindsnamen ist eine der Episoden aus dem ersten der Bücher von Giovannino Guareschi. Der Journalist, Karikaturist und Schriftsteller (1908 – 1968) begann seine fiktiven Geschichten in einem Satiremagazin. Aufgrund des großen Anklangs wurde daraus eine Serie, die später als Buch veröffentlicht wurde. Dem alle paar Jahre weitere Bücher mit neuen Episoden folgten.

Wikipedia zufolge hatte der Autor einerseits in einem katholischen Priester (Don Camillo Valota), der mit Partisanen gegen die faschistische Diktatur Mussolinis kämpfte und in den Konzentrationslagern der Nazis in Dachau und Mauthausen eingesperrt war und andererseits dem Dorfpfarrer in Trepalle (Gemeinde Livigno), Alessandro Parenti, reale Vorbilder für seinen Don Camillo Tarocci. Für den Gegenspieler Giuseppe Bottazzi, den er meist Peppone nennt, wird kein real existierendes Vorbild genannt. Vermutet wird, dass er mit dem Vornamen auf den damaligen sowjetischen – noch angehimmelten – Ober-Kommunisten Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, schlechter bekannt als Stalin anspielte, dessen Verbrechen erst gut zehn Jahre später auch ansatzweise offiziell zugegeben worden sind.
Zurück ins Ertl’sche Schloss in Neuhofen, das als „Geburtsstunde“ Österreichs, damals unter dem Namen Ostarrichi (erste urkundliche Erwähnung am 1. November 996) gilt – und den sich die Theatergruppe zum Namen machte. Schon auf dem hügeligen Zugangsweg zur Ebene zwischen Schloss und bewaldetem Hügel mit Höhle vor der gespielt wird, wanderten heuer vier Carabiniera (italienische Polizistinnen) – Kristina Lleshaj, Emilia Bill, Noemi Sulzberger, Marisa Berisha – entlang der Kieswege zwischen den Wiesen. So manche Besucher:innen begannen gleich ein wenig verkrampft Haltung anzunehmen 😉 Nein, es gab keine „polizeilichen Kontrollen“ 😉 Lediglich eine Einstimmung auf das folgende Spiel. Dafür dienten als deutlich sichtbare Deko auch große Obst- und Gemüsekörbe, zeitweise flankiert von zwei Statistinnen, die allerdings dann im Spiel – im Gegensatz etwa zu den Polizistinnen – keinen Auftritt hatten.
Zwei der Carabiniera übernahmen noch weitere Rollen, so fungierte Marisa Berisha als eine Fußballtrainerin und Kristina Lleshaj spielte Ariana, die Frau von Bürgermeister Peppone (Alexander Reikersdorfer) und Mutter des kleinen Lenin – nicht des sowjetischen ;), der nach Einigung mit dem Pfarrer (Josef Franz Ertl) – unter stimmgewaltigem Einschreiten von Jesus (aus dem Off: Michael Kurzbauer) auf die Namenskombi Libero Camillo Lenin getauft wurde.
Auch das Fußballspiel steht wie die anderen Episoden schon im Original, wobei es dort 2:1 und im aktuellen Spiel 3:2 endet- beide Male für „die Roten“. Im Schlosspark wird noch dazu auf einer abschüssigen Wiese des Hügels neben Bühne und Publikum gekickt, oder besser gesagt, versucht, solches zu tun – die einen in roten Dressen mit Hammer und Sichel, die anderen in schwarz mit großer Kerze als Team-Symbol.
Aus den rund 270 Seiten des ersten Buches von Guareschi hat der deutsche Theaterautor Gerold Theobalt eine bühnenreife Komödie mit vielen Originalzitaten verfasst. Die Ostarrichi-Theater-Prinzipalin Evelyn Ertl-Egger inszenierte auf dieser Basis jene Version, die nach zwei Aufführungen im Schlosspark Haagberg für eine Vorstellung am letzten Juli-Sonntag (2025) auf die Theaterbühne am Hauptplatz Haag übersiedelt.
Wie schon das Original und auch die Verfilmungen vor Jahrzehnten sorgen die Szenen immer wieder für viele Lachen. Das ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass die Protagonisten – und so manche ihrer Helfer:innen – die eigene Position in jedem ihrer Konflikte oft bis ins Absurde übertreiben und so der Lächerlichkeit preisgeben. Und trotz der äußerlichen, scheinbaren Gegensätzlichkeiten einander in ihren Haltungen und den Verhaltensweisen doch so ähnlich sind.
Der Erfolg und die Sympathie für Guareschis Werke ergab – und ergibt – sich nicht zuletzt daraus, dass Angehörige der gespaltenen Gesellschaft in den Szenen auch ein bisschen über sich selbst lachen können – und praktisch jede Episode mit einem augenzwinkernden Kompromiss endet. So tauft der Pfarrer den Sohn des Bürgermeisters und dessen Frau schließlich auf drei Vornamen: Libero, Camillo, Lenin. Dafür stellt sich nach langem Hin und Her der Pfarrer doch auf die Seite der streikenden Landarbeiter, denen der Großgrundbesitzer keine Lira mehr Lohn geben wollte.
Theaterleiterin Evelyn Ertl-Egger, die dieses Jahr wieder Regie führte, ist auch Tanzlehrerin und baut, wie langjährige Besucher:innen berichten, jedes Jahr zwischen manchen Szenen auch Tänze ein, manches Mal offenbar ein wenig unmotiviert, was sie vor der diesjährigen Premiere, die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… besuchte, selber auf der Bühne augenzwinkernd thematisierte. Insgesamt ist die Aufführung mit 15 Szenen in drei Akten und drei Stunden Dauer (mehr als ¼ Stunde Pause) trotz des Szenen- und Spielwitzes doch ein wenig lang(atmig) geraten. Da war schon da und dort ein Stöhnen in den Publikumsreihen zu vernehmen. Klar, jede Episode ist toll, aber es gibt im Originaltext noch viele weitere, und dennoch werden – zum Glück – nicht alle inszeniert 😉
Vor dem Start des zweiten Teils nach der Pause maßregelte die Regisseurin vor versammeltem Publikum öffentlich Schauspieler:innen, sie müssten, die Zuschauer:innen auslachen lassen und erst dann mit ihrem Text fortfahren. Das würde – zumindest längst – jede andere / jeder anderer dem Team sagen ohne Darsteller:innen bloßzustellen.
PS: Rund einen halben Tag nach dem Erscheinen dieses Beitrages rief die Regisseurin und Leiterin der Theatergruppe Ostarrichi, Evelyn Ertl-Egger, bei KiJuKU.at an und wollte klarstellen, „dass ich diese Kritik auch mit meinen Schauspielerinnen und Schauspielerinnen in der Pause gesagt habe und so besprochen war, dass ich es auf der Bühne noch einmal sage. Wir hatten noch nie so eine Situation, dass so viel gelacht worden ist, das war für uns ganz neu.“

Bevor Giovannino Guareschi sein erstes (1948 erstmals erschienenes) Buch mit 37 Episoden von Konflikten zwischen dem Pfarrer Don Camillo und dem kommunistischen Bürgermeister Peppone startet, stellt er dem Roman drei Geschichten voran, in der er Land und Leute der nördlichen Po-Ebene zu charakterisieren versucht. Auch das alles ausgedacht. Keine Fake Stories, sondern eben schriftstellerische, fiktive Geschichten. Auch wenn er gleich auf der ersten Seite schreibt: „Ich bleibe in diesem Buch jener Zeitungsberichterstatter und beschränke mich darauf, Tagesereignisse zu erzählen. Es sind erfundene Dinge, und sie sind daher so wahrscheinlich, dass ich in einer Reihe von Fällen eine Geschichte geschrieben und dann nach einigen Monaten gesehen habe, wie sie in Wirklichkeit sich wiederholt.“
Die Gegensätze des Pfarrers und des Kommunisten – die derzeit (Juli 2025) übrigens in Niederösterreich von einer Laien-Theatergruppe gespielt werden – Stückbesprechung unten am Ende der Buch-Rezension verlinkt – leben einerseits von Humor. Und diese ist aus der Sicht der beiden Protagonisten oft Selbstironie, die sich daraus ergibt, dass sie im übertragenen Sinn sich jeweils selbst überdribbeln. Und einander im Gegensatz sehr, sehr ähnlich sind, ziemlich gleich ticken, den anderen übertrumpfen zu wollen. Aber letztlich doch immer wieder – oft scheinbar unfreiwillig – zu Kompromissen finden.
Neben allen anderen Personen der verschiedenen Handlungen bis hin zu einer Art Romeo-und-Julia-Liebe zwischen der Tochter des reichen Ausbeuters im Ort und einem jungen aktivistischen Kommunisten, spielt eine dritte unsichtbare Figur eine zentrale Rolle: Die Stimme von Jesus Christus. Den will der Pfarrer mitunter austricksen, was natürlich nicht gelingt.
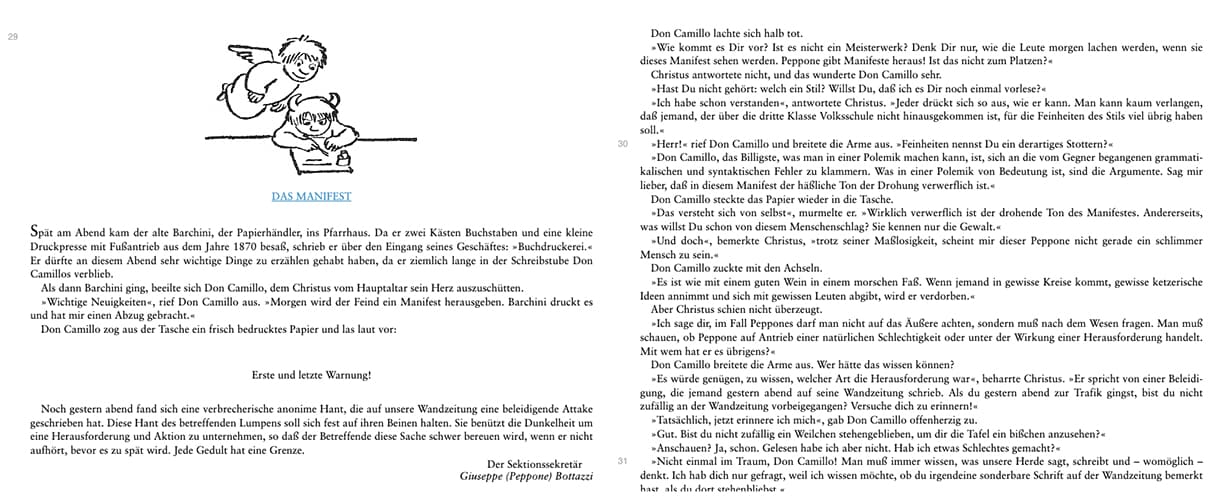
Nicht selten liest Jesus seinem Diener die Leviten: „Don Camillo, bleibe im Rahmen der Gesetzlichkeit. Wenn du jemanden umlegen willst, um ihm weiszumachen, dass er im Unrecht ist, dann sage mir bitte, wozu ich mich kreuzigen ließ?“, heißt es etwa im Kapitel „Rivalen“.
„Jesu“, flehte Don Camillo geradezu, „bist Du Dir darüber im Klaren, dass Du mich für die kommunistische Propaganda arbeiten lässt?“
„Du arbeitest für Grammatik, Syntax und Rechtschreibung, alles Dinge, die weder teuflisch noch ketzerisch sind.“ (Die Abendschule)
Über Episoden der unmittelbaren italienischen Nachkriegsgesellschaft hinaus fast zeitlos lesen sich so manche vom Autor der Stimme von Jesus in den Mund gelegte Sätze, etwa die folgenden:
„Was wichtig ist, sind die Gedanken. Die schönen Reden führen zu nichts, wenn hinter den schönen Worten keine praktischen und wahren Ideen stehen.“
„Im Sinne der christlichen Barmherzigkeit ist eine große Schweinerei geschehen, wenn man den Leuten Anlass gibt, sich über einen Menschen lustig zu machen, nur weil dieser Mensch über die dritte Klasse Volksschule nicht hinausgekommen ist…“ (Das Manifest)
„Don Camillo, das Billigste, was man in einer Polemik machen kann, ist, sich an die vom Gegner begangenen grammatikalischen und syntaktischen Fehler zu klammern. Was in der Polemik von Bedeutung ist, sind die Argumente.“


„Wir haben das Dschungelbuch schon vor 13 Jahren gespielt, aber der Regenwald ist heute noch mehr in Gefahr als damals“, begründet Prinzipal und „Vater“ von „teatro“, Norberto Bertassi, die Wahl von „Mogli – Dass Dschungelbuch“, eines der beiden starken, bewegten und bewegenden Stücke, die derzeit im Stadttheater Mödling zu erleben sind (das zweite – für Jugendliche und Erwachsene: „Sophie Scholl – Die Weiße Rose“).
Kinder, Jugendliche spielen, singen, tanzen seit mehr als ¼ Jahrhundert Musicals, meist mit wichtigen, inhaltsreichen Botschaften, so manche der einstigen Kinder und / oder Jugendlichen sind längst Profis; einer der bekanntesten wohl Moritz Mausser, der umjubelte „Falco“-Darsteller in „Rock Me Amadeus – das Falco-Musical“.

Die Grundgeschichte ist wohl bekannt – mehr noch als durch die Bücher Kiplings wohl durch die Zeichentrick-Verfilmung Disneys: Ein Kind wächst im Dschungel, nein nicht in einem sprichwörtlichen wie dem einer Großstadt, sondern in einem natürlichen mit Tieren und Pflanzen, auf. Wölfe ziehen das Menschenkind als eines der ihren auf. Mowgli, wie ihn Rudyard Kipling, der britische Autor der im Original sieben Erzählungen, nennt, lernt somit natürlich sich in dieser Welt zu bewegen, und die unterschiedlichsten Tiere zu verstehen. Die oft kolportierte auch in dieser Inszenierung angesprochene „Übersetzung“ des Namens aus einer scheinbaren indischen Sprache ist, wie Kipling einmal schreibt „ausgedacht, bedeutet in keiner mir bekannten Sprache Frosch.“

Wie schon 2012 will die menschliche Mutter Moglis, wie er in den deutschen Übersetzungen meist geschrieben wird und heuer dem ganzen Musical den Titel gab, eine toughe Business-Lady den ganzen Dschungel roden und die Grundstücke gewinnbringend vermarkten lassen. Damals hieß sie gleich entlarvend Mrs. Moneymaker, heuer Madame Kali Parvati (gespielt von Katharina Lochmann), ist aber um nichts weniger auf Geld versessen, speist ihre Tochter Tara (Anouk Auer), die noch immer um ihren vermeintlich beim Angriff durch Tiger Shir Khan (David Mannhart) getöteten Bruder trauert, mit Luxus-Gütern ab. Sie landet gut zehn Jahre später, als die Mutter die Rodungsabsichten besichtigen will, mitten unter den Tieren, vor allem den Affen, die an manchen ihrer Glitzerdinge Gefallen finden – und erkennt ihren Bruder (Joel Gradinger; zu Beginn gut zehn Jahre jünger gespielt von seiner Schwester Lina Gradinger) ziemlich rasch.

Pfaue, Affen, Elefanten – die großen Tiergruppen haben immer wieder eigene Szenen mit so manchem Witz. Vor allem die Darstellerin des jüngsten, kleinsten Elefanten Pauline Faerber (die übrigens auch Moglis Schwester zu Beginn als die noch sehr jung war, spielt) sorgt für viele Lacher, wenn sie die Rudel-Anführerin Hathi (Antonia Tröstl) liebevoll anblafft: „Mama, du bist so peinlich!“, vor allem als diese Herzerln bei der Begegnung mit Balu dem Bären (Manfred Schwaiger, der als einziger schon 2012 auf der Bühne dabei war) sieht.
Die Pfaue zeichnen sich – wie viele der Figuren, ob tierische oder menschlich, wie in allen teatro-Produktioen immer, diesmal aber fast übertreffend nicht zuletzt durch die kunstvollen Kostüme von Brigitte Huber aus. Weshalb die Pfaue allerdings eher tussihaft auftreten müssen, erschließt sich nicht ganz (Buch, Regie: Norbert Holoubek). Milena Mörkl ist einer der Pfaue, schlüpft aber wie viele andere auch in mehrere Rollen. „Ich spiel auch einen Geier und einen Affen. Aber Affen sind fast alle“. Letztere haben eine Massenszene, in die sie links und rechts neben den Publikumsreihen die Bühne stürmen.

Obwohl sie ja eigentlich eine böse Rolle spielt, begeistert die Schlange Kaa in grün-glitzerndem Ganzkörper-Suit besonders eine sehr junge Besucherin, die ausstrahlt und dies in der Pause auf KiJuKU-Frage auch bestätigt, selbst am liebsten mitspielen zu wollen. „Sie bewegt sich so toll, das liebe ich“, meint Lena, die schon in kleineren Produktionen der teatro Musical-Academy mitgewirkt hat. In der „Schlangenhaut“ steckt Lena Wiesinger. Sie hat übrigens – gemeinsam mit David Schieber die Musik für die aktuelle Musical-Produktion geschrieben, die wie immer einem Gesamtkonzept folgt. Sie selbst ist, wie sie kurz nach der Premiere erzählt, frisch fertig mit der Musical-Ausbildung, „und da ist es großartig, gleich mit so einer großer Aufgabe betraut zu werden“, freut sie sich – und natürlich auch über das ihr von KiJuKU erzählte Lob der jungen Besucherin über ihre Schlangen-Performance.
Apropos Musik: teatro-Aufführungen leben nicht nur von den wunderbaren Tänzen (Choreografie: Beatrix Gfaller, Dance Captain: Catarina Rachoner), Gesängen und dem Schauspiel auf der Bühne, sondern immer auch von der Musik, die live hinter den Kulissen von einem kleinen Orchester gespielt wird, den schon erwähnten Kostümen, der Maske (Renate Harter), den fast von Jahr zu Jahr noch besser werdenden Projektionen, die Kulissen an die Wände zaubern (Fabian Fischer) sowie den vielen helfenden Händen und Hirnen der teatro-„Familie“.

Hervorzuheben sind aber hier noch zwei junge und doch schon so professionelle Darsteller:innen:
Anna Fleischhacker (23) in der Rolle des Mogli beschützenden aber nie gluckhennen-bewachenden schwarzen Panthers Bagheera. Dass ihr die oben so sehr gelobte Kostümdesignerin allerdings Augen auf die Brust verpasst hat, obwohl die Darstellerin nicht nur meisterinnenhaft singt und tanzt, sondern auch über ein starkes Augenspiel verfügt, irritierte nicht nur den Rezensenten, sondern viele im Publikum, aber auch etliche hinter der Bühne.
David Paul Mannhart (20) gibt DEN Feind schlechthin, den Tiger Shir Khan. Die beiden spielen parallel auch im schon oben erwähnten Musical „Sophie Scholl – Die Weiße Rose“ (Besprechung folgt demnächst), sie die Sophie, er ihren Bruder Hans, die beide erst glühende Hitler-Jugendliche waren, nach und nach das undemokratische Verbrechen erkannten, sich gegen die Nazi-Herrschaft wandten und in einem kurzen Unrechtsprozess zum Tode verurteilt und ermordet worden waren. An Samstagen spielen die beiden am Nachmittag in „Mogli – Das Dschungelbuch“ und wenig später in den Hard-Core-Rollen!

„Mogli – Das Dschungelbuch“ endet übrigens mit einem Song, bei dem ein Teil des Ensembles phasenweise die Bühne verlässt und sich neben den Publikumsreihen platziert, um die Bedeutung der Zeilen rund um „Das ist eine Welt!“ auch körperlich zu manifestieren. Denn erst die Rettung von (Regen-)wäldern real und stellvertretend für den Umgang der Menschheit mit der Natur kann das Überleben ersterer ermöglichen.
teatros Dschungelbuch 2012 <- damals im Kinder-KURIER
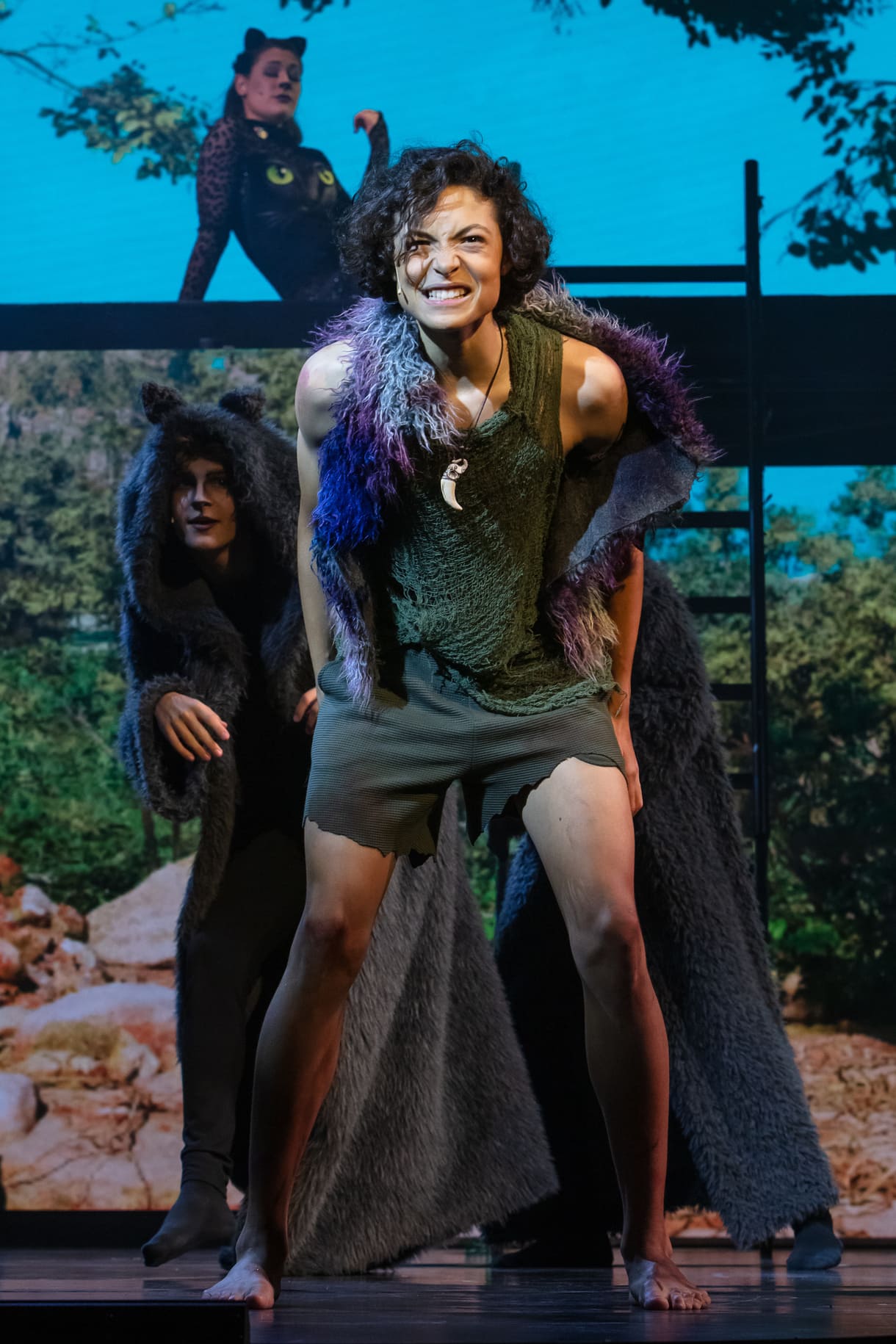

„Grauschnauz“ – auch wenn er auf der Titelseite ziemlich schwarz ist – will nicht mit den anderen Wölfen gemeinsam den Mond anheulen. Er möchte dem hell scheinenden Himmelskörper lieber ein eigenes, schönes Lied singen, verkriecht sich im Wald, um ganz allein mit dem Mond zu sein.
„Wie klar und rein das klang. Jeder einzelne Ton war perfekt! Selbst der Mond schien ein bisschen heller zu scheinen“, schreibt Larysa Maliush, die sich das Bilderbuch „Mahlzeit!“ ausgedacht und auch gezeichnet hat (Übersetzung aus dem Englischen: Anna Schaub). „Das war vollkommen falsch“ wird er da unterbrochen. Nicht von in den Wald zurückgekehrten anderen Wölfen, sondern von einem kleinen Häschen. Das heulte auch, aber anders, weil es ganz allein war.
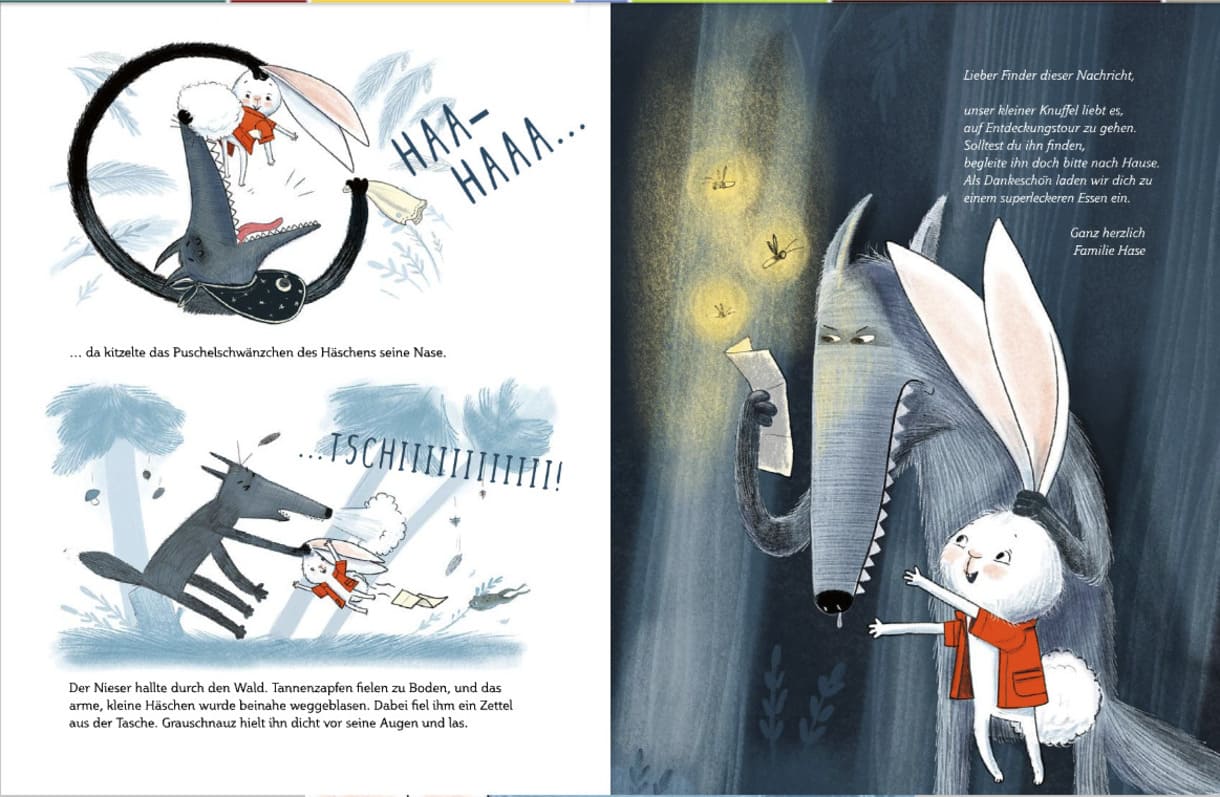
Üblicherweise ein Fressen für einen Wolf. Was hier natürlich nicht passiert, obwohl er es versucht.
Knuffel, so der kleine, weiße Hase kitzelt mit seinem Puschelschwänzchen Grauschnauz‘ Nase, der Wolf muss niesen – alles rundum erzittert, der Hase verliert einen Zettel – gerichtet an Finder, die gebeten werden, den kleinen Hasen nach Hause zu begleiten und als Dank winkt ein gemeinsames Essen. Auf das will sich die Titelfigur durchaus einlassen, an dem kleinen Häschen ist ja nicht viel dran…
Wie und was sich weiter abspielt – nein, wird hier sicher nicht gespoilert. Grau ist kein Zufall für des Wolfes Schnauze, die Autorin und Illustratorin wendet sich gegen die – im übertragenen Sinn – Schwarz-Weiß-Zeichnung von Verhältnissen 😉
Übrigens: Aktuell läuft im Mödlinger Stadttheater von der Gruppe teatro eine Musicalversion des Dschungelbuchs nach Rudyard Kipling, dessen Hauptfigur Mogli ja in der „Wildnis“ von Wölfen aufgezogen wird (Besprechung hier demnächst).
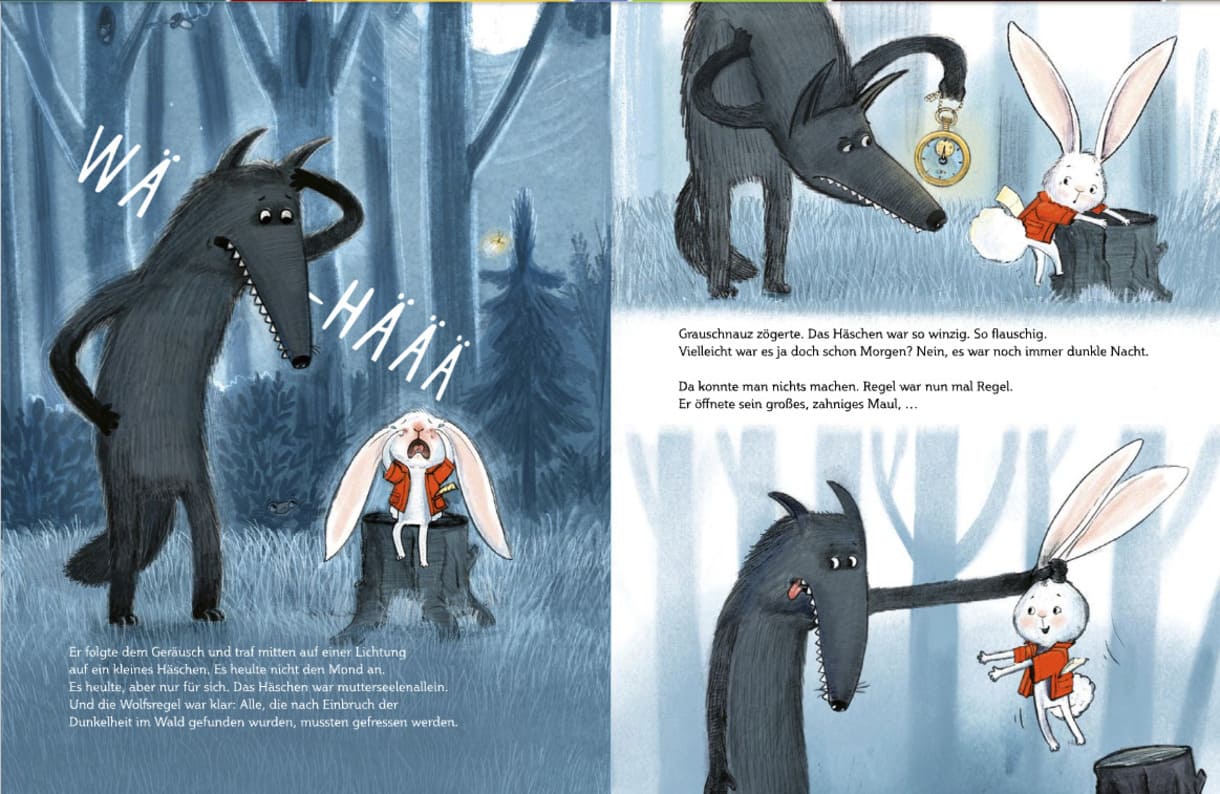
Obwohl tausendfach von Fachleuten erklärt, dass Wölfe sehr sozial sind, Dutzende neuere (Kinder-)Bücher und Theaterstücke die vielen Geschichten vom „bösen Wolf“ zurechtrücken, leiden diese Verwandten der oft vermenschlichten Hunde noch immer an schlechtem Image. Den wiederangesiedelten in Mitteleuropa schon fast ausgerotteten Wölfe geht es in jüngster Zeit wieder mehr an den Kragen. Lobbys verlangen „Entnahmen“ wie Abschüsse verschleiert genannt werden.
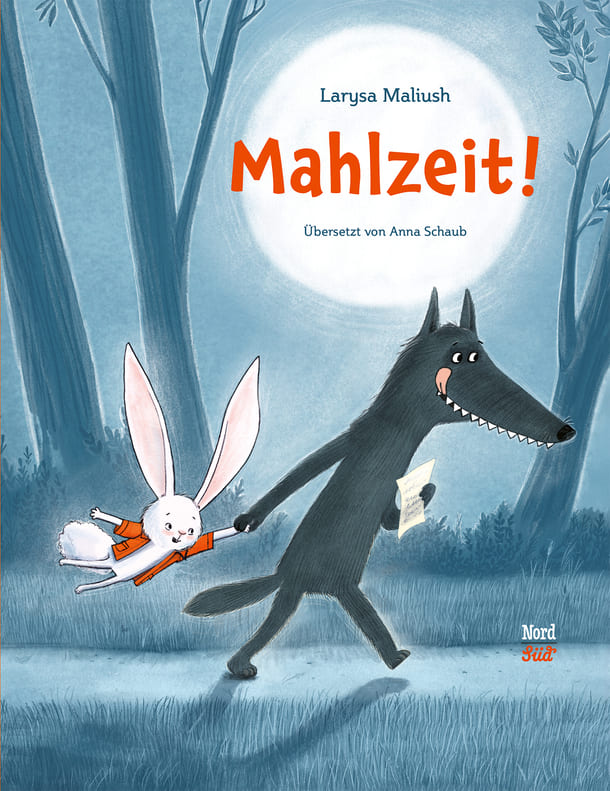

Shirin Grace Saeedi Razavi spielt in dem Kinofilm „Happy“ die im Film neunjährige Maya, Tochter des Hauptdarstellers. Ihre österreichische Mutter ist gestorben, der indische Vater lebt in einer rechtlosen Grauzone, ständig von Abschiebung bedroht. Sie lebt in einem Heim und darf den Vater höchstens einmal in der Woche treffen. Der tut alles für seine Tochter, verschuldet sich, unter anderem um sein Moped, mit dem er Essen ausliefert, rot zu lackieren, wie Maya das gerne hätte.
Die damals 12-Jährige spielte diese Maya sehr beeindruckend, kaum zu glauben, dass dies eine Premiere für sie war.
KiJuKU: Wie kam es dazu, dass Sie die Maya gespielt haben?
Shirin Grace Saeedi Razavi: „Ich wollte schon immer eine Schauspielerin werden und meine Mutter gebeten, dass sie mich bei einem Casting anmeldet. Damals hab ich Kathak, einen indischen Tanzstil gemacht. Eine meiner Tanzlehrerinnen hat Sandeep gekannt. Irgendwie ist es dann passiert ;)“
KiJuKU: Wann ist Ihr Wunsch entstanden, Schauspielerin zu werden, schon im Kindergarten?
Shirin Grace Saeedi Razavi: „Eher in der Volksschulzeit. Ich hab gern Filme und Serien angeschaut und mir gedacht, wowh, ich will auch irgendwann einmal vielleicht in Hollywood sein.“
KiJuKU: Und Sie haben nie vor diesem Dreh etwas in diese Richtung probiert?
Shirin Grace Saeedi Razavi: „Ich war eher mit Tanzen beschäftigt. Ach ja, einmal in der Volksschulzeit war ich in einem Schauspiel-Sommer-Camp.“
KiJuKU: Haben Sie das ganze Drehbuch gelesen oder nur kurz jeweils Ihre Szenen?
Shirin Grace Saeedi Razavi: „Das Ganze hab ich glaub ich zwei Mal durchgelesen und die Texte, die ich sagen sollte natürlich öfter.
KiJuKU: Sie sind als Maya ja in einer nicht ganz einfachen Situation – die Mutter ist tot, den Vater dürfen Sie nur fallweise sehen, leben in einem Heim. Wie ist es, sich in so eine Situation hinein zu fühlen?
Shirin Grace Saeedi Razavi: Ich hab’s schon hart gefunden. Manche Szenen besonders. Ich musste ja in die Geschichte eintauchen.
KiJuKU: Wie haben Sie das gemacht – Ihre eigene Lebenssituation ist davon ja weit entfernt?
Shirin Grace Saeedi Razavi: Meine Eltern – Vater Perser, Mutter Rumänin – hatten auch nicht wirklich immer ein gutes Leben, deswegen kenn ich schon solche Geschichten, die in echt so oder ähnlich passiert sind. Aber es war schon hart. Aber ich finde es toll, dass der Vater alles getan hat für seine Tochter.
KiJuKU: Danke, motašakkeram, kheli mamnoon, sepaz, mersi, Mulţumesc
Shirin Grace Saeedi Razavi: Khoish mi konam, cu placere, bitte, gern.

Im Film „Happy“ macht der Regisseur stellvertretend für Tausende Menschen, deren Arbeit die Gesellschaft in Anspruch nimmt, sie aber nicht beachtet, einen von ihnen sichtbar. Er, der wie viele andere in Österreich Zuflucht gefunden hat, aber weder Asylstatus noch einen anderen Aufenthaltstitel bekommen hat, schwebt in einer rechtlichen Grauzone.
„Happy“, so sein Name, stammt aus Indien, steht kurz vor der Abschiebung wie auch viele seiner Landsleute. Hält sich erst mit als Kolporteur mit dem Verkauf der großen Tageszeitungen und später als Essenszusteller für ein indisches Restaurant über Wasser. Kann überall ausgenutzt werden. Er kann sich ja nicht wehren, wo soll er hin. Sieht er Polizisten, traut er sich nicht einmal die Straße zu überqueren oder biegt, wenn mit dem Moped bei der Essenslieferung unterwegs, schnell ab. Als sein Moped während der Zustellung von Unbekannten über den Haufen gefahren wird – dasselbe. Da rennt er zu Fuß quer durch die Stadt.

So tragisch sein – und vieler anderer – Schicksal ist, der Film von Sandeep Kumar, der selbst vor mehr als zwei Jahrzehnten aus Indien nach Österreich kam – kommt nie anklagend, nie pathetisch, nie tränendrüsen-drückend daher. Er stellt diesen Mann und seinen Kampf ums (Über-)Leben plastisch, realitätsnah so dar, dass Happy stellvertretend für die vielen „Unsichtbaren“ als das wahrgenommen werden kann, was er ist: Ein Mensch wie alle anderen auch mit Träumen, Wünschen, Zielen und nicht einen namenlosen maschinen-ähnlichen Sklaven.

Und Happy rückt vor allem die Beziehung von Happy zu seiner österreichischen Tochter Maya ins Zentrum. Auch wenn er diese nur selten treffen darf, ist sie es, die ihm die Kraft gibt, den ganzen Überlebenskampf auf sich zu nehmen. Um ihren Herzenswunsch zu erfüllen, macht er sogar eine Reise nach Tirol – wo übrigens viel Bollywood-Filme spielen – möglich. Bei der Fahrt mit der schier anachronistischen Zillertalbahn schweben sie in einer aus der Zeit gefallenen Art Traumwelt.
Während Sahidur Rahaman, der Happy verkörpert, ein Top-Filmschauspieler aus Indien ist – einer von den ganz wenigen unter Tausenden Bewerber:innen der wichtigsten (Film-)Schauspielschule, ist seine Filmtochter Maya eine absolute Newcomerin: Shirin Grace Saeedi Razavi stand mit 12 zum ersten Mal vor der Kamera.
In der achten Woche in der „Happy“ in Kinos lief, fand in einem der Säle im Votiv-Kino noch einmal eine Vorführung mit anschließendem Filmgespräch – mit Regisseur und zwei Darsteller:innen statt – dem unguten Beamten Paschner, der Happys Aufenthalts-Akt ignorant bearbeitet – und den er noch einmal trifft, weil der Essen bestellt hat, das ihm der Fahrer liefert, gespielt von Robert Ritter. Eine sehr bewegende Szene, denn Paschner scheint den Fahrer gar nicht zu erkennen – oder will es in dieser Situation gar nicht. Happy sieht ein Foto des Mannes mit dessen Tochter, spricht es an und der Beamte wird traurig, weil er nach der Trennung von deren Mutter das Mädchen praktisch nie sehen kann…
Mit im Kino: Die sehr beeindruckende Maya-Darstellerin, die damals 12-jährige Shirin Grace Saeedi Razavi.

Für den Film hatte der Regisseur und Drehbuch-Autor, der die Idee zu diesem Film seit ungefähr 12 Jahren im Kopf hatte, unter anderem einen jener beiden Schauspieler gewonnen, „die ich immer schon einmal in einem meiner Filme wollte“, Roland Düringer; „der andere ist Robert De Niro, aber der muss noch warten ;)“
Düringer spielt einen windigen, „schlawinernden“ Gebraucht-KFZ-Händler, bei dem Happy sein Moped ersteht. Lilian Klebow spielt eine engagierte Sozialarbeiterin und Flüchtlingshelferin namens Karoline.
Bei den seltenen, berührend-bewegenden Begegnungen von Vater und Tochter spielt ein traditionelles indisches Spiel mit sieben Steinen eine große Rolle: Pittu. Dabei müssen die ungleichen Steine zu einem Turm aufgebaut werden, der meist ziemlich wackelig ist. Den gilt es gegenseitig umzuwerfen und schnellstmöglich wieder aufzubauen.
Sandeep Kumar seiht dieses Spiel stellvertretend für Happys und aller anderen „grauen Existenzen“: Aufbau, Zusammenbruch, wieder Aufbau – und immer sehr wackelig, von neuen Einstürzen bedroht.
Gespräch mit Kumar über seinen Film „Ohne Bekenntnis“ <- damals noch im Kinder-KURIER
Über den Film „Ohne Bekenntnis“ <- ebenfalls im KiKu
Über Kumars Austro-Bollywood-Film Servus Ishq <- ebenfalls noch im KiKu

Auf der ersten der 19 Doppelseiten unterscheidet die Illustratorin und Autorin dieses Bilderbuchs, Tini Malina, ihre Hauptfigur „nur“ durch eine Art rotes Hütchen. Ansonsten schaut Selma gleich aus wie all die anderen achtbeinigen Spinnen und arbeitet im selben Netz. Doch schon auf der folgenden Doppelseite sind Selmas Netze mit ganz anderen Mustern zu sehen. Sie knüpft mit ihren Fäden wahre Kunstwerke.
Doch, was erntet sie von ihren Artgenoss:innen: „Selma, du machst das falsch. In solchen Netzen fängt man keine Fliegen.“
„Aber Selma war das egal“, schreibt die Autorin weiter… „Selma wollte Netze spinnen, die die Pracht des Universums fangen würden.“
Und das eröffnet der Illustratorin die Schaffung solcher prächtigen, ganz un- und außergewöhnlichen Netze – und dir abwechslungsreiche Bilder. Was wären auch viele Bilderbuchseiten mit doch recht ähnlichen Spinnen-Netzen?

Durch herabwürdigende Kommentare ließ sich Selma nicht beirren, sie hatte eines Tages die fixe Idee, ein Netz möglichst nah am Himmel zu spannen, so dass alle Spinnen – und andere Lebewesen – ihr Kunstwerk zumindest sehen könnten. Das war dann doch nicht so einfach – zum Glück, denn das ergibt wieder die Möglichkeit weiterer Seiten mit den kunstvollen Collagen. Samt Begegnung mit einer uralten Spinne, die einen Satz loslässt, der sich aufs erste wie „no na“ liest und doch fast philosophisch klingt: „Nur die Spinne, die riskiert, zu weit zu spinnen, kann herausfinden, wieweit sie spinnen kann.“
Wie weit das geht? Und ob Selms ihr Ziel schafft – das sei hier natürlich nicht verraten; allein schon ihr Bestreben ermöglicht viele weitere Seiten mit teils verblüffenden Bildern – Und gibt dir vielleicht auch den Mut, dein eigenes Ding durchzuziehen, auch wenn (fast) alle anderen rund um dich meinen, dass du „spinnst“ 😉
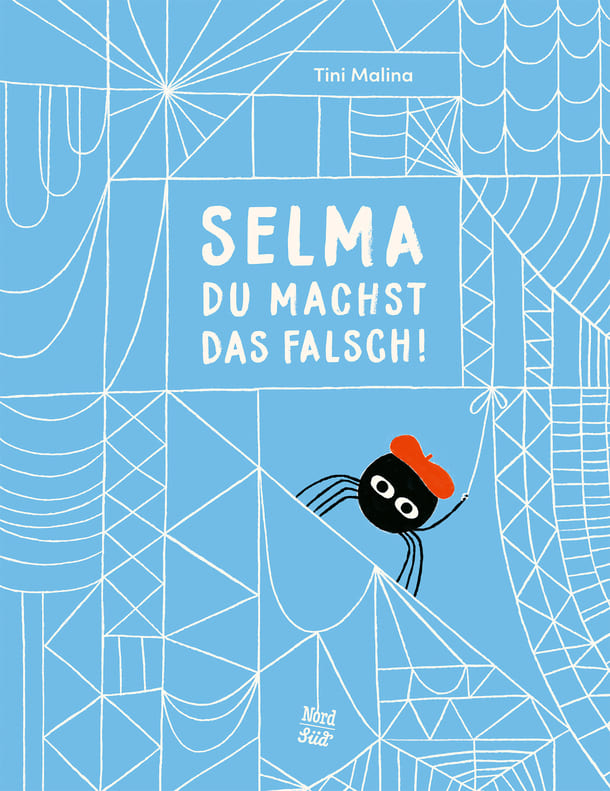

Erst und zweite Ferienwoche in Wien: Kinderuni Kunst, zweite und dritte Woche Kinderuni Wien – an allen anderen Universitäten und dem Fachhochschulcampus -, vierte Woche: Kinder Business Week (KBW). Standen und stehen bei den Lehrveranstaltungen auf der WU, der Wirtschaftsuni, die seit ein paar Jahren auch mitmacht, allgemeine Themen wie Geld, Steuern und so weiter auf dem Programm der Lehrveranstaltungen, so treffen Kinder bei der KBW auf Vertreter:innen von einzelnen Unternehmen und großen Konzernen. Die einen nutzen dies eher als Werbung für ihre Produkte, andere verbinden ihre Kurse nicht nur mit interessanten Fakten über das eigene Unternehmen, sondern auch mit spielerischen Workshops oder Ideen-Findungen zum Prinzip einer ganzen Branche.
So ließ am ersten Vormittag der Online-Vertrieb einer großen Versicherungsgesellschaft die Teilnehmer:innen Gelegenheiten sammeln, wann, wofür oder wogegen sie sich eine Versicherung wünschen würden – gegen schimpfende Lehrpersonen, einstürzende Bauwerke aus Bausteinen…
Mit einem Mineralwasserhersteller, der unter anderem kohlesäurehaltige Wasser mit verschiedenen fruchtigen Geschmacksrichtungen anbietet, konnten die Kinder ohne zu wissen, welches sie tranken, kosten und bewerten.
Manche verblüfften, dass sie eine größere Palette von Produkten anbieten, als gemeinhin bekannt. Ein Beispiel dafür: Teesorten, Knabbberwürstel und ein bekanntes Kakao-Getränk gehören unter anderem zum Portfolio eines Unternehmens, das üblicherweise nur mit Kaffeemilch verbunden ist.
Vom Flughafen über urschnelle Boote bis Bratislava oder den Donauturm mit seinem wohl höchsten Aufzug in Wien erkannten die Teilnehmer:innen rasch, doch noch viel mehr gehört zur Wien-Holding, wie die Kinder in einem weiteren Kurs erfuhren.
Dass ausgerechnet dort, wo’s um IT (Informationstechnologie) ging, die Internet-Verbindung des Computers im Lehrsaal nicht gut funktionierte, lag allerdings an zumindest jenem Teil des Veranstaltungsortes, immerhin dem Campus der Wirtschaftskammer!
Apropos Computertechnologie. Mit einem weltweit bekannten und tätigen Soft- und Hardwareproduzenten drehte sich fast alles um Künstliche Intelligenz. Das Disco tanzende Känguru sorgte allerdings nicht nur wegen seiner Bewegungen und scheinbaren Coolness für Lacher. „Das sind ja Hasenohren“, ertönte es aus den Sitzreihen der Kinder.
Am ersten Tag der Kinder Business Week 2025, der 19. insgesamt, vertraten viele Chefitäten ihre Unternehmen, CEO (Chief Executive Officer), ihre Unternehmen – und da zeigt(e) sich wieder einmal deutlich: Männer-Dominanz.
Einer der bekanntesten am Montagvormittag: Andreas Matthä, der Boss der Österreichischen Bundesbahnen, der bei den ÖBB selbst vor mehr als 40 Jahren zu arbeiten begonnen hatte. Doch er brachte unter anderem vier Lehrlinge – zwei Mädchen und zwei Burschen mit, die allesamt sehr technische Berufe erlernen: Maschinenbau und Mechatronik. Und eine Lokführerin – auch (noch) nicht alltäglich.
Da wollte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte wissen, ob das schon immer von Kindheitstagen an, ihr Traumberuf gewesen sei. „Gar nicht“, beginnt Vera Bauer zu erzählen: „Ich war zuerst Tierpflegerin, spezialisiert auf Pferde. Doch dann war ich auch als Tierpflegerin viel im Ausland, in Spanien, Deutschland, Italien und den USA. Dort ist der Umgang mit Pferden viel gelassener und als ich dann zurück in Österreich war, wollte ich deswegen nicht mehr als Tierpflegerin arbeiten. Ich begann bei den ÖBB – aber zuerst hab ich nur im Caterin, ich hab in den Zügen Kaffee und so verkauft.“ Später wurde sie Disponentin (ein Bürojob zur Einteilung von allem möglichem) und machte die Ausbildung zur Lokführerin. „Das hat mit total mit dem Eisenbahn„fieber“ infiziert. Seit 14 Jahren bin ich nun Lokführerin, vor allem auf der Südstrecke und zum Teil auch im Personennahverkehr in Wien, also auf Schnellbahnzügen.“
Sie sei absolut zufrieden mit ihrem Job, „du bist zwar als Lokführerin allein, aber ich mag diese hohe Eigenverantwortung. Du hast immerhin das Schicksal vieler Menschen in Händen, für die du zuständig bist. Und ich schätze sehr, dass die ÖBB viel Wert auf Sicherheitsaspekte legt. Außerdem triffst du dich darüber hinaus oft und viel mit Kolleginnen und Kollegen. Übrigens habe ich jetzt zwei Pferde!“
Mädchen-Überhang gab es übrigens mit viel umjubelten offiziellen Start der 19. Kinder Business Week nach der ersten Runde an Vorträgen: Zwei Tanz- und Gesangsnummern von und mit Young Republic, eine drehte sich ums Berühmt-werden-wollen.
Reportage aus der ÖBB-Lherwerkstätte am Wiener Hebbelplatz <- damals noch im Kinder-KURIER

Anna-Sousana Savvidou ist ausgebildete Zahnärztin, praktiziert aber nicht, sondern unterrichtet Gesundheitsfächer im Rahmen beruflicher Bildung vor allem für Umsteiger:innen in Thessaloniki.
KiJuKU: Wie kam’s zu Ihrer beruflichen Veränderung?
Anna-Sousana Savvidou: Ich habe nach dem Studium zunächst begonnen als Zahnärztin zu arbeiten, sollte aber nur assistieren. Das wollte ich nicht, sondern habe entschieden, ich will viel von meinem Wissen über menschliche Körper und Gesundheit – von der Anatomie bis zur Makrobiologie – anderen Menschen vermitteln.
KiJuKU: Sind sie Lehrerin geworden?
Anna-Sousana Savvidou: Irgendwie, aber ich vermittle als externe Expertin in einer Bildungseinrichtung für Menschen, die unterschiedlichste Berufe erlernen, Elektriker:innen, Installateur:innen, Friseur:innen, Make-Up-Atists… Viele davon wechseln nicht nur ihren Beruf, sondern verändern auch ihr Leben. Ich habe in meinen Klassen Studierende von 18 bis 55 Jahre. Wobei ich nur Theorie unterrichte. Die Menschen lernen in diesen Einrichtungen zwei Jahre Theorie all jener Fächer, die für ihre Berufe notwendig sind und haben danach sechs Monate Praxis-(Aus-)Bildung.
KiJuKU: Inwiefern spielt Inklusion in Ihrer Arbeit eine Rolle?
Anna-Sousana Savvidou: Zum einen ist schon die altersmäßige Bandbreite wie erwähnt recht groß. Dann sitzen in den Klassen viele, die sich eben neu orientieren müssen oder wollen. Und gerade in Thessaloniki haben wir viele nationale Herkünfte – vor allem aus Albanien, Georgien und Armenien. Außerdem viele verschiedene Religionen und auch sexuelle Orientierung spielt eine Rolle, gleichzeitig herrscht, obwohl wir 2025 haben, noch immer viel Homophobie.

All das muss einerseits berücksichtigt werden und andererseits haben meine Themen ja mit dem menschlichen Körper zu tun. Also gilt es vor allem auch Body Shaming anzusprechen. Dass niemand wegen körperlicher Eigenschaften oder Merkmale beleidigt werden darf. Das gleiche gilt natürlich auch in Identitätsfragen aller Art.
KiJuKU: Was nehmen Sie von dem internationalen Seminar mit?
Anna-Sousana Savvidou: Bis dahin hab ich mich mit Inklusionsfragen meist theoretisch beschäftigt, Fachartikel, Online-Materialien gelesen. Aber nie so etwas gemacht wie die sagen wir „hands-on“-Workshops, wo Dinge zu be-greifen sind durch die Erzählungen und auch Übungen mit Menschen, die unterschiedliche Perspektiven einbringen – einerseits die verschiedenen Teilnehmer:innen, andererseits die Referent:innen. Mich hat vor allem die Tour mit dem ehemaligen Obdachlosen stark beeindruckt, die hat mir die Augen für solche Menschen geöffnet.
Sein und andere Beispiele zeigen mir: Aufhören zu reden, lieber mehr unterschiedlichen Menschen zuhören. Das macht uns zu besseren Menschen, die auch ihre eigene Arbeit besser machen können.
KiJuKU: Efcharistó
Anna-Sousana Savvidou: Parakaló
Beitrag über das angesprochen Seminar sowie die anderen drei Interviews sind hier in der Folge verlinkt.

Die einen fotografieren stolz ihre Kinder oder Enkelkinder auf dem Weg zur Sponsion der Kinderuni auf den Stufen zur großen Universität Wien an der Ringstraße, andere empfangen ihre bereits absolvierten Jung- und Jüngststudent:innen im Arkadenhof und erinnern sich daran, dass sie vor einigen Jahren ihr eigenes (erwachsenes) Studium im selben altehrwürdigen Festsaal ebenfalls zu den Klängen von „Gaudeamus igitur“ (Lasst uns also fröhlich sein!) abgeschlossen haben.
Die Freude und der Stolz sind die gleichen. Nur, dass die Kinder – bevor sie mit Magistra bzw. Magistra universitatis iuvenum (der Kinderuni) belohnt werden – geloben (spondeo) müssen, „nie aufzuhören, Fragen zu stellen“ sowie „nie aufzuhören, Antworten auf diese Fragen zu suchen“. Da reißen praktisch alle Kinder, die meisten in den markanten T-Shirts, heuer in blau, die Arme in die Höhe. Sie versprechen das liebend gern. Und das unterscheidet sie im Übrigen oft von erwachsenen Studierenden, wie Lehrende der Kinderunis immer wieder erfreut betonen: „Die stellen Fragen, bei Erwachsenen dauert es oft lange, bis sich wer in Vorlesungen meldet!“
Nach dem Abschluss des zehnten KinderUNIversums in Waidhofen an der Ybbs in der ersten (im Osten Österreichs) Sommerferienwoche – Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … berichtete, Link unten am Ende des Beitrages und der Kinderuni Kunst, beendete die Kinderuni Wien, die mittlerweile alle Hochschulen – außer den Kunstunis umfasst – den 23. Durchgang. Was 2003 als Pilotprojekt und nur für eine Woche und mit nur einigen Universitäten begann, ist eine fixe Größe im Bildungsangebot für wissbegierige und neugierige Kinder geworden – übrigens ohne Studiengebühren, kostenlos. Rund 4.200 Kinder studierten in einer oder mehreren der 358 Lehrveranstaltungen, die von ca. 700 Wissenschafter:innen gehalten worden waren; einige davon waren übrigens vor gut 20 Jahren Kinderuni-Student:innen 😉
Längst beschränkt sich die Kinderuni Wien nicht auf diese beiden Ferienwochen, die Kinderuni on Tour bringt wissenschaftliche Experimente und dialogische Lehrveranstaltungen in Wiener Parks, nicht zuletzt, um auch Kinder in Grätzeln und Regionen zu erreichen, für denen der Weg zu einer der Unis – nicht nur räumlich – nicht so leichtfällt. Das ganze Jahr über wird Dock am Wiener Donaukanal an der Spittelauer Lände mit Workshops „bespielt“. Spielerisches Lernen, Wissen be-greifbar machen ist sehr oft die Devise.
Apropos, möglichst alle erreichen: der erste Durchgang der Kinderuni Wien-Sponsion – jede Stunde eine Feier – wird seit vielen Jahren immer auch gebärden-gedolmetscht. Heuer übersetzte Katharina Marsh die Reden der Würdenträger:innen in ihren schwarzen, teils pelzbesetzten Talaren – Barbara Bockstahler (Veterinärmedizinische Universität), Elisabeth Haslinger-Baumann (Hochschule Campus Wien), Franz Kainberger (Medizinische Universität Wien), Michael König (WU – Wirtschaftsuni), Kurt Matyas (Technische Uni) und Sebastian Schütze (Universität Wien) -, aber auch Gesang und Musik in die Österreichische Gebärdensprache.
Die Talarträger:innen appellierten übrigens an (Groß-)Eltern, den Kindern nun auch echt Zeit zu Spiel und Erholung zu gönnen und sie ja nicht unter (Lern-)Stress zu setzen. So manche große Erfindung und Erkenntnis sei auch aus vermeintlichem Nichts-Tun und Gedanken frei schweben lassen entstanden.
Traditionell wird auch der erste Durchgang der Kinderuni-Wien-Sponsionen von Medien begleitet. Einer der jüngsten Kinderuni-Studierenden, Oscar, filmte selbst Teile der Zeremonie mit seiner smarten Armbanduhr und präsentierte das Gefilmte stolz seiner Mama im Arkadenhof. Jene Lehrveranstaltung, die ihn am meisten beeindruckt hat, „war die über Bakterien“.
Celina (6) erinnert sich im Gespräch mit KiJuKU vor allem daran, „dass wir mit dem Finger in eine Pflanze fahren und den süßen Nektar kosten durften“. Alexander und Leon fanden die Lehrveranstaltung „mit dem Therapiehund am besten, den durften wir füttern und streicheln“. Für Georg war Highlight „als wir eine Gerichtsverhandlung nachsielen durften, ich war zwei Mal Richter!“
Im Arkadenhof und am Fuß der Uni-Rampe nutzten so manche neuen Absolvent:innen eines der Geschenke des neuen Hauptsponsors (BAWAG) aus, eine Springschnur. Die beiden Schwestern Laura und Emilia hüpfen und können zwischendurch KiJuKU sagen, dass Zweitere (6) „am liebsten den Kurs mit dem Rettungshund gehabt habe und Physik auf der TU, da konnten wir Experimente machen“. Ihre um drei Jahre ältere Schwester: „Ich war heuer schon zum dritten Mal bei der Kinderuni und mir hat am besten der Kurs auf der Boku gefallen, wo wir die Wiese mit Blumen und Insekten entdeckt haben. Vor den Insekten hatte ich keine Angst.“
Als 3-fach-Absolventin hat sie auf ihrer Urkunde nun an den oben schon erwähnten Kinderuni-Magistra-Titel ein „multiplex“ (was dann auch bei noch mehrmaligem Besuch nicht gesteigert werden kann, denn mehr als Vielfach?!) angehängt, beim zweiten Mal gibt’s ein „zum Quadrat“ – was jedes Mal die versammelten erwachsenen Verwandten und anderen Begleiter:innen ziemlich laut lachen lässt, wenn eine der Talar-Personen diese Titel nennt. Darauf lässt sich wetten – wobei, es gibt sicher kaum wen, wer dagegen wetten würde 😉

Diversität und Inklusion – diesem Themenfeld war nun eine internationale Seminarwoche in Wien gewidmet – im Rahmen von insgesamt vier „Mobilitätswochen“ zu inklusiver Bildung in regulären Schulen. Teilnehmer:innen aus Griechenland, Irland, der Türkei und Österreich verbrachten / verbringen je eine Woche in den genannten Ländern bei Partner-organisationen des von der EU co-finanzierten Programms „Tutor“. Wobei der Begriff nicht für die gängige akademischen Lehrkräfte steht, sondern für „Teachers’ Upskilling aiming aT a hOlistic inclusivity in leaRning“ (Lehrer:innen-Fortbildung mit dem Ziel einer ganzheitlichen Inklusivität im Lernen) – was ein bisschen nach einer krampfhaft zusammengebastelten Abkürzung wirkt; aber darum geht’s ja nicht.
In Wien waren / sind ÖJAB (Österreichische Jungarbeiterbewegung) und „die Berater“ gemeinsam Partner des Projekts und waren für das Programm der internationalen Seminarteilnehmehr:innen zuständig. Die Tour „Nimmerland“ mit einem ehemaligen Obdachlosen, Besuche queerer Jugendzentren, einer Buchhandlung für Schwule und Lesben, eine Workshop zu Gender Diversität, ein Besuch des Hauses der Geschichte Österreichs, des Wien-Museums sowie Diskussionen, Workshops und Gruppenübungen zur Reflexion über Erkenntnisse der Besuche, internationalen Erfahrungsaustausch und darüber wie Erfahrenes in Unterrichtspraxis umgesetzt werden könnte, rundeten das Programm ab.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… traf in einer Mittagspause Teilnehmer:innen, von denen sich vier – je einer/r aus den genannten vier Ländern – für kurze Interviews bereit erklärten. Diese finden sich als jeweils eigene Beiträge unten verlinkt.

Kevin Thompson, ist Lehrer für Mathematik und Science an einer öffentlichen Schule der Sekundarstufe (12- bis 18-Jährige) im irischen Portarlington, Irland. „Außerdem hab ich eine Zusatzqualifikation in „Special Education“, damit kann ich Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Bereichen unterstützen – ob beim Lesen und Schreiben, beim Rechnen oder wenn’s um Defizite im sozialen oder emotionalen Bereichen geht.“
KiJuKU: Das heißt, in Irland wird inklusiv unterrichtet und ist das generell so?
Kevin Thompson: In Irland hängt das davon ab, wie eine Schule entscheidet, dass sie dies handhaben will.
KiJuKU: Jede Schule entscheidet das eigenständig, ganz unterschiedlich?
Kevin Thompson: Es gibt schon gesamtstaatliche Richtlinien dafür, aber es soll flexibel auf die Bedürfnisse von Kindern und deren Eltern eingegangen werden.
Ich habe Zusatzdiplome, die mir erlauben inklusiv zu unterrichten. So kann ich Barrieren abbauen und die betreffenden Schüler:innen in der gemeinsamen Klasse betreuen mit ihren Peers, ihren Kolleg:innen, statt sie aus der Klasse rausnehmen zu müssen.
KiJuKU: Aber Schulen können entscheiden, dass sie nicht inklusiv unterrichten wollen?
Kevin Thompson: Ja, und auch wir entscheiden manches Mal so, einzelne Schüler:innen fallweise aus der Klasse zu nehmen und individuell extra zu betreuen.
KiJuKU: Aber es gibt keine Sonderschulen, oder?
Kevin Thompson: Wir haben eine starke Zunahme von Schüler:innen mit Autismus, die eine unterschiedliche, differenzierte Betreuung brauchen. Eine Reihe von Eltern sagen, für ihre Kinder sei es besser sie separiert zu unterrichten und nicht in großen Klassenverbänden. Dort würden sie die ganze Zeit weinen, im anderen Fall gehen sie glücklich in ihre eigenen Schulen. Andere sagen, das sei nicht gut, das wäre Ghettoisierung, Segregation… Es gibt keine Übereinstimmung, was der beste Weg ist.
Aber ich denke, die Wünsche der Eltern müssen genauso berücksichtigt werden. Solange es eine Wahlmöglichkeit gibt, solange wir mit den Schülerinnen und Schülern reden und mit deren Eltern und ihnen ermöglichen, sich den für sie besten Weg auszusuchen, ist es gut und besser als früher, als die Schule die Entscheidungen getroffen hat.

KiJuKU: Sie haben sich erst später, während des Lehrerdaseins entschieden, sich auch in Sachen Inklusion weiterzubilden oder waren schon von Anfang an darauf ausgerichtet?
Kevin Thompson: Zuerst hab ich ein Chemie-Studium abgeschlossen, irgendwann einmal wollte ich nicht mehr in Labors arbeiten. So ging ich zurück an die Uni, machte meine pädagogische Ausbildung und unterrichtete Chemie und Science ein Jahr lang in London. Ich mochte das, aber dann ging ich in die USA, Jahre lang arbeitete ich in einer Spezialschule für Kinder und Jugendliche mit großen Verhaltensauffälligkeiten, darunter vielen Traumata nach körperlichem und sexuellem Missbrauch.
Möglicherweise war es falsch, diese Kinder zu separieren, aber die hatten so große, umfassende Bedürfnisse, dass sie nicht in regulären Klassen sein hätten können. So arbeitete ich letztlich insgesamt 14 Jahre in den USA
mit Kindern und Jugendlichen in Spezialeinrichtungen – zuerst zehn Jahre in Massachusetts in der Nähe von Boston und dann in Portland im US-Bundesstaat Oregon.
KiJuKU: Was hat Sie dann nach Irland gebracht?
Kevin Thompson: Nach 14 Jahren USA – ich bin mittlerweile US-Bürger – wollte ich zurück zu meiner Familie und meinen Freunden. Und so begann ich in einer irischen öffentlichen Schule zu arbeiten. Das hatte ich zuvor nie gemacht. Das mache ich seit zwei Jahren und ich genieße das wirklich – ich mag den inklusiven Ansatz und Zugang.
KiJuKU: Was hat Ihnen bisher dieses internationale Seminar gebracht?
Kevin Thompson: Es ist ein spannendes Programm, wir waren in queeren Jugendzentren, wir haben eine Stadttour mit einem ehemaligen Obdachlosen, einem anarchistisch gesinnten Mann, gemacht.
Ich finde ja, der grundlegende Punkt von Inklusion ist, auf die Stimmen der unterschiedlichsten Menschen zu hören, die Sichtweisen der „kleinen Leute“ wahrzunehmen. Wenn du Minderheiten egal ob Gender, sexuelle Orientierung, Menschen, die nicht in die große Box passen, sicher leben lässt, so dass sie sich sicher fühlen können, dann machst du alle anderen auch sicher.
Besser als spezielle Behandlungen ist es, die gemeinsame Klasse in den Vordergrund zu rücken. Es geht darum, die verschiedenen Perspektiven in unsere Klassen zu integrieren. Dafür ist es oft notwendig, dass die Pädagogik „out-of-the-box“ denkt und handelt.
KiJuKU: Go raibh míle maith agat (Tausend Dank)

Emma Lang ist noch nicht Lehrerin, aber schon im Masterstudium auf Lehramt in den Fächern Englisch und Geschichte in Österreich.
KiJuKU: Spielt Inklusion im Lehramtsstudium eine Rolle?
Emma Lang: Tatsächlich hab ich im Rahmen einer Lehrveranstaltung von diesem Seminar erfahren. Es gibt einige, die sich mit Inklusion beschäftigen. Ich hab’s spannend gefunden, weil es mehr Praxisbezug bietet als die theoretischen Lehrveranstaltungen dazu an der Uni.Und ich hab einen Platz bekommen.
KiJuKU: Hat sich die Erwartung erfüllt? Was haben Sie Neues erfahren?
Emma Lang: Ganz spannend waren und sind die verschiedene Ansichtsweisen, weil eben nicht Uni-Lehrende vortragen. Unglaublich spannend war die Tour mit einem ehemaligen Obdachlosen, der uns durch Wien geführt hat. Da hab ich vieles erfahren, das ich vorher nicht wusste. Und da kriegt man so auch Tipps mit, was man auch mit Schüler:innen machen kann oder könnte.
Auch in dem Buchladen („Löwenherz“ für Schwule und Lesben) war es sehr spannend. Ich hab einfach Neues kennengelernt, auf das ich sonst vielleicht nicht draufkommen würde, weil Vieles davon in der Ausbildung nicht so detailliert vorkommt.
KiJuKU: Hat der internationale Austausch Ihnen auch Neues vermittelt?
Emma Lang: Zu einem gewissen Teil schon, weil für Gruppenübungen schon gesagt wurde: Mischt euch und bleibt nicht in euren nationalen Gruppen. Aber in der Freizeit findet das weniger statt, weil wir alle auch in verschiedenen Hotels untergebracht sind.
Interessant war auch zu erfahren, wie das Schulsystem in anderen Ländern aufgebaut ist und dass nicht nur Lehrpersonen teilgenommen haben.
KiJuKU: Vielen Dank

Mehmet Yılmaz unterrichtet Englisch und Sport im türkischen Antalya, hat aber auch schon unter anderem in Van, im Südosten, dem kurdischen Teil seines Landes gelehrt.
KiJuKU: Wie schaut die Situation in Ihrer Schule bzw. insgesamt in der Türkei aus Inklusion in den Klassen?
Mehmet Yılmaz: Die meisten Schulen sind inklusiv, bei manchen, schweren Behinderungen körperlicher oder mentaler Natur gibt es schon separierte Schulen. Divers sind unsere Klassen vor allem, weil wir viele Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen nationalen Hintergründen haben, Migrant:innen aus Nachbarländern der Türkei. Sicher haben wir auch LGBTIQ-Jugendliche (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender, Intersex & Queers) aber es ist schwierig, solche Themen anzusprechen, weil sich Eltern beschweren könnten, dass wir darüber sprechen. Das ist in der Türkei ein bisschen ein kompliziertes Thema.

KiJuKU: Was hat Sie bewogen, an diesem Seminar in Sachen Inklusion teilzunehmen?
Mehmet Yılmaz: Ich habe keine Ausbildung in diesem Bereich, ich wusste da noch nicht so viel und wollte mehr lernen, wie ich mit unterschiedlichen Schüler:innen umgehen kann, sie besser entsprechend behandeln kann.
Im Bereich Migrant:innen ist es so, dass jene Schüler:innen, die noch nicht gut Türkisch können entweder vor oder nach dem Unterricht in der gemeinsamen Klasse Sprachkurse machen müssen.
KiJuKU: Was nehmen Sie sich von diesem internationalen Seminar bisher mit?
Mehmet Yılmaz: Vor allem Vieles rund um LGBTIQ war für mich neu, da ist die Türkei schon recht konservativ. Dieses Wissen und auch die Erfahrungen der anderen Diskussionen, und Programmpunkte will ich meinen Schülerinnen und Schülern weitergeben. Ich hoffe, ich kann ihnen ein gutes Vorbild für gemeinsames, gutes Zusammenleben geben.
KiJuKU: Teşekkür ederim, spas (Kurmanji, eine der kurdischen Sprachen)
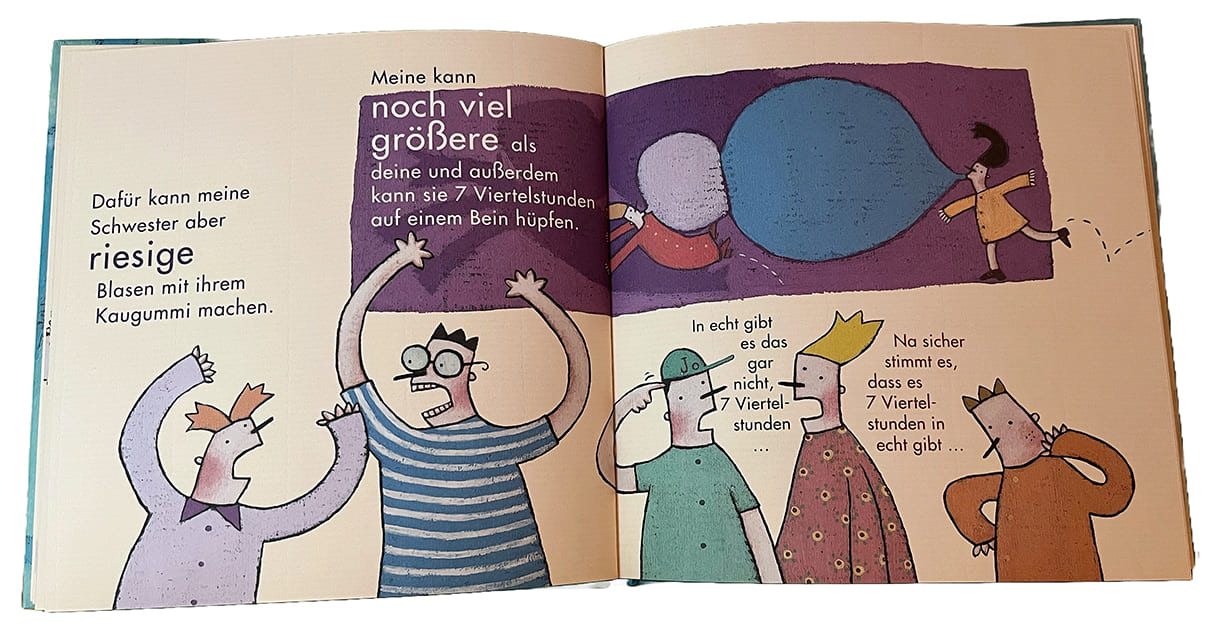
Gleich die erste Doppelseite macht in Wort und Bild deutlich, dass „Die Allertollsten“ nicht von wirklich solchen handelt. Sondern von Angeberei. Beginnt dieses Bilderbuch doch mit „Dafür ist mein Bruder größer als der Eiffelturm“ und einer gezeichneten Figur, die gar nicht mehr ganz auf die Seite passt, um das Wahrzeichen von Paris zu überragen. Der Großspurige reißt dabei die Arme in die Höhe – und den Mund soweit auf, dass er fast halb so groß ist wie sein ganzes Gesicht.
Einer und eine nacheinander versuchen sich in der Folge zu übertrumpfen. Noch dazu gar nicht eigenem Können – nach der Körpergröße, für die sowieso niemand was kann – geht’s ums laute Pfeifen, Kaugummiblasen machen, Weitspucken oder Pipi machen und vieles mehr. Doch stets sind es neben dem Bruder die Schwester, die Oma, die Mama, der Papa, Onkel und, und, und.
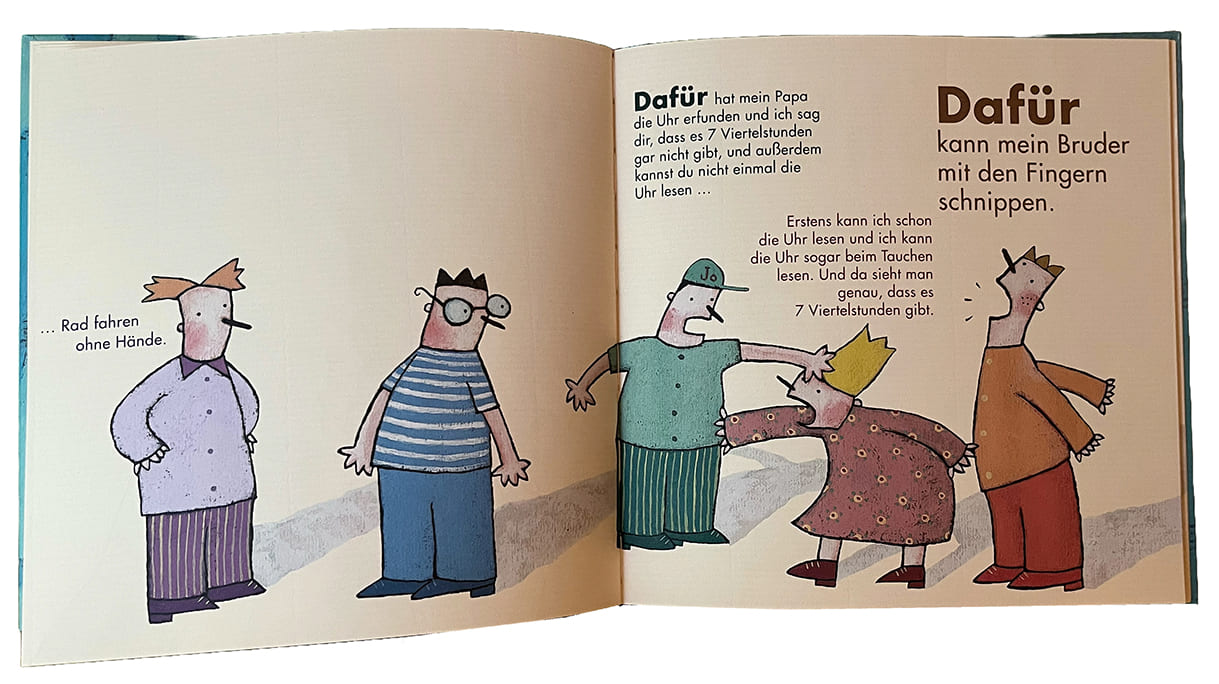
Nur einer steht meistens ein wenig abseits und schaut drein, als zweifle er am Sinn dieser Konkurrenz. Bis auch dieser Figur sozusagen der Kragen platzt: „Dafür kann mein Bruder mit den Fingern schnippen.“
Dafür erntet er nur Verhöhnung, „babyleicht“ und so… Aber immerhin schnippen die nächsten sieben Seiten alle mit den Fingern und noch viel öfter fliegt das Wort „Schnipp“ samt Rufzeichen in unterschiedlicher Größe über diese Seiten.
Dabei bleibt’s nicht. Doch, womit der Außenseiter die anderen wirklich verblüfft … – nein, hier wird nicht gespoilert.
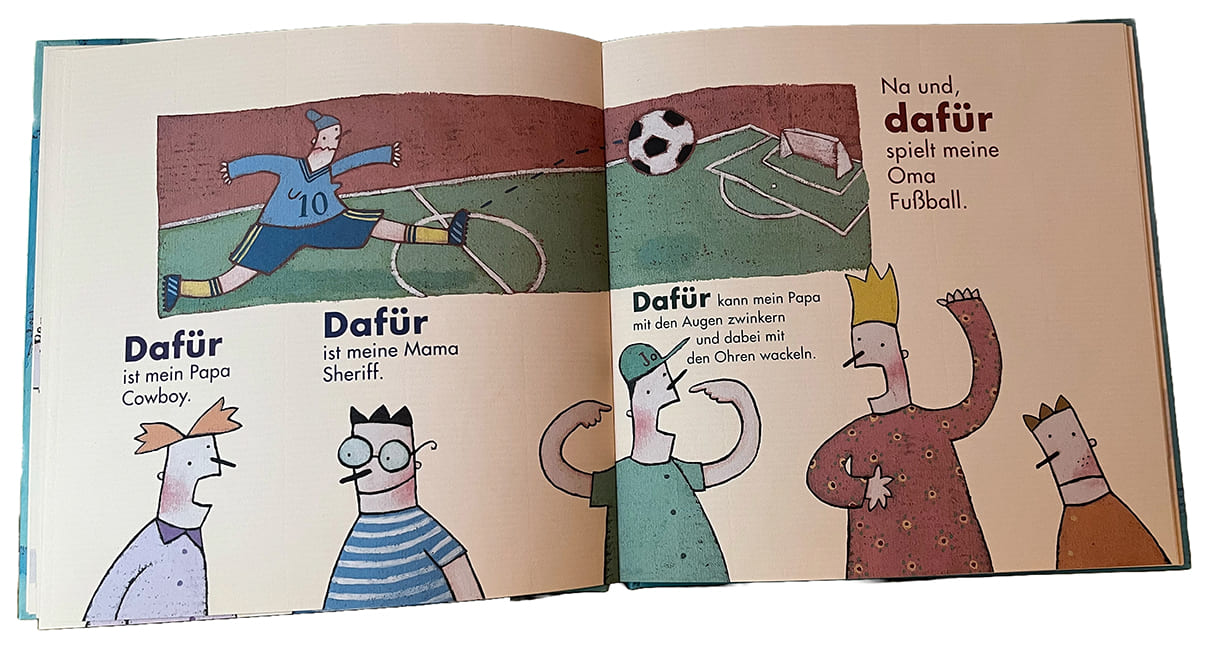
Auch wenn das Bilderbuch schon für sehr junge Kinder gedacht ist – geschrieben von Olivier Douzou (aus dem Französischen übersetzt von Alexander Potyka) – zeigen die Zeichnungen der Figuren, die fast durchgängig eher Erwachsene als Kinder zeigen, wer die wirklichen Prahler:innen und Möchtegern-Übertrumpfer:innen sind 😉
Von Anfang 2018 ist auf etlichen Videos zu sehen, wie Donald Trump damals in seiner ersten Amtszeit als Präsident der USA stolz behauptete „Mein Atomknopf ist viel größer als der von Kim Jong-un“ (Nordkoreas Diktator).
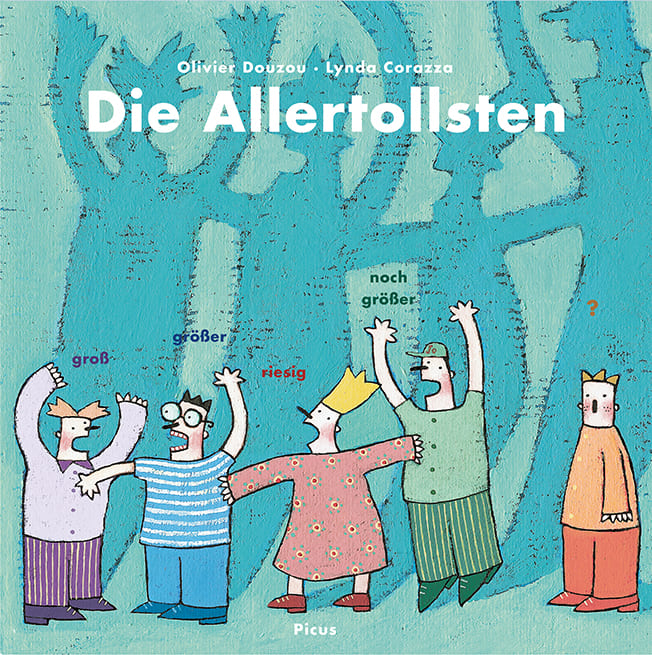
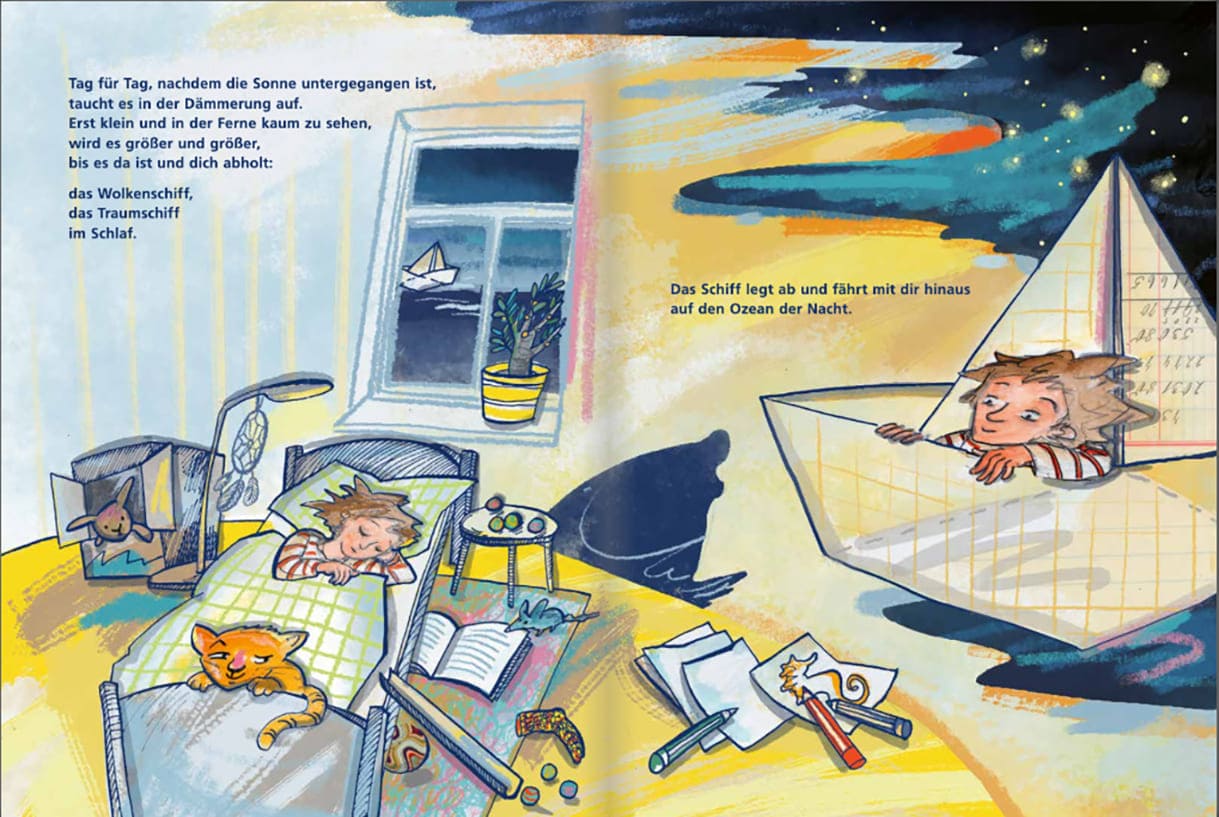
Bilderbücher rund ums Einschlafen für junge Kinder gibt es viele. Oft dreht sich vieles darum, dass Kindern immer noch was einfällt, was sie tun wollen oder müssen, um ja nicht…
Lust auf den Einstieg ins Land der Träume, die Abfahrt dahin und durch die spannenden, bunte Bilderwelt, in der alles möglich ist, macht auch dieses jüngst erschienene von Sylvia Graupner.
„Im Papierschiff durch die Nacht“ hat sie sowohl ausgedacht als auch getextet und gezeichnet. Ein klassisches kariertes Papierschiff – mit einer alt wirkenden Rechnung darauf führt schon auf der Titelseite das Kind mit wehenden Haaren über Wellen durch den Nachthimmel.

Auf der ersten Doppelseite findet sich dieses Schiffchen, nun sitzt das Kind drinnen gleichzeitig mit demselben Kind unter einer – karierten – Bettdecke. Schlaf einer – und Traum andererseits. Die Reise geht weiter inmitten wilder Wellen auf der nächsten Doppelseite, auf der das Kind wie in einem Zirkus durch einen Reifen springt und in der Luft umher wirbelt. Später riesig geworden, den Mond berührt und Abenteuerliches sieht und erlebt – später wird aus dem Schiff – oder ist es ein anderes kariertes Blatt? – ein Papierflieger.
Wie wild auch immer die „Ritte“ durch die oder in der Traumwelt sein mögen, „doch dir kann nichts passieren. Du bist in Sicherheit unter deiner Bettdecke im wild schwankenden Traum“, schreibt die Autorin und Illustratorin auf einer der Seiten.
Und das will sie vermitteln.
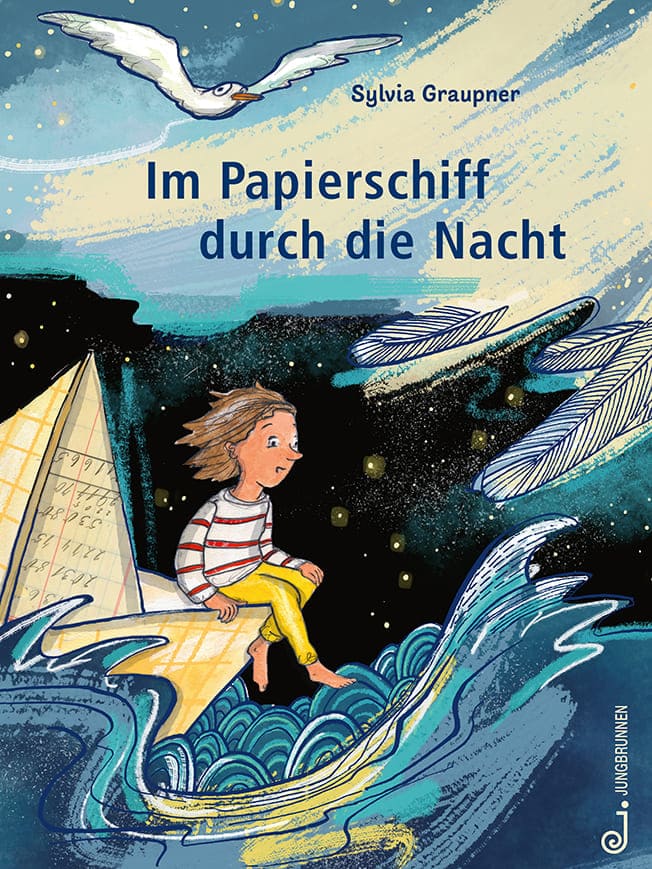

Praktisch zeitgleich mit der Kinderuni-Wien-Lehrveranstaltung zu 80 Jahre UNO – KiJuKU berichtete, Link am Ende dieses Absatzes – startet am 14. Juli 2025 der UNO-Prüfbericht für Österreich. Alle fünf Jahre prüft ein Ausschuss der Vereinten Nationen, wie die Mitgliedsländer die verbrieften Menschenrechte einhalten.
In der ersten Phase ist die Zivilgesellschaft der jeweiligen Länder, die gerade geprüft werden, ihre Sichtweisen an die Welt-organisation zu senden. Aus Österreich fordern mehr als 300 Organisationen gemeinsam, konkrete und zukunftsorientierte Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Kinderrechte, darauf wies die Katholische Jungschar Österreichs (KJSÖ) in einer medien-Aussendung hin.
Die Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit, sowohl in den USA als auch in Europa, werden weitreichende Folgen mit sich bringen. Auch Österreich plant bis Ende 2026 eine Verringerung um fast ein Drittel (32 %), obwohl es bereits vorher auf niedrigem Niveau lag. Die Sparmaßnahmen drohen auf Kosten der Zukunft von Kindern zu gehen und nehmen Kinderarmut in Kauf.
Fast die Hälfte der Kinder auf der Welt – etwa eine Milliarde, also mehr als doppelt so viel wie die EU insgesamt an Einwohner:innen hat – lebt in Ländern, in denen sie in hohem Maße Umweltrisiken ausgesetzt sind. Obwohl Kinder besonders von der Klimakrise und Umweltbelastungen betroffen sind, fehlt in der Politik der Blick auf Kinderrechte.
Die KJSÖ fordert, ökologische Kinderrechte und Generationengerechtigkeit gesetzlich zu verankern und Kinder und Jugendliche aktiv in Entscheidungen einzubeziehen. „Kinder haben ein Recht darauf, in einer intakten Umwelt groß zu werden. Anstatt zu kürzen, muss Österreich hier Kurs halten und echten politischen Willen zeigen“, fordert Martina Erlacher, Bundesvorsitzende der heimischen Katholischen Jungschar.
Das Dreijahresprogramm (2025-2027) der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) berücksichtigt Kinderrechte nur punktuell, obwohl Kinder fast ein Drittel der Weltbevölkerung ausmachen. Die KJSÖ fordert daher ein konsequentes Kinderrechtemainstreaming in der Entwicklungszusammenarbeit. Nur so können die Rechte von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden.
Weltweit müssen rund 138 Millionen Kinder – viele unter gefährlichen und ausbeuterischen Bedingungen in der Landwirtschaft – arbeiten. Das UNO-Ziel, Kinderarbeit bis 2030 zu beenden, liegt in weiter Ferne. Österreich und die EU als zentraler Absatzmarkt von Produkten tragen hier Verantwortung. Für die KJSÖ ist klar: Österreich muss sich entschieden gegen ausbeuterische Kinderarbeit stellen. Ein wirksamer Hebel ist die Europäische Lieferkettenrichtlinie, die aktuell zu einem zahnlosen Papiertiger verkommt.
Österreich hat das Dritte Fakultativprotokoll zur UN- Kinderrechtskonvention bislang noch nicht ratifiziert. Damit fehlt Kindern der Zugang zu internationalem Rechtsschutz. Die KJSÖ begrüßt, dass die Ratifizierung ins Regierungsprogramm aufgenommen wurde. Nun braucht es eine rasche Umsetzung.
„Kinder sind keine Randnotiz. Sie haben ein Recht auf Schutz, Förderung und echte Teilhabe sowie eine gesunde Umwelt – hier und weltweit“, betont Martina Erlacher abschließend und verlangt von der Regierung Vorrang für Kinderrechte.
Umfangreiches Paket der rund 300 österreichischen zivilgesellschaftlichen Organisationen

Nach dem fröhlich-feierlichen Empfang der Friedensradler von der Kinderuni Wismar (Deutschland – Link zu einem Bericht darüber unten am Ende dieses Beitrages) wanderten die Jung- und Jüngst-Studierenden hinein ins Hörsaal-Zentrum zur Lehrveranstaltung „Für Frieden und Zusammenarbeit: 80 Jahre UNO“ mit der Jus-Professorin Irmgard Marboe vom Institut für Europarecht der Rechtswissenschaftliche Fakultät der Uni Wien, die sich auf Völkerrecht spezialisiert hat.
Doch bevor’s los ging, kamen die Jung- und Jüngst-Student:innen zuerst einmal an zwei Tischen mit Karton-Burgen vorbei, die andere Kinderuni-Studierende in einer Lehrveranstaltung über Projektmanagement gebaut hatten. Wobei Burgen ja nicht unbedingt fürs völkerverbindende Miteinander oder Frieden stehen – mit Ausnahme von Schlaining im Burgenland, die seit mehr als 40 Jahren Heimat des Österreichischen Friedenszentrums ist (Besprechung zu einem Bilderbuch rund um diese Friedensburg unten am Ende dieses Beitrages).
Die Friedensradler brachten ihre Fortbewegungsmittel mit in den Hörsaal und wurden zunächst auch hier noch einem mit einem kräftigen Uni-Applaus – auf die Tische klopfen bzw. trommeln – begrüßt. Dann aber konnte die Professorin loslegen – mit einem – fast aufgelegten – Gag in der ersten Präsentationsfolie. Das gleichnamige Kartenspiel vs. weltumspannendes Logo der Vereinten Nationen, also des Vorlesungs-Gegenstandes UNO. Die wurde 1945 als Lehre aus dem mörderischen zweiten Weltkrieg mit rund 60 Millionen Toten gegründet, um künftig Kriege zu verhindern. „Wie können Länder zusammenarbeiten, damit nie wieder Krieg ist und es mehr Gerechtigkeit gibt?“, lautete der Untertitel der Vorlesung.
Auch nach 80 Jahren ist das allerdings leider noch immer nicht gelungen. „Aber wenigstens, so die Überlegung, reden die Vertreter:innen der meisten Länder miteinander“, skizzierte die Völkerrechtlerin den Grundgedanken der UNO, die immerhin in Wien auch mit einigen ihrer Spezialorganisationen einen ihre Sitze – neben der Zentrale in New York sowie in Genf und Nairobi – hat.
Die Weltbevölkerung auf wenige gezeichnete junge Menschen auf einem Kinderspielplatz – mit daneben geschriebenen Gegensatzpaaren wie beispielsweise mit Boot oder nicht als Symbol für Länder, die am Meer liegen und Binnenstaaten andererseits. Die Flaggen aller 193 Mitgliedsländer führte zu einer der ersten Fragen eines Kinderuni-Studenten, ob es auch Länder gibt, die nicht zur UNO gehören und warum. Als Beispiel nannte Marboe Kosovo, „weil es von vielen anderen Ländern nicht als eigener Staat anerkannt wird“. Und schon die nächste Kinderhand in der Höhe und der Aussage eines Kindes, dass dies auch für Palästina gelte.
Wie weit in die Erde gehört Land zu einem Staat wurde gefragt – bis zum Erdmittelpunkt kam die klare Antwort der Vortragenden, die für die folgende Frage wie weit in die Höhe das Staatsgebiet reiche, erklärte, dass die Länder der UNO schon 1957 darüber streiten, ob bis in eine Höhe von 100 Kilometern oder doch weniger. Als eines der Kinder meinte bis weit hinein ins Weltall, konterte ein anderes: „Aber die Erde dreht sich ja und das Weltall nicht.“
Natürlich durften die 2015 beschlossenen allumfassenden 17 Nachhaltigkeitsziele bis 2030 – übrigens sind die Radler von der Kinderuni Wismar bis Wien in 17 Tagesetappen unterwegs gewesen 😉 – genauso wenig fehlen wie der Hinweis auf die Kinderrechtskonvention.
Die Mitarbeit der Kinderuni-Student:innen war hier – wie in praktisch allen anderen Lehrveranstaltungen so intensiv, dass gar nicht alle Fragen bzw. oft auch Ergänzungen, Anmerkungen usw. geäußert werden konnten – die Zeit war zu kurz.
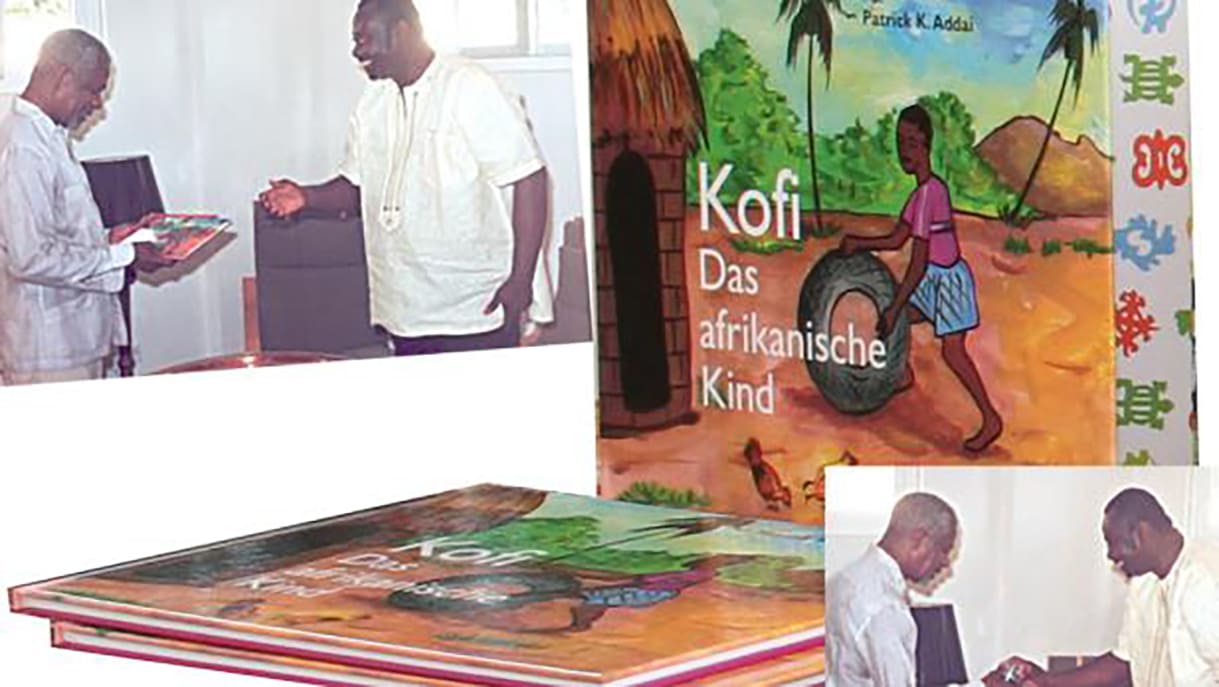
„Kinder von möglichst klein auf zum Frieden zu erziehen, weil wenn sie als Kinder nur Krieg und Gewalt erlebt haben, ist es viel schwieriger, dass sie sich für den Frieden einsetzen!“ Das war eine wichtige Botschaft von Kofi Annan, erzählt Patrick Kwasi Addai bei den Afrika-Tagen (2018 damals dem Kinder-KURIER, wo dieser Beitrag erstmals veröffentlicht worden ist). „Mit ihm hat ein großer Weltbürger leider diese Welt verlassen“, trauerte der oberösterreichische Ghanaer am 18. August 2018.
Kofi Annan war von 1997 bis 2006 Generalsekretärs der Vereinten Nationen (UNO). „Frieden und Bildung war ihm sehr wichtig“, sagt der seit Jahrzehnten in Österreich lebende aus der Gegend von Kumasi in Ghana (so wie Annan) stammende Kinderbuchautor. Am 31. Dezember 2008 hat der Autor den ehemaligen UNO-Generalsekretär in Ghana getroffen. Dort hat er ihm sein Buch „Kofi – das afrikanische Kind“ überreicht. „Damals war es nur in Deutsch, aber seine zweite Frau, eine Schwedin, konnte auch Deutsch.
Inspiriert vom ersten UNO-Generalsekretär aus Schwarzafrika hatte Addai ein Bilderbuch (Illustrationen: Kabu Kabute) über einen an einem Freitag (Kofi) geborenen Buben geschrieben. Der will „unbedingt in die Schule gehen, damit er einmal für den Frieden in der Welt arbeiten kann“.

Wie wichtig Kofi Annan Bildung für alle oder zumindest für möglichst viele Kinder auf der Welt war, zeigt auch sein Engagement für die Initiative „One Laptop per Child“. Gemeinsam mit Nicholas Negroponte vom weltbekannten Massachussetts Institute of Technology stellte der damalige Uno-Chef Mitte November 2005 beim Weltgipfel über die Informationsgesellschaft in Tunis Prototypen dieses Geräts vor. Robust, sogar mit Handkurbel aufladbar so die Hardware. Als Software sollte nur Open Source, also frei verfügbare, benutzt werden. Und via LAN – so die Idee – sollten sie leicht zu vernetzen sein, um über Internet leichter und schneller Zugang zu Bildung zu bekommen. Drei Millionen Kinder, Jugendlich und Lehrkräfte in rund vier Dutzend Entwicklungs- und Schwellenländern lernen und arbeiten mittlerweile damit.
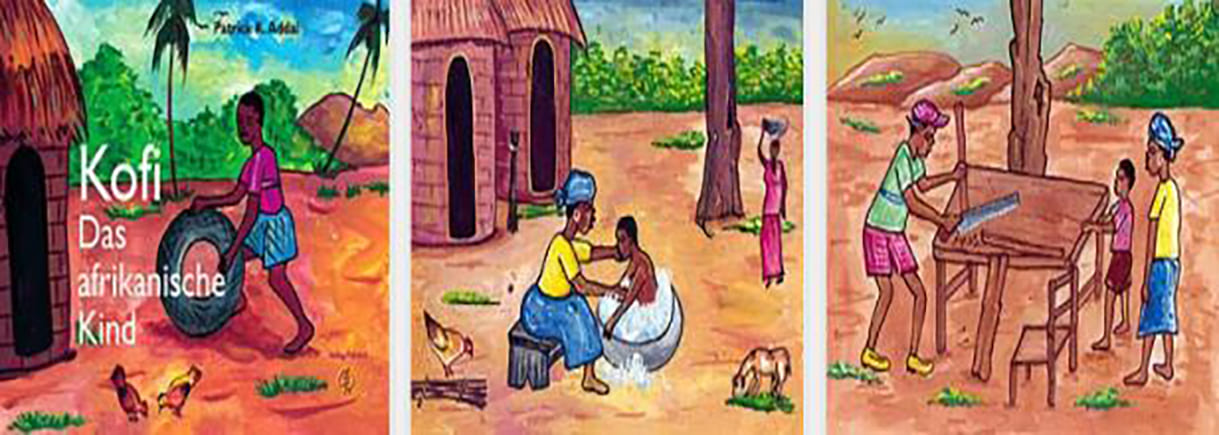
„Stolz ist er darauf, erstmals Schulkleidung aus Baumwolle, genäht vom Schneider Amadu Saani seines Dorfes Dodowa, zu bekommen“, heißt es zu Beginn des oben genannten Buches von Addai über Annan und weiter: „Der Tischler Papa Asanu hat für Kofi bereits die Schulmöbel gezimmert. Weil Kofi noch klein ist, werden ihn seine Mutter und der Tischler begleiten. Der Tischler Papa Asanu will Kofi unbedingt zur Schule bringen, weil er glaubt, Kofi sei noch zu klein, um den Sessel und den Tisch alleine zu tragen.
… Ich möchte in der Schule gut lernen und einmal groß sein wie Kofi Annan, der auch immer für den Frieden in der Welt gearbeitet hat.“
Dieser Beitrag ist – leicht verändert – erstmals erschienen im Kinder-KURIER, August 2018
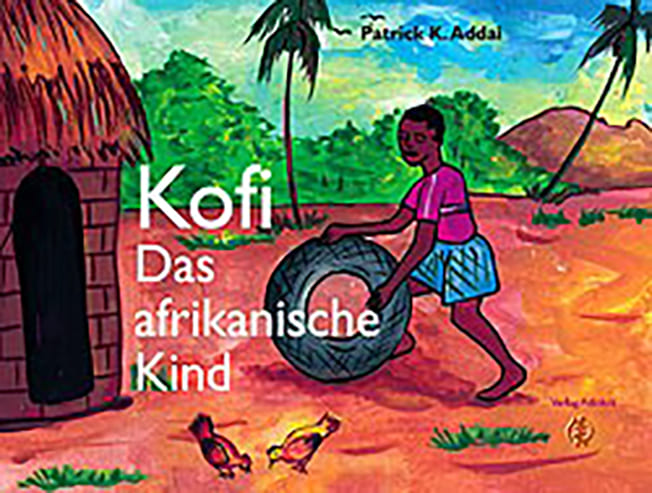

Viele bunte in alle möglichen Richtungen gedrehten Friedenszeichen auf einem orangefarbenem Stoff-Banner, Herzen, Handabdrücke und der Spruch „Kinderunis für Frieden“ sowie zwei große ebenfalls von Kindern farbenfroh gestaltete weiße Plakate mit der selben Botschaft wurden in die Höhe gehalten als Montagmittag (14. Juli 2025) mehr als drei Dutzend Radler:innen in den Hof 2 am Campus der Uni Wien (dem Alten AKH) einfuhren und noch eine Ehrenrunde drehten.
Für ein halbes Dutzend Erwachsene war es die letzte Etappe nach einer 17-tägigen Tour vom norddeutschen an der Ostsee gelegenen Wismar bis Wien. Dort gibt es seit 20 Jahren ebenfalls eine Kinderuni – allerdings nicht in den Ferien, sondern einmal monatlich während des Schul- bzw. Studienjahres (nur neun Monate!). Anlässlich 80 Jahre Ende des zweiten Weltkrieges brachen die Radfahrer zu einer Tour entlang der „Demarkationslinie“ (Kriegsfront im Mai 1945, die später mehr oder minder in dem mündete was als „Eiserner Vorhang“ 1989 fiel) auf. Wien als Endpunkt der Reise wird am Dienstag mit einem Besuch in der UNO-City abgeschlossen.
Die Ankunft im Uni-Gelände war abgestimmt auf eine Lehrveranstaltung zu 80 Jahre UNO, die aus den tragischen Erfahrungen des Krieges mit rund 60 Millionen Todesopfern die friedliche Gemeinschaft der Staaten schaffen wollte – und noch immer will. (Mehr dazu in einem weiteren Beitrag.)
In Wien wurden die rund 1400-Kilometer-Radler von mehr als drei Dutzend Kinderuni-Wien-Kindern und -Erwachsenen von der Spittelauer Lände am Donaukanal (Dock – Ganzjahres-Räume der Kinderuni Wien) bis zum Campus begleitet. Nicht zuletzt diese letzte – gemeinsame kurze Radtour ist die Verwirklichung einer der Forderungen des Kinderbeirats der Wiener Kinderuni. Eine andere wurde schon in einem vorherigen Bericht kurz vorgestellt: Eine Bibliothek. Weiters hatten sich die Kinder einerseits mehr Bewegung und andererseits mehr „wichtige Themen“ gewünscht – Frieden ist den meisten Kindern ein großes Anliegen.
Viel Applaus und großer Jubel für die Radler:innen – in Wien stießen dann nicht nur Männer oder Buben dazu 😉
Und hoher Empfang – durch viele Kindern in den Kinderuni-Wien-T-Shirts, heuer in blau, sowie die Uni-wien-Vizerektorin Christa Schnabl, die Leiterin des UNO-Informations-Services in Wien, Sonja Wintersberger, Karoline Iber (Geschäftsführerin des Kinderbüros der Uni Wien, das die Kinderuni organisiert). Jörg Türmer, der schon bei der Kinderuni in Wismar Lehrveranstaltungen über die EU gehalten hatte und „Initiator und Motor“ der Radtour „bike the line“ (Link zur Homepage am Ende des Beitrages) berichte von berührenden Begegnungen auf der Tour, nicht zuletzt auch mit älteren Menschen, die als Kinder noch den Krieg erleben mussten.
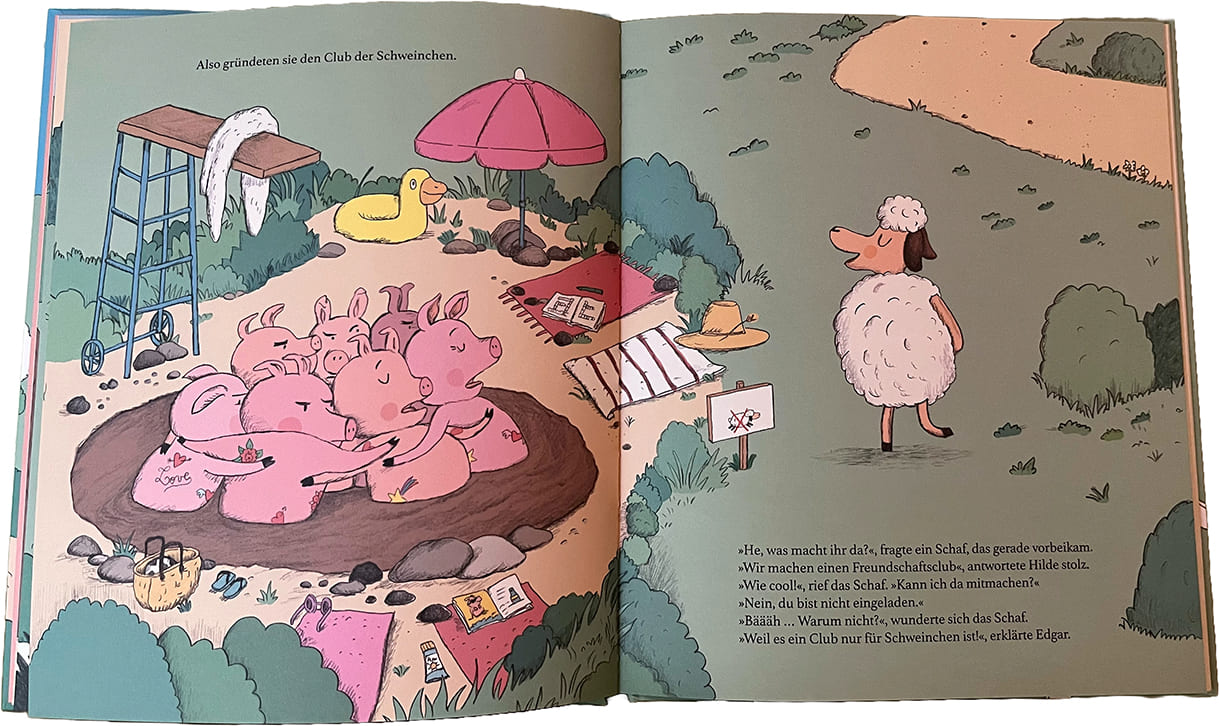
Nach „Wählt Wolf!“ veröffentlichte Autor Davide Cali und Illustratorin Magali Clavelet – im Original in Französisch – nun das Bilderbuch „Der Club der Schweinchen“.
Legte das erwähnte vorige Buch – im Gewand einer Tierfabel – schon sehr jungen Kindern das Prinzip Populismus anschaulich und leicht nachvollziehbar dar, so geht’s im neuen Werk um den widersprüchlichen Mix aus Gemeinschaft einer- und (damit oft) Ausgrenzung andererseits.
Schweinchen Edgar tanzte eines Tages mit einem Herzerl auf dem Oberarm bei seinen Artgenoss:innen an, ein Klebe-Tattoo. Und er hatte viele davon in seiner Tasche. Plötzlich tauchte die Idee auf, die dem Bilderbuch auch den Titel gab: Die Gründung eines Clubs. Bevor sie sich überhaupt noch Gedanken machten, was sie mit der Vereinigung anfangen könnten oder wollten, wiesen sie aber schon ein Schaf ab, das fragte, ob es mitmachen könnte.
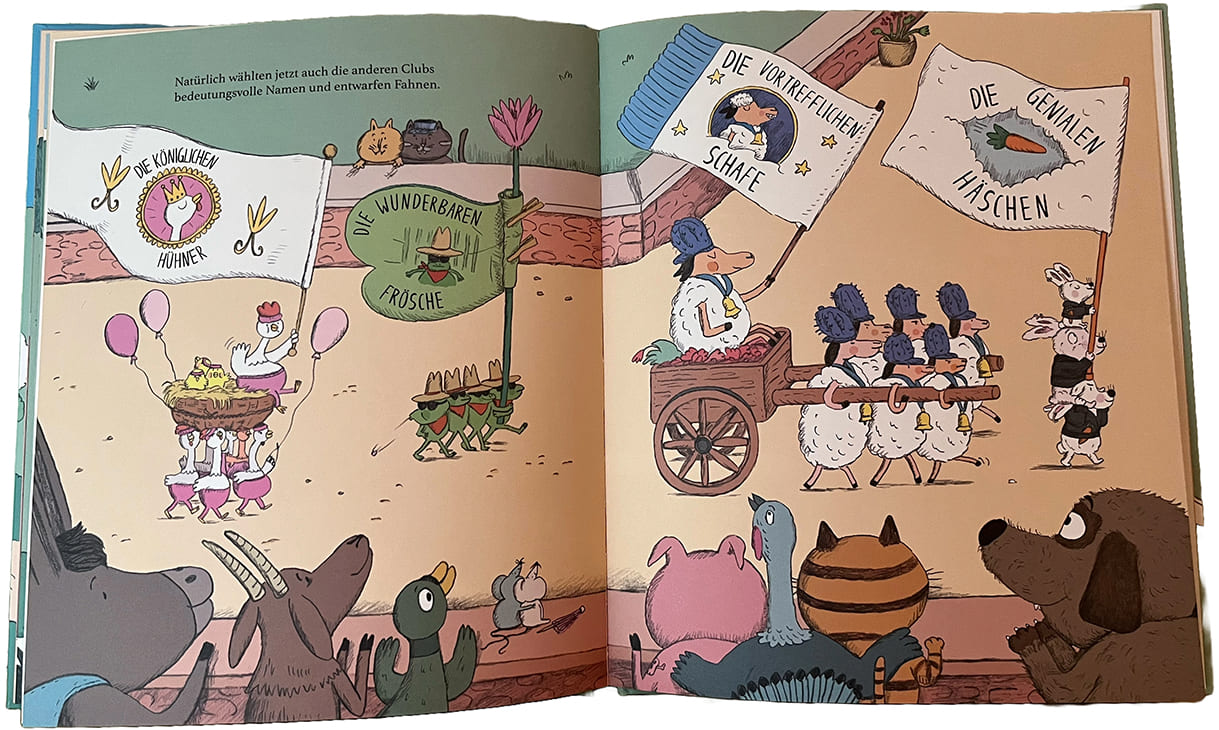
Begründung?
„Weil es ein Club nur für Schweinchen ist!“, erklärte Edgar.
Und so gründeten die Schafe einen eigenen – nichts für Hühner. Und diese wiederum – nichts für Hasen und so weiter.
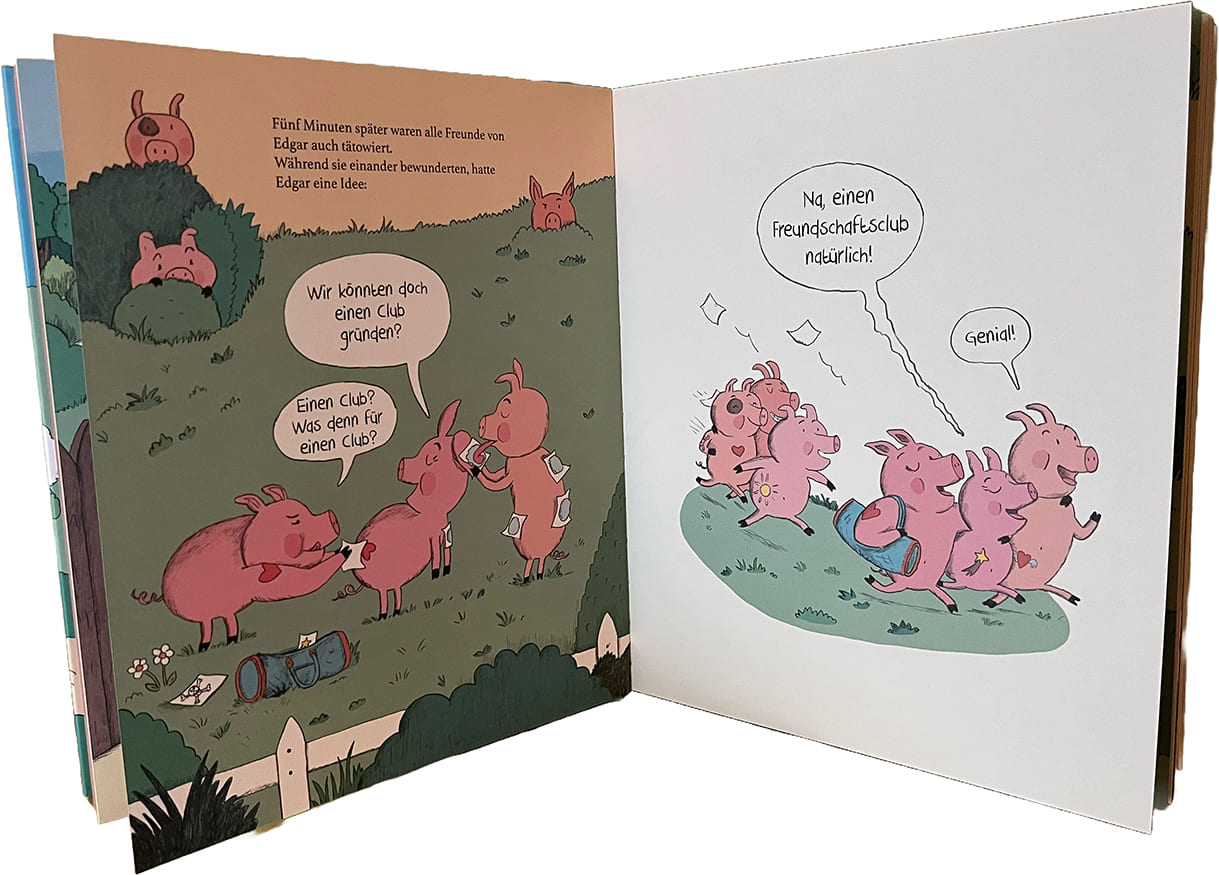
Ungefähr in der Mitte des Buches fragte plötzlich Susi: „Was machen wir eigentlich im Club der Schweinchen?“ – „Hmm… darüber haben wir gar nicht nachgedacht“, gestand Edgar. Und so gaben sie sich einen Namen: Super Schweinchen, entwarfen eine Fahne. Ähnliches spielte sich bei den anderen Tier-Clubs ab.
Und weiter???
Nun, sie nehmen sich kein Beispiel an den Menschen, ziehen nicht in Kriege gegeneinander, sondern … – aber das sei hier nun nicht verraten.
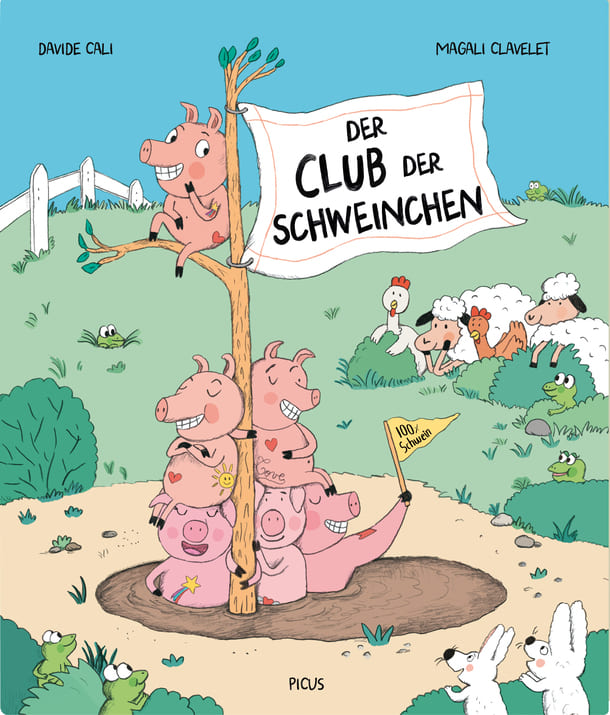
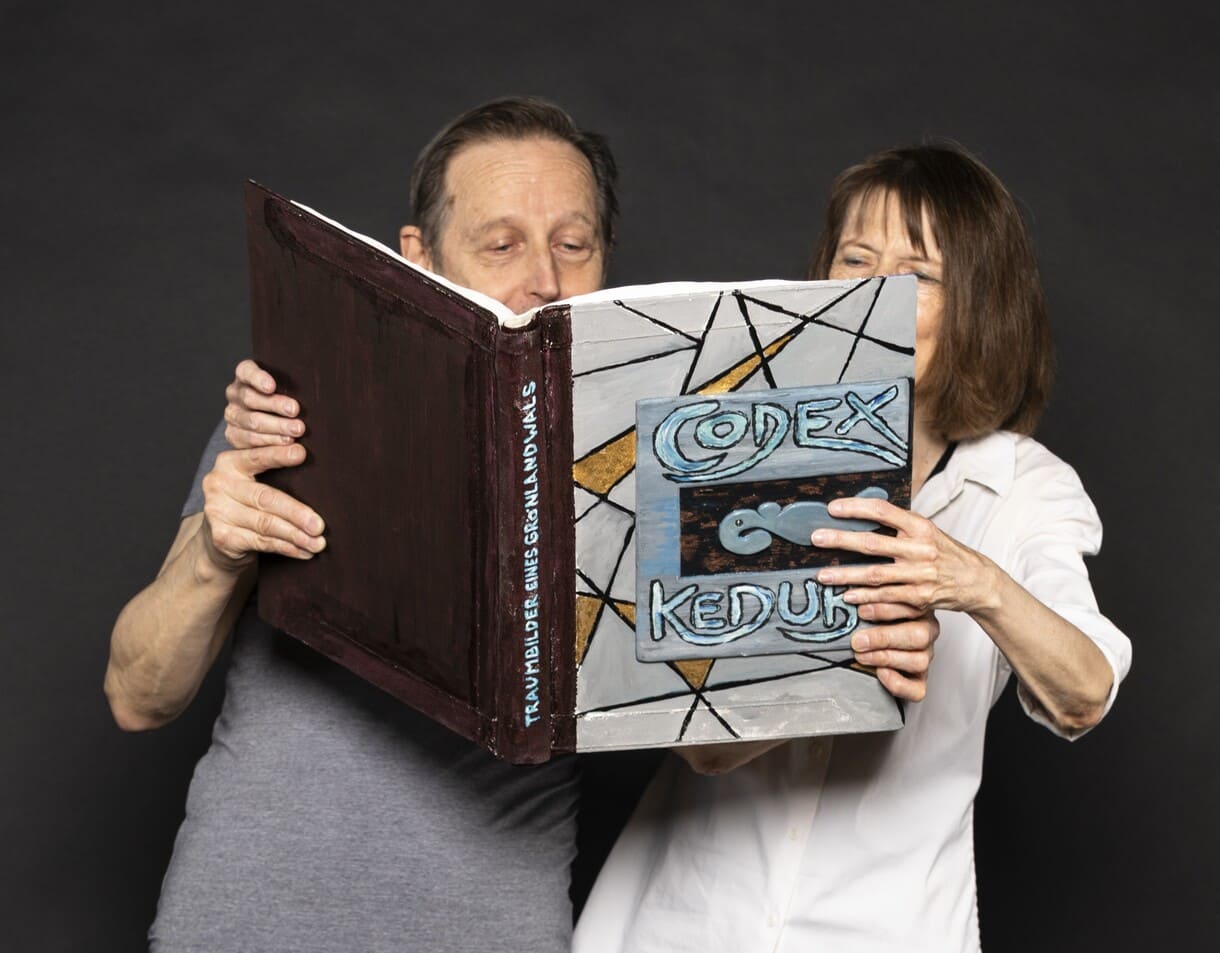
Was vermeintlich wie die Wiedergabe aufgenommener Walgesänge klingt, ist Stimmakrobatik von Evelyn Blumenau. Sie und Walter Kreuz schaffen seit mehr als 30 Jahren als Duo geckoart Performances, kommend vom Theater immer mehr in Richtung sicht- und live erlebbares Hörspiel. Und davon ausgehend viele – auch internationale – partizipative Community-Projekte rund um Radio-machen mit starker sprachspielerischer Komponente.

Kürzlich waren sie im kleinen Kunstraum „Ideenlandebahn“ in der Wiener Aegidigasse mit „Codex Kedube – Traumbilder eines Grönlandwals“ zu erleben. Die beiden sitzen am Tisch, bedienen ein Audio-Mischpult mit dessen Hilfe die eingangs erwähnten Gesänge, die jenen eines Grönlandwales nachempfunden oder umgekehrt von diesen inspiriert sind, zu Gehör gebracht werden. Momente, die dazu einladen, die Augen zu schließen und sich „nur“ aufs Hören zu konzentrieren.
Andere Momente der rund ¾-stündigen Erzählkunst bzw. künstlerischen Erzählung verknüpfen Akustik und Optik – vor allem gegen Ende. Abwechselnd, manchmal chorisch stellen sie die utopisch, fiktionalen Gedanken von Ke-Du-Be vor, einer ausgedachten Unterart der Grönlandwale, die übrigens mit bis zu 200 Jahren die langlebigste Säugetierart der Erde sind.

Dieser Kedube, ein Kunstwort, das – auf Nachfrage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… – nicht wie vielleicht zu vermuten, Abkürzung für Begriffe ist, sondern einzig und allein für dieses aus Gedanken erschaffene Tier ist. Und ein Fantasie-Wesen kann sich natürlich so seine Gedanken jenseits aller Normen und Konventionen machen 😉
Und somit hat Walter Kreuz zehn „Traumbilder“ von Kedube „von der Zukunft abgeschrieben“. Eine Utopie wie sie durchaus so manchem von Menschen immer wieder fantasierten, ja ge- und erwünschten vielstimmigem Einklang aller Lebewesen dieses Planeten nahekommt. Und doch mit weiteren sprach- und gedankenspielerischen Drehungen und Wendungen weitere Gesichts- und Hörpunkte hinzufügt.
Was die beiden performativ lesen bzw. vortragen, in Gehörgänge und Gehirnwindungen des Publikums losschwimmen lassen, hat Walter Kreuz im Sommer des Vorjahres in mehreren Monaten kunstvoll in einem Buch-Unikat niedergeschrieben. Mit Feder und eigener Schrift auf speziell behandelten Skizzenpapier-Seiten, die er zuvor bemalte, was diese wellenartig werden ließ, verfasste er den Text, fügte ihm Tusche-Zeichnungen – von ihm und Evelyn Blumenau hinzu und verschafft jenen, die nach der Lese-Performance mit Fingern über die Seiten gleiten ein zusätzliches haptisches Erlebnis. Die Seiten sind in mehreren Bünden an einen Leinen-Segeltuch genäht und der Einband aus Pappelholz – samt einem Relief des fantasievollen Exemplars einer Kedube – mit Bergkristall-Auge.
Die „Traumbilder eines Grönlandwals“ bauen auf vorangegangenen geckoart-performances auf, wie das Duo erzählt, vor allem der „Grammatik der Stille“, einem mehrtägigen „begehbaren Audio-Feature“ im Theater Spielraum in der Wiener Kaiserstraße.

Mittlerweile schon fast zur Tradition geworden sind diesen besonderen Salzburger Festspiele – nicht in der gleichnamigen Landeshauptstadt, sondern im kleinen Hüttschlag (rund 900 Einwohner:innen) im Bezirk St. Johann im Pongau: Bilingual in Österreichischer Gebärden- sowie deutscher Lautsprache findet nun zum fünften Mal ein visueller Musiktheaterabend im Turnsaal der örtlichen Volksschule statt.
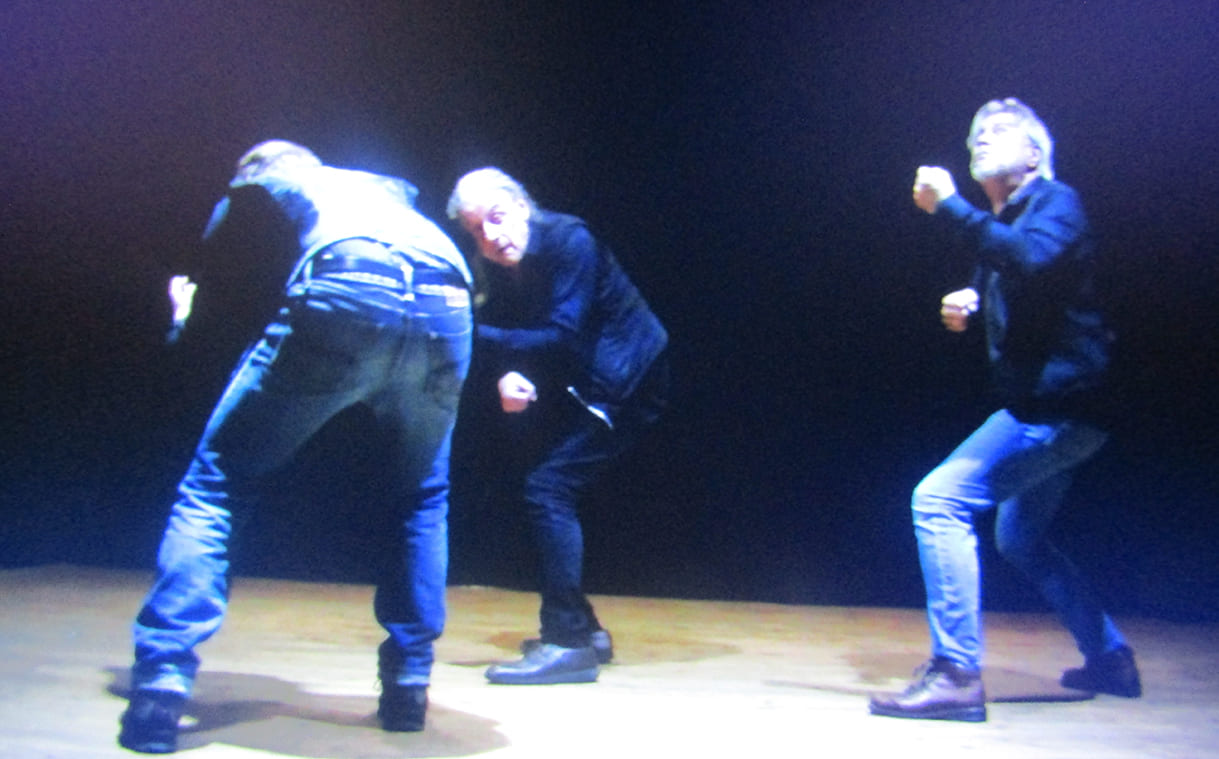
Schauspieler:innen und Musiker:innen gestalten ein vielschichtiges, inhaltsreiches Programm, das sich vor allem gegen Krieg(slust) richtet. In diesem Jahr wird unter anderem „Kriegsschweine“ mit Szenen und Gedichten von August Stramm (Patrouille, Sturmangriff, Kriegsgrab), „Schwarzer Sabbath“ mit Szenen und Gedichten von Giuseppe Ungaretti (Veglia / Nachtwache); Musik von Ozzy Osbourne, Terence Michael Butler, Willaim T. Ward, F. Frank Iommi, „Sabbath blutiger Sabbath“ mit Szenen und Gedichten von Paul Scheerbart (Kriegstheater) und den schon Genannten inszeniert.
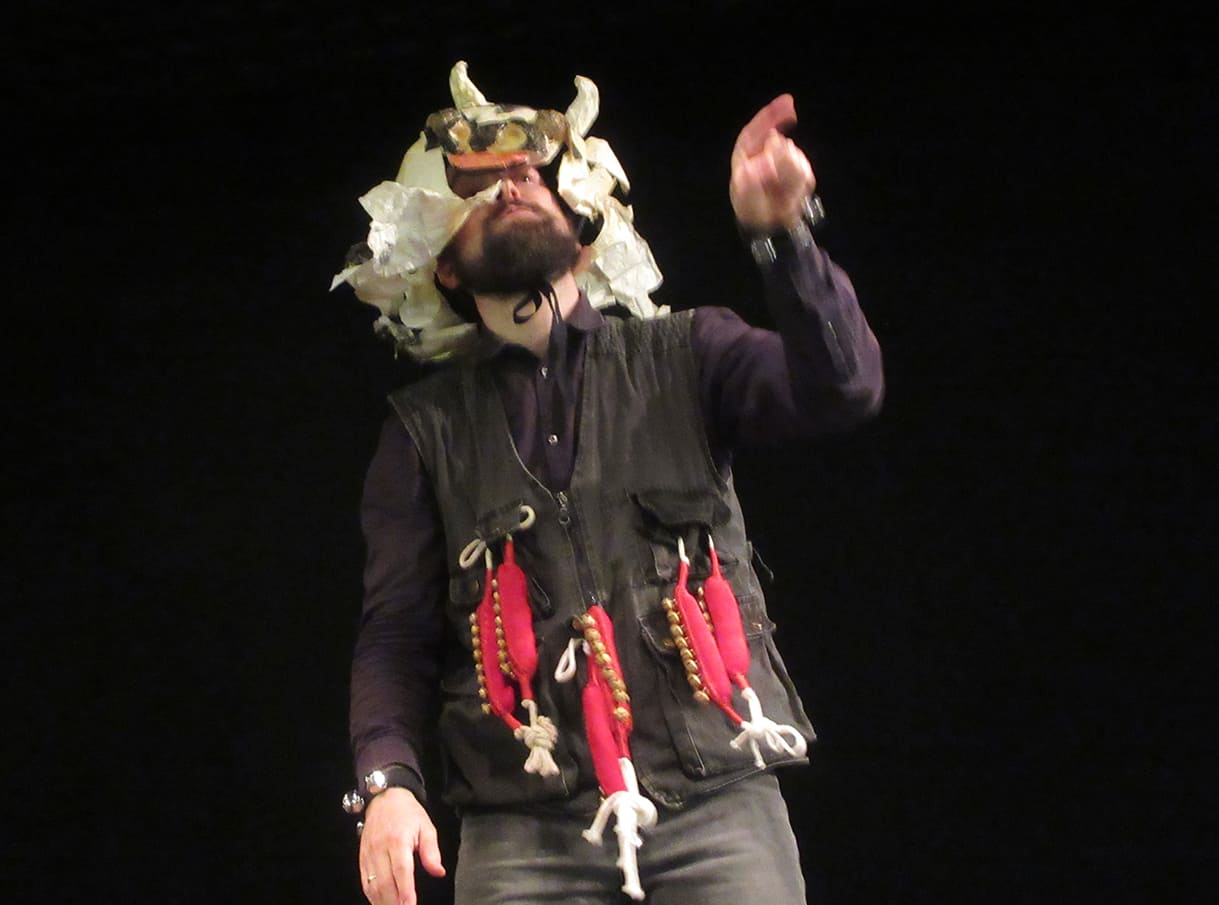
Ferner wird unter dem Titel „Wir genießen die himmlischen Freuden“ visuelles Theater und Musik in Bewegung nach Gustav Mahlers vierter Symphonie bearbeitet für Stimme, Kammerensemble und Gebärdensprach-Chor komponiert von Werner Raditschnig gegeben – mit Werner Mössler, Markus Rupert, Markus Pol und Rita Luksch; für die Musik sorgt das arbos-ensemble: Thomas Trsek (Violine), Nicola Vitale (Klarinette, Saxophon und Bass-Klarinette), Bojana Foinidis (Akkordeon) und Adi Schober (Schlagwerk); Kostüme und Objekte: Burgis Paier; Regie: Herbert Gantschacher.

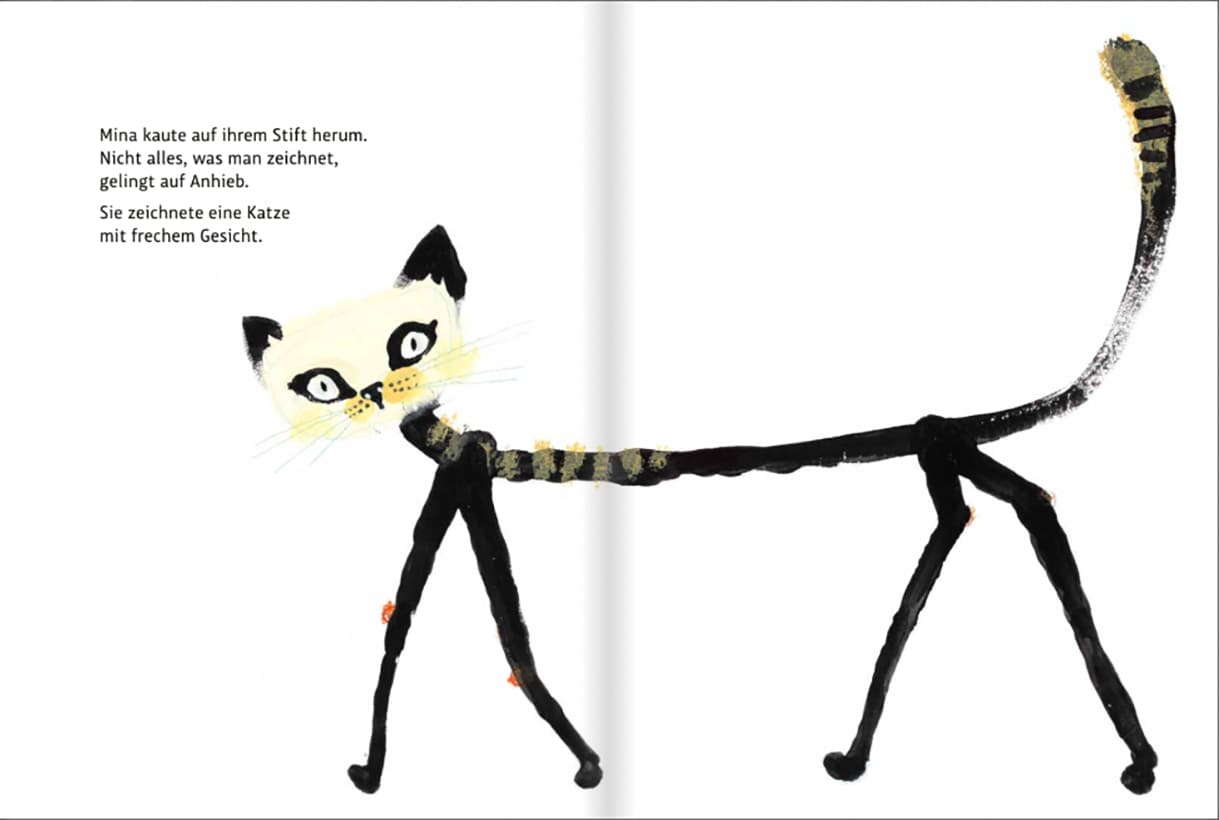
Als wär’s tatsächlich ein erster Versuch einer gezeichneten Katze, erstreckt sich diese ausgewachsene Strichfigur über die zweite Doppelseite (siehe Bild oben) dieser kunstvollen Einladung zur eigenen Kreativität.
Die Geschichte, geschrieben von Claudia Gürtler, beginnt damit, dass Mina, ein Kind, zu Weihnachten als ihr letztes Geschenk ein „dickes Buch mit leeren, weißen Seiten“ und „dazu eine Schachtel mit Stiften, Farben und Pinseln“ auspackte. Und große Freude daran zu haben schien.
„Nicht alles, was man zeichnet, gelingt auf Anhieb. Sie zeichnete eine Katze mit frechem Gesicht“, steht dann neben der eingangs beschriebenen Zeichnung. Renate Habinger verknüpft die zwölf Doppelseiten von „Farbe, Eule, Stift und Katze“ hinweg elaborierte künstlerische Zeichnungen mit kunstvoll gestalteten Elementen, als wären diese erste Malversuche.
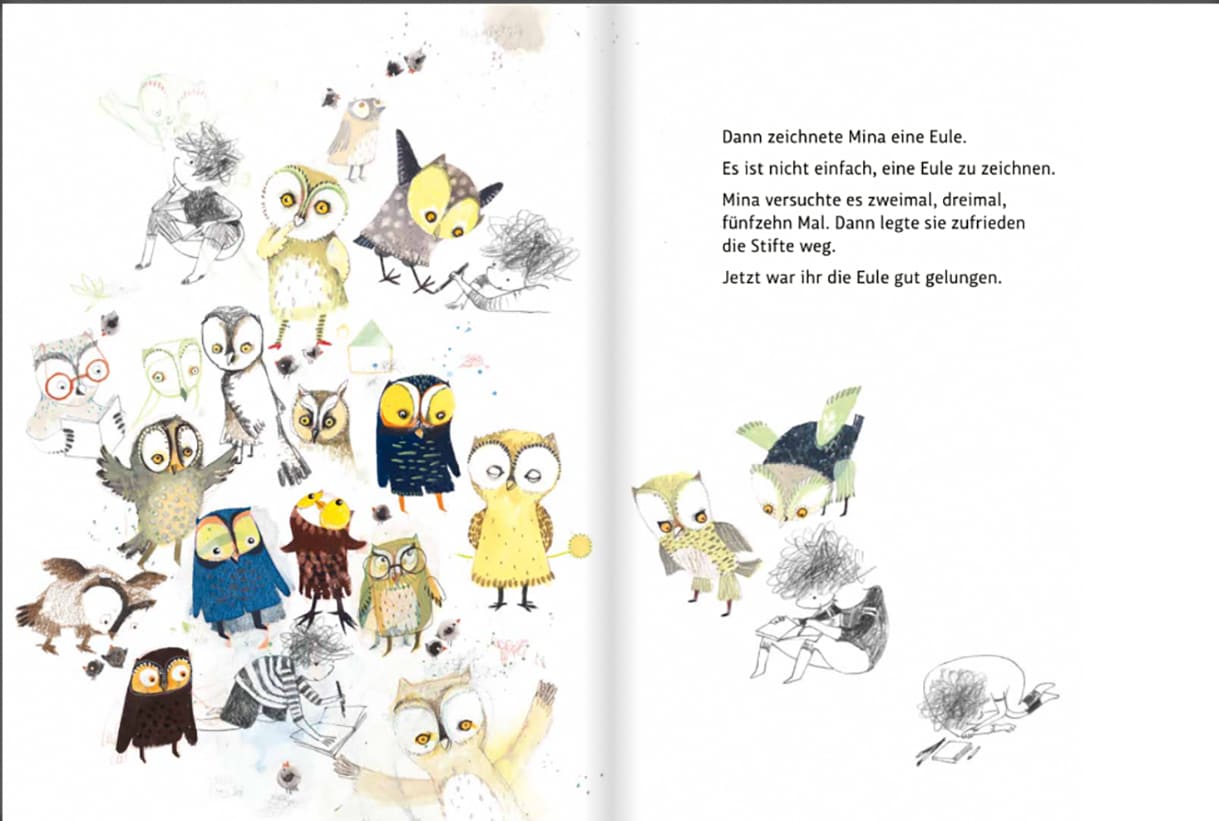
Damit nimmt das Buch von vornherein all jenen Angst, selber zu malen oder zeichnen, denen eingeredet wird: „Das kannst du nicht“ oder die sich das selber vorsagen. Und dieses Bilderbuch animiert durch die Geschichte des offenbar sehr jungen Kindes Mina alle, die es lesen oder vorgelesen bekommen, sich mit Stift und Pinsel eigene fantasievolle Bild-Geschichten auszudenken.
In diesem Buch spielen neben Katzen natürlich – wie der Titel besagt – Eulen eine große Rolle – und die scheinen von Mina erschaffen, dann doch auf den Seiten die sie gestaltet ein Eigenleben zu entwickeln. Wie das recht oft auch bei Schriftsteller:innen und Illustrator:innen vorkommt, wenn diese ihren Figuren Freiraum für ihre Entwicklung geben.
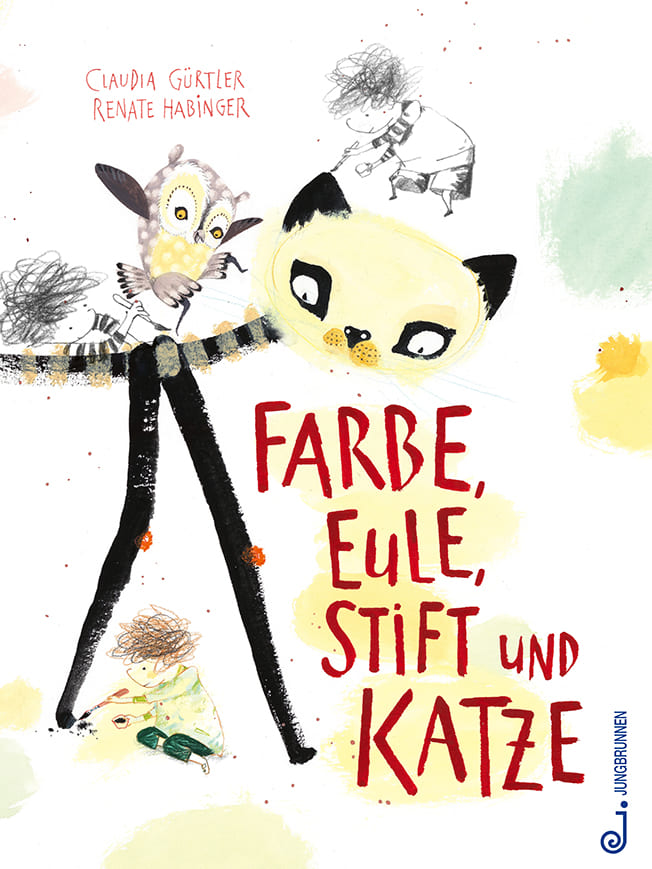

Zirkus im Doppelpack. Als Clown mit buntem Hemd und orangefarbenen Crocs stets auf der Jagd nach Beifall aus dem Publikum, das er dazu immer wieder, teils massiv, animiert zeigt Philippe Ducasse in „Ah Bah Bravo!“ Kunststücke wie Jonglieren mit bis zu fünf Bällen, balanciert einen langen dünnen Stock, den einige Kinder im Publikum zunächst für einen Riesen-Zauberstab halten, sogar im Handstand mit seinen Füßen und einen Hulla Hoop-Reifen rund um seinen weit nach hinten gestreckten Po.
Was bei der Kultursommer-Wien-Bühne am Nordwestbahnhof (warum vom Mortarapark in den beiden vergangenen Jahren, den die lokale Bevölkerung ohnehin gut besuchte, abgegangen wurde, war nicht wirklich in Erfahrung zu bringen) nicht beim ersten, und nicht einmal beim zweiten Versuch, sondern erst im dritten Anlauf klappte.
Aber so ist live nun einmal – oder war’s sogar geplant. In so manche Zirkusarena dieser Welt gehen hin und wieder Tricks zunächst bewusst schief, um die Schwierigkeit erst recht zu unterstreichen.
Im Hintergrund auf der Bühne selbst hängt schon ein – ganz unüblich – schwarzer Vorhang und die – noch nicht leuchtende – Schrift „Pupa Circi“ (Zirkuspuppe oder Puppen-Zirkus). Ein solcher löst den eben beschriebenen akrobatischen Clown-Auftritt – oder clownesken Akrobatik-Act ab.
Michael Pöllmann, Leiter des Marionetten Theaters Schwandorf (Deutschland) führt den frech dreinschauenden Igel Riccio Ricci an Fäden an einem Holzkreuz in die „Manege auf der Bühne“. Der – nicht der Puppenspieler, sondern der Igel – bleibt nicht der einzige, wenngleich alle kommenden Figuren auch ihre Solo-Auftritte haben. Riesen-Stoffschlang Agatha Magnolia erobert praktisch die gesamte Bühne, Stinkwanze Stepolino wandert an den Fäden gar durch die Publikumsreihen, während Adelheid, die rosa spinnenbeinige Königin der Lüfte geschickt als Seiltänzerin balanciert.
Die ungewöhnlichste der Figuren – alle erdacht, entworfen und geschickt und bespielbar gebaut von Scarlett Köfner – ist eine Geige namens Ann-Sophie. Die Musik dazu spielt allerdings eine solche aus Fleisch und Blut: Johanna Kugler live in einer Ecke der Bühne sitzend – und nicht nur während des Auftritts der Marionetten-Geige, die übrigens noch eine kleine Baby-Geige aus ihrem Umhang hervor„zaubert“.
Die Live-Musik erfolgt im Duo – neben der Geigerin sitzt Bläser Daniel Moser, der abwechselnd Saxofon, Bass-Klarinette und Holz-Querflöte spielt.

Schmale geschwungene Papierstreifen meist in Pastellfarben liegen bereit. Der Reihe nach holen sich Kinder in einem der vielen Kurse der Kinderuni Kunst, in denen mit Papier gearbeitet wird, solche. Bella, Sebastian und Linna lassen sich gleich zu Beginn von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nicht nur auf die Finger schauen, wie sie geschickt mit Hilfe einer Art Stift mit gespaltener metallspitze einen Streifen nach dem anderen dort einzwicken und kleine Röllchen drehen. Diese kleben sie auf ihre Zeichnungen. Ganz unterschiedliche. Sebastian und Linna haben beide jeweils einen Dinosaurier gezeichnet, Bella eine Figur mit gelber Krone auf dem Kopf. „Nein, Prinzessin oder Königin will ich nicht sein“, stellt sie aber gleich einmal klar.
Welche Bilder auch immer mit Bleistift gezeichnet wurden, sie werden nun nach und nach mit den Röllchen vollgeklebt womit sich ein 3D-Bild ergibt. „Quilling“ heißt diese Technik, die offenbar vom englischen Wort unter anderem für Feder kommt – wie die eingedrehten Metallband-Federn in einem Uhrwerk.
Anregungen finden sich in einem bunten Buch mit hochkomplizierten Kunstwerken in dieser Technik neben den vielen bunten Streifen, die sich die Jung- und Jüngst-Studierenden holen. Sarah lässt sich von der Rückseite des Buches, einem ausgefeilten Mandala inspirieren – und erhält von Claudia-Eva, der Leiterin dieses Workshops, den Tipp, dass die Streiferln nicht unbedingt nur kreisrund aufgewickelt werden müssen, sondern durchaus auch in Form von Blütenblättern – was für einige der inneren Elemente des Mandalas sogar besser passen wird…

Vielfältig sind die Techniken und Kunstsparten, in denen sich Kinder von 6 bis 14 Jahren – und das nicht nur im Haupthaus, der Universität für Angewandte Kunst, sondern in zahlreichen anderen Kunst-Einrichtungen „austoben“ können. „Viel spannender als in der Schule“, fällt in einem der Kurse die Bemerkung mehrerer Kinder, weshalb sie gern in den Sommerferien solche Workshops besuchen.
Beim Lokalaugenschein beschränkte sich KiJuKU in diesem Jahr dennoch nur auf „die Angewandte“. In einem anderen Gebäudeteil im ersten Stock haben Teilnehmer:innen unterschiedlichste „Tiefseemonster“ gezeichnet, die einen ließen sich von echten Tieren – Riesenquallen, Anglerfischen, Aalen und weiteren inspirieren, andere schufen Fantasiewesen unter Wasser. Und die Zeichnungen, so zeigen James, Megan, Valentino, Luise, Victoria und noch weitere Student:innen, „werden dann von uns gebaut. Holz-Kreuz um die herum Draht gebogen ist, stehen schon auf den Tischen. Stunden später werden die Kinder Gipsbandagen darum herum wickeln, um aus den zweidimensionalen Zeichnungen dreidimensionalen Skulpturen zu schaffen.
Ganz anders geht’s in einem der Dachgeschoßräume zu. Gruppenweis schlüpfen Kinder in die Rollen von Spinnen, Schnecken, Schildkröten. Inspirationsquelle für das hier entstehende Theaterstück in Kooperation mit der Schauspielakademie Stanislavski ist „Tranquilla Trampeltreu“. Der berühmte Autor Michael Ende (u.a. Momo, Die unendliche Geschichte…) hat vor mehr als 50 Jahren die Geschichte über eine Schildkröte dieses Namens geschrieben, die zum Hochzeitsfest von Sultan Leo, dem 28., aufbricht und unterwegs von anderen Tieren belächelt wird, weil sie ja so langsam dahinschreitet. Sie kommt dennoch rechtzeitig zum Fest an, allerdings bereits von Leo, dem XXIX (29.) 😉
Das – ursprünglich von Marie-Luise Pricken und später von anderen Künstler:innen – Michael Bayer / Julia Nüsch / Manfred Schlüter illustrierte Bilderbuch gab es schon in unterschiedlichen Bühnenversionen, unter anderem einer Kinderoper (Komponist Wilfried Hiller) – in der Leo der König der Tiere, also ein Löwe ist. In der kinderunikunst-Version ist es Königin Leonie, die zum Fest einlädt. Und da ist die Schildkröte auch nicht die Langsamste, Schnecken wundern sich sogar über das rasend schnelle Tempo der Schildkröte.
Ebenfalls im Dachgeschoß darf KiJuKU begeisterten Maler:innen ein wenig zuschauen – und zuhören über verschiedene höchst kreative Titelvorschläge für schon fertige Bilder im Ersatzkurs für eine erkrankte Workshopleiterin. „Plantschen mit Farben“ nannte sich das, was offenbar weit mehr als ein Ersatz wurde und viel Spaß bereitete. „Frittiertes, mutiertes, genmanipuliertes Kaninchen mit lackierten Gelnägeln“ war dann das Ergebnis für eines der Bilder, das noch den Namen Jeffrey bekam.
In einem geräumigen Gangabteil werken die einen an großen Kartonteilen, andere an Stoffstreifen, dritte positionieren sich auf großen Würfeln, proben Auf- und Abgänge. Plötzlich taucht einer der KinderuniKunst-Studierenden mit burgzinnen-artiger Gesichtsmaske auf. „Das ist aber nur Teil von… wart ich zeig’s dir“, und schon stemmt er eine große Kartonburg in die Höhe und wandert mit dieser den Gang entlang. Viele der anderen Teile wirken robotermäßig. Und genau das sind sie – nach und nach entstehen in „Robot Rock“ ein Roboter und verwandte Figuren und Objekte – die letztlich alle für die Gestaltung eines Musik-Videos …
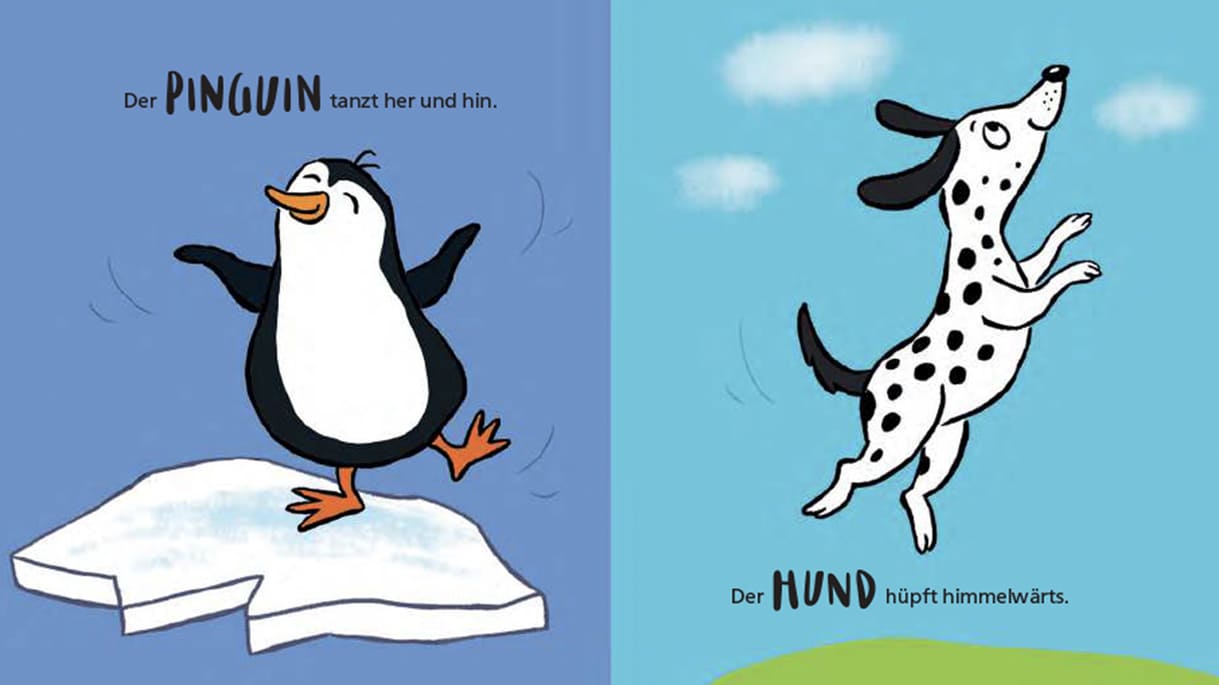
Vom Pandabären über einen Orca, Zebra, Katze, Pinguin, Hase und noch so manche Tiere tanzen, springen, schwimmen fröhlich über die bunten Seiten. Sogar „das Stinktier riecht nach Blütenduft“.
Ein lustig sich bewegendes Tier (Illustration: Birgit Antoni), ein passender kurzer Satz (Text: Lena Raubaum) dazu lassen die jeweilige Freude aus dem quadratischen hand- und reißfesten Buch auf seine Betrachter:innen und (Vor-)Leser:innen überspringen. Warum die alle so gut drauf sind?
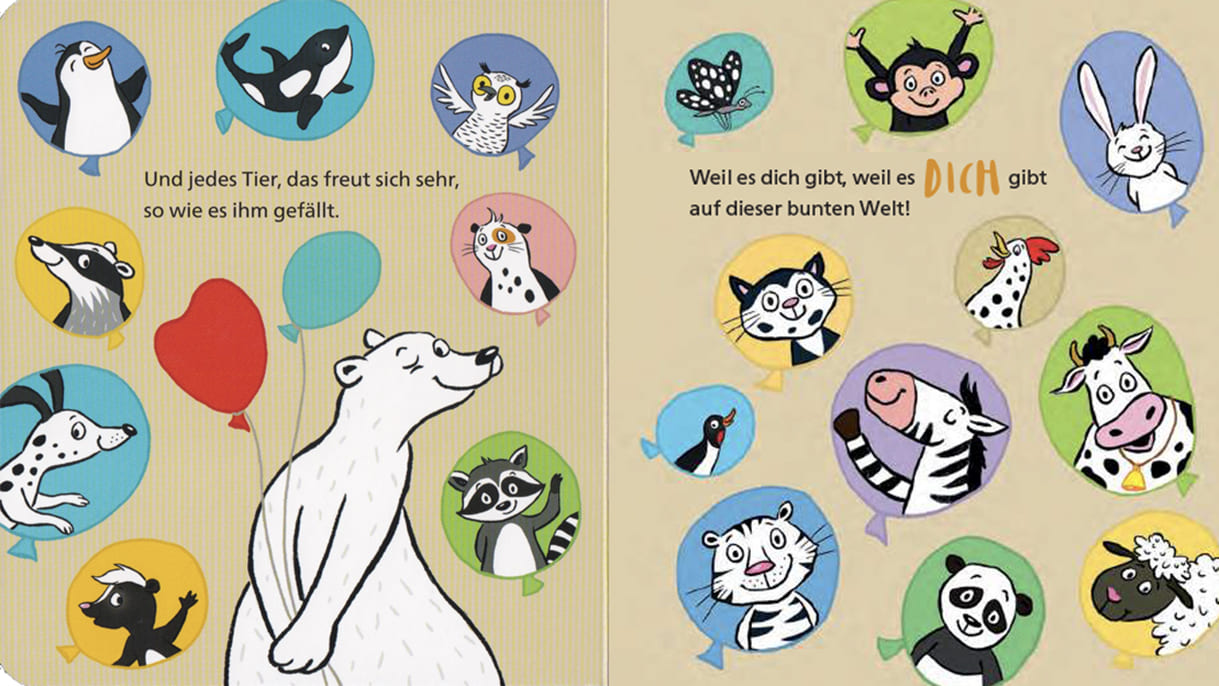
Das steht im Titel – und geballt noch einmal auf der letzten Doppelseite – ausnahmsweise wird hier einmal der Schluss gespoilert – weil es eigentlich ohnehin um jede einzelne Seite – und noch viel mehr, die vielleicht in deinem Kopf entstehen werden geht: „Weil es dich gibt“… „auf dieser bunten Welt!“
Wenn der große, kleine Schmerz kommt oder schon da ist, kann dieses Papp-Bilderbuch Trost spenden. Aber auch ganz einfach so schafft es das kleine und doch so große Buch vielleicht sogar Älteren ein stilles oder auch lautes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und auch in nicht gerade zu Optimismus Anlass gebenden Zeiten ein positives „ach ja“ in Hirn, Herz und Bauch zu rufen.
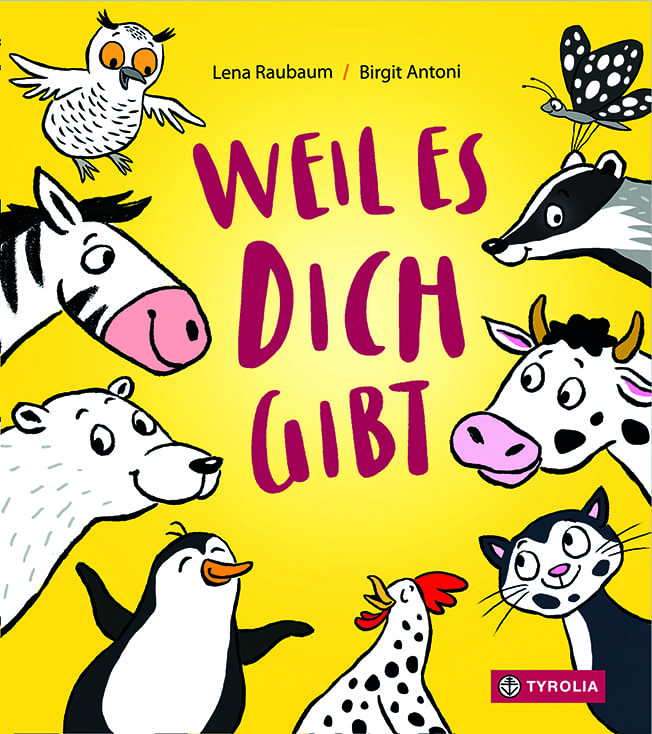

Doch bevor es zur ersten Vorlesung in den C2 im Hörsaal-Zentrum am Campus der Universität Wien – für jahr(zehnt)elange Wiener:innen im Alten AKH – ging, brauchte es „natürlich“ eine offizielle Eröffnung.
Zum ersten Mal seit fast einem ¼-Jahrhundert musste diese – aufgrund des Regens – aus dem Hof nach innen ausweichen. Dort ging es auf Stiegen und Gängen dicht gedrängt zu wie vielleicht in einem Ameisenhaufen. Könnte sein, dass diese Tiere in der einen oder anderen der fast 400 Lehrveranstaltungen für die rund 4000 jungen und jüngsten Studierenden (7 bis 12 Jahre) an praktisch allen Wiener „hohen Schulen“ (samt Fachhochschul-Campus) – an den Kunst-Universitäten läuft diese Woche auch noch die kinderunkunst – eine Rolle spielen werden 😉
Und noch eine Premiere gab’s im 23. Jahr der ältesten Kinderuni Österreichs: Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ist so jung (32), dass sie als Kind, wäre die Oberösterreicherin damals in Wien gewesen, Studierende an der Kinderuni sein hätte können. Sie durchschnitt gemeinsam unter anderem mit dem Rektor der Wiener Universität, Sebastian Schütze, sowie dem Vertreter des Sponsors (auch eine Neuheit: Bawag), Enver Siručić (Präsidenten des Bankenverbandes und stellvertretenden CEO – Chief Executive Officer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied – der BAWAG Group) das rote Band. Erstmals übrigens kein Kind mit Schere mit dabei ;(
Deutete der Titel der ersten Lehrveranstaltung in diesem Sommer – zwei Wochen lang warten Lehrende aus allen Fachbereichen darauf ihr Spezialwissen mit Kindern zu teilen – darauf hin, dass Quantenphysik ein doch recht kompliziertes Fachgebiet ist, so verblüfften viele der Jung- und Jüngststudierenden nicht nur mit Fragen, sondern schon mit Vorwissen. Kaum stellt der Lehrende, Markus Aspelmeyer (Fakultät für Physik) eine Frage, schon schossen Dutzende Arme in die Höhe. Eine Studierende bekam ihren fast nie herunter, auch wenn sie (zu) selten drangenommen wurde. Die eine oder der andere war hingegen sichtbar überfordert und freute sich mehr über das Ende der Vorlesung.
Bevor direkt ins Thema eingestiegen wurde, gab’s einige Minuten zum Grundsätzlichen von Wissenschaft und Forschung und der Herangehensweise, zu schauen ob eigene Theorien mit der Wirklichkeit, mit der Natur in diesem Fall übereinstimmen. Und der im speziellen Fall recht jungen Erkenntnis, dass sich Licht einigermaßen wie Wellen verhält und doch aus Teilchen besteht. Apselmeyer brachte auch einen Photonenzähler, den der „Papst der Quantenphysik“, Anton Zeilinger, erfunden hatte. Er bekam übrigens vor nicht ganz drei Jahren den Physik-Nobelpreis. Klick, klick, klick – wenn der Unilehrer die Hand von der Abdeckung weggab und Licht drauf stieß – und bei besonders viel Licht gingen die einzelnen Laute in ein Dauergeräusch über.
Und doch lässt sich vieles noch gar nicht erklären, eröffnete der Wissenschafter den Kindern – mit der Perspektive, dass möglicherweise die eine oder der andere später sich auf dieses Fachgebiet spezialisiere und Forschung weitertreiben könnte 😉
Ach ja, zurück zum Titel dieses Beitrages: Aspelmeyer projizierte eine Zeichnung, in der viele Menschen einen Hasen und noch mehr eine Ente zu erkennen glauben, um zu erklären: Wir haben noch nicht einmal eine Sprache dafür, dass Licht beide Eigenschaften, die von Welle und Teilchen, besitzen, als müsste ein Wort für diesen Entenhasen oder diese Hasenente gefunden werden.
Im Erdgeschoss des Hörsaal-Zentrums steht neben dem Info-Point ein Bücherregal. Daneben sitzen Kinderuni-Studierende gemütlich auf dem Boden. Buchstaben auf einer Schnur zeigen, was zu sehen ist: Bibliothek. Seit einigen Jahren gibt es einen Kinderuni-Beirat aus – genau! – Kindern. Im Vorjahr wurden Kinder speziell um ihre Meinungen gefragt – und neben viel positivem Feedback wurde auf einen Mangel hingewiesen: Jede Uni hat eine Bibliothek, die Kinderuni hatte da noch keine.
Und weil aller Anfang schwer ist, steht schräg gegenüber ein Tisch mit einigen Büchern und einem Hinweisschild: Tauschregal – samt der Bitte um Bücherspenden für die Erweiterung dieser Bibliothek.
Zwar gibt es – neben den Wegen zu den Lehrveranstaltungen samt so mancher Stiegen – und Spiel und Bewegungsangeboten von wienXtra im Hof oder dem Spielplatz einen Hof weiter am Uni-Campus – den kritischen Kindern aus dem Vorjahr zufolge zu wenig Bewegung. Mehr wichtige Themen war ein weiterer Wunsch.
Beides wird in diesem 23. Jahr kombiniert: Kommenden Montag „landet“ in Wien eine Rad-Tour der Kinderuni Wismar (Deutschland), die eine Friedensfahrt von der Ostsee weg organisiert. Die fährt entlang des einstigen „Eisernen Vorhangs“ unter dem Motto „bike the line“ nun bis Wien. Vom DOCK an der Spittelauer Lände am Donaukanal, einem Ganzjahresangebot der Kinderuni Wien, wir dann, begleitet von Wiener Kinderuni-Studierenden bis zum Campus geradelt – bis zur Lehrveranstaltung „Für Frieden und Zusammenarbeit: 80 Jahre UNO“, gehalten von der Juristin Irmgard Marboe.
Übrigens: Auch wenn die meisten Lehrveranstaltungen längst ausgebucht sind, es gibt immer wieder noch den einen oder anderen Restplatz – auf der Website – Link am Ende des Beitrages.
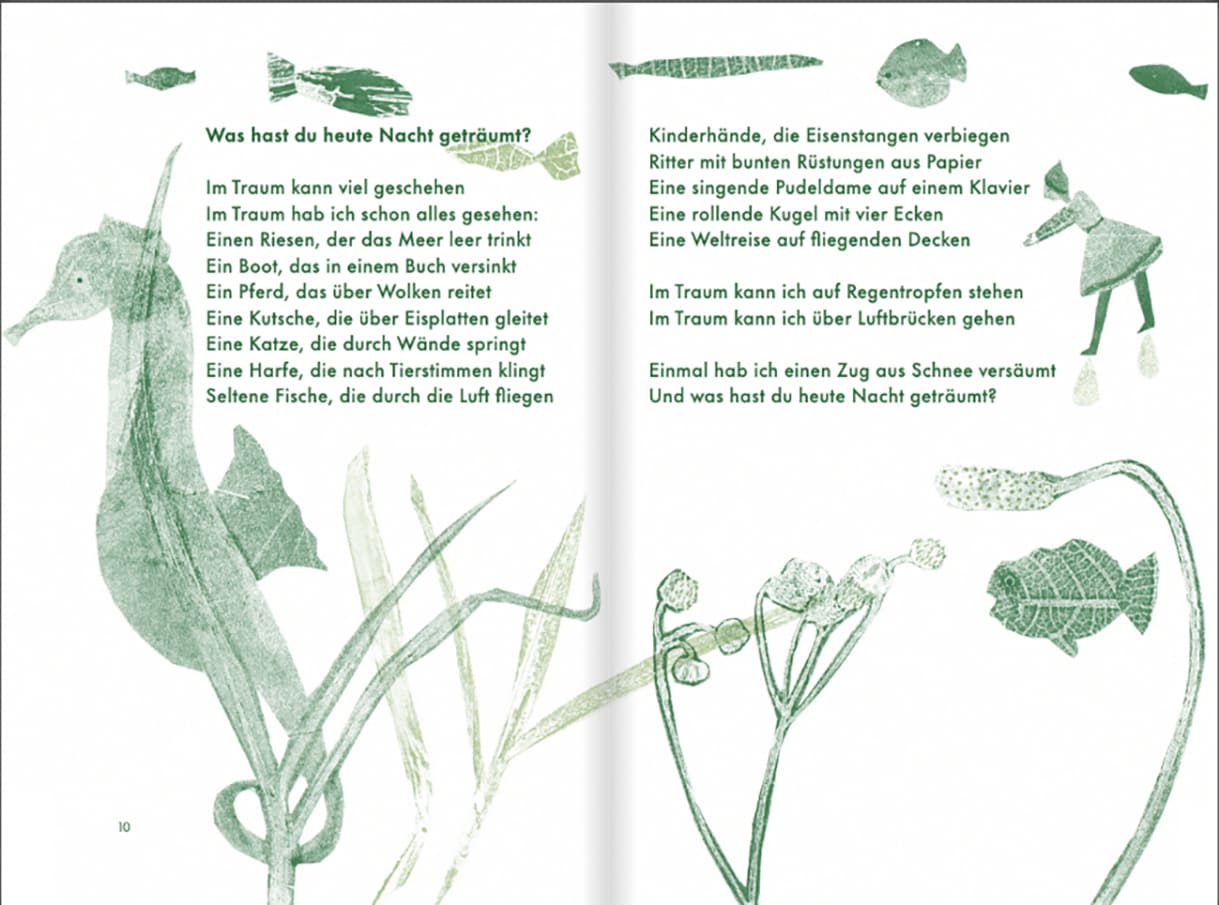
Der Zauberer
steckt
seine schlechte Laune
in die linke Hosentasche
Und zaubert
aus der rechten
ein fröhliches Lachen hervor
Dieses siebenzeilige Gedicht auf Seite 54 bringt vielleicht am besten die Grundidee dieses wunderbaren Bandes der beiden preisgekrönten Kinderbuch-Künstler:innen Heinz Janisch (Text) und Linda Wolfsgruber (Illustration) auf den Punkt. „Ich freue mich furchtbar sehr“ versammelt auf fast 90 Seiten meist in sehr wenigen Zeilen große Geschichten, die allen Widernissen der Welt zum Trotz positive Momente ins Zentrum rücken. Und so riesig machen, dass sie – nein, nicht das Schlimme der Welt vergessen, aber Hoffnung vermitteln. Und dies weder zwanghaft, noch aufgesetzt oder gar pathetisch.
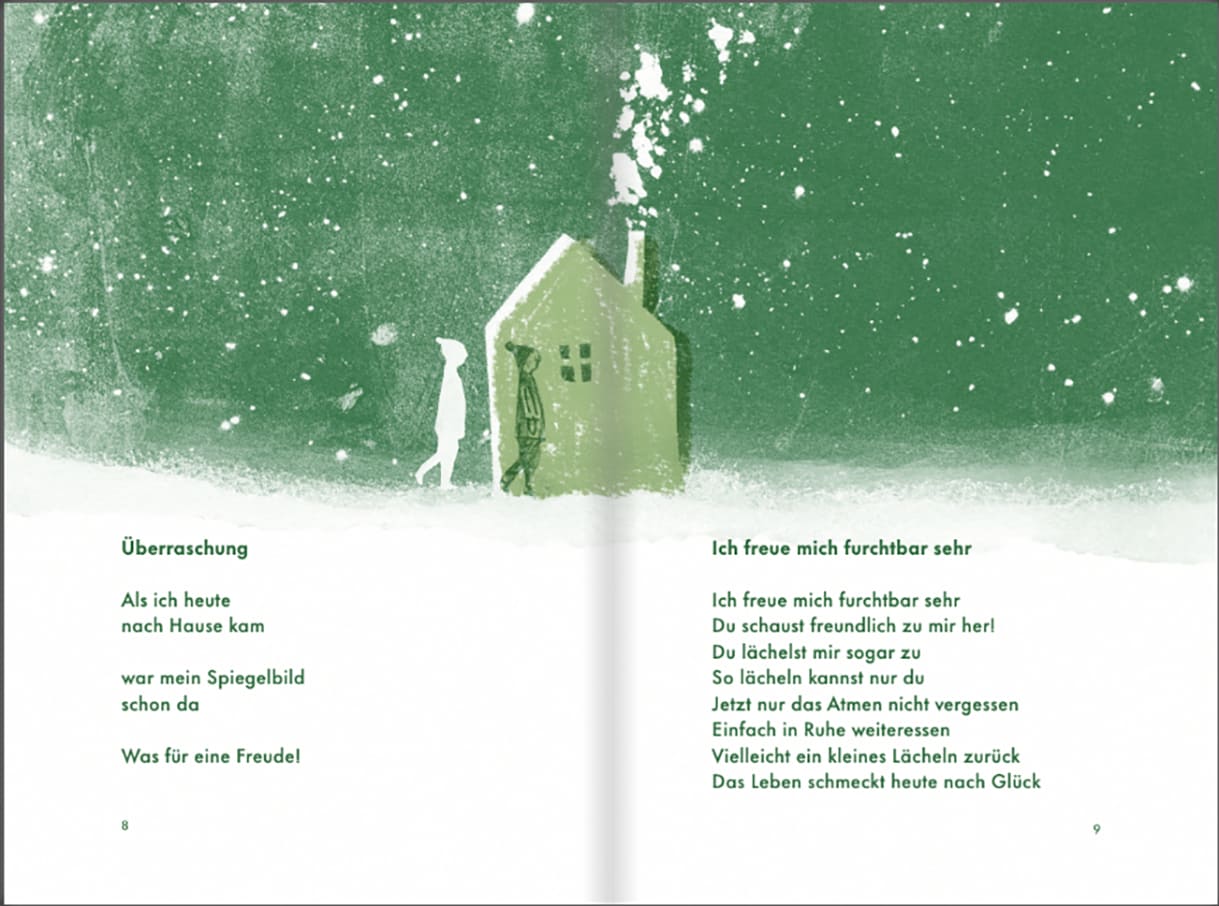
So manches ergibt sich auch aus dem Humor, der beim Denken um die Ecke immer wieder mitschwingt. In etlichen Gedichten spielen Fragen eine große Rolle, nicht zuletzt in „Was kann man in Hosentaschen tragen? – Eine ganze Welt – und viele Fragen!“ Das passt wunderbar zu den ersten Ferienwochen, in der so manche Kinderunis stattfinden, in denen Kinder Hörsäle und Labors stürmen, um am Ende (beispielsweise der Kinderuni Wien bei der Sponsion) zu geloben, „nie aufzuhören, Fragen zu stellen – und Antworten darauf zu suchen“.
Das eine oder andere der Gedichte stößt auch riesige (kinder-)philosophische Themen auf, wenn der Autor etwa „Nichts“ zehn Zeilen widmet. Die beginnen mit einem Gefühl, das sicher jede und jeder kennt: „Heute will mir nichts gelingen / Nicht einmal / ein richtiges Gedicht /“ und damit endet, das dies gar nicht stimmt, weil nun ja doch was da steht 😉
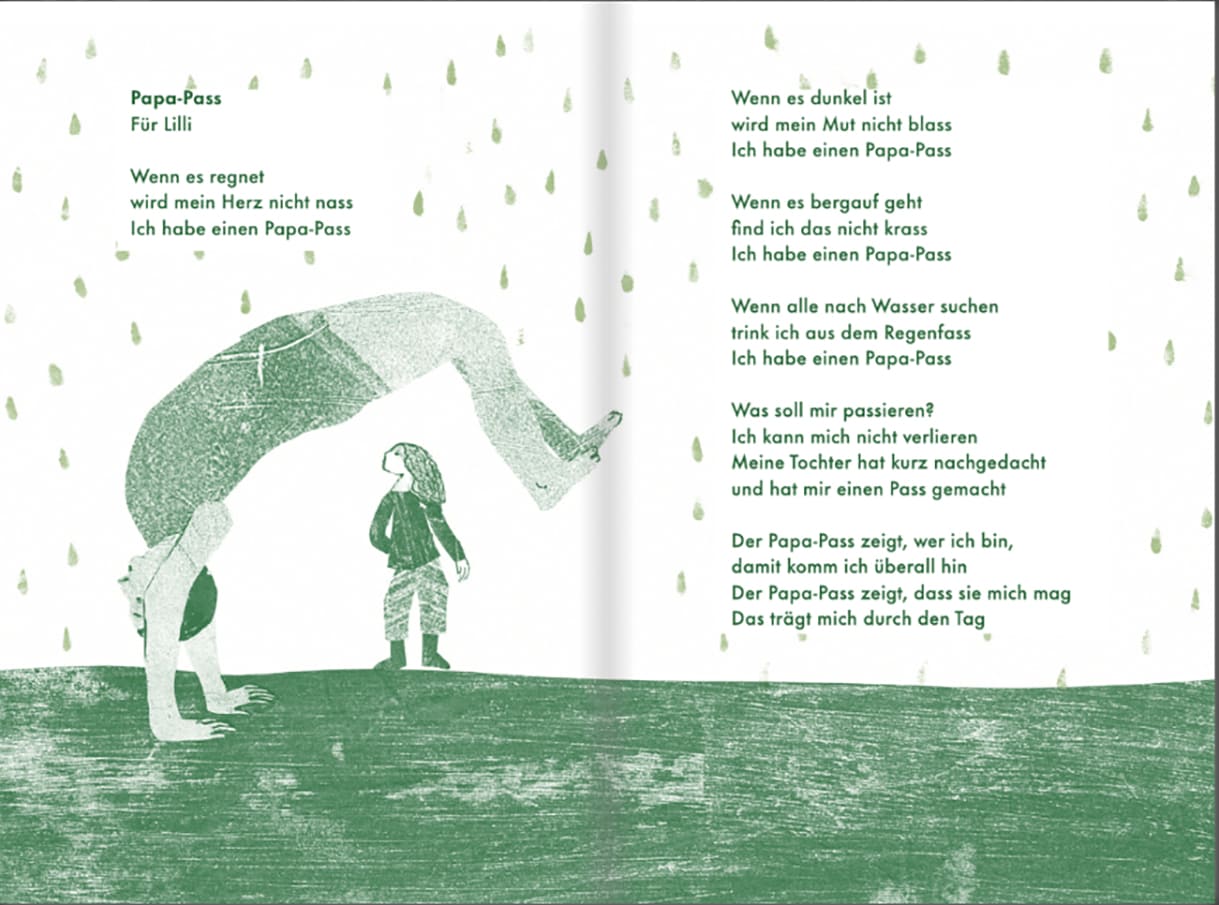
Wie bei guten Illustrationen üblich, aber von Linda Wolfsgruber besonders meisterinnenhaft ausgeführt, eröffnen ihre Zeichnungen mehr als nur die Bebilderung des Textes. Eigene – durchgehend in grün gehaltene, sehr oft naturnahe, häufig zerbrechlich wirkende und doch kräftige menschliche, tierische und pflanzliche Figuren setzen zwischen, neben und unter die Textzeilen Bilder, die ähnlich wie der Text oft Anregungen zum Weiterspinnen der Gedanken einladen.
Ach ja, Heinz Janisch stellt dem Buch die Bemerkung voran: „In unfreundlichen Zeiten braucht es freundliche Gedichte.“
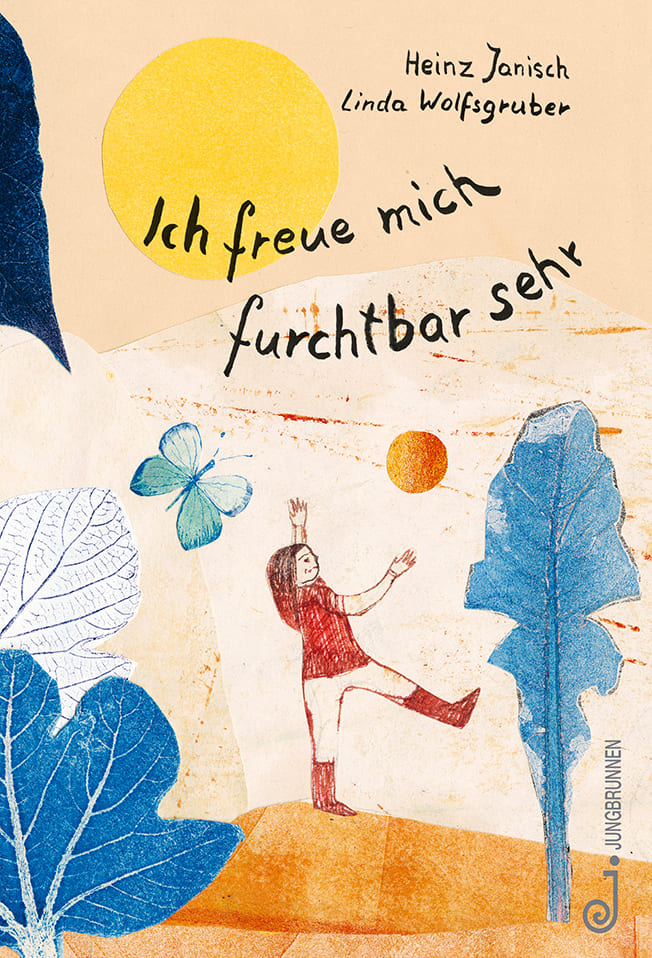

Wo sie begonnen hat, da endet die Jubiläums Kinderuni in Waidhofen an der Ybbs – im Kristallsaal von Schloss Rothschild. Vor zehn Jahren wurde aus der Nicht-Universitätsstadt auf dem Umweg über Kinder und Kurse für sie doch eine. Nicht zuletzt aufgrund dieser Besonderheit heißt die Kinderuni hier KinderUNIversum.
Apropos Universum – ein Kurs drehte sich um unser Sonnensystem, die Heimat der Erde im unendlichen Weltall – und das mit Planeten zum An- und damit leichteren Be-greifen. Vieles, das Kinder in diesen drei Tagen im Schloss sowie an anderen Orten der Stadt bzw. noch weiter weg bei Exkursionen erleben konnten, findet sich auch in Form von Berichten und Fotos auf einer sechs-seitigen Campus-Zeitung, die unter anderem mit Unterstützung von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr im Foyer vor dem besagten schon genannten Kristallsaal aufgebaut war.
Zurück zum Abschluss. Einer der – zeitlich – letzten Kurse am Nachmittag war eine „Zauberschule“, auch wenn dieses Schloss nicht zu Hogwarts wurde, erlernten die teilnehmenden Kinder einige Tricks vom Magier Illusian, alias Julian Grafenhofer. Und so verblüffte nicht nur er alle Gäst:innen der Sponsion, sondern auch Kinder „zauberten“, unter anderem mit riesigen Spielkarten.
Übrigens Zauberschule: Eine der eifrigsten Jungredaktuer:innen, die zehnjährige Anna-Lena Gschnaidtner verfasste neben etlichen Berichten auch einige Witze für die Campus-Zeitung. Einer hat’s auf Seite 1 geschafft – und der sei hier schon verraten, auch wenn die sechs Seiten Teil der nächsten Ausgabe der acht bis zehn Mal jährlich erscheinenden Waidhofener Stadtnachrichten sind und diese erste in der kommenden Woche an alle Haushalte dieser niederösterreichischen Stadt gehen:
„Lasst euch von euren Eltern nicht reinlegen, ich habe Harry Potter schon oft gesehen. „Bitte“ ist gar kein Zauberwort!“, schrieb die fast stets lächelnde und besonders eifrige junge Redakteurin.
Sie führte übrigens ein kurzes, knackiges mit einem Schuss Humor durchzogenes Video-Interview mit dem Bürgermeister der Stadt, Werner Krammer. Gefilmt hat Stefanie Grasberger, die in diesem Jahr die Zeitungsredaktion mit betreute – und, wie schon in einem vorigen Bericht erwähnt, beim ersten KinderUNIversum als Elfjährige selber Beiträge geschrieben hat – damals noch im festlichen Sitzungssaal des Rathauses. Sie hat das Video auch geschnitten und auf Instagram veröffentlicht – Link am Ende dieses Beitrages.
Beim Betreten des Saales fand sich übrigens eine große Kartonkiste mit der Aufschrift „Nachhaltigkeitskiste“. Diese ist eines der sichtbarsten Errungenschaften des neuen Kinderbeirates für das KinderUNIversum. Von Nachhaltigkeit soll nicht nur geredet werden. Brauchbare Gegenstände, die manche Kinder nicht mehr benötigen, konnten / können in dieser deponiert werden. So können andere sie verwenden, statt Ressourcen zu verschwenden 😉
Zum Jubiläum gab’s eine Torte mit dem Logo des KinderUNIversums – die allerdings bei Weitem zu klein war für die Absolvent:innen ;(

„Freiheit für alle politischen Gefangenen in der Türkei!“. „Hoch die internationale Solidarität“, „Solidarität heißt Widerstand – Kampf dem Faschismus in jedem Land!“ Hin und wieder rief ein halbes Dutzend Aktivist:innen vor der Mall in Wien-Mitte diese Solgans. Dazwischen erzählten Rednerinnen und Redner den Grund für die Aktion mit Zelt, Transparenten, Flugblättern und den genannten Sprech-Chören.
In der Türkei lässt der autokratisch herrschende Präsident Recep Tayyip Erdoğan immer wieder politische Widersacher einsperren, darunter auch Journalist:innen. Eine davon ist Sevda Perihan Erkılınç, die knapp vor dem 1. Mai eingesperrt wurde, im Frauengefängnis B-6 in Bakırköy. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen unter dem „Codenamen“ Sevda verbotenen Aktionen zu initiieren. Dabei ist dies ihr zweiter Vorname, für dessen Eintragung in amtliche Dokumente sie schon lange kämpfte, wäre als nicht besonders konspirativ. Sie ist Reporterin der linken Zeitung Özgür Gelecek (freie Zukunft). Anklageschrift gibt es auch nach zwei Monaten noch nicht.

„Es ist weder ein Verbrechen noch kann man damit terrorisieren, Nachrichten für eine Zeitung zu berichten, die die Stimme der Unterdrückten, Arbeiter, Frauen und LGBTI+-Personen ist.“ Schreiben der Wahrheit sei ein legitimes Recht, journalistische Tätigkeit dürfe nicht bestraft werden, wird ein Schreiben von ihr an die Öffentlichkeit zitiert.
„Die inhaftierte Journalistin erinnerte daran, dass viele Journalisten im Land aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im Gefängnis sitzen, und erklärte, dass selbst grundlegende Rechte in der Türkei unter Druck stünden.

Erkılınç hingegen sagte, dass die Täter von Femiziden oft freigelassen würden und argumentierte, dass Femizide durch Straflosigkeit gefördert würden. Sie nannte das Beispiel von Bahar, die von ihrem Ex-Mann in Şişli getötet wurde“, schreibt das unabhängige Kommunikationsnetzwerk (bağımsız iletişim ağı)
Obendrein wird im Gefängnis nicht auf ihre Erkrankungen – Asthma und Zöliakie – eingegangen, und somit ihre Gesundheit massiv gefährdet.
Drei der Aktivist:innen haben gelbe Warnwesten an – mit der Aufschrift Hungerstreik. Aus Solidarität mit eingesperrten Journalist:innen läuft in der Türkei ein Hungerstreik, in Österreich verweigern die drei für drei Tage die Nahrungs-Aufnahme.
Übrigens sitzt seit mehr als drei Monaten auch der gewählte Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, seit mehr als drei Monaten im Gefängnis. Er, dessen Wahl 2019 von der türkischen Regierungspartei AKP angefochten worden war und der in der Wiederholung eine noch größere Mehrheit der Stimmen (Vorsprung rund 800.000) von den Wähler:innen bekam, gilt als aussichtsreicher Gegenkandidat bei künftigen Präsidentschaftswahlen.
bianet.org -> gazeteci-perihan-erkilinc
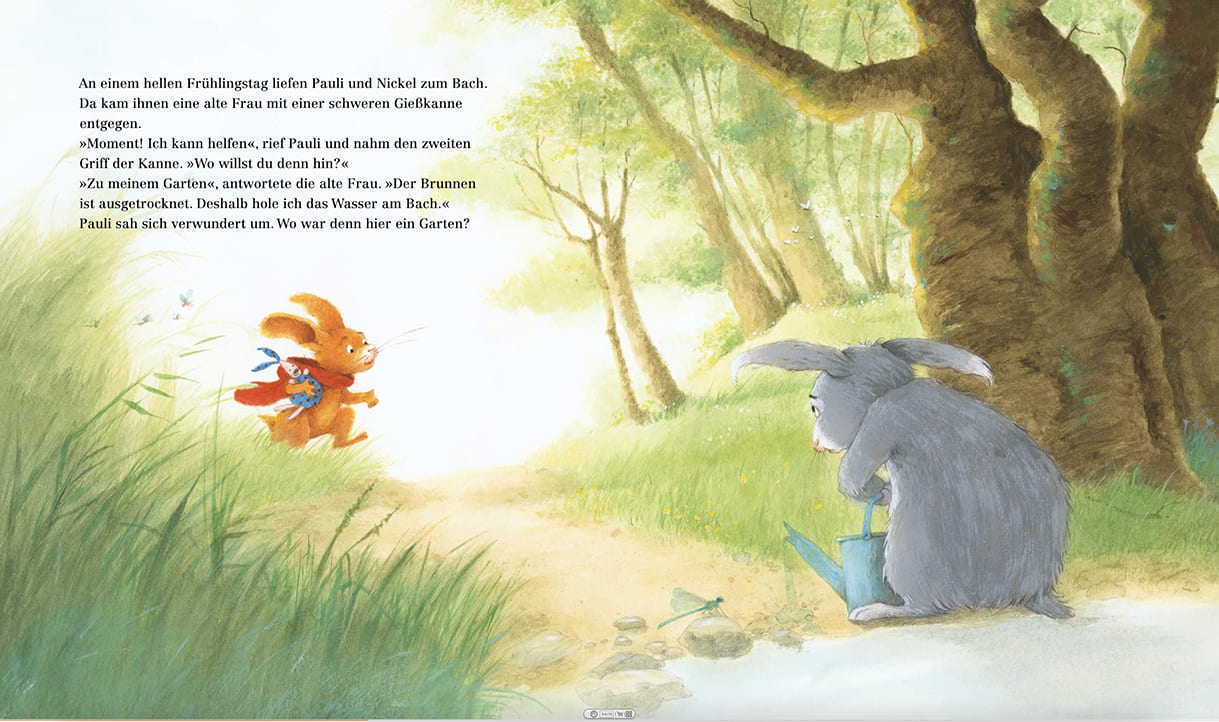
Pauli, ein mittlerweile dank seiner Erfinderin, der Autorin Brigitte Weninger, schon ganz schön berühmtes Kaninchen, ist im jüngsten Abenteuer zu Beginn rasend schnell mit seinem Kuschel-Nickel unterwegs in Richtung Wald. Illustratorin Eve Tharlet lässt ihn fast über den Boden fliegen.
Plötzlich stoppt Pauli, denn er sieht, wie eine alte graue Häsin eine schwere Gießkanne schleppt. Sofort bietet er seine Hilfe an, um den Wasserbehälter gemeinsam zu tragen. Wundert sich aber als Elise sagt, dass sie den Garten gießen will. Weit und breit sieht der Titelheld keinen solchen.
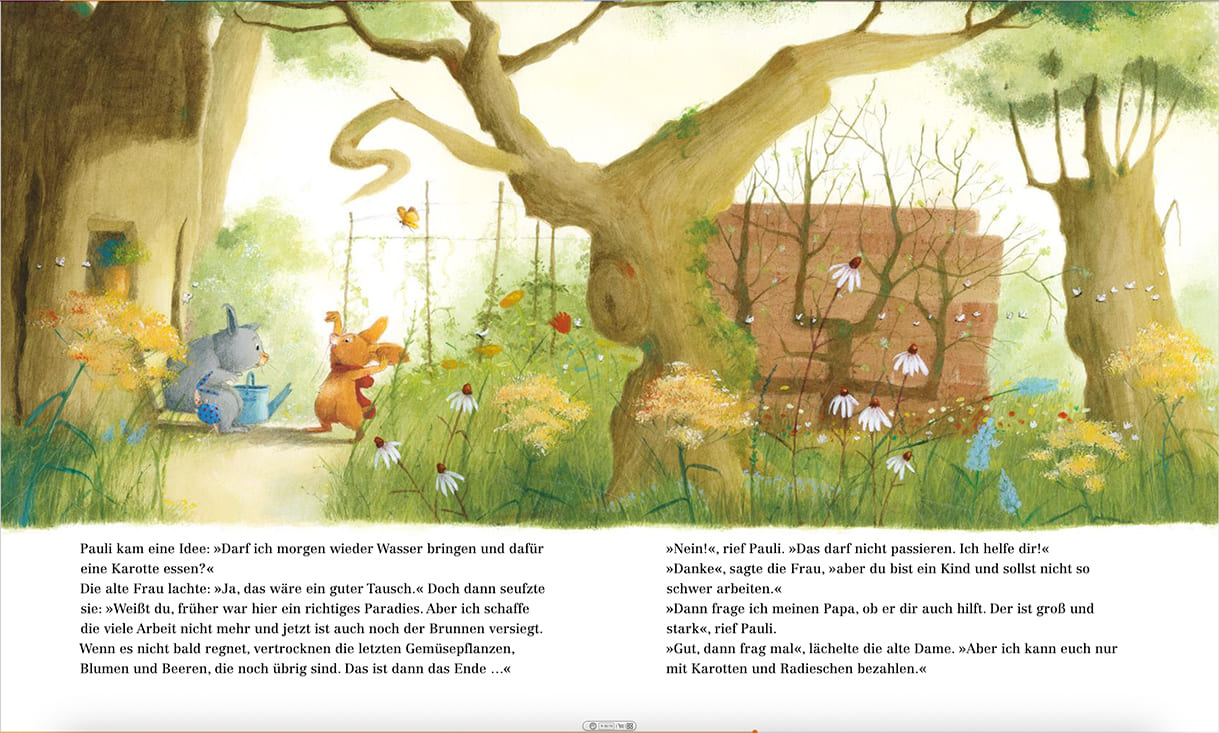
Hinter einem verwitterten Holztor liegt der alten Häsin verwilderter Garten. Da packt nicht nur Pauli mit an, sondern nach und nach organisiert er auch den „Rest“ seiner großen Familie. Im Team richten sie den Garten her. Als Belohnung gibt’s Karotten und Radieschen.
Nein, es gibt keine Wendung, keinen Streit, nur noch später die Herausforderung eines Hochwassers. Aber auch diese lässt die Autorin, vormals zwei Jahrzehnte lang Elementarpädagogin, die Kaninchen gemeinsam meistern. Weshalb das Buch folgerichtig nach dem ersten Teil des Titels (mit dem Namen der zentralen Figur, der Weninger schon viele Geschichten gewidmet hat), „Ein Garten für alle“ heißt.
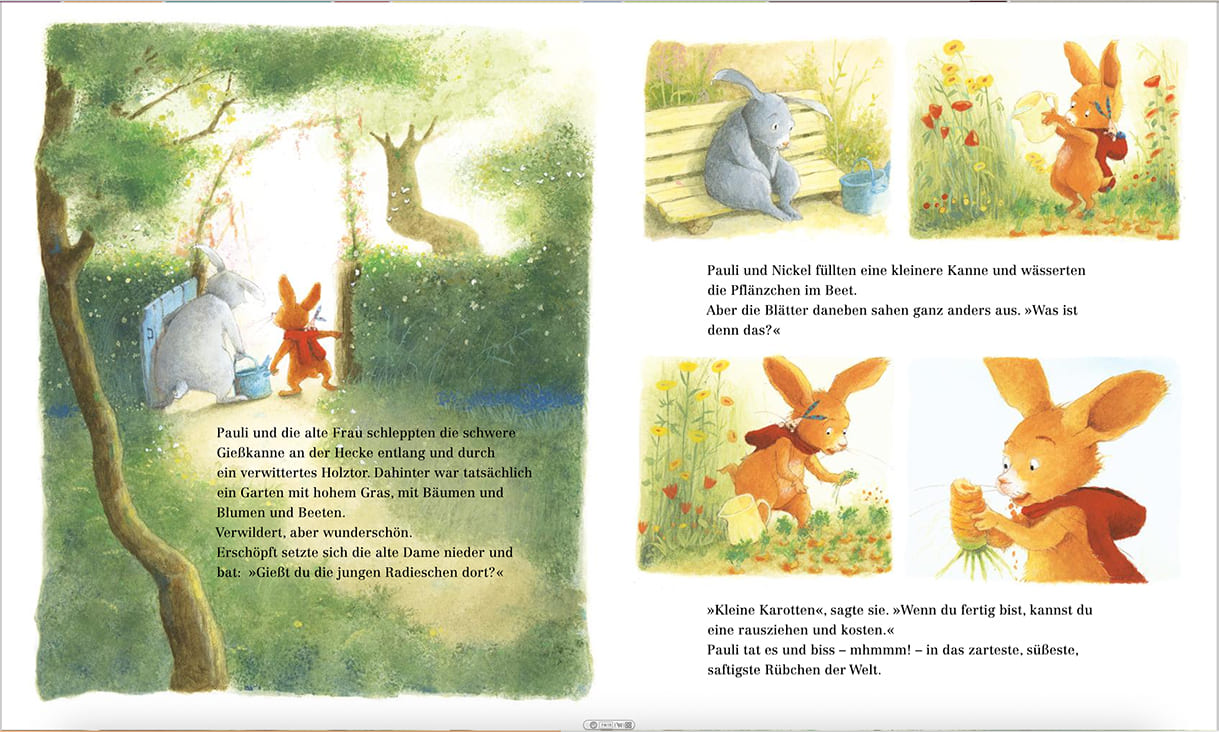
Auch wenn hier jetzt schon sehr viel gespoilert wurde – dieses Bilderbuch – übrigens auch als Hör-Datei von der Verlagsseite runterzuladen – lebt weit darüber hinaus von vielen kleinen Einzelheiten in der Erzählung ebenso wie den detailverliebten Zeichnungen.
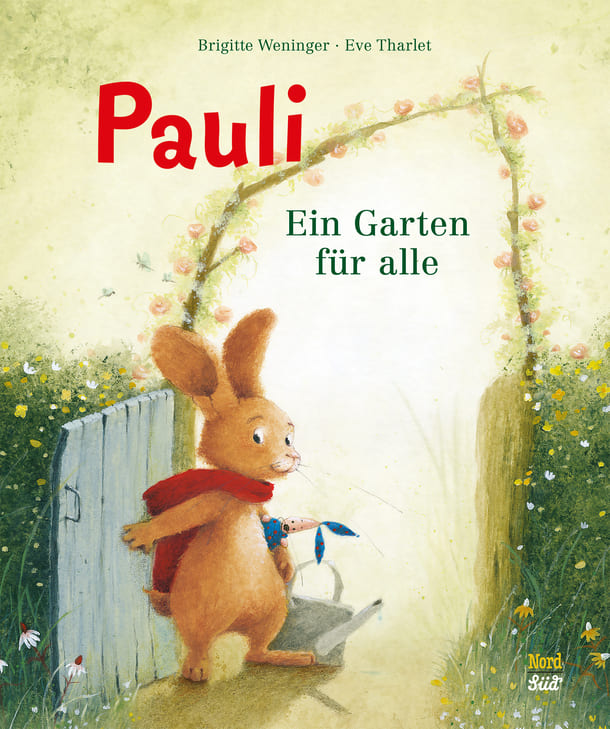

Fröhliche Laute im Chor klingen durchs Stiegenhaus von Schloss Rothschild mit seiner altehrwürdigen, knarrenden hölzernen Treppe auf der einen und den marmorierten Steinstufen, die hinauf zum Kristall-Saal führen andererseits. Dies ist eine der zentrale Locations des KinderUNIversums im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs. Diese Kinderuni begeht in diesem Jahr den zehnten Geburtstag.
Und die Klänge, von denen anfangs die Rede war, sind Zungenbrecher in verschiedensten Sprachen – Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch und jedenfalls noch Japanisch. Das machte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ziemlich neugierig. KiJuKU darf hier – wie in den Anfangsjahren der Vorläufer Kinder-KURIER die junge Redaktion der Campus-Zeitung mit betreuen und die Jung- und Jüngst-Journalist:innen bei der Arbeit begleiten, sowie sechs Seiten der kommenden Stadtnachrichten zusammenfügen.
Also zunächst auf ins Erdgeschoß und ein paar Schnappschüsse so wie ein Video – solche Zungenbrecher wirken nur, wenn sie auch vernommen werden; daher unten am Ende des Beitrages ein Video verlinkt;)
Vermittelt hat diese Zungenbrecher Fatma Efendioğlu als Lehrende beim KinderUNIversum, die beim Verein „Startklar“ als Sprachförderin arbeitet und Kinder beim spielerischen Erlernen der deutschen Sprache unterstützt, selbst mehrsprachig ist und unter anderem Zungenbrecher in weiteren Sprachen mitgebracht hat.
Da passt ein KiJuKU-Buchtipp aus dem März gut hierher: „A wie Biene“. Klingt aufs Erste verwirrend? Nun, „Arı ist etwa das türkische Wort für Bienen. Auf dieser ersten der Bilderbuchseiten von Ellen Heck (Illustration und Text im englischen Original, Übersetzung: Regina Jooß) gibt’s noch drei weitere Bienen-Bezeichnungen: Abelha (Portugiesisch), Aamoo (Ojimbwe – so steht’s im Buch, dürfte aber eher korrekt Ojibwe heißen, und dies ist laut Wikipedia eine der größten indigenen Bevölkerungen in Nordamerika – Kanada und USA). Schließlich beginnt Biene noch in Igbo, einer der mehr als 500 Sprachen im westafrikanischen Nigeria, mit A – Aṅụ“, stand hier damals – unten, am Ende des Beitrages Link zu dieser Buchbesprechung; weitere Links zum mehrsprachigen Redebewerb „Sag’s Multi!“
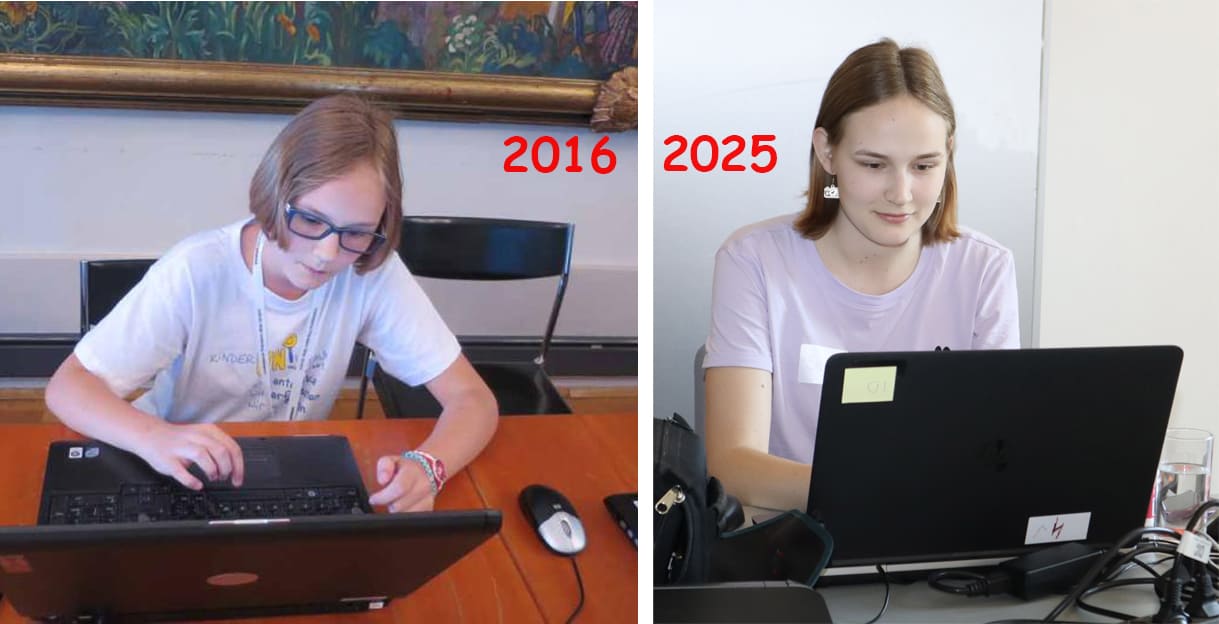
Übrigens: Die Campus-Jung- und Jüngst-Redaktion wurde in diesem Jahr unter anderem von Stefanie Grasberger mitbetreut. In den ersten Jahren von KinderUNIversum hat sie als Kind in verschiedenen Kursen studiert und wurde mittlerweile Journalistin mit schon einigen Praktika in verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen 😉
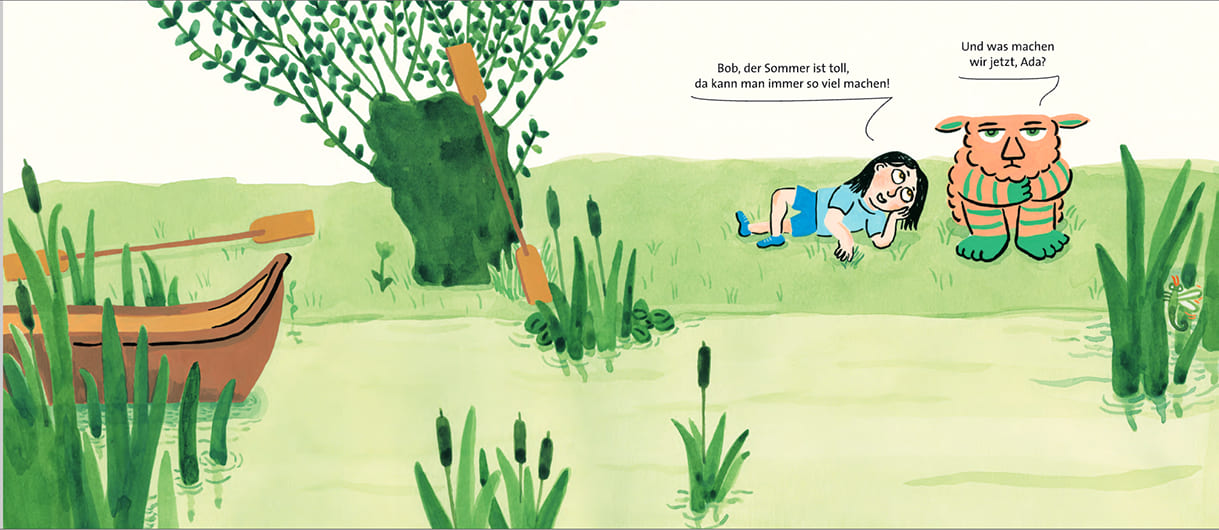
Fast alles in diesem Bilderbuch spielt sich in einem Kajak ab. Ein Boot, gezeichnet von Magali Bardos, das vorne und hinten glich ausschaut. Mit diesem machen sich Ada und Bob, ein Mensch und ein Tier, die beide zu Beginn auf einer Wiese am Ufer eines Flusses liegen, auf die Reise.
Ganz so einfach ist das Paddeln aber nicht, aber dann gleiten sie übers Wasser, freuen sich am Vorwärtskommen und der Landschaft. Klar, so einfach kann’s nicht bleiben, jedes Buch braucht Abwechslung und Spannung. Dafür sorgt Ada. Nicht immer zur Freude von Bob. Die Last des Paddelns ist auch – nicht nur aus der Sicht von Bob – offenbar nicht fair verteilt. Ada spielt sich als Chefin auf und so kommt’s zu durchaus heftigen Streitereien. Und damit – so viel darf schon verraten werden, bist du auf der letzten Seite.

Da ließ sich Autorin Clémence Sabbagh (aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel) was Besonderes einfallen: „Lies die Geschichte noch einmal – jetzt aber rückwärts“, lautet der allerletzte Satz. Sozusagen wie die Form des Bootes, weshalb das Buch auch „Kajak – Eine Geschichte in zwei Richtungen“ heißt.
Eine witzige Idee, funktioniert nur nicht ganz – denn erstens musst du auf manchen Seiten dann doch zuerst den Text auf der rechten statt in umgekehrter Reihenfolge auf der linken lesen. Und zweitens, kennst du ja sowohl den Anfang als auch das Ende.
Andererseits: Es könnte auch sein, dass du den beiden – wieder am Beginn – eine zweite Chance schenkst und dir selber ausdenkst, wie die zweite Kanu-Reise verlaufen könnte.


Schon in der letzten Schulwoche (im Osten Österreichs, Ende Juni) meinten einige Volksschüler:innen am Rande eines Besuchs im „Curiosity Cube“ (Neugier-Würfel), der zwei Tage in Wien Station gemacht hat, dass sie durchaus auch lieber weiter lernen statt Ferien haben würden. Seit mehr als 20 Jahren stürmen Tausende Kinder in Wien in den Sommerferien zwei Wochen lang so ziemlich alle Universitäten und Hochschulen für die Kinderuni. Sie wollen in jenen Fachgebieten, die sie besonders interessieren mehr wissen, Experimente machen, Neues lernen.
Derzeit läuft in Wien auch schon die Kinderuni Kunst und aktuell drei Tage lang auch das KinderUNIversum im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs, das auch „nichts anderes“ als eine Kinderuni ist, nur dass die Stadt selber über keine Universität verfügt. Zeitgleich mit Wien startet die Kinderuni in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz, jene in Steyr im selben Bundesland gegen Ende der Sommerferien, in Krems (NÖ) steigt sie auch diese Woche, jene in der steirischen Landeshauptstadt Graz in der dortigen ersten Ferienwoche, jene in Salzburg hat schon während der Schulzeit begonnen, läuft aber auch noch in der ersten Ferienwoche, Innsbruck startet kommende Woche.
Diese Kinderuni mit Jahr für Jahr rund 200 neugierigen, wissbegierigen Jung- und Jüngst-Studierenden – Kurse in verschiedenen Altersgruppen von 5 bis 15 Jahre – feiert heuer den 10. Geburtstag. Zum Jubiläum kam die erste Garde der Kinderuni Wien, die in zwei Jahren ihr erstes ¼ Jahrhundert begehen wird.
Nach einem Vortrage über Stahl von Axel Michels vom Hauptsponsor voestalpine mit Anleihe beim TV-Kinder-Klassiker 1 – 2 oder 3 mit babyleichten Fragen, spannte Karoline Iber von der Kinderuni Wien einen großen Bogen von kindlicher Neugier bis zu forschenden Wissenschafter:innen. In einem kleinen, handlichen Experiment ließ sie einen Tischtennisball schweben. Der „Zaubertrick“ – ein Föhn. Heiße Luft, kann aber auch kalte sein, hält den Ball in der Höhe.
Die eine oder andere (Quiz-)Frage lief hier nicht mit Feldern, auf die es galt, sich zu stellen samt „wenn das Licht angeht“ ab, sondern mit bunten Karten – rot, grün, lila. Ihre Fragen waren nicht immer einfach. Und wahrscheinlich war auch für die wenigen Erwachsenen im Raum die Auflösung, welches die älteste Universität der Welt ist, verblüffend. Wien – gegründet 1365 – ist „nur“ die älteste deutschsprachige hohe Schule, Bologna – fast 300 Jahre früher, 1088 – ist „nur“ die älteste in Europa. Aber schon noch einmal mehr als 200 Jahre früher öffnete die Universität al-Qarawīyīn im marokkanischen Fès ihre Tore für Studierende, und natürlich Lehrende. Übrigens wurde diese Uni von einer Frau gegründet Fāṭima al-Fihrīya. Letzteres wurde leider gar nicht dazu gesagt.
Handwerk und Technik, Wissenschaft unterschiedlichster Sparten, aber auch viel Kunst und Kultur spielt sich in Kursen des Waidhofener KinderUNIversums ab. Umwelt und Nachhaltigkeit sind ebenfalls Themen. Über so manches davon berichten auch junge Reporterinnen und Reporter in der Campus-Zeitung, die von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… mit betreut wird – wie in den Anfangsjahren vom KiJuKU-Vorläufer Kinder-KURIER. Mit im Betreuer:innen-Team ist übrigens mit Stefanie Grasberger eine Frau, die in den Anfangsjahren als Kind selber auch in der Campus-Zeitung als Kinder-Reporterin geschrieben hat 😉
Erstmals wird die Campus-Zeitung aber Teil der offiziellen Stadtnachrichten von Waidhofen an der Ybbs, die dann in der kommenden Woche an alle Haushalte der Stadt gehen werden.
Übrigens: Im ersten Jahr von KinderUNIversum und der Campus-Zeitung hat ein junger Reporter in einem Beitrag erklärt, dass Ybbs nicht wie es die meisten Menschen außerhalb dieser Gegend als Übs, sondern als Ibs ausgesprochen wird 😉

Wie schon im ersten Teil – Link dazu weiter unten – verraten, steht in diesem Sommer „Rotkäppchen – neu verirrt“ auf dem Spielplan des alljährlichen „Märchensommers“ im Schloss Poysbrunn (Weinviertel, Niederösterreich). Viele Theater- und Musical-Versionen haben gerade dieses Märchen auch schon neu und ziemlich anders erzählt – zuletzt im heurigen Frühjahr der Wiener Rabenhof in Kooperation mit dem Theater der Jugend – mit einem vegetarischen Wolf – Link zu dieser und weiteren Stück- sowie Buch-Besprechungen weiter unten.
Zurück nach Poysbrunn. Obwohl im Weinviertel gelegen, hat Rotkäppchen (Patrizia Leitsoni) – wie auch in vielen neueren Versionen – in ihrem Korb für den Besuch der Großmutter im Wald natürlich keinen Alkohol mehr mit, sondern Hollersaft. Der wächst, so wie der Kuchen, hier ein Kürbis(kern)-Gugelhupf, aus dem Korb heraus – zu personifizierten Schauspieler:innen: Christian Kohlhofer als wandelnde Flasche mit Stoppelhut und grünen Stiefeln sowie Gudrun Nikodem-Eichenhardt mit jedenfalls an diese Kuchenform erinnerndem breitem Rock samt rosa Zuckerguss und ebensolch farbigen Sneakers. Da blieb die Verkleidung ab der Körpermitte nach oben noch ein Geheimnis, das bei der Probe nicht gelüftet wurde (Kostüme: Agnes Hamvas).
Die beiden begleiten nun Rotkäppchen auf der Suche nach Omas Waldhaus. Die Oma, die hier mit Helga sogar einen Namen hat – im Gegensatz zu den meisten Versionen -, ist eine kreuzfidele, lebenslustige und reise- und tanzfreudige (wie auch die anderen Figuren und Darsteller:innen, schließlich gibt es immer wieder Lieder im Verlauf der Vorstellung) Dame mit altem, kleinen Handy (Johannes Kemetter). Sie verfügt übrigens – auch wenn nicht alles, so sei doch ein bisschen schon verraten – über ein magisches Kochbuch und beheimatet bei sich eine Hausmaus. Diese wird von Kindern abwechselnd gespielt, unter anderem Linus Nikodem-Eichenhardt (Interview siehe im ersten untern verlinkten Teil); fast vier Dutzend Kinder (genau 45) schlüpfen in bunte Stastist:innen-Rollen die einige Szenen bereichern – als Glimmerleins und Zauberblumen – neben den Hausmäusen.
Wie immer im wahrhaft märchenhaft wirkenden Schloss spielt sich die Story als Stationen-Theater ab – Beginn und Schluss für alle gemeinsam in einem großen Zelt neben dem Schloss und dann in drei großen Gruppen – in verschiedenen Räumen in Schloss und dessen Garten, was abwechslungsreich, dafür leider nicht barrierefrei ist.
Dazwischen wandern die Zuschauer:innen – unter anderem zu Omas Haus, zu einer Fee (Viktoria Hillisch), zum Großen Glimmer (Barbara Kramer) und den Glimmerleins (etliche der Kinder, die sich in verschiedenen Rollen wochenend-weise abwechseln) oder dem Steinbeißer (Johannes Kemetter, ja, genau, der der auch die Oma spielt). Von allen drei Stationen muss das Publikum – mit ein bisschen Mitmachen – Dinge mitbringen, um die Story aufzulösen. Von der Fee zum Beispiel Glitzerstaub.
Diese „residiert“ in einem der hintersten Zimmer im zweiten Stock, der sich in eine Art Himmelsbogen samt wolkiger Hollywoodschaukel verwandelt hat (Bühnenbild: Marcus Ganser). Beim Probenbesuch durfte diese Station und damit die eher grantige, weil singesuntaugliche Fee miterlebt werden. Klar, dass sich das im Verlauf der Szene auflöst, der Guglhupf – mit Hilfe der Kinder und anderer im Publikum – bringt sie so weit, dass sie sogar fröhlich jodeln lernt.

Ach ja, da wäre doch noch der Wolf (Daniel Ogris)!? Dass er Oma und Rotkäppchen nicht frisst, wurde hier schon im ersten Teil gespoilert. Trotzdem geht die große Angst vor ihm um. Tier- und gar Wolf-Liebenden könnte das recht lange auf die Nerven gehen und wirken, als würde dies den Jagdwütigen, die derzeit viel um leichtere Abschüsse lobbyieren, in die Hände spielen. Aber natürlich wendet sich auch da die Story zum Guten; doch wie? Das soll doch beim Besuch eine Überraschung bleiben.
Interviews mit 2 der 45 Kinder, die – abwechselnd – mitspielen hier unten

Viele Märchen spielen in oder rund um Schlösser. Dieses zählt nicht dazu: Rotkäppchen. Zum „Glück“ gibt es auf dem Areal des Schlossgartens vom Poysbrunn (Niederösterreich), der natürlich über etliche Bäume, die an Wald erinnern, verfügt, auch eine Art große hölzerne Hütte. Die ist einer der Spielorte – auf der Veranda davor als Großmutters Waldhäuschen.
Wie schon in den vergangenen Jahren wird nicht einfach die Story aus der Sammlung der Gebrüder Grimm oder eine andere Geschichte (es gab schon Alice im Wunderland, die Lewis Carroll erfunden hatte) inszeniert, sondern die Geschichte neu und ziemlich verändert erzählt, gespielt, gesungen und getanzt. Gerade für Rotkäppchen gibt es übrigens zahlreiche veränderte Versionen – in Büchern und auf Bühnen – Links zu einigen Besprechungen am Ende dieses Beitrages.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte knapp eine Woche vor der Premiere von „Rotkäppchen – neu verirrt“ einer der Proben, bei der alles durchgespielt wurde, zuschauen. Rund um wurde noch gebohrt, geschraubt, gehämmert, Holzplatten für Kulissenteile gemalt…
Und während die sieben erwachsenen Darsteller:innen alle spielten, waren nur zwei der Kinder im Einsatz. Junge und jüngste Mitwirkenden übernehmen bei den Inszenierungen im Märchensommer immer nur die Rolle von Zauberblumen, Trolle, Glimmer und andere, also eher Statist:innen. Im Gegensatz etwa zu den Aufführungen von teatro im Stadttheater Mödling wo Kinder und Jugendliche gemeinsam mit erwachsenen Profis die Musicals prägen.
… dafür kommen hier ausschließlich die beiden Kinder des Proben-Sonntagmittags zu Wort: Louis (10) und Linus (8), ersterer spielt einen Glimmer, Zweiterer die Hausmaus bei Oma. Und als solche kommt er auch mehr zum Einsatz und darf sogar den Wolf vertreiben, der hier übrigens – so viel sei hier schon verraten, weder Oma noch Rotkäppchen frisst.
Beide sind „heuer schon zum dritten Mal dabei“, erzählen sie im Journalist:innen-Gespräch (eine Kollegin war auch dabei), und erinnern sich an frühere Rollen als Teil der Crazy Chickens bzw. als Gnom bei Rapunzel.
Sehr schwierig seien die Proben nicht gewesen, aber schon ein bisschen, lassen sie durchklingen, „aber ich freu mich, wenn ich’s dann kann“, meint Linus, der sich freut, „dass ich zum ersten Mal auch eine kleine Sprechrolle habe“, wobei er „hofft, mich nicht zu verhaspeln, das wäre nicht so cool.“
Übrigens haben die beiden wie fast alle ihre Alterskolleg:innen zwei verschiedene Rollen, die sie abwechselnd übernehmen; „jedes Wochenende spielen andere Kinder“, so Louis. „Das Wechseln ist aber nicht so schwer“, versichern sie beide in dem Interview, das sie beide gemeinsam vor dem Eingang zum Efeu-verhangenen Schloss vor der Probe führen.
Beide sind aus Wien – im Gegensatz zu einigen anderen der mitwirkenden Kinder, die in der Gegend wohnen, „aber wenn wir spielen, bleiben wir hier“.
Auf die Frage wie der Wechsel von der Großstadt in den kleinen Ort ist, schätzen beide die viele Natur und das Grün hier. „Ich wollt immer schon einmal in der Wildnis wohnen“, meint etwa Linus.
KiJuKU will auch wissen, ob Theater, Schauspiel ein möglicher Berufswunsch sein könnte?
Louis, schon ziemlich überzeugend: „Ich will Kellner werden!“ Und sein Kollege Linus träumt eher vom Fliegen als Pilot, schaut später zum Himmel und berichtet ganz aufgeregt, dass in dem kleinen Flugzeug das zu sehen und zu hören ist, „mein Vater fliegt, der macht gerade den Pilotenschein“.
Mehr zur Story und der Inszenierung „Rotkäppchen – neu verirrt“ (3. Juli – 24. August 2025; an den Wochenenden) in einem weiteren, eigenen Beitrag – dann auch mit allen Detail-Infos -, der noch folgt.
neu-ertraeumte-alice-mal-3-im-wunderland <- damals noch im Kinder-KURIER

„Ich schenke euch ein Wort“, begann Lena Raubaum ihre Festrede bei der diesjährigen Preisverleihung der Jury der jungen Leser*innen. Ein Schuljahr lang lesen Kinder bzw. Jugendliche gut ein Dutzend Bücher, diskutieren darüber, bewerten die Lektüre und wählen gegen Ende der Saison ein Lieblingsbuch aus. Dieses stellen sie öffentlich, teils performativ, vor, begründen ihre Entscheidungen und zeichnen die Autor:innen aus. Manche reisen an, andere erfahren von ihrer Wahl – mittlerweile längst auf elektronischem Weg und die meisten aus der Ferne antworten auch – schriftlich oder hin und wieder per Video-Botschaft.
Seit vier Jahren gibt es – nach der Pause aufgrund des Todes der Gründerin der ersten Jury vor mehr als 30 Jahren, Mirjam Morad – sozusagen die Jury der jungen Leser*innen 2.0. Als Verein Literaturbagage organisieren Greta Egle, Anna und Kathi Pech sowie Sara Schausberger, die in Morads Zeit selber als Kinder bzw. dann Jugendliche Teil dieser Jury waren, die wieder auferstandenen regelmäßigen Zusammenkünfte junger Menschen, die gern lesen und über Bücher diskutieren. Das genannte Quartett holt jedes Jahr zur Preisverleihung auch eine Person, die schon etliche Bücher (auch) für junge Leser:innen geschrieben hat; so war es im Vorjahr Renate Welsh und heuer Lena Raubaum, die über Bedeutung und Wichtigkeit von Lesen erzählten.
Lena Raubaum betrat das Redepult mit einem Rucksack, aus dem sie nach und nach sozusagen Requisiten hervor holte. Aber zunächst zurück zum Beginn dieses Beitrages: Das Wort das sie – nicht nur den jungen Juror:innen, sondern natürlcih dem gesamten Auditorium und über diesen Artikel (hoffentlich) noch viel mehr Menschen „schenkte“: Litera-Tür, ausgesprochen wie im Französischen, aber eben mit der bewussten Bedeutung Tür bzw. Türen. Solche können Bücher öffnen – zu verschiedensten Welten;)
Zu den spannenden Objekten, die sie aus dem Rucksack holte zählte ein eher ungewöhnliches Symbol für Zeit – die mit Büchern verwendet, nie verschwendet werde: Das fast kreisrunde Ding war keine Uhr – die wäre ja gewöhnlich -, sondern die Scheibe eines Baumstammes!
Apropos Zeit: Die 41-jährie Autorin zahlreicher, auch preisgekrönter, Bücher, zählt zu den wenigen, die neben Prosa-Geschichten auch Gedichte verfasst. Ein solches aus dem Band „Mit Worten will ich dich umarmen. Gedichte und Gedanken“, illustriert von Katja Seifert, teilte sie zum Abschluss mit dem Publikum, indem sie es nicht nur hörbar vortrug, sondern auch in Gebärdensprache, die sie derzeit erlernt, sichtbar machte – und alle dazu einlud, bei der nachfolgenden Wiederholung mit zu gebärden. Ein Gedicht übrigens, das derzeit fast jeden Tag bei Betrachtung der Weltlage vielleicht eine Spur von Trost vermitteln könnte:
Tage gibt’s, da spinnt die Welt
da dreht sich alles um
da geht was schief
da rennt was schräg
da frag dich nicht warum
denn Tage gibt’s, da spinnt die Welt
das Tröstliche dabei:All diese schrägen Tage
die gehen auch vorbei
Aus Lena Raubaum / Katja Seifert: Mit Worten will ich dich umarmen. Gedichte und Gedanken

Apropos „spinnen“ und vorbeigehen – vielleicht unterstützt das Kulturamt der Stadt Wien ja im kommenden Jahr die Aktivitäten dieser wunderbaren Initiative wieder. Heuer hat sie – im Gegensatz zu all den vergangenen Jahr(zehnt)en die Subvention dafür gestrichen, noch dazu kurz vor der Preisverleihung.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wandte sich mit der Frage nach einem warum an die Wiener Kulturstadträtin und wurde von dort direkt an die zuständige MA (MagistratsAbteilung) 7 verwiesen. Von dort hieß es in der eMail-Antwort mit Verweis auf die Förderung zahlreicher anderer Kinderliteratur-Initiativen unter anderem: „Die Absage in dieser Runde erfolgte aus budgetären Erwägungen, die in jeder neue Einreichrunde gefasst werden. Da es in dieser Einreichrunde eine große Zahl von Einreichungen von hoher Qualität bei einem begrenzten Budget gab, und da die Veranstaltung laut Antrag auch auf andere Fördermittel aus Bund und Stadt (Bezirk) zurückgreifen und daher stattfinden konnte, wurde in dieser Runde eine Förderung nicht empfohlen. Der durchaus sichtbare Wert der Veranstaltung ist in dieser Empfehlung aber nicht widergespiegelt und wir laden die Literaturbagage ein für 2026 in der nächsten Einreichrunde Ende des Jahres anzusuchen…“
Also Nachfrage bei der Literaturbagage, wie das mit den anderen Fördermitteln ist. Antwort: „Es stimmt, dass wir Förderung von Bezirk und Kulturministerium. Aber der Bund (Ministerium) finanziert den laufenden Betrieb, jene von Bezirk und Stadt Wien wären direkt für die Veranstaltung der Preisverleihung. Also nach der MA-7-Logik könnte dann der laufende Betrieb funktionieren, aber die Preisverleihung geht sich eigentlich nicht aus. Außer wir machen alles gratis, wobei wir das Ganze ohnehin schon quasi für kein Geld machen.“

Die längsten (Warte-)Schlangen im Wiener Donaupark am Samstagnachmittag, dem ersten Tag des Ferienspiel-Startfestes, beim Zorbing (in einem großen luftgefüllten Ball über die Wiese rollen), dem Autobus-Fahr-Simulator und bei der legendären Schrei-Box – kein Schreibfehler. In dem Zelt des Medienzentrums dürfen Kinder nach Herzenslust schreien – und werden dabei fotografiert. Die ausdrucksstarken, fröhlichen Bilder können nach ganz kurzer Zeit mitgenommen werden. „Noch einmal! Noch einmal!“, vernahm Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… beim Lokalaugenschein nicht nur einmal. Aus Rücksicht auf die wartenden Kolleg:innen gaben sich die meisten dann doch mit dem jeweiligen Schnappschuss zufrieden.
In einer eigenen, kleinen Sportwelt warteten eine Fußball-Torwand, Basketballkörbe in unterschiedlichen Höhen, an andere Stelle konnte anstelle eines runden Balls, das berühmte „Eierlaberl“ wie der Football in Wien auch liebevoll genannt wird, geworfen werden.
Statt einer Hüpfburg gibt’s traditionell riesige aufgepumpte Rutschen – auch eine sehr beliebte Station. Bauerngolf, Schminken lassen, selber auf großen Papierbögen an Staffeleien malen, wissenschaftliche Experimente an mehreren Stellen, Infos und Tipps für Notfälle von den Helfer:innen Wiens, spielerisch über Mülltrennung bzw. Klimaschutz lernen.
Eine der ersten Stationen – beim Zugang von der U1, andernfalls eine der letzten: Wiener Wasser – entweder im Becher oder die eigene Falsche wieder auffüllen lassen. Was angesichts der Hitze sehr notwendig war; wobei es auch ständig hier verortete Hydranten gibt. Wasser versprühten auch die Künstler:innen, die alle anderen überrag(t)en, weil sie auf Stelzen gingen /gehen.
Der Scooter-Parcours eignete sich besonders für beeindruckende Fotos – direkte Sicht auf den Donauturm im Hintergrund. Ausprobiert werden kann aber auch, wie es sich in einem Rollstuhl fährt und dass es da so manche Hindernisse gibt. Apropos Inklusion: Das Programm auf der Bühne wurde abwechselnd von zwei Dolmetscherinnen in Österreichische Gebärdensprache übersetzt. Ein bisschen davon kann auch am Stand der „Kinderhände“ erlernt werden, unter anderem durch Zusammenfügen von Legosteinen mit den an der Seite aufgedruckten Zeichen für die Buchstaben – so kommst du zu einem Turm mit deinem Namen.
Übrigens, auf der Bühne gibt es abwechslungsreiches Programm – von unterschiedlichsten Tanzstilen über ebenso verschiedene Musik – Musical, Beatboxen, Hip*Hop, Rap bis zu Punk, dazu Clownerie, Geschichten UND natürlich dem leibhaftigen Holli – als Mensch im Kostüm des Ferienspiel-Maskottchens wandert der Sonnenkopf auch übers Festgelände. Sein aufblasbares riesiges Gegenstück hingegen bleibt gleich neben der Bühne stehen.
Mehr als vier Dutzend Stationen haben ihre Zelte mit Aktivitäten und Infos für Kinder aufgestellt. Letzteres natürlich auch für Eltern, Pädagog:innen und andere Erwachsene, die nun für die kommenden neuen Wochen Programm suchen, wobei es im Rahmen des Ferienspiels rund drei Mal so viele unterschiedliche Aktions-Angebote gibt; viele davon übrigens gratis oder wenigstens kostengünstig.
Das Startfest – im Laufe der Jahrzehnte immer wieder an verschiedenen Orten – ist dieses Jahr wieder im Donaupark, einem grünen Gelände, das vor knapp mehr als 60 Jahren auf dem Areal einer ehemaligen Müllhalde für die internationale Gartenausstellung errichtet worden ist. Alle Stationen sind aber gar nicht über den ganzen Park verteilt, sondern entlang einer – natürlich autofreien – Straße – auf der einen Seite wenige Gehminuten von der U1 Station Alte Donau, auf der anderen Seite U6, Station Neue Donau; dass die S-Bahn ausgerechnet schon ab Samstag zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt war, hätte sich vielleicht doch um zwei Tage nach hinten verlegen lassen.

Amelie Herold, Mia Mende, Emma Wille und Talitha Worster lasen bei der diesjährigen Preisverleihung der Jury der jungen Leser*innen im Literaturhaus Wien wenige Tage vor Schulschluss Passagen aus „Alle Farben von Licht“, das die Jugendlichen als Ältere der Jury der jungen Leser*innen zum Preisbuch 2025 – nach Lektüre von elf Büchern und intensiven Diskussionen darüber -gewählt hatten. Da sie und Lara Menner, Sara Subotić, Delia Frassine und Mara Vecchiotti sich nicht auf ein einziges einigen konnten, stellten die vier zuletzt Genannten einen Sonderpreis der jugendlichen Jury vor: Nachtschatten – Rosenheim-Trilogie (#3) von Gry Kappel Jensen.
Die vier Erstgenannten begründeten ihre Entscheidung für das Buch von Annika Scheffel so: „Es hat uns auf so vielen Ebenen berührt und überzeugt. Die Sprache ist einfühlsam und authentisch, die Figuren sind lebendig. Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene handeln glaubwürdig, ihre Gedanken und Gefühle sind nachvollziehbar. Das Buch berührt – still aber tiefgehend ohne jeglichen Kitsch. Gerade diese Kraft der Erzählweise der Autorin hat uns beeindruckt und auch nach dem Lesen noch nachdenklich gestimmt.
Gleichzeitig spricht das Buch wichtige und ernste Themen an: Verlust, Identität, Familie und auch psychische Belastung. Diese Themen werden mit viel Feingefühl und Respekt einverwoben. Die Verbindung aus berührender Sprache und inhaltlicher Tiefe machen „Alle Farben von Licht“ für uns preiswürdig. Und aus diesem Grund möchten wir nun auch den Blick auf die ernsteren Themen der Geschichte richten, die oft leiser, aber umso eindringlicher erzählt werden.
„Alle Farben von Licht“ zeigt, wie wichtig es ist, offen und ehrlich über psychische Gesundheit zu reden. Rio leidet, doch Schritt für Schritt und Wort für Wort findet er zurück ins Leben. Seine Geschichte schenkt Hoffnung. Rios Probleme verschwinden nicht einfach, doch er lernt mit seiner Trauer zu leben. Seine Geschichte zeigt, dass es okay ist, nicht o.k. zu sein. Das Leben hat viele Schattierungen – aus diesem Grund war es uns wichtig, dieses Buch hervorzuheben, denn am wichtigsten ist es, dass man nicht alleine kämpfen und den Weg zum Licht nicht alleine gehen muss.“

… ihr euch ran und tief reingewagt habt in dieses Buch, das für mich tatsächlich das persönlichste und wichtigste ist, das ich bisher geschrieben habe; ein Buch, das es nicht leicht hat auf dem Buchmarkt, vielleicht auch wegen der Themen, weil es neben Freundschaft und Lieben eben auch vom Tod, Trauer, Verlust und Einsamkeit handelt…“ las Anna Pech aus dem Antwortbrief der Autorin. Anna ist eine der vier Gründerinnen und Betreiberinnen der „Literaturbagage“, die die Jury der jungen Leser*innen nach dem Tod der Erfinderin dieser Buchdiskussionen vor mehr als 30 Jahren, Mirjam Morad, wieder belebt hat.
Ein bisschen erinnert der Plot an Harry Potter und Hogwarts. Kamille, Kirstine, Malou und Victoria besuchen ein Internat, in dem unter anderem Magie, Hellseherei, aber auch Mythologie, nicht zuletzt aus dem Nordischen Kulturkreis. Rosenholm heißt diese Zauber-Schule – und die Trilogie von Gry Kappel Jensen.
Lara Menner, Sara Subotić, Delia Frassine und Mara Vecchiotti aus der älteren Gruppe der Jury der jungen Leser*innen (12 bis 16 Jahre) lasen Auszüge aus „Nachtschatten“, dem dritten „Rosenheim“-Band. Die Jugendlichen – zu denen noch Amelie Herold, Mia Mende, Emma Willer und Talitha Worster gehören – hatten sich bei den Buchdiskussionen nicht auf ein Preisbuch einigen können bzw. wollen und vergaben für die magische Trilogie samt Kriminalfall um einen lang zurückliegenden Mord einen Sonderpreis.

In ihrer Begründung für die Entscheidung sagten sie bei der Vorstellung auf der Bühne des Wiener Literaturhauses unter anderem: „Unserer Meinung nach gab es in der Reihe einen sehr gelungenen Perspektivenwechsel. Wann aus der Sicht welcher der Protagonistinnen geschildert wurde, war für uns während des Lesens klar ersichtlich. Auch der Schreibstil der Autorin hat uns gut gefallen, er ist klar und verständlich. Dass einige Elemente der nordischen Mythologie in die Geschichte eingearbeitet wurden, hat den Spannungsfaktor noch einmal erhöht. Die Probleme der Hauptfigur waren nachvollziehbar und spannend erzählt und auch die Liebesgeschichte kam trotz des Genres Fantasy nicht zu kurz. Die gesamte Rosenheim-Trilogie beinhaltet fesselnde Abenteuer, die uns dazu gebracht haben, die Bücher in einem durchzulesen und sie nicht so schnell wieder aus der Hand zu legen.“
Kathi Pech, eine aus dem Quartett der Literaturbagage und wie ihre Kolleginnen eins selbst Kind in der Jury der jungen LeserInnen vor mehr als 20 Jahren, verlas die englische Antwort der Autorin Gry Kappel Jensen, die sich über diese Auszeichnung sehr freute und nun Österreich noch mehr schätze… (siehe Video).
Wird mit einem dritten Teil fortgesetzt.

Als Carla Steiner, Emma Gruber, Zeynep-Sara Türk, Alma Hammerer und Suren Leo Paydar an den Tischen auf der Bühne des Wiener Literaturhauses Platz genommen hatten, wurden ihnen Schalen mit Gemüse und Obst gebracht. Suren griff zu einem aus grünen Krepp-Papieren kunstvoll gebastelten „Brokkoli“. Da war selbst jenen, die den Folder beim Büchertisch noch nicht gesehen oder gelesen hatten, aber mindestens dieses eine Buch kannten, klar: Die Wahl dieser jungen Leser:innen und ihrer beiden Kolleginnen Mia Hildebrandt, Marie Kozojed, die mit ihren Klassen auf Projekttagen waren, ist aus jenen 13 Büchern, die sie alle gelesen hatten – wie auch schon im Titel hier angekündigt – auf „Drei Wasserschweine brennen durch“ (Idee und Text: Matthäus Bär; Illustration: Anika Voigt) gefallen. Denn die Requisiten deuten auf das Futter zumindest einiger der im Buch vorkommenden Tiere im Zoo Schönbrunn hin.
Nicht zufällig war der Autor, dessen zweiter Band „Wasserschweine wollen’s wissen“ auch schon erschienen ist, ein dritter folgt, im Literaturhaus anwesend. Und lauschte aufmerksam, welche Stellen die fünf jungen Juror:innen ausgewählt hatten. Noch mehr war er neugierig auf die Begründungen der, wie er schon bei einem früheren Treffen festgestellt hatte, sehr kritischen Viel-Leser:innen.
Mehrfache sagten die genannten Kinder, dass sie es spannend gefunden haben; dazu kam noch, dass es leicht zu lesen war, dass es im Zoo Schönbrunn spielt, viel davon in der Nacht „und weil Wasserschweine drin vorkommen“. Außerdem wurde hervorgehoben, „dass das Buch aus der Sicht der Tiere geschrieben ist“ und verschiedene Altersgruppen anspricht, es auch lustig ist und „man sich so richtig in die Geschichte hineinversetzen konnte“ (siehe dazu auch das Video von den Begründungen der jungen Juror:innen).
Im Zuge der Preisverleihung interviewten die Kinder auch den Autor, der lange vor allem als Liedermacher und Sänger bekannt war. Die 3:50 für einen Song seien ihm zu kurz geworden, er wollte länger und mehr erzählen, weshalb er die künstlerische Disziplin gewechselt habe. Matthäus Bär gestand auch, dass er durch die Zusammenarbeit mit der Illustratorin Anika Voigt erst draufgekommen sei, dass Wasserschweine keine Hufe haben, weshalb er diese Passagen ändern musste. Diese Tiere faszinierten ihn, weil sie vor allem mit schwimmen, schlafen und fressen auskommen. Und Brokkoli habe er so einen wichtigen Stellenwert eingeräumt, weil da die Meinungen so ganz verschieden wären – die einen lieben, die anderen mögen ihn so gar nicht. Was für das Publikum im vollbesetzten Veranstaltungssaal des Literaturhauses, das er gleich einmal fragt, ganz und gar nicht stimmte – da gingen beim „mögen“ fast alle Arme hoch. „na gut, dann hab ich’s geschrieben, weil alle Brokkoli lieben!“, schwenkte er verschmitzt um.
Wird fortgesetzt mit den Ergebnissen der „älteren“ (12-bis 16 Jahre) sowie der Festrednerin, einer bekannten jungen Kinderbuchautorin.
In den Links unten u.a. eine schon vor Längerem erschienene Besprechung des ausgewählten Buches, das übrigens auch einen der österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise bekommen hat; sowie von anderen der Bücher auf der Lese-Liste dieser jungen Jury.
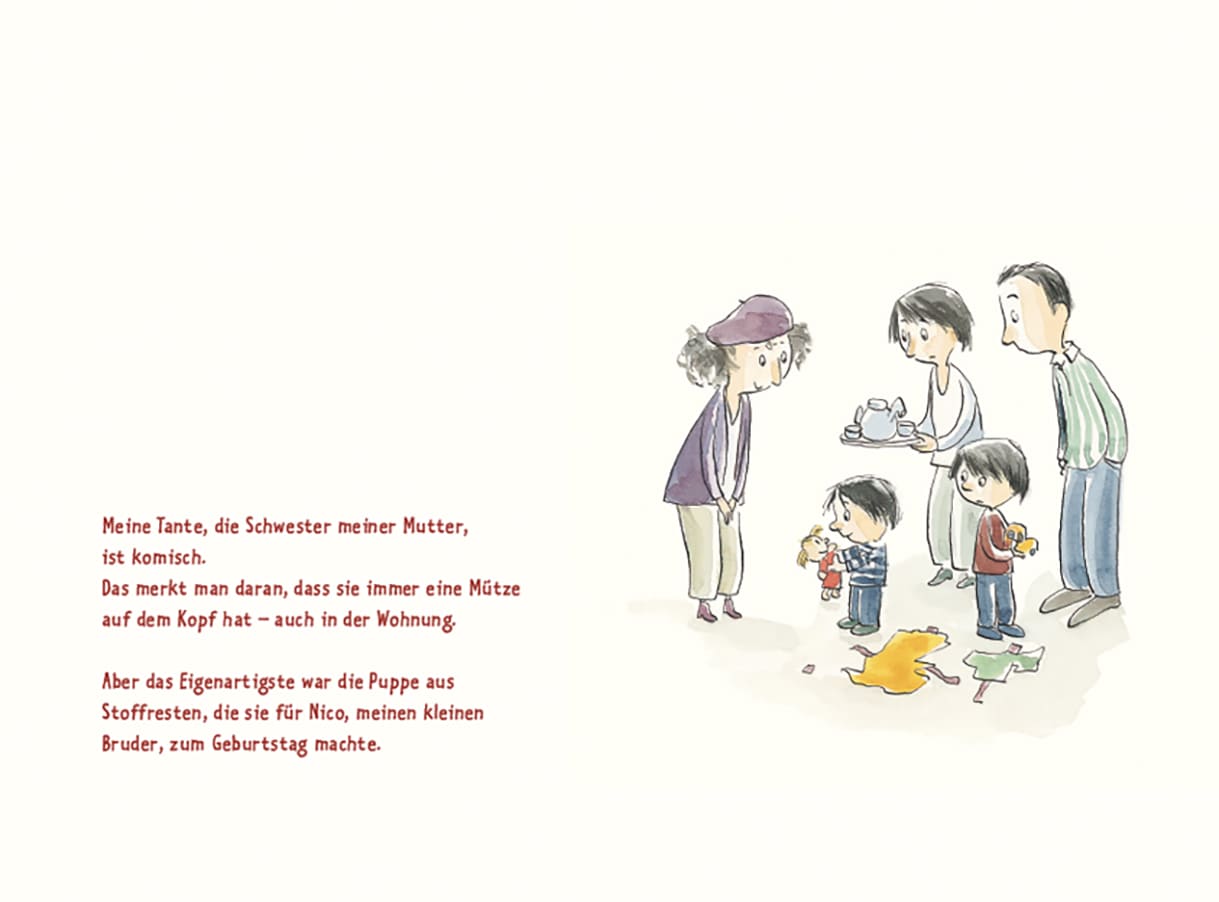
Nico, der jüngere Bruder des ich-erzählenden, namenlos bleibenden, Kindes, kriegt von seiner Tante eine Puppe geschenkt, freut sich und nennt sie Mimi. Das freut den Papa gar nicht, „heute Abend gehen wir dir ein super Spielzeug kaufen. Ein echtes Jungenspielzeug“, kündigt er an. Doch weder Schwert noch Feuerwehrhelm oder Rennauto, das der Vater ihm vorschlägt, taugt Nico, sondern „einen Puppenwagen für Mimi“.
Da zuckt der Vater aus, kauft eine große Werkzeugkiste, was seinen jüngeren Sohn zum Weinen bringt und Mama an der Kassa zur Frage veranlasst, „wozu ein Geschenk gut sein soll, das … zum Heulen bringt.“
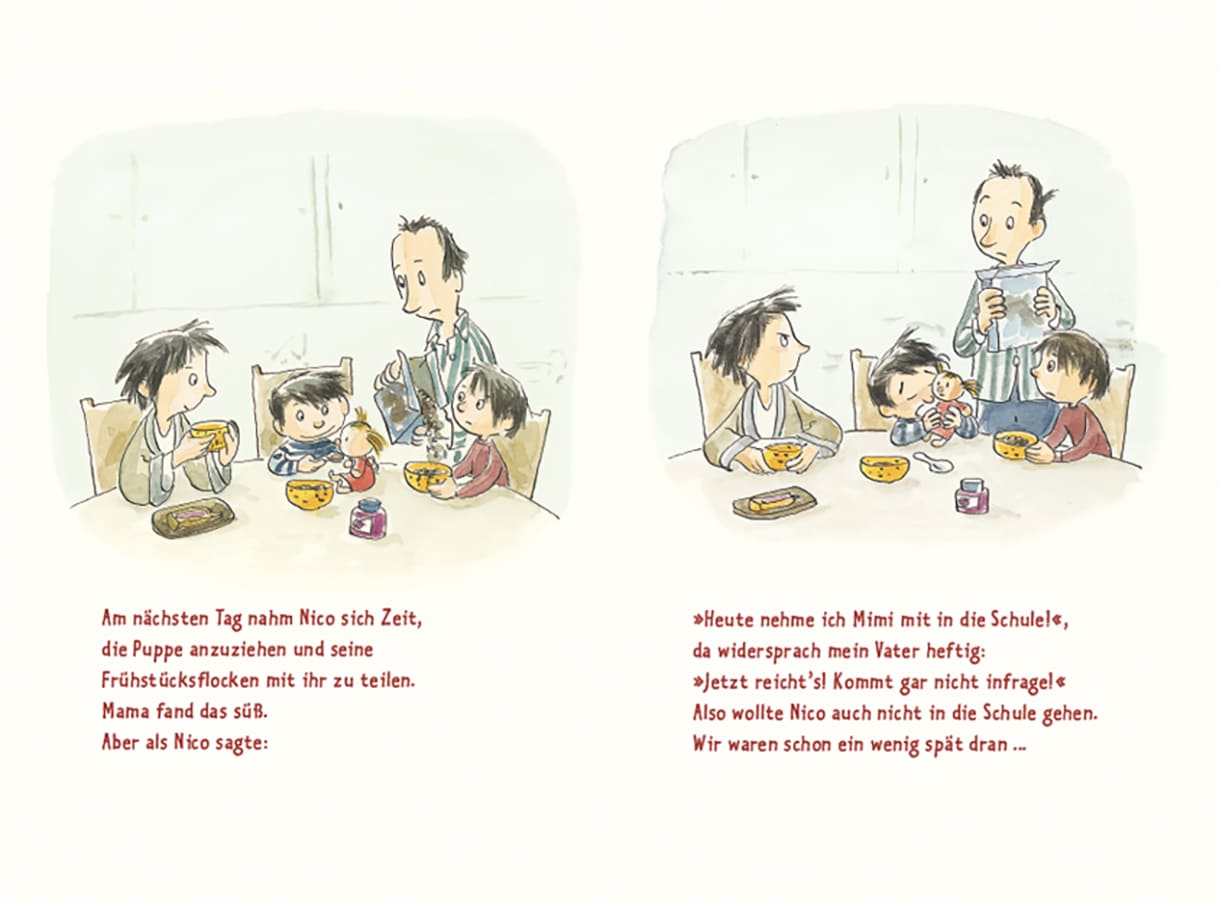
Klar, so kann’s nicht bleiben und so hat dieses reich bebilderte Buch Puppen sind doch nichts für Jungen! (Text: Ludovic Flamant; Übersetzung aus dem Französischen: Alexander Potyka; Illustration: Kean-Luc Englebert) letztlich eine große Wendung – die sei natürlich hier nicht verraten.
Während Mädchen – trotz aller Versuche, Errungenschaften in Sachen Gleichberechtigung zurückzudrängen einerseits, und der in vielen Ländern, darunter auch Österreich noch immer nicht gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit andererseits – doch so ziemlich alle Wege offenstehen, werden Buben, die mit Puppen spielen oder andere, die gern tanzen, viel zu oft belächelt, ausgelacht, runtergemacht oder sehen sich Erwachsenen gegenüber, die ihnen Fürsorglichkeit und Sanftheit austreiben wollen. Sich dann aber über männliche Gewaltbereitschaft wundern ;(
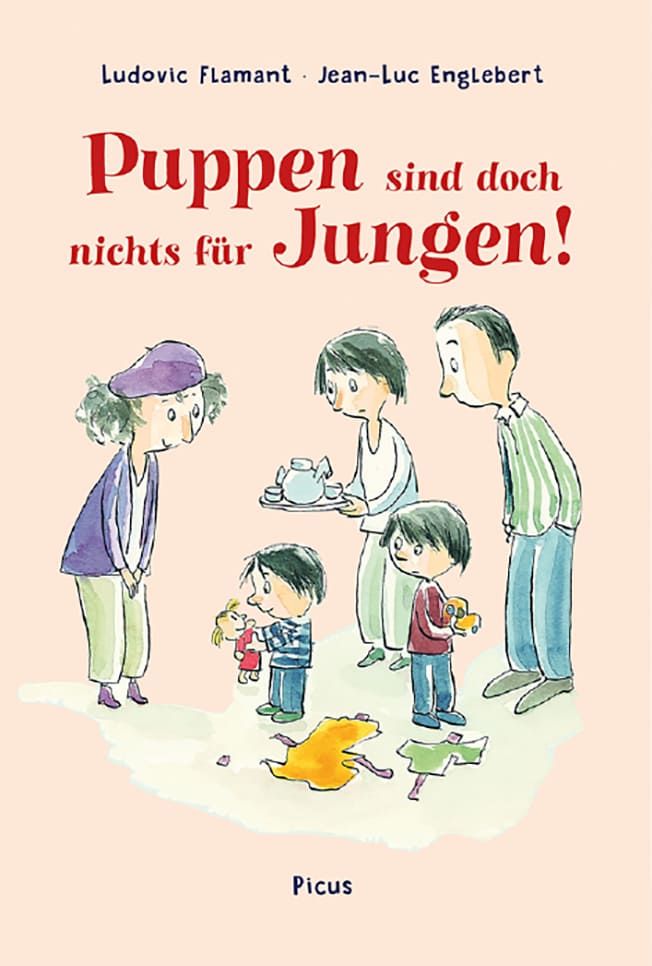

Welches der Bilder ist von einem Menschen fotografiert und welches hat eine Künstliche Intelligenz (KI) erstellt? Sofort schnellen einige Hände der vor den Fotos befragten Kinder in die Höhe. „Das rechts, die Frau im Labor hat nur einen blauen Schutzhandschuh an und die Pipette schwebt in der Luft“, sagt eines der Mädchen aus der Mehrstufenklasse der Volksschule Brüßlgasse in Wien-Ottakring.
Menschen- oder KI-gemachte Fotos war eine von drei Stationen des durch Europa tourenden „Curiosity-Cubes“ (Neugier-Würfel), der zwei Tage lang Halt im MuseumsQuartier Wien – knapp vor der fast schwarzen Wand des MuMoK (Museums Moderner Kunst“ in jenem Hof, an dessen anderer Seite das AZW (ArchitekturZentrum Wien liegt). Wobei „Würfel“ stimmt, selbst halbwegs genau genommen, nicht wirklich. Die „Heimat“ des mobilen Experimentier„kastens“ ist ein umgebauter Schiffs-Container; solche sind ein bissl größer als jene Metallkisten, die auf LKW genau drauf passen; und selbst die sind länger als breit bzw. hoch. Aber gut, das englische Cube umfasst auch Räume, deren Seiten nicht gleich lang sind 😉
KI ist das diesjährige Thema der Tour – bei den beiden anderen Stationen – jede Klasse teilt(e) sich in drei Gruppen, die reihum alle Experimente und Spiele machen konnten. Eine Station, die von vielen Kindern der Klasse von KiJuKU danach befragt, sehr geschätzt wurde, war das Bauen eines Weges von zu Hause in die Schule. Kärtchen mit schwarzen dicken Linien, gerade oder mit einer Kurve – wie sie auch aus manchen Brettspielen bekannt sind – mussten einen geschlossenen Weg ergeben. Auf solche setzten die Kinder dann winzige, kreisrunde Roboter. Die simulierten sozusagen fahrerlose Autos, blieben auf der Straße, stoppten bei roten Ampeln, verringerten beim Verkehrszeichen für Baustellen das Tempo und so weiter. „Cool, dass wir da selber die Straßen für die Roboter bauen konnten“, kam es von einem der Kinder danach und gleich stimmten viele andere ein, „das hat mir auch am besten gefallen“.
Andere meinten hingegen, „wir haben eh schon in der Schule in Freiarbeit mit größeren Bee-Bots gearbeitet“.
Ein bisschen tricky fanden nicht wenige die dritte Station – das meinten auch einige der Betreuer:innen für sich selber. Auf einem Spielfeld mit 100 kleinen Knöpfen, die bei Berührung zu leuchten beginnen, taucht immer auf der linken Hälfte ein Muster auf – das gilt es auf der rechten Spielhälfte zu „spiegeln“. Herausfordernd war nicht zuletzt, dass sich zwei verschiedene Rot-Töne sehr ähnlich sind, und die strahlende Sonne machte dies noch schwieriger. Manche Kinder setzten sich daraufhin so auf den Boden, dass sie mit ihren Oberkörpern Schatten auf das Spielfeld warfen 😉
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte natürlich von den Volksschüler:innen auch wissen, ob sie einerseits selber schon mit KI-Tools experimentiert haben und / oder andererseits bei Bildern oder Informationen im Internet nicht ganz sicher waren, von Menschen oder sozusagen Robotern gemacht?
So manche haben bei etlichen Fotos, unter anderem wurden Hundewelpen genannt, schon überlegt und genauer geschaut, ob Merkmale von KI-generiert zu erkennen gewesen wären. „Hausübung gemacht hab ich nicht mit einer KI, aber einmal hab ich meine HÜ kopiert und von ChatGPT überprüfen lassen, ob sie auch wirklich richtig ist“, erzählt ein Schüler.
Der Curiosity Cube wird vom internationalen Pharma- und chemischen Unternehmen Merck (60.000 Mitarbeiter:innen weltweit; Gründung 1668 in Darmstadt, Deutschland, mit einer Apotheke) betreiben und auf Reisen geschickt. In den USA und Kanada begann diese Förderung von Wissenschaft an Kinder bringen 2017, in Europa tourt der Container seit 2022, in Österreich war er nun erstmals; übrigens auch in Afrika in einigen Ländern im Süden (Südafrika, Botswana, Lesotho, Namibia und im kleinen Eswatini (bis 2018 Swasiland), aber auch kaNgwane genannt, einem Königreich zwischen Südafrika und Mosambik).
Der „Neugier-Würfel“ bezieht einen Teil des benötigten Stromes aus der Kraft der Sonne (solarbetrieben). Betreut werden die Stationen von Mitarbeiter:innen der Firma, den meisten im Rahmen ihrer Freistellung für freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeiten (16 Stunden oder zwei Arbeitstage pro Jahr) – die sie aber auch woanders ausüben können.
Seit mehr als 20 Jahren vermitteln in den Sommerferien, mittlerweile an den meisten Hochschulen Kinderunis Lust an Wissenschaft, Forschung, vor allem am Neugierig-Sein und Fragen-Stellen. Nach zwei Wochen Kinderuni in Wien werden die Kinder, die zur Sponsion kommen wollen, gefragt / gebeten, wer von ihnen gelobt, nie aufzuhören, Fragen zu stellen und Antworten darauf zu suchen, werde mit dem Titel Magistra oder Magister universitatis iuvenum belohnt.
Die Kinderuni Wien betreibt seit ein paar Jahren auch ganzjährig DOCK an einem Donaukanalufer (1090, Spittelauer Lände). Der Science Pool bietet ganzjährig Workshops an. Beide in praktisch allen Wissenschaftsdisziplinen. Und im „Zirkus des Wissens“ an der Linzer JKU (Johannes Kepler Universität) werden manche wissenschaftliche Themen in theatralen Geschichten auf die Bühne gebracht.
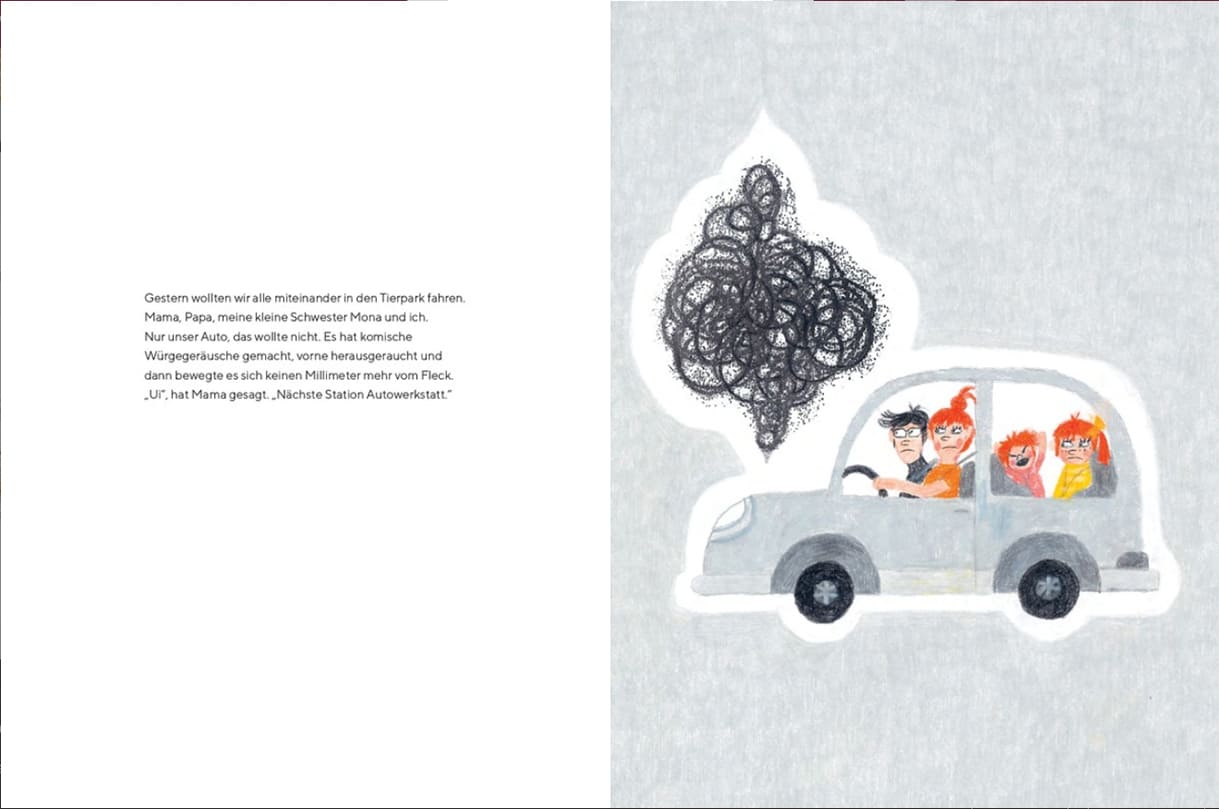
Ach wie gut, dass das elterliche Auto einmal „streikt“, wenngleich diese sehr dunklen Rauchwolken eher auf ein Uralt-Vehikel hindeutet. Aber, diese Szene ist für die mehrfach preisgekrönte Autorin und Illustratorin Leonora Leitl ohnehin „nur“ eine Art Schuhlöffel für ein Loblied auf die Fantasie von Kindern, wenn sie zu Fuß einen Weg zurücklegen. Da entdecken sie viel, das Erwachsene übersehen (würden), bleiben da und dort stehen, oder finden etwas, auf das sie klettern können oder darüber springen, staunen, versinken in Geschichten… nicht selten stören Erwachsene dabei mit „komm, geh schon weiter!“
Das erspart die Gestalterin von „Wir sind ja nicht aus Zucker!“ ihrer Titelheldin Sanna. Grantig, unausgegoren und genervt lässt Leitl Mama, Papa und die jüngere Schwester Mona rund um den Frühstückstisch dreinschauen, während Sanna fröhlich meint, wenn das Auto nicht fährt, könne sie ja zu Fuß in die Schule gehen. Wenn sie sich beeilt, erwischt sie sogar noch ihre Freund:innen – Action-Alma und Käpt’n Kurti, die schon länger auf diese Art und Weise ihren Schulweg – und den nach Hause zurücklegen.

Skeptische Mutter, erhellter Blick des Vaters, der gleich von seinen Schulweg-Abenteuern zu schildern anfängt – und sich dabei seines Spruches von damals erinnert, der dem Buch auch den Titel gegeben hat.
Gesagt, pardon geschrieben, und getan. Sogleich lässt die Autorin und Illustratorin, die hier vor allem mit Buntstiften und Wachsmalkreiden gearbeitet hat und stilistisch von Kinderzeichnungen ausgegangen ist, das Trio in fantasievolle Abenteuer eintauchen: Durch Schluchten, vorbei an wilden Tieren samt einem Säbelzahntiger, einem Imbisstand-Hexer und einer – im Text zahnlosen, im Bild ein-zahnigen – Hexe in einer Höhle. Weitere Stationen sind Sumpf, Moor, Vulkan und manches mehr – das du vielleicht in deiner Fantasie nochmals ausschmücken, ergänzen oder anreichern möchtest.

Natürlich kommen die drei Kinder – gerade noch – rechtzeitig in der Schule an, um sich auf dem Heimweg neue Abenteuer auszudenken. Vielen Kindern müsste das zu Fuß in die Schule gehen – noch dazu mit Freund:innen oder Kolleg:innen ja vielleicht weniger schmackhaft gemacht werden als Eltern. Da gibt’s eine ganze Reihe, die aus falsch verstandenem Sicherheitsgefühl ihre Kinder mit dem Auto am liebsten direkt bis vor die Schultüre bringen würden. Dieser starke Autoverkehr vor Schultoren ist allerdings eine Gefährdung weswegen viele Schulen am liebsten die Schulvorplätze autofrei machen (würden).
Und „nebenbei“ legen viele Kinder mehr Wert auf umweltfreundliches Verhalten – daraus hat sich sogar schon seit Jahren die Aktion von „Pedibus“ entwickelt, sozusagen Schulbus zu Fuß – mit gemeinsamer Geh-Strecke und Haltestellen zum „Ein-“ bzw. „Aussteigen“.


Aus tragischem aktuellen Anlass muss das aktionstheater ensemble, das ab Donnerstag „Ragazzi del Mondo“ im Bregenzer Kosmos Theater (Details siehe Info-Box) spielt, jeweils eine Vorbemerkung – auf kleinen Plakaten im Foyer anbringen und damit’s niemand übersieht, auch vortragen, und die sei auch hier auszugsweise veröffentlicht: „Sämtliche Textpassagen, wie etwa die Tatsache, wie leicht es ist, in Österreich an Waffen zu gelangen, sind im Laufe des Probenprozesses entstanden und somit keine direkte Reaktion auf die jüngste Tragödie des Amoklaufs in Graz. Es handelt sich im Stück also um Reflexionen auf das allgemeine Zeitgeschehen.“ Samt dem Verständnis dafür, dass angesichts dieser Ankündigung, manche Besucher:innen das Stück unter diesen Voraussetzungen nicht anschauen können oder wollen.
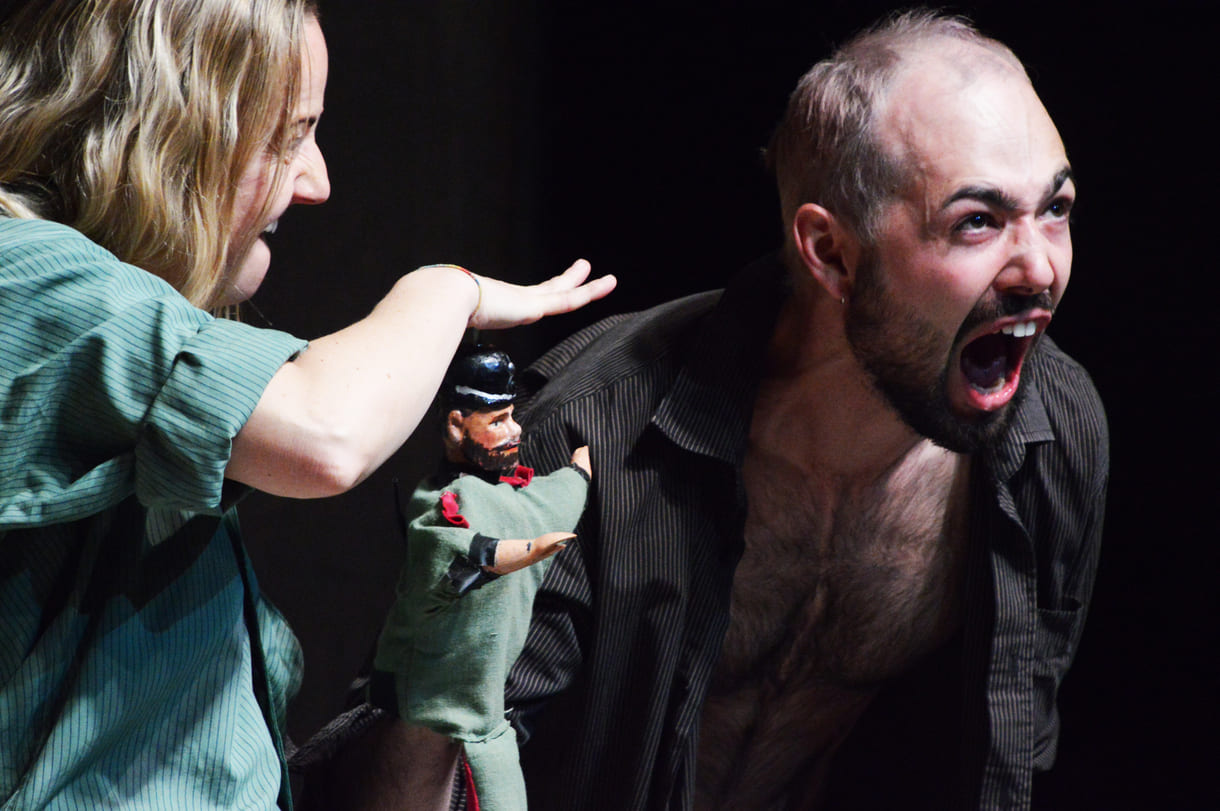
Gleich in der ersten Szene steht die Lust am Schießen, auch wenn’s „nur“ auf Feldhasen ist, zu der Touren in den USA einladen, im Zentrum. Und dazu Erfahrungen aus Recherchen in einem österreichischen Waffengeschäft. Dort bzw. auf der Homepage eines solchen Dealers ist 1:1 zu lesen, was – hoffentlich nicht mehr lange so gelten wird: In drei Stunden von null auf Waffe samt dem psychologischen Gutachten. Das war übrigens bisher in der Berichterstattung nach dem Massenmord an dem Grazer BORG noch kaum bis nicht zu vernehmen – und ebenfalls bislang offenbar noch kein Thema bei der angekündigten Verschärfung der Waffengesetze: Ein Unternehmen, das Waffen verkauft, sorgt auch gleich für das Gutachten!!!???
Die heftige und aufgrund der Aktualitäten – Graz sowie Krieg Israel-Iran – noch heftigere Eröffnungsszene lässt den Atem des Publikums stocken, auch wenn die Gruppe schon vorab das jüngste Stück als „theatralisches Gemälde über die Möglichkeit und Unmöglichkeit des Miteinanders vor der Kulisse internationaler Kriegsszenarien, unter anderem die gestiegene Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft“ ankündigte.

Und so fetzen sich Darsteller:innen heftigst – und verströmen dabei auch noch teils riesengroße Lust an gegenseitigen zumindest verbalen Verletzungen. Klar, jede und jeder im Publikum weiß, das ist „nur“ gespielt. Aber es wirkt über weite Strecken derart authentisch, dass es innerlich wehtut – und noch viel mehr, weil viele der Auseinandersetzungen allzu bekannt vorkommen, dass sie zum Spiegelbild dessen werden, was permanent – vor allem – auf Social Media abläuft; und dazu so manches das sich im analogen Leben abspielt: Trotz schier unendlich vieler Worte und Sätze findet Kommunikation miteinander selten statt – aneinander vorbeireden, die / den anderen ignorieren, überhören trotz oder eben auch wegen der Lautstärke…

Konnten Menschen zu Beginn ihrer Geschichte nur (über-)leben, wenn sie zusammenhielten, so scheinen wir alle nicht nur in Sachen Umgang mit der Umwelt, sondern auch miteinander ziemlich kräftig an der eigenen Auslöschung zu arbeiten. Dem Planeten selber wird’s überspitzt formuliert wurscht sein. Wie schon Jura Soyfer in seinem Stück „Der Weltuntergang“ den Planeten Saturn sagen lässt: „Er hat sich gedacht, ein Zusammenprall ist eh überflüssig. Die Menschen rotten einander sowieso über kurz oder lang aus!“ Als Die Sonne zur Versammlung der Planeten rief, um die Störung der Sphärenharmonie zu besprechen und die Erde als Verursacherin ausmachte, entschuldigt der Mond diese mit der Bemerkung: Die Erde hat Menschen.

Das aktionstheater ensemble hat natürlich auch Kinder der EINEN Welt (Ragazzi del mondo) wie immer gemeinsam entwickelt: Mastermind Martin Gruber mit dieses Mal Zeynep Alan, Isabella Jeschke, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Benjamin Vanyek (Schauspiel, Tanz und Text) sowie den Live-Musikern Andreas Dauböck (Drums, Klavier, Synthesizer, Looper, Gesang) und Pete Simpson (Gesang, Bass); und dazu noch Martin Ojster (Dramaturgie), Valerie Lutz und Martin Platzgummer (Bühne) sowie Luis Kaindlstorfer (Kostüme). Und wie ebenfalls praktisch immer zielt die Inszenierung darauf ab, dass sie die Zuschauer:innen nicht außen vor lässt und über „die anderen“ erzählt, sondern sich das Ensemble selbst sowie das Publikum in die „Selbst-)Kritik einschließt.
Und damit dies auch möglich ist, die Distanz, die vierte Wand durchbricht, weist trotz aller Heftigkeit auch „Ragazzi del Mondo“ die eine oder andere humorvolle Passage und Szene auf, auch wenn das Lachen dann – bewusst provoziert – nicht selten im Hals stecken bleibt.

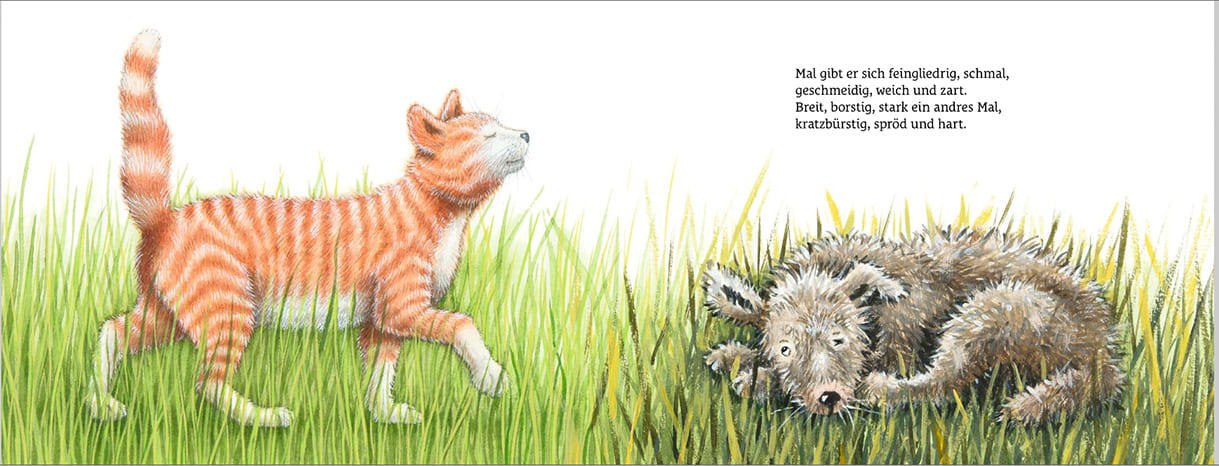
Ein Elefant trägt einen breiten, großen Pinsel fast wie einen Baumstamm in seinem Rüssel. Freundlich-neugierig schaut er auf die Maus mit ihrem zarten Malgerät, die auf einem bunten Farbtopf steht. So deutet der Autor und Illustrator Marcus Pfister schon auf der Titelseite seines jüngsten von mehr als fünf Dutzend Bilderbüchern die Vielfalt an, die Leser:innen und vor allem Schauer:innen auf den folgenden Seiten erwarten wird.
In „Jedem seinen Pinsel! Die bunte Welt der Malstile“ versammelt er viele seiner bisherigen Schöpfungen, einige davon Titelhelden früherer Bücher. Klar, dass da auch der Regenbogenfisch nicht fehlen darf, dem er schon rund ein Dutzend Abenteuer gewidmet hat. Hier aber spielt er nur eine „nebenbei“-Rolle.
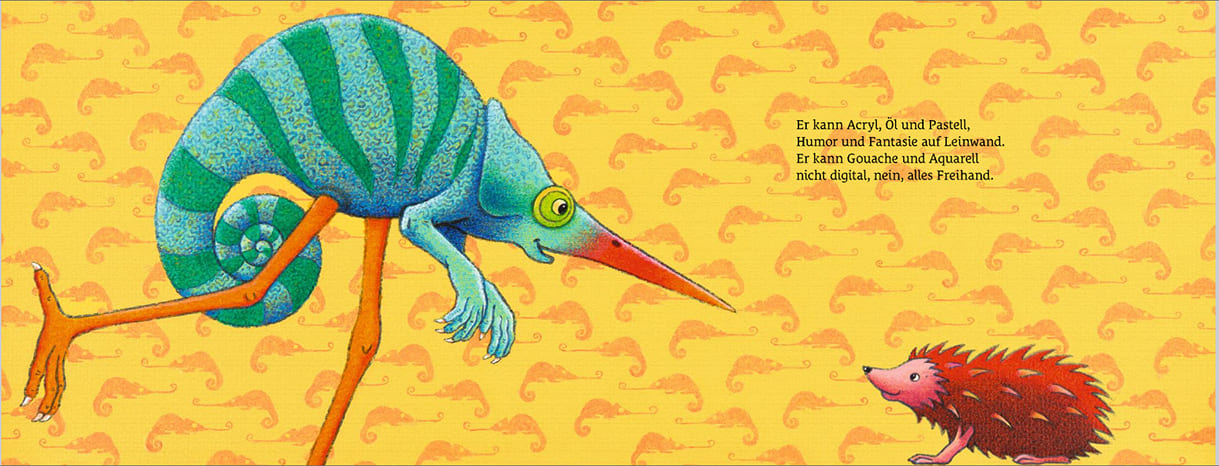
Pinguine, das tanzende Walross Franz-Ferdinand, Mondrabe, Pardiesvogel, Maus Mats, Igel Mitschka und noch so manch anderes seiner gemalten und mit Geschichten ausgestatten Tiere bevölkern zunächst 12 Doppelseiten, bevor’s auf vier weitere mit einem Überblick über Pfisters Schaffen geht – auf diesen erläutert er auch jeweils, zu welchen Pinsel und Farben sowie weiteren Illustrationsmöglichkeiten (nicht zuletzt die glänzenden Heißfolienprägungen) er gegriffen hatte.
Und was so alles Pinsel und Farbe – auch wenn’s in seltenen Fällen nur eine ist – aufs Papier „zaubern“ können, wie unterschiedlich scharfe Kanten oder ausfransende Striche ein Tier erscheinen lassen. Und vieles mehr.
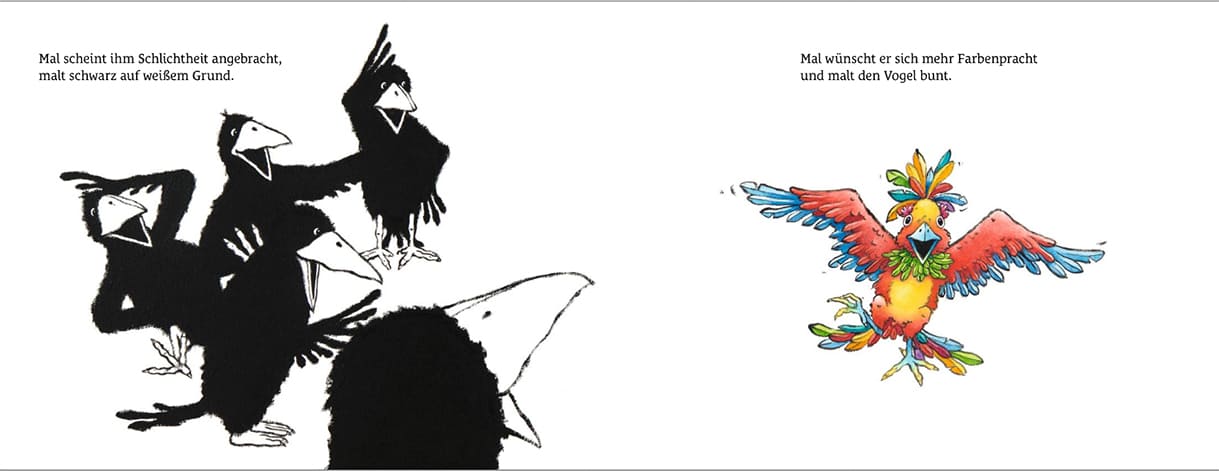
Alles erzählt aus der Sicht von Pinseln: „Mal scheint ihm Schlichtheit angebracht, malt schwarz auf weißem Grund“ – auf der einen Seite und als ergänzenden Gegensatz auf der gegenüberliegenden Seite: „Mal wünscht er sich mehr Farbenpracht und malt den Vogel bunt.“
Marcus Pfister will mit diesem Buch aber neben dem Überblick über die Vielfalt seiner Arbeit geben, sondern vor allem: Es würde mich sehr freuen, wenn daraus bei euch die Lust am eigenen kreativ-Sein geschürt wird. Ich wünsche euch viel Freude dabei!“
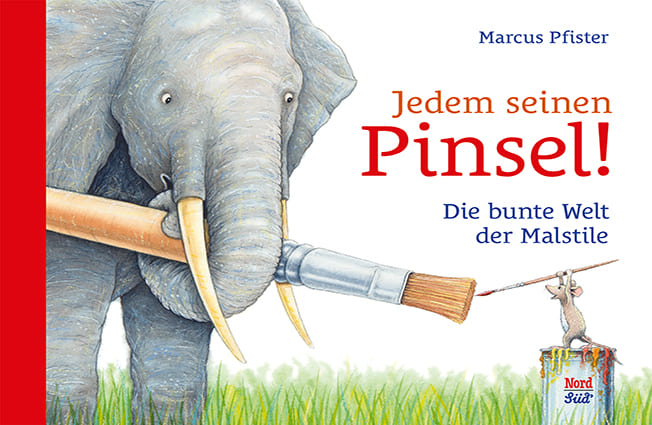

In einem mitreißenden Mix aus unterschiedlichsten Tanzstilen von Musical bis Breakdance, begleitet von einer Live-Band, sowie Schauspiel und Videos in Comic- und Computerspiel-Ästhetik zauberten vor allem Studierende verschiedener Abteilungen der Anton Bruckner Privatuniversität Linz eine mit auch viel Witz gewürzte zeitlose Story, die vor allem Gier aufs Korn nimmt. „Sin City oder die salzigen Tränen der Edith Lot“ nimmt Anleihe bei der mehr als 2000 Jahre alten Geschichte der Stadt Sodom, die hier Sodor heißt. Sie ist DAS Symbol für Ansammlung sündiger, vor allem gieriger Menschen und findet sich sowohl im hebräischen Tanach als auch der christlichen Bibel und dem islamischen Koran – wie viele andere Geschichten der drei großen, monotheistischen Weltreligionen.
Auf halbem Weg hinauf auf den Linzer Pöstlingberg liegt diese Uni schön im Grünen, fast „paradiesisch“. In der Studiobühne „rockten“ die mehr als zwei Dutzend jungen Darsteller:innen, meist gleichzeitig auch Tänzer:innen diese Story, die – im Gegensatz zu den religiösen Büchern – der dort namenlosen Frau des Lot einen Vornamen, nämlich Editz, gaben und sie ins Zentrum rücken. Da es sich um eine reife Ensemble-Leistung handelt, seinen hier keine Mitwirkenden erwähnt – sie alle, auch das Leading-Team mit Idee, Konzept, Regie, Choreo und so weiter sind hier „nur“ in der Info-Box alle genannt.
Die Stadt ist dem Verderben geweiht, der (jeweilige) Gott will wegen der Sündhaftigkeit ein Exempel statuieren und sie vernichten. Engel wollen wenigstens Edith Lot, hier eine Aktivistin gegen den Raubtier-Kapitalismus, samt ihrer Familie retten. Einerseits mit Flügel, andererseits wirken sie auf der Erde irgendwie wie Aliens und doch wieder wie heutige Menschen, suchen sie doch verzweifelt nach einem Ladekabel für ihr SmartPhone.
So alt die Geschichte in ihren Grundzügen, so praktisch zeitlos und besonders aktuell sind diese knapp mehr als 1½ Stunden gegen Menschheit und Planeten zerstörende „Sünden“ ebenso wie für den Widerstand dagegen und für eine (menschen-)freundlichere Welt. Denn hier ist Frau Lot nicht nur eine von einer himmlischen Macht Auserwählte „sündenfreie“, sondern eben eine Kämpferin für eine bessere Welt und Klima und dessen Rettung versus Zerstörung ein zentrales Thema.
Würde sich auszahlen, damit auf Tour zu gehen, oder die Story von anderen großen, jungen Ensembles eigenständig neu zu inszenieren.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Honig und Essig? Klingt aufs erste, naja, nicht gerade verlockend. Doch es ist ein Jahrtausendealtes erprobtes, vor rund 2500 Jahren auch schriftlich verbürgtes Hausmittel, genannt Oxymel (meist im Verhältnis 3 bis 4 zu 1)– der zweite Wortteil ist für Honig bekannt und oxy – ebenfalls aus dem Altgriechischen – steht für sauer.
Gut, das wäre somit nichts Neues. Aber die „vitalOxy“-Jungunternehmer:innen aus der HBLA in Salzburg-Ursprung bauten nicht nur auf dem Wissen Theresa Mühlbachers auf, die von ihrem Vater, einem Imker, viel über Bienen und Honig einbrachte, sondern konnte es auch mit der von Iris Mackingers mütterlicher Kräuter-Expertise vermengen. Im wahrsten Sinn des Wortes.
Die beiden Genannten sowie Tristan Scheibenbauer, Maximilian Scheikl und Nico Kräutner vertraten als Quintett das gemeinsam mit vier weiteren Jugendlichen betriebene Unternehmen VitalOxy. Die Jungunternehmer:innen suchten Rezepturen mit gesundheitsfördernden Wirkungen für verschiedene Anlässe und gaben ihnen selbsterklärende Namen: Immun, Kraft, Darm, Kater und soll in besagten Fällen helfen. Der fünfte süß-saure dickliche Saft, den sie nach Wien mitgebracht haben namens „Küche“ könnte als Marinade oder beim Kochen Verwendung finden. 13 Sorten hatten sie im Laufe der Produktion gemixt.
Was aber ganz besonders an VitalOxy ist: „Wir verwenden den sogenannten Zementhonig, ja, der heißt wirklich so“, versichern die Jugendlichen dem zweifelnd dreinschauenden Journalisten. „Naja, der Fachbegriff ist Melezitose-Honig, der ist so fest, dass ihn Imker:innen kaum aus der Wabe kriegen, weshalb er meistens weggeschmissen wird. Man könnte die Wabe samt dem festen Honig kochen, aber dann verliert der Honig seine Nährstoffe. Wir haben uns gedacht, wir probieren’s einfach aus, diesen harten Honig mit Essig zu vermischen und schonend zu erhitzen. Das ist ein eigenes Verfahren, das wir entwickelt haben
Wem die sogenannten grünen Daumen fehlen und bei der oder dem Pflanzen in der Wohnung somit regelmäßig eingehen oder nicht richtig blühen und gedeihen, für den dachten sich Schüler:innen der HTL Anichstraße (Innsbruck, Tirol) etwas aus, und machten es zu ihrer Geschäftsidee. Nein, sie schicken keine Gärtner:innen in diverse Wohnungen oder WG-Zimmer, sondern konzipierten relativ kleine und doch beachtliche, noch dazu dekorative Glashäuser. Diese Mini-Gärten im geschlossenen Glas, womit das Wasser in diesem kleinen geschlossenen Ökosystem im Kreislauf bleibt, lassen sich auch via Handy-App pflegen – der spezifisch fachliche Part der HTL’er:innen Silvana Schennet, Christian Baumann, Andreas Achrainer, Benjamin André und Hannes Egger, die die Hardware entwarfen und das Gehäuse dazu 3D-druckten und die Software programmierten für die unterschiedlichen EcoSphere-Produkte ihres Unternehmens „Grow Green“.
Wähl deinen eigenen Spruch und mach (d)ein T-Shirt zu einem einzigartigen. Nicht schon vorgedruckte Kleidungsstücke aus dem Geschäft, sondern individuell designt – das ist die Geschäftsidee der Junior-Company „Print it“ aus der Handelsakademie und -schule im Vorarlberger Bludenz. Wem keine passende Idee kommt, für den halten Shaden Khalil, Enkhlen Buyansargal, Eva Fuchs, Maxima Lorenzin und Isabel Bruggmüller, die ihr und ihrer Kolleg:innen Schüler:innen-Unternehmen aus der 2. Klasse BHAK/BHASch beim Bundesfinale der Junior Companies in Wien vertraten, auch schon einiges bereit – Highlight: MEGA – Make Empathy Great Again.
Ihre Firma ist Teil des Unterrichtes im Pflichtfach Projektmanagement mit zwei Wochenstunden. Für ihr Leiberl-Bedruck-Business haben sie sich auch einen Werbespruch ausgedacht: „Your style – our mission“.

Im ersten Teil der Berichte über jene Unternehmen, die Jugendliche für ein Schuljahr gründen, und in ihren Bundesländern gewonnen haben, wurden hier auf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… jene drei Junior Companies vorgestellt, die von der Jury auf die ersten drei Plätze gewählt wurden. Hier beginnt nun die Präsentation der anderen Landes-Sieger:innen – in alphabetischer Reihenfolge der Bundesländer; die Top 3 kamen aus der Steiermark, aus Wien sowie Kärnten; hier nun die nächsten drei von Schüler:innen gegründeten Unternehmen.
Wie schon bei den Erstplatzierten sowie in vielen anderen unternehmerischen Projekten – auch bei Jugend Innovativ in der Kategorie Entrepreneurship – setzt das Schüler:innen-Unternehmen aus dem Burgenland auf regional und nachhaltig. Laurin Breuer, Emma Pober, Lorena Balaj, Valerie Pfister und Finn Poller vertraten die Junior Company „Apfelrausch“ im Bundesfinale.
Auch wenn das Wort Rausch im Titel der Firma steckt, diese Jugendlichen produzieren aus Äpfel kein alkoholisches Getränk, selbst der Apfel-Ingwer-Shot kommt ohne Alk aus 😉 Des weiteren „haben wir Saft, Marmelade, Mus – entweder mit Zimt oder mit Chili und Rosmarin – im Angebot. Saisonal hatten wir auch Bratapfelmarmelade.“ Auf Äpfel als Basis für ihr Unternehmen „sind wir gekommen, weil bei uns in der Nähe Kukmirn ist, das auch Apfeldorf genannt wird“, berichten die Schüler:innen aus der Güssinger Höheren Bundeslehranstalt und Fachschule, die sich den Namen ecole gegeben hat. Das französische Wort für Schule würde durchaus für die Abkürzung verschiedener Begriffe stehen, meinen die Jugendlichen, wüssten es aber im Moment nicht – kein Wunder, es ist selbst auf der schuleigenen Homepage nirgends zu finden 😉
Sie verarbeiten nicht nur die Äpfel mit besonders kurzen Lieferwegen, sondern „wir haben auch darauf geschaut, dass wir umweltfreundliche und wiederverwendbare Verpackungen für unsere Produkte organisieren“.
„Wir machen aus Gabeln und Löffeln Schmuck, vor allem Ringe, aber auch Anhänger für Halsketten und haben sogar das Verfahren dazu selber entwickelt“, verkünden Sebastian Rogl, Lukas Hörth, Christina Valenta, Alexander Veit, Lukas Ondrusek aus der HTL St. Pölten und weisen einerseits auf ihre Schmuckkollektion und eine noch nicht verarbeitete exquisite, glänzende, reich verzierte Kuchengabel hin und zeigen andererseits Bilder von den Verarbeitungsschritten.
„SilverWear Jewellery“ haben die genannten fünf Jugendlichen und zwei weitere Schülerinnen hergestellt – bisher 65 Stück. Auch wenn es vielleicht nicht leicht ist, sich von so durchaus alten Erbstücken zu trennen, meint einer der Jugendlichen, „aber sonst würden sie ja vielleicht nur in einer Lade vergammeln“; jedes Stück kostet 24 €
Simon Franz Freilinger, Severin Anton Kickinger, Alois Hajek und Hons Ortner stehen vor und hinter einer rustikalen Verkaufshütte, mit kurzer Lederhose und ebenso trachtig wirkenden Hemden halten sie Flaschen in die Kamera oder weisen auf solche hin. Nach dem Rezept einer der Omas haben die erstgenannten drei Schüler (der vierte hilft „nur“ hier mit) der HTL Braunau (Oberösterreich) sechs verschiedene Liköre hergestellt.
„Eine Schnapsidee“ nennen die drei, die ihren Junior-Firmennamen AAF aus den Anfangsbuchstaben ihrer jeweiligen zweiten Vornamen gemixt haben, zu Beginn der Story auf ihrer Website ihr Unternehmen wortspielerisch.
Schnäpse und Liköre gibt es hektoliterweise, „aber wir wollten etwas Hochwertiges und das aber nachhaltig und umweltschonend herstellen“, so die Innviertler. „Unsere Zutaten sind aus biologischem Anbau, unsere Produktion umweltschonend, den Korn müssen wir allerdings zukaufen.“ Und manches ist auch ausgefallen, wo gibt es sonst Bratapfel-, Eiszuckerl- oder Rotwein-Chilli-Likör?
Ob auch wirklich schon alle, die am Schulball eifrig eine der sechs Sorten tranken, dies eigentlich schon durften (ab 18 Jahren)?
Wird fortgesetzt – die drei weiteren Finalist:innen werden in einem dritten Teil vorgestellt.

Ob Jugend Innovativ, Merkur oder auch der Bewerb der Junior Companies und sicher noch viele andere Gelegenheiten, die noch weniger an die Öffentlichkeit kommen – neben Kreativität, Einfallsreichtum und sehr viel Engagement zeigen Projekte von Schülerinnen und Schülern, dass sie Gedanken der Nachhaltigkeit stark verinnerlicht haben.
So setzten viele der neun Unternehmen (Gewinner:innen in ihren Bundesländern), die Jugendliche für ein Schuljahr gründeten und mit denen sie im aktuellen Bundesfinale landeten auf Re- und Upcycling. In diesem ersten Teil jene drei für ein Schuljahr gegründeten Unternehmen, die von der Jury auf Platz 1, 2 und 3 gereiht worden sind; in weiteren Teilen stellte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die sechs weiteren Finalist:innen, jeweils Sieger:innen in ihren Bundesländern, vor.
Beginnen wir, weil nach dem Lokalaugenschein von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die Jury sie zu den diesjährigen Gewinner:innen gewählt hatten mit [re]whey aus dem B/R/G Stainach (Steiermark). Katharina Ebenschweiger, Sophie Steinecker, Jakob Daum, Luca Neuper und Rasmus Zaihsenberger vertraten das Unternehmen beim Finale in der Wirktschaftskammer Österreich in der Wiedner Hauptstraße (Wien). Gemeinsam mit vier Kolleg:innen verkaufen sie Molkepulver. Aus einem Milchbetreib in der Region sammeln sie die Molke, lassen ihr – in einem Profibetrieb in Oberösterreich – durch natürliches und regionales Fruchtpulver Apfel- oder Himbeergeschmack zufügen, und es in Verpackungen aus abbaubarem Material abfüllen. „Die 180 Gramm reichen für ungefähr zehn Portionen – mit Milch oder Joghurt“, berichtet das Quintett dem Reporter. „Diese Molke würde ansonsten weggeschüttet werden“, vertrauen sie auf Nachfrage noch an.
Als Österreich-Gewinner:innen treten sie in der kommenden Woche, vom 1. bis 3. Juli in der griechischen Hauptstadt Athen beim Europa-Bewerb an. Ihre unmittelbaren Schulkolleg:innen hatten im Vorjahr, damals in Sizilien, erstmals den EM-Titel für rot-weiß-rot geholt; übrigens mit der Verarbeitung von einem anderen Abfallprodukt: Treber aus der Herstellung von Bier. Daraus stellten die Mitglieder der „Treberei“-Junior-Company unter Zugabe von Mehl und Ei unterschiedlichste Nudelsorten her, die es sogar in regionale Supermarkt-Regale schafften.
Zurück zum Österreich-Finale 2024/25, das – einen Tag nach dem School-Shooting in Graz daher nicht groß und bombastisch, sondern zurückhaltend, in kleinem Rahmen stattfand – mit der Bitte auch mit der Veröffentlichung mehr als eine Woche zuzuwarten:
Mit Platz 2 belohnte die Jury „Neutoro“ von Schüler:innen aus der Wiener Chemie-HTL (Höhere Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie). Nick Odehnal, Nico Oberortner, Kim Furigan, Kathrin Suschny und Sophie Schaffer öffneten für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… einen Mini-Kühlschrank auf ihrem Präsentationstisch um ihr Produkt – und das ihrer 13 Mitschüler:innenvorzustellen: Einen Geruchs-Adsorber.
Gut, solche Dinge gibt’s schon lange zu kaufen, „aber unsere Entwicklung überdeckt nicht wie andere nur Gerüche. Erstens entzieht unser Neutoro im Kühlschrank auch Feuchtigkeit UND vor allem ist er dauerhaft. Das Gehäuse ist 3D-gedruckt – aus recyceltem Filament, das Ganze ein Modulsystem und der Adsorber selber kann einfach in den Backofen gelegt, eine Stunde bei 110 Grad, danach wieder im Kühlschrank Gerüche und Feuchtigkeit aufsaugen“.
Der Stand der – von der Jury Drittplatzierten – Jugendlichen war bald um die Mittagszeit belagert. Mitglieder der Teams aus den anderen Bundesländern kauften hier kleine Gläser und löffelten eine Mahlzeit – à la Weltküche. „Spoon it“ nannten zehn Schüler:innen der sechsten Klasse im (Real-)Gymnasium in der Klagenfurter Mössinger Straße, vor allem dank der im Gebäudekomplex auch angesiedelten HTL in österreichweiten Schulbewerben ein Begriff, ihr Unternehmen.
„Ausgangspunkt war, dass unser Schulkantinen-Betreiber insolvent wurde“, berichten Dylan Stadler, Nina Raab, Somaya Burnić, Raphael Salbrechter und Daniel Pretnar, die ihre Schüler:innen-Firma in Wien vertraten zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Dann haben wir uns überlegt, wir könnten doch was anbieten, in der kleinen Teeküche haben zu experimentieren begonnen, was wir kochen könnten, das dann in der Schule nur mehr aufgewärmt werden muss. Und es sollte gut schmecken und abwechslungsreich sein“, setzen die fünf Jugendlichen mal fast im Chor, dann wieder nacheinander die Schilderung fort.
Die zehn jugendlichen Unternehmer:innen kochen – vor allem mit regionalen Zutaten, aber dennoch internationale Gericht – füllen sie noch heiß in Gläser mit Schraubverschluss a, die durch nochmaliges Erhitzen haltbar gemacht werden und dann vier bis sechs Wochen kühl gelagert werden können. Für 5 € pro Glas können sie in der Schulaula in einer kleinen Verkaufskoje erworben, aufgewärmt und – idealerweise mit mitgebrachtem Löffel – verzehrt werden. Im „Notfall“ wird das Ess-Werkzeug auch zur Verfügung gestellt. Und selbstverständlich werden die Gläser zurückgenommen.
„Gut 1400 solcher Gläser haben wir schon hergestellt, 900 verkauft, und wir haben auch drei verschiedene Toppings (60 Cent bis 2 €).
Auf ihrer Homepage listen sie nicht nur die 13 Speisen in Gläsern – von Kürbissuppe (Österreich) über Chili con Carne (Mexiko) und Chässpätzlie (Schweiz), Krumpigulyás (Ungarn) bis Beans and Rice (Uganda) und Couscous Maghreb (Marokko) auf, sondern liefern unter „Fun Facts“ so manche Fakten. Die sind alle echt, viele informativ, andere könnten unter die Rubrik „unnützes wissen“ fallen.
Dass Kürbisse botanisch zu Beeren zählen mag vielleicht verblüffen, warum sie gesund sind (vor allem Vitamin A) ist recht nützlich, aber, dass es auch einen Weltrekord – schwerster Kürbis 1200 Kilo gibt, eben eher Fun.
Apropos Bewerb: Bei Chili-Kochbewerben gibt es, so diese F&F-Rubrik, „spezielle „Anti-Schärfe-Teams“, die Eis, Milch und Joghurt für die Teilnehmer bereitstellen“.
Später verkleidete sich – meist Dylan Stadler – werbewirksam in einen Löffel – siehe Fotos, um die löffelfertigen Gerichte bildhaft darzustellen.
Wird fortgesetzt – die sechs weiteren Finalist:innen werden in eigenen Beiträgen vorgestellt.
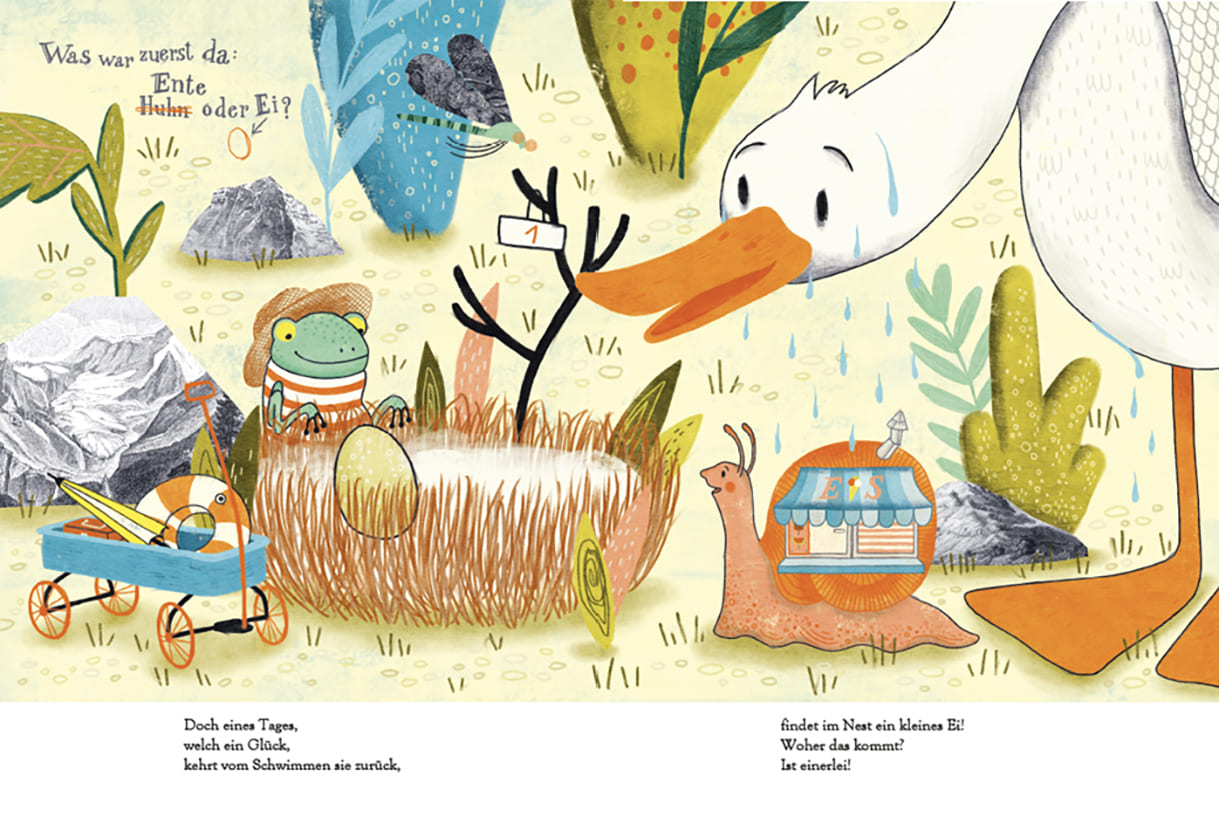
Schade, leider verrät der Titel des Bilderbuchs schon alles. Aber der Reim „Henne Jenne“ ist natürlich zu aufgelegt, drängt sich auf. Nachdem aber schon der Buchtitel so, dann brauch sich diese Besprechung nicht vor Spoilern fürchten, es gibt ja das Überraschungsmoment nicht.
Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Du als Leserin / Leser bzw. Bildbetrachter:in und beim Zuhören, wenn dir das Buch vorgelesen wird, weißt daher schon, dass aus dem Ei, das eines Tages im Nest der Entenmutter liegt, eben kein kleines Entlein, in dem Fall auch kein Schwan wie in Hans Christian Andersens „Das hässliche Entlein“ entschlüpft, sondern ein junges Huhn.
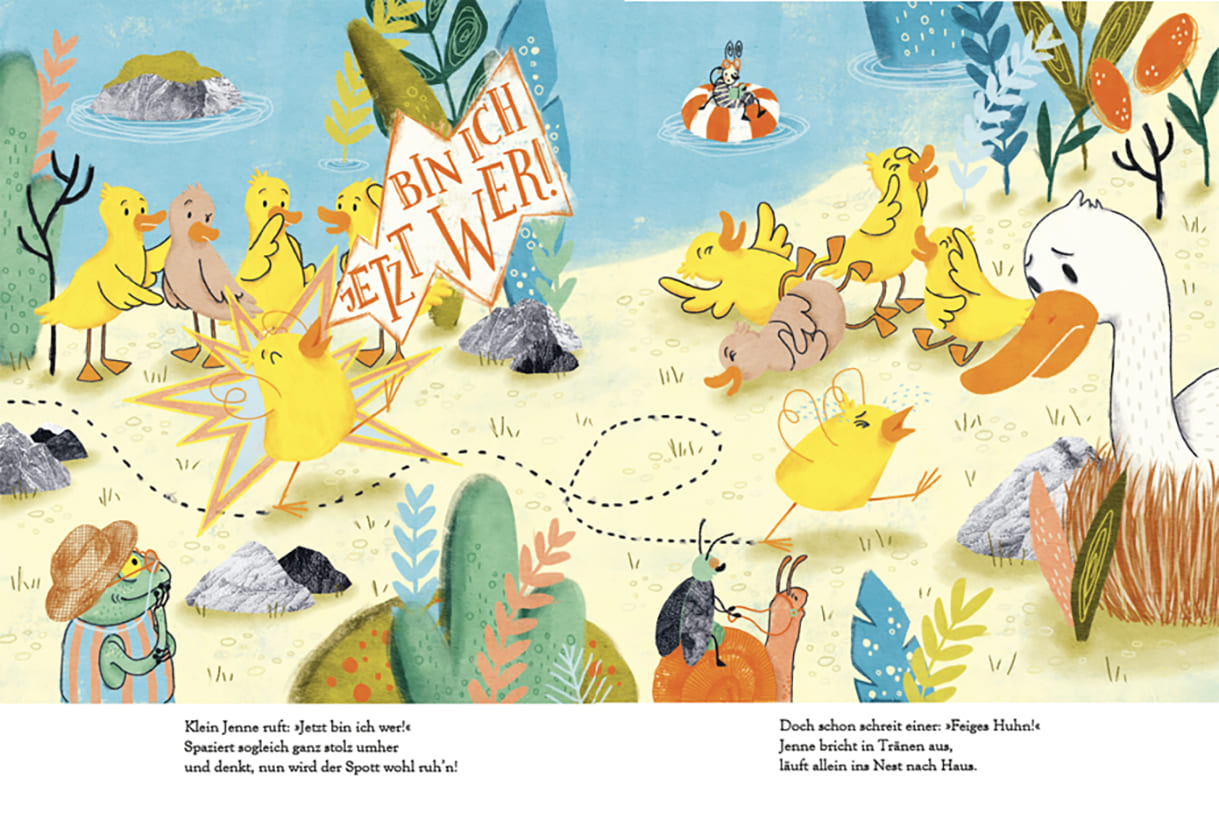
Bald ist das kleine Federvieh – und mit ihm seine „Mutter“ – von Sprüchen aus der Umgebung konfrontiert: „Seltsame Füße“ und erst „der Gang“… Außerdem will es nicht und nichts in Wasser, fliegen kann es auch nicht… Lauter Eigenschaften, die es zum Spott seiner Umgebung machen.
Wir aber wissen ja, es ist eine junge Henne – das erfährt Frau Ente von der Eule. Und stolz entfährt es Jenne, so nannte die Ente „ihr“ Junges schon zu Beginn, jetzt endlich zu wissen, wer es ist. Ähnlich widerfährt’s dem „kleinen Ich-bin-ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel ja erst gegen Schluss.

Doch Autorin Cornelia Travnicek, die sich schon im Jugendbuch „Harte Schale, Weichtierkern“ hervorragend in eine Außenseiterin hineinversetzt hat, beendet mit dieser (Selbst-)Erkenntnis das Buch noch lange nicht. Dass sie nun weiß, Henne zu sein, hindert die anderen Tiere nicht, sich über sie lustig zu machen – „feiges Huhn“ kriegt Jenne zu hören.
Was und wie der sozialen Mutter Ente einfällt, um ihr Junges auch dagegen zu stärken – nein, das sei nun hier wirklich nicht aufgedeckt, eine überraschende Wendung bleibt ja noch.
Schon verraten werden darf, nein soll sogar, dass die vielen bunten Zeichnungen von Raffaela Schöbitz den Text nicht nur illustrieren, sondern viel mehr zu entdecken anbieten, so manches, das beim ersten Mal vielleicht sogar übersehen wird. Und wie beispielsweise bei der in einem der Bilder gestellten Frage, „Wie klingt ein zerbrechendes Herz?“ trotz der schon angebotenen Comic-Sprachen-Ausdrücke „Pling?“, „Klonk?“ und „Krrrack?“ noch viel Raum für Weiter-Fantasieren offen lässt.
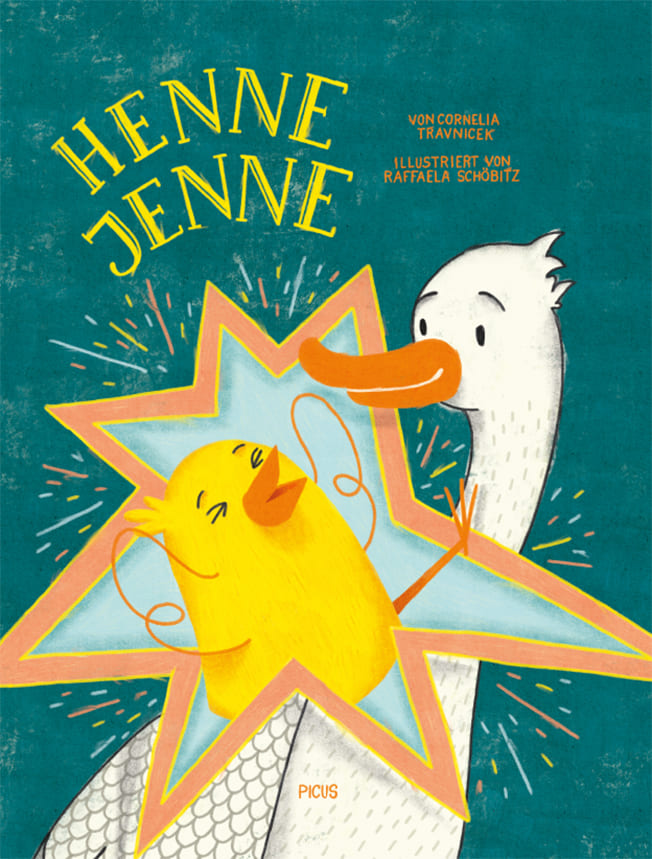

Ist „Hand made Tyrant“ mit Figuren im Theater Schubert professionelle künstlerischer (Hand-)Arbeit, so gab es am Tag nach der Premiere des besagten Stücks eine handgestrickte Performance zu einem ähnlichen Thema. Hubsi Kramar und die 3raum-anatomietheater-revivalband spielte, sang und musizierte „Die 11 Zehennägel des Donald Trump – eine Reinigung“ – in der Kunsttankstelle Ottakring.
Entsprechend Location, die den Charme einer abgefuckten tatsächlich ehemaligen Tankstelle versprüht, agierte auch die Crew – mit selbstgebastelten, fantasievollen Kostümen aus Karton – schlüpften sie in die Rollen des D.T. himself, der sich größer als Gott sah – er hätte die Welt ja an einem einzigen Tag erschaffen. Seiner Anhänger:innen, der Määääähga-Bewegung, Motto „Sheep first“ (Schafe zuerst).
Mit einer nur wenig überspitzten Pressekonferenz – die Originale lassen sich kaum toppen, samt Abführung eines „Journalisten“, der wagte, die nicht vorher vereinbarte Frage zu stellen, welches Buch er zuletzt gelesen habe.
Der Wortwitz Maga – Gaga – Dada schien fast aufgelegt, obwohl davor noch nie wer darauf gekommen war. Der schräge Titel erschloss sich im Verlauf des immer wieder improvisierten Abends voller Gags – allein durch Anspielungen auf den echten D.T. – aufgrund einer „Theorie“ für das jenseitige Agieren des US-Präsidenten: In seinem Thalamus, dem größten Teil des Zwischenhirns, sei ihm ein elfter Zeh samt dazugehörigem Nagel gewachsen. Der soll(te) in dieser Performance theatral entfernt werden, um das Quantenfeld als Verbindung zwischen Bewusstsein und Materie wieder in Ordnung zu bringen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen