
Wie derzeit – noch bis 11. Juni 2025 – in einer Bühnenversion im Krimi-Klassiker „Warte, bis es dunkel ist!“ im Wiener Theater Center Forum so war auch bei „Jetzt!“ im Vestibül des Burgtheaters Audiodeskription für alle Besucher:innen zu hören. Was sich auf der Bühne wie abspielt wird erklärt. So können einerseits blinde bzw. sehschwache Menschen dem Geschehen folgen, andererseits alle anderen dies miterleben. Für Zuschauer:innen, die nicht oder nur schwer hören, wurden die gesprochenen Texte als Schrift an die Wand projiziert.
Simon Couvreur, Billy Edel, Giuliana Enne, Jenny Gschneidner, Felix Elias Hiebl, Yuria Knoll, Christine Krusch, Magdalena Helga Franziska Tichy, Leonie Frühe sowie Lukas Hagenauer, Josefine Merle Häcker, Niels Karlson Hering, Mathea Mierl, Justus Werner Pegler, Elisa Perlick und Leonie Rabl sprachen und spielten Monologe, Dialoge sowie Szenen mit mehreren Personen aus klassischer bis moderner Theaterliteratur – von altgriechischen Dramen nicht zuletzt mit dem blinden Seher Teiresias über Georg Büchner bis zu Thomas Bernhard und Caren Jeß. Letztere wahrscheinlich die Unbekannteste und den Genannten, ist ein 40-jährige deutsche Schriftstellerin, von der Yuria Knoll kurze Passagen aus „Die Katze Eleonore“ über eine Frau, die zur Katze wird und mit ihrem davon faszinierten Therapeuten spricht.
Simon Couvreur, nicht zuletzt von Tanztheater-Auftritten mit „Ich bin O.K“ bekannt ließ bald nach Beginn seine Hände tanzen – was eine Kollegin in Audiodeskriptions-manier poetisch schilderte. Auch jeder Lichtwechsel wurde – im Wechselspiel mit Enrico Zych an den entsprechenden Reglern und Tasten – vorab angesagt.
„Jetzt!“ war die – wie es viele im Publikum bedauerten leider nur zwei Mal – aufgeführte Abschluss-Performance des gleichnamigen ersten inklusiven, großen Projekts in diesem großen wichtigen Theater. Das die ganze Saison gelaufene Projekt vereinte in Zusammenarbeit mit der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) Studierende der Bereiche Schauspiel und Tanz sowie theaterinteressierte und teils auch schon -erfahrene Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen (Rollstuhl, blind, Trisomie 21 / Downsydrom).
Unter der künstlerischen Leitung von Constance Cauers hatten Monika Weiner die Teilnehmer:innen des Projekts in Bewegungstraining sowie Steffi Krautz-Held und Dorothee Hartinger im Rollenunterricht gecoacht. Wobei im Publikumsgespräch manche der Beteiligten davon erzählten, dass die Lehrenden mitunter unterschiedliche, ja gegensätzliche Lehren vermittelten. Woraus die Spieler:innen jedoch dann oft ihre eigenen Versionen entwickeln konnten 😉
„Jetzt!“ ist ein Programm für Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen, die vorhaben, professionell am Theater sowie im Bereich Film und Fernsehen als darstellende:r Künstler:in zu arbeiten. Das Programm wird jeweils für die Dauer einer Spielzeit angeboten und ist eine Initiative des Burgtheaters und der Fakultät Darstellende Kunst der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien.

Rund ein Jahr nachdem in der Theater-Werkstatt des niederösterreichischen Landestheaters in St. Pölten eine der schrägen Satiren Franz Kafkas, „Der Prozess“ über die Bühne ging, spielt – noch bis Ende Mai 2025 – ein wahrhaft kafkaeskes Stück Real-Satire. „Siebenundfünfzig“, geschrieben und inszeniert vom Filmer Arman Tajmir-Riahi.
Mitten in der Nacht klopft die Hausmeisterin (Anna Stieblich) beim Protagonist:innen-Paar.

So aufdringlich sie auch antanzt und sich anfangs umständlich ausdrückt, so rettend ihre Nachricht. Über mehrere Ecken habe sie erfahren, dass der Mann dieser Wohnung vom Inlandsgeheimdienst gesucht werde. Weshalb – dieser Vorwand wird erst später enthüllt. Also kann der Mann praktisch in letzter Sekunde abhauen.
Schon sind die „Geheimen“ an der Tür und durchsuchen die Wohnung. Und nicht nur an diesem Abend. Sie werden so etwas wie unheimliche fast Dauergäste, belagern und bedrängen die Ehefrau (Caroline Baas), zu verraten, wohin ihr Mann geflüchtet sei. Nicht selten devastieren sie dabei die Wohnung.

So krass und unverschämt ist, was sich zugetragen hat und auf der Bühne abspielt, so schafft es Stück, Inszenierung und Schauspiel der Darsteller:innen die an Absurdität grenzende Szenerie so rüberzubringen, dass gar nicht so wenig Raum bleibt für Lachen. Wofür in erster Linie die „Geheimdienstler“ – Michael Scherff (Kommandant), Augustin Groz (Adjutant) und vor allem der mit fast gesichtsloser Maske agierende Tobias Artner – der übrigens auch den Ehemann spielt – gekonnt, teils fast slapstickartig, tollpatschig, sorgen.
Das Lachen bleibt allerdings immer wieder im Hals stecken – schwingt doch stets mit: Dem Ganzen liegt ein echtes Schicksal zugrunde.

Der Autor und Regisseur hat vor Jahren eine Frau getroffen, der genau solches passiert ist. Nicht in den inszenierten und gespeilten Details, aber jedenfalls ist die Zahl verbürgt, die Riahi zum Stücktitel gewählt hat. Als er das gehört hatte, war für ihn schon klar, dass kann, ja muss ein Theaterstück werden, weil es sich kammerspielartig praktisch nur im Wohnzimmer und angrenzenden, oft nicht sich, sondern nur hörbaren Nebenräumen (Bühne und Kostüme: Ece Anisoğlu) abspielt.
Als die Betreffende auch zusagte, machte sich Arman T. Riahi, der schon als Schüler Kurzfilme gedreht hatte – wie sein Bruder Arash, mit dem er so manche der erfolgreichen bekannten Kinofilme drehte bzw. produzierte (u.a. Die Migrantigen, Everyday Rebellion“…) an die Umsetzung.
Details sind nicht nur zum Schutz der Frau, deren Privatsphäre über mehr als ein Jahr ständig missachtet wurde, verändert, sondern weil sich solches mittlerweile nicht nur im Iran, sondern auch in vielen anderen Ländern abspielen könnte – Stichwort Trumpistan, wo kürzlich eine Richterin vom Inlandsgeheimdienst FBI festgenommen wurde, weil die sich für einen von Abschiebung bedrohten Einwanderer eingesetzt hat. Deshalb ist die Inszenierung auch nirgends konkret verortet.

Ein alter Lustgreis mit Glatze und Brille – mit einer derartigen Perücke verwandeln sich fast alle Schauspieler:innen des Abends in diese Figur – wandelt der Regisseur durch die verschiedenen Räume des Wiener Off-Theaters, das sich in bei „006.Am.Psychosee“ von „das.bernhard.ensemble“ (Regie / Konzept: Ernst Kurt Weigel; Konzept/Immersiv-Expertin: Christina Berzaczy) in verschiedenste Stationen eines Filmsets verwandelt.

Der Typ ist eine Legende des österreichischen Films. Neben der Verfilmung von „Der Bockerer (Theaterstück von Ulrich Becher und Peter Preses) rund um den schlawinerischen, leicht widerständigen, Fleischhauer, ist Antel aber vor allem für frühe, seichte Soft-Porno-Komödien berühmt geworden. Das Plakat für einen solchen Film, „Wenn Mädchen zum Manöver blasen“, hängt in der „Rezeption“ des Theater-/Film-Etablissements, in dem die Tour durch das Set beginnt. „Alles Sommerfilme, die Mädchen sind sehr leicht bekleidet“, versucht einer der Tour-Guides augenzwinkernd zu beschönigen.

Der große Filmemacher, der sich in seiner Autobiographie noch mehr oder minder zum Erfinder von allem überhöhte, war aber in der Szene auch bekannt für seine übergriffige, missbräuchliche Art. Und das steht bei diesem Theater-Abend im Vordergrund. Kaum wird „der Franz“ eines weiblichen Wesens ansichtig – ob Darstellerin, Kamerafrau, Tonangel-Halterin, schon geraten seine Grapsch-Finger in Zuckungen.

Alles das, was bis zur Me-Too-Bewegung nach dem Aufdecken von Harvey Weinsteins sexuellen Belästigungen und mehr sozusagen „nur“ ein offenes Geheimnis war und nun zum No-Go samt Verurteilungen von Tätern wurde, wird in den verschiedenen Räumen angespielt und von so manchen Opfern mit lapidaren „das gehört halt dazu“ mitgetragen.

Zum einen schwingt sozusagen mit, zum Glück wurden solche Missbräuche aufgedeckt, wenngleich sie noch immer nicht völlig überwunden sind, zum anderen kann die Drastik mit der hier gespielt wird, wenngleich ins Karikaturhafte verzerrt (unterschiedlich gespielt von Sophie Resch, Christian Kohlhofer, Christina Berzaczy, Leonie Wahl und besonders provokant Rina Juniku), auch ganz arg triggern. Weswegen für den Theaterabend einerseits eine entsprechende Warnung gegeben wird. Und, das noch viel besser und vor allem neu in der Szene: Unter den vielen Räumen des Off-Theaters, das diesmal – wie schon vor zwei Jahren bei „Die.Stunde.Shining“ – in seiner Gänze bespielt wird, steht einer unter dem Titel Safe Space (sicherer Raum) zur Verfügung.
Wem das Gesehene und Erlebte zu weit geht, kann sich hier vorübergehend zurückziehen. Das machen hin und wieder auch die eine oder der andere von den Schauspieler:innen – und steigen hier aus ihrer Rolle / ihren Rollen (viele switchen) – aus. Ein Beispiel das (Theater-)Schule machen könnte, wo es angebracht scheint.

Ob immersiv wie hier oder im Mash-Up von Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ und Stanley Kubricks „The Shining“ (nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King) oder auch in den „nur“ Bühnenstücken verknüpft „das.bernhard.ensemble“ seit Jahren einen Film (in diesem Fall „00 Sex am Wörthersee“) mit einem Theaterstück. Der zweite Teil des Titels „Psychosee“ basiert auf Sarah Kanes „4.48 Psychose“. Die britische Dramatikerin, die in ihren fünf innovativen mit vielen Konventionen brechenden Theaterstücken einen Bogen vom Bürger- über Familien-Krieg bis zum Inneren Kampf mit sich selbst bis zu ihrem Freitod spannte, wandelt als irritierender Geist (Yvonne Brandstetter, die als einzige in keine andere Rolle schlüpft) durch die Stationen des Filmsets. Mal verkörpert sie als direkter Gegenpol eine Darstellerin, die Besucher:innen ersucht, sie zu berühren, um ihre eigenen Grenzen zu spüren, begleitet von Leonie Wahl als Intimitäts-Coach – ein mit Me Too neu erschaffener Berufszweig. Mal wälzt sie sich nackt in klein geschnittenem Kraut – als Symbol für das angeblich so berühmte Szegediner Krautfleisch, das Franz Antel für Hunderte Gäste zubereitete; wohl eher zubereiten hat lassen.

Die schon genannten Franz-Antel-Darsteller:innen verkörpern immer auch noch – mindestens – eine weitere Rolle – vor und hinter der Kamera. Ergänzt wird das Schauspiel-Ensemble von Bernhardt Jammernegg als Ton, Kamera-mensch sowie Handwerker, Matthias Böhm (Produzent / Kamera-Mensch / Schmäh-Schreiber) und Mastermind Ernst Kurt Weigel als einer der Tour-Guides sowie in verschiedenen Kostümen (Julia Trybula) für F.A.s Mode-Schau. Musik (Rafael Wagner) und teils schockierende Visuals mit Einsatz von viel KI (Evi Jägle) runden den immersiven, intensiven, fast an, für manche auch über die Grenzen gehenden Abend ab. Der trotz dessen auch von viel sarkastischem Humor lebt. Und in der Figur der vielen Franz Antels vielleicht ein wenig auch Anklänge an Sarah Kanes „Gier“ hat – ein Stück, in dem sie vier Personen ein Leben teilen lässt. Nicht zuletzt lässt sie die Stimme eines alten Mannes Begierden eines Menschen sagen, der andere missbraucht.

Ein dichte, abwechslungsreiche, spannende Theaterstunde voller immer wieder krasser Wendepunkte samt sarkastisch-ironischen Momenten lebt darüber hinaus aber vor allem davon, dass es sich um eine echte Lebensgeschichte – und dies mit Happy End handelt. „Lotfullah und die Staatsbürgerschaft“ im Vestibül des Wiener Burgtheaters erzählt szenisch die Jahre in Österreich nach seiner Flucht. Als Kleinkind mussten die Eltern mit ihm das afghanische Ghazni verlassen, fanden Zuflucht in Pakistan, wo nach einigen Jahren das Leben auch nicht mehr erträglich war. Es war schon äußerst schwierig für die Familie, das Geld für die Flucht eines der ihren aufzutreiben. Tränenreich verabschiedet die Mutter den jugendlichen Sohn. Und rät ihm, auf der gefährlichen Fluchtroute im Schlaf immer doch auch irgendwie wach sein zu müssen (adir).

Europa war das Ziel, irgendwann landete er zufällig in Österreich. Weder flossen hier Milch und Honig im sprichwörtlichen Sinn, noch wurden Menschen, die flüchten mussten, mit offenen Armen empfangen wie es in früheren Fluchtbewegungen – von Ungarn (1956), Tschechoslowakei (1968) bis zu den Jugoslawienkriegen (Anfang der 90er Jahre) noch eher der Fall war. Schikanen, Willkür trotz Rechtsstaat, Waaaaaarten auf Papiere, ein Flüchtlingscontainer hinter Drahtzaun, Abnahme des Ausweises durch die Behören, weil im Asylinterview nicht verstanden wurde, dass viele Afghan:innen schon lange vor der wieder völligen Machtübernahme durch die demokratiefeindlichen Taliban, von dort flüchten mussten – die einen in den Iran, andere nach Pakistan.

Monatelang staatenlos. „Wenn du keinen Ausweis hast, existierst du nicht“, fällt der treffende Satz. Der erinnert an Bert Brechts „Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so eine einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.“ (Flüchtlingsgespräche 1940/41).

Leben im Freien – im „Rosengarten“. Irgendwann dann doch wieder ein Ausweis, Flüchtlingsunterkunft weit ab im tiefsten Niederösterreich. Und dennoch nahm Lotfullah dreieinhalb-stündige tägliche Reisen in die HTL Mödling, aber auch nach Wien ins Burgtheater zu Proben für Projekte auf sich. Die Theaterprojekte boten ihm geborgenen Halt, auch wenn er manches nicht verstand, wie es im Stück heißt und nachvollziehbar zu erleben ist – für Außenstehende kaum verständliche Aufwärmübungen für die Stimme mit bedeutungslosen Lautkombinationen 😉

Der Humor kommt in dieser Stunde nicht zu kurz. Das Stück entstand in langem Hin und Her aus der neun Jahre währenden Zusammenarbeit von Anna Manzano, Marie Theissing, Lotfullah Yusufi und Magdalena Knor, anfangs als Spielclub im Burgtheater, später als freie Gruppe. Ergänzt und erweitert um Florian Jungwirth, Waltraud Matz, Himali Pathirana, Marlen Schenk-Mair, Ben Schidla und Patrick Werkhner sowie Alex Teufelbauer, der in den „Rosengarten“-Szenen in Lotfullahs Rolle schlüpft, entwickelte das Team rhythmisch choreografierte Szenen, die Begegnungen mit Bürokratie ebenso wie mit Helfer:innen knapp und rasch wechselnd, teilweise chorisch schildern.

Der Staatsbürgerchor mit fast höfischen Halskrausen, getrötete Bundeshymne, beamtliche Stempelzeremonien… – was für Theaterpublikum und -beschäftigte vielleicht „kafkaesk“ wirken mag, ist Alltag der meisten Geflüchteten seit Jahren. Kaum ein oder einer kennt es anders. Rascher Erwerb der deutschen Sprache, gut integriert, sozial engagiert – hilft alles (fast) nichts. Bewahrt nicht vor widersinnigen Entscheidungen, Ablehnungen, drohender Abschiebung…

Doch neben Zielstrebigkeit, Ausdauer, Energie und doch die einen oder anderen Menschen, die helfen, unterstützen, sich einfach menschlich zeigen, sind verantwortlich für ein Happy End. Die Energie Lotfullah Yusufis, der gemeinsam mit Regisseurin Anna Manzano sowie seinen Mitspieler:innen Marie Theissing und Magdalena Knor (auch Live-Musik) das Stück entwickelt hat, macht den Raum zeitweise fast zu klein für seine Power. Eine Art befreites Aufspielen, ist das Stück doch ein geglückter Sieg über alle Hindernisse und Schikanen.

Ohne es direkt anzusprechen, ergibt sich so „nebenbei“ die Lehre: Hätte Lotfullah Yusufi selbst aufgegeben und wäre er nicht bei seinem Einspruch gegen den ersten Abschiebebescheid unterstützt worden, gäbe es auch diesen bewegenden und doch Mut machenden Theaterabend nicht!

Neben einem weißen, zarten Vorhang, der durch jede Bewegung leicht ins Wehen kommt, sitzt – im Video an die Wand projiziert eine Frau mit großer Handtasche, schmatzend, neugierig schauend und das Geschehen kommentierend. Bald gesellt sich am anderen Ende des Bühnenhintergrunds ebenfalls an die Wand „geworfen“ ein Mann mit Hut dazu. Die beiden sind eine Art Side-Kick für das folgende spannende, bedrückende und doch immer wieder von Humor und Sarkasmus durchbrochene Stück, das sich in der Mitte zwischen ihnen abspielt. Wobei die beiden als Video dann ohhen immer wieder verschwinden.

„Alles gerettet!“ spielt sich hier in der mittleren der drei Röhren der Wiener Neustädter Kasematten – wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt – ab. Es handelt sich um einen für die Bühne adaptierten von Helmut Qualtinger und Carl Merz (berühmt u.a. für „Herr Karl“) geschriebenen TV-Spielfilm (1963 erstveröffentlicht, u.a. mit Attila und Paul Hörbiger) über den Wiener Ringtheaterbrand (8. Dezember 1881, Schottenring 7 – wo heute die Polizeidirektion Wien residiert). Dieser forderte offiziell 384, manchmal ist die Rede von 386, Todesopfer, informelle Berichte sprachen von bis zu 1000 Toten. Die beiden nahmen den Prozess, der immerhin schon wenige Monate nach der Katstrophe stattfand und bei dem auch führende Feuerwehr- und Polizeimänner angeklagt waren, zum Anlass für ihren dramatischen Text.

Die Wortwiege (neuerdings mit dem Untertitel „Festival für Theaterformen“), die seit 2020 in der ehemaligen Befestigungsanlage der Stadtmauer (2019 für die damalige niederösterreichische Landesausstellung renoviert) hier regelmäßig Programm macht, hat das in Vergessenheit geratene Stück sozusagen ausgegraben, eine eigene Bühnenfassung, die sich ziemlich an den Originaltext hält, erstellt – und inszeniert (Regie: Anna Luca Krassnigg; künstlerische Mitarbeit: Ira Süssenbach). Wichtigste Abweichung: Etliche Männer aus dem Original und der damaligen Realität sind hier mit Frauenrollen, teils wiederum von Männern gespielt, besetzt; u.a. die eingangs erwähnte Gerichtskiebitzin Hromatka (die im Stück hier nie mit Namen genannt wird) mit Martin Schwanda; oder Zeugin Völkl (Vorgänger:in in der Ringtheater-Direktion) mit Jens Ole Schmieder, der wie auch seine Kolleg:innen Lukas Haas, Ida Golda, Isabella Wolf und Saskia Klar in etliche der Rollen als Zeug:innen bzw. Angeklagte schlüpfen; Schmieder vor allem auch als einer der Hauptangeklagten, Polizeirat Landsteiner.

Ringtheaterbrand – dies ist in der Theaterszene Wiens und Österreich ein bekannter Begriff – strenge Sicherheitsbestimmungen sind darauf zurückzuführen. Die reichen vom Eisernen Vorhang, der vor Beginn eines Stückes Bühne und Publikumsraum großer Theaterhäuser trennt, ständig sichtbare Notbeleuchtung bis hin dazu, dass Mäntel und dergleichen bzw. Taschen und Rucksäcke an der Garderobe abzugeben sind, damit im Notfall, niemand auf der Flucht vor einem Brand über irgendetwas stolpert und die Nachfolgenden dann über diese Person.

Aber was sich so wirklich am Abend des 8. Dezember 1881 abgespielt hat, kennt kaum wer. Dabei hatten Helmut Qualtinger und Carl Merz – ausgehend vom Prozess im Frühjahr 1882 und mit vielen Zitaten aus den Gerichtsakten – einen Fernsehfilm „Alles gerettet!“ geschrieben. Erst vor weniger als zehn Jahren gab es auch bei der Viennale und der Diagonale den Film „Sühnhaus“ der Journalistin und Filmemacherin Maya McKechneay über diesen Brand.

Der Titel „Alles gerettet!“ bezieht sich auf eine Aussage, die dem obersten Polizisten beim Brand zugeschrieben wird. Und dies obwohl zahlreiche Menschen, die sich aus dem Theater retten konnten von Leichenbergen sprachen. Ausgelöst durch einen lichterloh brennenden Vorhang, der durch einen heftigen Luftzug bis hinauf in die vierte Publikumsgalerie geweht wurde, stand bald das ganze Theater in Flammen. Die Notbeleuchtung funktionierte nicht und so stolperten Menschen, die dem Feuer bzw. der Hitze entkommen wollten, fielen übereinander. Vor allem eben aus der vierten und dritten Galerie, also von den billigen Plätzen. Always the Same ;( – siehe Untergang der Titanic.

Wer trägt Verantwortung, bzw. wer hat solche selbstlos aus eigenem Antrieb übernommen? Wer hat Hilfe verunmöglicht oder gar be- oder verhindert? Diesen Fragen wollte das Gereicht nachgehen. Das hier ausschließlich als vorgenommene Simmen aus dem Off zu hören ist: Präsident (Horst Schily), Staatsanwältin (Lena Rothstein), Rechtsanwalt Dr. Fialla (Helmut Jasbar), Rechtsanwalt Dr. Markbreiter (Franz Schuh), Schriftführerin (Julia Kampichler).

Während die meisten Zeug:innen schilder(te)n, wie lax oder gar kontraproduktiv Einsatzkräfte vorgegangen sein sollen, putzen sich die Angeklagten ab. Von sie hätten alles Mögliche getan bis zum Abstreiten der Vorwürfe ihrer Untätigkeit. Unterschiedliche, individuelle, teils karikierte Typen, die dennoch ein gesamtgesellschaftliches Panoramabild ergeben: Es sei nichts zu verhindern gewesen. Alles in Ordnung. Ohne dass dieser Satz fällt, entsprechen viele der „Verantwortungen“ dem Geist von „ich habe nur meine Pflicht erfüllt“ – damals oft noch viel weniger.
Obendrein hatte ein halbes Jahr davor im französischen Nizza ein Theater gebrannt und 200 Menschen das Leben gekostet. Daraus wurden Lehren gezogen und es gab bereits auch in Niederösterreich schon neue Brandschutzbestimmungen – die von Wien noch nicht übernommen worden sind.

Im Gegensatz dazu schildern einige der Zeug:innen, dass sie beherzt versucht hatten, trotz Flammen, trotz Rauch und trotz der Drohungen, da ja nicht hineinzugehen, es doch getan und wenigstens die eine oder den anderen gerettet zu haben. Womöglich waren gerade diese Aspekte der Grund, weshalb das kritische Erfolgsduo dieses – damals (Fernseh-)Stück geschrieben hatte.
Die fünf genannten Schauspieler:innen switchen bei ihren jeweiligen Rollenwechseln in immer wieder unterschiedliche Charaktere – sowohl als konkrete Personen als auch als stellvertretende Typ:innen in einem schrägen Bühnen- und teils auch Kostüm-Ambiente (Bühne: Andreas Lungenschmid, Kostüme: Antoaneta Stereva Di Brolio, Maske: Henriette Zwölfer).

Die zwei Figuren aus dem Video sind inszeniert als typische „Herr-Karl“-Figuren. Martin Schwanda als Hromatka kommentiert das Prozessgeschehen in diesem Stil, bedauert selbst nicht in den Zeugenstand geholt zu werden. Kramt immer wieder in der Tasche, reicht dem Kollegen übers „Nichts“ hinweg ein „Wiener Zuckerl“, hält ein solches auch aus dem Film mit ausgestreckter Hand dem Publikum hin. Was die mit einer solchen Kette geschmückte Regisseurin und Co-Leiterin der Wortwiege, Anna Luca Krassnigg, am Premierenabend erklärt, war also keine Anspielung auf den aus Wr. Neustadt stammenden Bundeskanzler der sogenannten Zuckerlkoalition;). Hromatkas kongenialer Video-Partner (Film und Musik: Christian Mair) als Gerichtskiebitz: Lukas Haas alias Schagerl, der auch als Zeuge aussagt, aber auch noch in der Rolle weiterer Zeugen sowie eines Angeklagten (Feuerwehr-Exerziermeister Heer) auftritt.
Das Krasse, das an diesem (mehr als zweistündigen) Theaterabend mitschwingt: Das war keine Fiktion, die dramatischen Szenen, die Zeug:innen schildern, haben tatsächlich stattgefunden. Und: Trotz offensichtlichen Bemühens des Gerichts: Die hohen Herren wurden alle freigesprochen, Haftstrafen für Beleuchter als Bauernopfer.

Zwei Schauspieler stehen zunächst seitlich vom Publikum, kommen auf die Bühne und schlüpfen vor aller Augen erst in ihre Rollen. Jugendliche. Pubertierende. Burschen. Goschert der eine, voll der Macker – zumindest will er sich so geben, sähe sich auch selbst gern so. Manchmal aufbrausend. Ohne Ansatz. Eher zurückhaltend, schüchtern, verträumt, ja poetisch der andere.
Aber sie sind nun einmal hier zusammen. Auf engem Raum. Zusammengeschweißt durch Schicksalsschläge, von denen der Name Ikarus noch nicht der allerschlimmste ist. Der ist querschnittgelähmt von TH 10 – von zwischen Brust- und Bauchmuskeln abwärts. Francis, der spätere Kumpel, hat Multiple Sklerose, geht mit Krücken.

Ihre Behinderungen haben sie hier in einer Rehabilitationsklinik zusammengebracht, sind klarerweise nicht zuletzt deswegen Gesprächsthema. Und mit dem gehen sie – wie es echt Betroffene oft wirklich tun, scheinbar respektlos, bitterböse, schwarzhumorig um. Weshalb der ursprüngliche Stücktitel „Mongos“ (das in gut einem halben Dutzend deutschsprachiger Theater lief/ läuft) ziemlich zutreffend ist – so wie sich in Wien vor mehr als einem Vierteljahrhundert eine Gruppe von Satirikern mit verschiedenen Behinderungen „Krüppelkabarett“ nannte. Weil der Begriff aber doch diskriminierend wirkt, haben sich Verlag und Theatergruppe entschlossen, es unter neuem Titel zu spielen: „Irreparabel“.
Geblieben ist die für manche mitunter verstörend radikale Ablehnung von Pseudo-Mitgefühl, das eher ins Mitleid abgleitet. So zeigen sie einander – und dem Publikum wie Respekt geht: Sich als Menschen zu behandeln, genauso wie wenn sie keine Behinderung hätten. Nicht in Watte packen, also auch benennen, vielmehr sogar beschimpfen, wenn sich einer als A…-loch aufführt…

Vor diesem Hintergrund spielt sich in diesen knapp eineinviertel Stunden des Stücks von Sergej Gößner vor allem die Annäherung zweier völlig unterschiedlicher Typen ab: Von der Ablehnung des Zwangsgenossen – es gibt anfangs fast keine echte gemeinsame Gesprächsbasis – bis hin zur Freundschaft. Derzeit ist eine Version des Stücks in einer Koproduktion der Grazer Gruppe „Follow the Rabbit“ mit dem Theaterhaus TiG7 Mannheim in Österreich zu sehen – derzeit im Wiener Werkstätten- und Kulturhaus (WuK), demnächst im Grazer Theater am Ortweinplatz (taO!).
Gefühle – auch da klafft’s lange auseinander. Ach wozu sollen die gut sein, lehnt Ikarus (sehr überzeugend Nuri Yıldız) die ab. Macho. Frauen sind in seinem Hirn und in seinen Sprüchen nichts als Sexualobjekte. Schüchtern im Gespräch, tiefgreifend gefühlvoll in seinen aufgenommenen Gedichten hingegen Francis (voll glaubhaft Jonas Werling). Und dann taucht Jasmin auf. In die verknallt sich Ikarus – und wird sanfter. Zunächst nur vorübergehend. Dauerhaft will – oder kann – er noch nicht von seinem schon eingeschliffenen Männlichkeitswahn lassen. Als er droht, allein in der Reha-Klinik zurückzubleiben, bereut er kurz, will alles gut machen, nochmals von vorn anfangen, um wieder und nochmals ins alte Fahrwasser zu kippen, bis … – schau und erlebe dieses Stück selbst mit!


Willkommen in einer Art „Geisterbahn“ zwischen analoger und digitaler Welt. Teil drei der Justitia!-Tetralogie (vier Episoden) widmet sich dem Thema Einsatz Künstlicher Intelligenz im Justiz-Bereich. „Justitia! Data Ghosts“ ist als interaktives Stationen-Spiel gebaut (Konzept, künstlerische Leitung & Text: Gin Müller, Laura Andreß).
Es beginnt schon damit, dass du dich als Besucherin / Besucher mit deinem SmartPhone via Scan eines der vielen an den Wänden aufgehängten QR-Codes in einen Fragebogen einloggen musst. Neben persönlichen Daten – du kannst die klarerweise auch faken -, werden mögliche eigene Erfahrungen mit der Justiz erhoben. Ergebnis: Eine Buchstaben-Ziffern-Kombination, die dich in eine von vier Farbzonen zuteilt.
Gemeinsamer Start für alle: Der Theaterraum, eine per Vorhängen abgetrennte „Black-Box“ im Wiener brut nordwest wird zum Verhandlungs-Saal. Als überdimensionale Geister verkleidete Schauspieler:innen (Anna Mendelssohn, Alexandru Cosarca, Lisa Furtner, Nicholas Hoffman, Nora Jacobs, Johnny Mhanna; Kostüm & Bühne: Sophie Baumgartner) tragen über Kopfhöhe Monitore. Diese Ankläger:innen, Verteidiger:innen, Richter:innen werden mit KI-generierten Gesichtern und Stimmen bespielt (Video & Bühne: Jan Machacek; Sound Design: Nicholas Hoffman, Sound Engineering: Lisa Maria Hollaus).
Der Fall: Künstlerperson XX ist mit Plagiats-Vorwürfen konfrontiert. Hat sich XX für das digitale Geisterbild einer Winterlandschaft bei Werken einer künstlerischen mit KI arbeitenden Gemeinschaft bedient? Oder waren diese „nur“ Inspiration wie vieles andere auch – kein Kunstwerk entstehe aus dem Nichts…
Der „Fall“ tritt in der Folge in den Hintergrund. Die Justiz-KI will lernen, so die Ausgangs-Botschaft für die folgenden Spiel-Stationen an das Publikum. Sie sollen / dürfen / können über ihre Interaktion viele Inputs – samt (Selbst-)Reflxion für die Weiterentwicklung der künstlichen Juristerei liefern / leisten. Ziel: Mehr Gerechtigkeit und leichterer Zugang für möglichst viele Menschen zum Recht.
Denn, so die Realität, Verfahren dauern lange, Rechtsberatung ist nicht für alle erschwinglich… und alle Menschen lassen in ihre Handlungen Vorurteile einfließen, die wiederum Urteile beeinflussen. KI-Richter:innen würden – so ein Postulat – solchen weniger bis nicht unterliegen.
Und so geht es – aufgeteilt in vier Gruppen – auf in unterschiedliche Stationenspiele; von denen gibt es allerdings fünf und jede Gruppe versäumt eines der Spiele, was doch schade ist.
Diese reichen von der Entscheidung ob Bilder bzw. Fotos von Menschen produziert bzw. KI-generiert sind, von wem welche Zitate stammen über Zuordnung vermeintlicher Fotos, ob die Abgebildeten Gesichter Cis- oder trans-gender Personen gehören, wie eine KI für autonome Fahrzeuge programmiert werden sollten, wen von Menschen auf einem Zebrastreifen sie im Notfall verschonen solle bis hin zum „Malen“ eines gemeinsamen digitalen Bildes mit Hilfe von Armbewegungen mit kleinen Lämpchen in der Luft.
Am Ende treffen einander wieder alle Gruppen im – mittlerweile aufgelösten – Gerichts-Saal. Wenngleich der Ausgangs-Fall nicht zur Debatte steht, spielt nun auf überraschende Weise (kein Spoilern!) die Frage KI vs. Recht realer Menschen auf ihr schöpferisches Tun eine wichtige Rolle.
In einem Interview, das Flori Gugger (Leitung Dramaturgie brut Wien) mit Laura Andreß und Gin Müller zur Entwicklung der Performance für die Unterlage für Medien führte, meinte Erstere: „Mich hat verblüfft, wie weit fortgeschritten der Einsatz von KI-basierten System im Justizbereich schon ist und dass diese KI-Systeme längst nicht mehr nur in Amerika oder China Anwendung finden, sondern auch bereits in vielen Ländern Europa… Im Rahmen eines Pilotprojekts hat Estland 2019 einen „Roboter-Richter“ geschaffen, der über kleinere Auseinandersetzungen entschied. Das KI-System traf vollständig autonome Entscheidungen.“
Rund 30 Leute seien in den Prozess der Recherche und Entwicklung dieses Formats, das die Zuschauer:innen tatsächlich stark aktiviert, einbezogen gewesen.
Eine große Rolle habe übrigens ein Text von Noam Chomsky gespielt: „Der menschliche Verstand ist ein überraschend effizientes und sogar elegantes System, das mit kleinen Informationsmengen arbeitet; es versucht nicht, grobe Korrelationen zwischen Datenpunkten abzuleiten, sondern Erklärungen zu schaffen. Hören wir also auf, sie künstliche Intelligenz zu nennen, und nennen wir sie als das, was sie ist, nämlich „Plagiatssoftware“. Denn sie erschafft nichts, sondern kopiert bestehende Werke von bestehenden Künstlern und verändert sie so, dass sie dem Urheberrecht entgeht.“
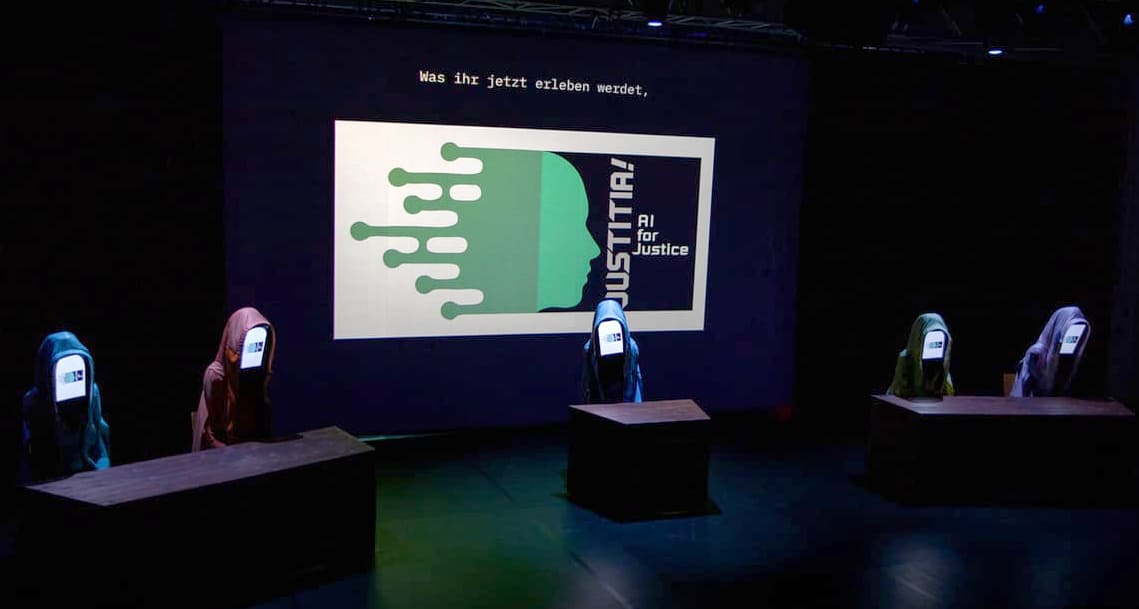

Weihnachten war in – früheren – Kriegen oft Anlass für wenigstens einen kurzzeitigen Waffenstillstand. Berühmt sind etwa die Bilder von Soldaten im ersten Weltkrieg, die aus den Schützengräben kamen und gegeneinander Fußball spielt und miteinander feierten. Einen solchen Waffenstillstand gab es nicht nur an der Westfront 1914, sondern auch im Osten – wie hier schon vor zwei Jahren berichtet wurde. Dieser Absatz sei im folgenden hier wiederholt, sozusagen ein Eigen-Zitat:

Es gab eine solche Unterbrechung des Krieges auch im Osten zwischen den Truppen des Russischen Reiches und der Habsburger-Monarchie im belagerten Przemysl. Darüber berichtete die Krankenschwester Ilka Michaelsburg, deren Buch „Im belagerten Przemysl“ 1915 erschien. Drei Mal gab es solchen Waffenstillstand, berichtet sie: Am Heiligen Abend 1914, am Neujahrstag 1915 und zum russischen Weihnachtsfest Anfang Jänner 1915. „Im Vorfeld schwenkte der Feind die weiße Fahne und schickte eine Deputation von zwei russischen Offizieren zur Weihnachtsbeglückwünschung in unser Lager herüber. Sie brachten russischen Tabak und Zigaretten als Weihnachtsgabe … daß am russischen Weihnachtsabend österreichische Offiziere die russische Beglückwünschung erwidert haben, indem sie gleichzeitig als Gegenleistung für die Zigaretten der Belagerungsarmee – Sardinen und Salami überreichten“, heißt es in dem Buch.

In beiden Fällen ging der Krieg danach jedoch unvermindert weiter. Aktuell gibt es nicht einmal solche Waffenstillstände – egal wo und egal zu welchen Feiertagen. An diese kurzfristigen Unterbrechungen der Kampfhandlungen einerseits und generell an die Frage Krieg oder Frieden möchte auch dieses Jahr Arbos – Gesellschaft für Musik und Theater (veranstaltet unter anderem das internationale Visuelle Theater-Festival vormals Gehörlosentheater-Festival) erinnern. Online wird erneut ein Konzert mit thematisch passender Musik gestreamt – im Wesentlichen die selben Stücke wie in den vergangenen Jahren u.a. „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“ von Viktor Ullmann (Libretto und Musik), aber mit einigen wenigen Abweichungen (gespielt von anderen Ensembles) bzw. Ergänzungen – Liste in der Info-Box am Ende des Beitrages.


Nachdenken über sich, das Theater und die Welt – vielschichtig, von vielen Seiten beleuchtet, dabei sich selbst immer wieder auch hinterfragend, mitunter auch auf die Schaufel nehmend. Das tun derzeit in Wien zwei Theaterstücke. Im TAG, dem Theater an der Gumpendorfer Straße, spielt sich dies bitterböse-komödiantisch im „Sumpf des Grauens“ samt Werwolf ab (bis 25. Februar 2025 – Link zur Stückbesprechung am Ende des Beitrages).
„Grau“ steckt auch im Titel des zweiten dieser Stücke: „Grau. In einer farbenfrohen Welt“ vom Ensemble „Farbenfroh“, alles Absolvent:innen der allgemeinbildenden höheren Schule mit künstlerischem Oberstufenzweig (Polyästhetik) in der Wiener Innenstadt (Hegelgasse 12). Geschrieben hat es einer aus diesem Ensemble, Max Melo, der gleich noch auch co-inszenierte (gemeinsam mit Olga Psenner) und obendrein darin eine Rolle spielt.

Apropos Rolle: Dieser Begriff lädt zu einem der vielen Wort- und Gedankenspiele in dem Stück ein. Welche Rolle spielt Theater, bzw. Kunst im Leben – einzelner aber auch der Gesellschaft. Wichtig? Lebensnotwendig? Unnötiges Beiwerk? Behübschung?
Und welche Rolle spielt das Publikum? Ist es überhaupt ein Stück, wenn niemand zuschaut? Steigen Wert und Wichtigkeit bei hohen Quoten? Wird Kunst (immer mehr?) zum Kommerzspektakel? Oder ist die Rolle gar nur eine solche aus vielen Metern perforierten Papiers? Um das es immerhin in der Pandemie vor dem ersten Lockdown sehr viel G’riss, ja fast Schlägereien in Supermärkten gegeben hat?

Diese und viele weitere, meist sehr tiefschürfende Gedanken verpackt das Stück noch dazu in eine Story um ein intensives Ringen zwischen autoritär und demokratisch. Esto (Jakob Köllesberger) meint, den Ton angeben zu müssen – irgendwie auch getrieben von Miss Traun, der Intendantin im Hintergrund (Lisa Zwittkovits). Die beiden spielen übrigens einen zu wenig bemerkten Prolog im Foyer des Veranstaltungs- und Theaterraums im Lokal Spektakel an der Hamburger Straße (nahe U 4 Kettenbrückengasse). Während das Publikum in den Saal drängt, verfasst die Intendantin einen Brief an einem Tisch mit Büchern und einem Uralt-Wählscheiben-Telefon.
Dieses Schreiben spielt später drinnen auf der Bühne eine wichtige Rolle (schon wieder!): Absage des Theaterstücks, wenn nicht die / der Schuldige gefunden werde, wer die Farben gestohlen habe… Solche kommen übrigens lediglich als breite aufgemalte Streifen auf den Armen der Schauspieler:innen vor. Grau taucht übrigens lediglich als optische Täuschung auf – die Bluse von Schill (Livia Andrä) vermittelt durch ihre engen schwarz-weißen Streifen eine Art Schattierung. Ansonsten alles nur weiß und schwarz – womit ein weiteres zentrales aktuelles Thema optisch transportiert wird.

Wie auch immer, Esto kommt abhanden, landet in einem (selbstgewählten?) Gefängnis. Die übrigbleibende Gruppe – Parz (Torben Day), Soy (Theresa Gerstbach), Less (Lena Hergolitsch), Kaff (Max Melo), Weig (Linnea Paulnsteiner) und Jura (Mirandolina Wissgott) – versuchen es nun als basisdemokratisches Ensemble. Was sich auch nicht gerade immer als so einfach darstellt. Heftige Diskussionen in der Gruppe über das weitere Vorgehen, Monologe, Zwiegespräche – über individuelle Zugänge zu Kunst im Allgemeinen oder Theater im Besonderen, nicht selten aber auch über die Welt und den möglichen eigenen Anteil, sie retten zu wollen, wechseln einander ab. Und nicht zuletzt die Frage Individuum oder Gesellschaft ich oder wir mit einem wortspielerischen Highlight als Frage was steckt in Nichts. Die Auflösung ist nicht so schwer und hätte vielleicht dem Publikum selber überlassen werden können 😉
Hochphilosophische Gedanken schwirren ebenso wie scheinbar Banales über die Bühne und den Zuschauer:innen-Raum. Auch wenn blad nach Beginn die Fiktion ins Spiel gebracht wird, sie alle spielten in einen leeren Raum ohne Publikum. Samt der existenziellen Theaterfrage, was das bringen könnte / sollte, wie viel und welchen Sinn das mache.

Sinnfragen, echt oder gespielt? Authentizität – ein seit geraumer Zeit wahrhaft (fast) ständig präsenter Begriff im Diskurs rund um Kunst und Kultur. Fast alles, was gut und teuer (!) ist, wird in „Grau. In einer farbenfrohen Welt“ vom Ensemble aus jungen, enthusiastischen, leidenschaftlichen Theaterleuten, die erst im Vorjahr die Schule mit diesem Schwerpunkt absolviert haben.
Im Hintergrund spielt immer wieder Musik eine weitere Rolle, live auf der Geige gespielt von Maria Laun, die mitunter durch kurze, schrille, schräge Töne manch Bühnengeschehen kommentiert, unterstreicht oder konterkariert.
Ein wirklicher Blick von außen hätte vielleicht geholfen, die doch mit gut zwei Stunden – samt dem Vorspiel sogar 2¼ Stunden – zu kürzen. Klar, wer involviert ist – schreibend, inszenierend und spielend tut sich schwer das zu tun, was so landläufig mit „kill your darlings“ nicht selten (dramatische) Texte doch prägnanter machen kann / könnte.


Die vielen dunkelweiß-grauen Pölster (Bühne & Kostüme: Michael Lindner) auf der Bühne deuten zwar schon auf die Heimat der Hauptfigur des Theatervormittags hin – „Der kleine Eisbär“, eine Produktion des niederösterreichischen Landestheaters wird in der Bühne im Hof St. Pölten gespielt. Doch der erste – und nicht nur dieser – Auftritt gehört einem anderen tierischen Wesen; natürlich in menschlicher Schauspiel-Gestalt. Als schriller Florian Maria, später auch als Flora Mario, rückt sich ein Flamingo ins Rampenlicht. Seine Show wäre das, vermeint die pink-grelle Erscheinung. Auch das ein nicht unwichtiges Element in dieser Inszenierung (Regie: Paola Aguilera): Wer drängt sich in den Vordergrund. Und bleibt dabei noch Platz für andere?
Und der bleibt durchaus. So raumgreifend führt sich Sven Kaschte als dieser Vogel nicht auf 😉 Der Schauspieler kann übrigens auch viel dezenter, wie er später in der Rolle des Hundes Nanuk beweisen wird.

Natürlich bekommt der Titelheld Lars, dem Hans de Beer mittlerweile ein Dutzend „Kleiner Eisbär“-Bilderbücher gewidmet hat, seine – nicht zu geringe – Bühnenzeit. In dieser flotten Stunde ist er zu Beginn noch sehr jung, sein Vater will ihn dazu bewegen, schwimmen zu lernen. Immer passt dem Sohn irgendwas aber nicht, um ins Wasser zu springen. Auch so kann Angst dargestellt werden. Außerdem brauche er es gar nicht lernen, er könne es sowieso – verbreitet Lars – in Gestalt der Schauspielerin Katharina Rose, die nachvollziehbar die Wandlung von Lars im Laufe des Stücks verkörpert.

Doch bevor Lars mutig wird, muss er noch Abenteuer erleben, die seine Veränderung plausibel machen. Er schläft auf einer Eisscholle ein, diese driftet vom Rest der gefrorenen Landschaft weg. Irgendwo im Süden trifft Lars auf Häsin Leni, den sich der Autor der Stück-Fassung von einer Braunbärin aus den Büchern von Hans de Beer ausgesucht hat, die zur Freundin von Lars wird. Beide – Hase und kleiner Eisbär – ängstlich und allein. Allein? Jetzt sind sie doch zu zweit – was die Angst ein wenig mindert. Später gesellen sich noch Hund Nanuk und Papagei Pedro zur Reisegesellschaft. Wobei Hase und Papagei nie gleichzeitig auftreten können, werden beide doch – so wie Lars’s Vater – vom wandlungsfähigen Florian Haslinger gespielt.

Zwischenzeitlich spielt sich das Abenteuer der Gefangenschaft beim Tierhändler ab – Flamingo und kleiner Eisbär in vergitterten Zelten – und dem mutig werdenden Hasen der sie befreit. Ein zweites wichtiges Element der Bühnenfassung: Ängstliche erleben Situationen, in denen sie mutig werden.

Letztlich muss Lars etwas ganz anderes lernen – schwimmen kann er wirklich wie sich herausstellt, wenn er’s braucht: Um nach Hause in den hohen Norden zu kommen – mittlerweile vermisst er seinen Vater sehr – muss er um Hilfe fragen / bitten; das ist die dritte Lehre aus dem meist kurzweiligen Stück für ein sehr junges Publikum (ab 4 Jahren): Es ist eine Stärke, um Hilfe fragen bzw. bitten zu können, nicht wie oft verklickert wird, eine Schwäche.
An manchen Stellen wird das gespielte Stück dann doch hin und wieder zu einer Art Show – mit Liedern und Tänzchen (Musik: Thorsten Drücker).

Der Autor der Stückfassung Raoul Biltgen wurde vom Landestheater, das dieses Stück für die Aufführungen in der Bühne im Hof produziert hat, für die Materialmappe für Pädagog:innen gefragt, wie er aus den Bilderbuchgeschichten den Bühnentext verfasst hat.
„Keine leichte Aufgabe“, sagt er diesem Interview zufolge, „denn auf der einen Seite will ich ja den ursprünglichen Geschichten von Hans de Beer gerecht werden, auf der anderen Seite geht es natürlich darum, ein eigenständiges Theaterstück zu schreiben, das auf einer Bühne funktioniert, wo ich weiß, ich habe nur eine gewisse Anzahl von Schauspieler*innen zur Verfügung usw. … Für dieses Theaterstück habe ich mir die (ersten) 10 Lars-Geschichten von Hans de Beer ganz genau durchgelesen und analysiert: Was passiert? Wem begegnet Lars? Was steckt hinter der Geschichte? Worum geht‘s? Und dann picke ich mir manchmal auch nur einzelne Elemente raus, die ich benutzen kann, so wie zum Beispiel Nanuk, den Hund, der eigentlich sein eigenes Abenteuer mit Lars hat. Ich setze ihn aber in den Hinterhof des Tierhändlers, der in einer anderen Geschichte vorkommt, und lass ihn dann in einem Heißluftballon aus noch einer anderen Geschichte zusammen mit Lars und Pedro, dem Papagei, der bei Hans de Beer Yuri, der Papageientaucher ist, davonfahren.“
An einer anderen Stelle dieses Materials wird genau aufgelistet, dass Geschichten aus Band 1, 3, 4, 6 und 7 von Hans de Beers „Kleiner Eisbär“-Bilderbüchern verarbeitet worden sind – aber leider nur mehr fünf Mal in dieser Saison (bis 29. März 2025) gespielt wird.
Lars trifft auf Pandas <- damals noch im Kinder-KURIER

„Dschungel Wien, Dschungel Wien, Dschungel Wien, wir fordern, wir fordern, wir fordern… Nachttheater für alle…“ Aber auch Sommer- und Freilufttheater beispielsweise im Hof vor diesem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier. Alice, Alma, Helen, Ida, Jan, Kilian, Lilo, Nawa und Zeynep (beglück-)wünschten so manches zum Jubiläum. Am Wochenende wurde die 20. Spielzeit dieses Theaterhauses, das nach vorangegangenem fast genauso langem Kampf der freien Kinder- und Jugendtheater-Szene 2004 eröffnet worden war.

Neben informativen und bewegenden Reden von Veteran:innen des Theaterhauses und einer (selbst-)ironisch-kabarettistischen Nummer von Magdalena Fatima Al-Ghraibawi mit so manch kritischer Anmerkung in noch längst nicht ausreichenden Diversität wurde der Reigen der Festreden von Kindern eröffnet. Die Genannten hatten in einem einwöchigen Ferien-Workshop ihre Wünsche, Forderungen und Anregungen erarbeitet und in einer Art szenischen chorischen Rede mit Solo- und Duett-Auftritten dargeboten – in voller Länge unten in dem Video zu sehen und hören.

Über die eingangs zitierten Wünsche hinaus, gab es noch so manch weitere, nicht zuletzt jene, mehr Spenden zu sammeln, dass alle Kinder, unabhängig von der finanziellen Lage ihrer Familien Aufführungen besuchen und an Workshops teilnehmen können. Andere Forderungen gingen weit über Theater hinaus, etwa: späterer Schulbeginn, um ausgeschlafen in den Unterricht kommen zu können und vieles mehr. Nicht zuletzt war eine höchst engagierte Rede fast im Stile Greta Thunbergs Teil dieser performativen Geburtstags-Ansprachen: „Wie könnt ihr es wagen, unsere Erde so zu zerstören, … immer mehr Autos herzustellen…! Ich fordere von euch, dass ihr das ändert!“
Mehrmals wiesen die Kinder auch darauf hin, dass es die Kinderrechte auf Freizeit, Spiel, Erholung und Kultur gibt (in der 1989 von der UNO-Generalversammlung verabschiedeten Kinderrechte-Konvention).
Neben den Reden und natürlich zwei Premieren – Besprechung der Stücke, die beide allerdings für Jugendliche und nicht Kinder angesetzt waren, unten verlinkt – startete am Eröffnungs-Wochenende auch eine – teils interaktive – Ausstellung auf Bühne 3 und den Räumen davor. Künstler:innen hatten Requisiten aus Stücken – oder von Gegenständen hinter der Bühne zur Verfügung gestellt. Diese können betrachtet werden. Es gibt aber auch eine kleine Bühne mit Green-Wall – die dein Bild davor automatisch auf einer großen Projektionswand gegenüber erscheinen lässt. Und wenn du bittest, das die vor der Bühne stehende Windmaschine eingeschaltet wird, kannst du beispielsweise deine Haare im Wind flattern lassen. Auch KiJuKU wurde angeschrieben, um etwas zur Schau beizutragen – nun finden sich gedruckte 70-seitige Hefte mit Screenshots der auf kijuku.at erschienen Dutzenden Beiträge über Produktionen in diesem Theaterhaus und einige wenige noch online verfügbare aus der Zeit davor im Kinder-KURIER.
Nach-nachträgliche Anmerkung: Die Kern-Idee dieses „musée sentimentale“ sind übrigens nicht die Objekte, sondern die Beschreibungen der Leihgeber:innen dazu. Und dies geht auf eine Idee des Künstlers Daniel Spoerri und seiner Lebensgefährtin Marie-Louise Plessen zurück. Diese Zusatz-Information, die ich nicht ge-checkt hatte, wurde mir erst durch den nachträglichen Hinweis eines Dschungel-Mitarbeiters bewusst gemacht. Natürlich will ich diese Informationen und meinen Fehler / mein Versäumnis auch öffentlich machen. Die ursprüngliche Formulierung hier wurde von manchen missverständlich aufgefasst, daher diese neue Textierung.


Der große Saal im Pförtnerhaus am Ill-Ufer, in dem bei den vorangegangenen Vorstellungen eine große Tribüne stand, ist es an diesem letzten Nachmittag ziemlich dunkel, wenn die Zuschauer:innen hereinkommen. Höchstens mit ein bisschen Licht von dezenten Taschenlampen führen zwei Puppenspieler in schwarzen Overalls die Gäste in ein aus schwarzem Stoff abgehängtes Theaterzelt – nur knapp mehr als 70m² klein – und doch werden sich hier große Welten öffnen. Der Stücktitel „Komm her!“ (im Original Kom hier) wird sozusagen schon live vorweggenommen – oder sinnlich erfahrbar eingeleitet.

Dieses „Zelt“ beherbergt eine nicht ganz halbrunde Publikumstribüne und gegenüber stehen ein paar, teils filigran wirkende, Objekte, aber auch ein paar recht massive. Hier versetzten Sven Ronsijn und Rupert Defossez vom Ultima Thule aus Gent (Belgien) ihr Publikum immer wieder mit ihrem Puppen- und vor allem Objektspiel immer wieder in fast ungläubiges Staunen mit so manchen „Aaahs“, „Ooohs“ und manchmal auch so etwas wie „Huchs“. Die Grundstory, die sie in der nicht ganz einen Stunde spielen: Zwei Kinder-Figuren – dem Programmheft zufolge Marco und Kubo (im Stück fällt kein Wort und damit auch kein Name) spielen mit einem rot-weiß-gestreiften Ball, irgendwann landet dieser unerreichbar in den Ästen eines winterlichen Baumes ohne Blätter. Nicht nur der Ball – auch die beiden Freunde verlieren sich – aber nur räumlich. In Gedanken und Herzen bleiben sie verbunden.

Zwischen ihnen liegen aber Welten – ober und unter der Erde, von dort raucht es etwa auch durch die Häuser und ihre Rauchfänge raus – mit Hilfe einer kleinen Theater-Nebelmaschine. Letztere ist übrigens das einzige, das die Theaterleute gekauft haben. Alles andere haben sie selber nicht nur ausgedacht, sondern auch entworfen und hergestellt – vor allem tat dies Gestalterin Griet Herssens, die die meisten der bisherigen 200 Vorstellungen von „Komm her!“ auch gespielt hat – gemeinsam mit Rupert Defos. Sven Ronsijn spielte – nach kaum mehr als zwei Tagen Probenzeit – in Feldkirch das erste Mal. Allerdings hat er diese Produktion schon zuvor gecoacht und dramaturgisch begleitet – gemeinsam mit Kobe Chielens.
Zu diesen Welten – Häuser und Objekte wie Strommasten, Schiffe, Vögel und vieles mehr aus Karton bzw. Holz per digital gesteuertem Leser ge-cuttet (ausgeschnitten), Skelette und Köpfe der Puppen 3D-gedruckt – ließ sich die Gruppe durch Italo Calvins Kurzgeschichtensammlung „Unsichtbare Städte“ anregen. Ein Abschnitt daraus findet sich auch im pädagogischen Begleitmaterial für Schulen und so manche Bilder entsprechen den Schilderungen Marco Polos über Städte und Gegenden in Kublai Khans Reich, das der Herrscher offenbar nicht selber erkunden konnte oder wollte. Weil der all das, das er in für ihn unverständlichen Sprachen gehörte hatte, nicht in einer für den Kahn wiederum unverständlichen Sprache erzählte, sondern „nicht anders als durch Gesten, Sprünge, Ausrufe der Bewunderung und des Entsetzens, Bellen und andere Tierlaute ausdrückte, oder durch Gegenstände, die er aus seinen Doppelsäcken hervorholte – Straußenfedern, Blasrohre, Quarze –, um sie dann wie Schachfiguren vor sich auszubreiten“, fand der eine Verständigungsebene mit dem Herrscher des Reiches im Osten. „Der Großkhan entzifferte diese Zeichen, doch die Verbindung zwischen ihnen und den besuchten Orten blieb ungewiss: Er wusste nie, ob Marco ein Abenteuer darstellen wollte, das ihm unterwegs widerfahren war, eine Tat des Gründers der betreffenden Stadt, die Weissagung eines Astrologen, ein Bilderrätsel oder eine Charade, um einen Namen zu nennen.“ (Italo Calvino, „Die unsichtbaren Städte“, übersetzt aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber, Hanser Verlag).

Das Duo, das fallweise trotz der Dunkelheit auch selber zu sehen ist, aber sich stets im Hintergrund hält – „es geht um die Figuren und Objekte, sie sind im Zentrum, auch wenn sie ohne uns nichts können“ – spielt mit klitzekleinen Objekten, von denen es so manches deutlich größere Ebenbild gibt, ebenso wie mit echt massiven. Beispielsweis betätigt Rupert Defossez mehrmals einen metallenen Kran- samt dreizackigem Greifarm – auch knapp über den Köpfen von Zuschauer:innen.
Natürlich kommen die beiden Freunde am Ende auch wieder physisch zusammen – das darf durchaus verraten werden, wenngleich dazwischen so manch durchaus gruselig anmutendes Abenteuer gespielt wird. Zum Spiel gehört noch Musik (Griet Pauwe) und nicht zuletzt dasjenige mit Licht und Schatten. So kommst du erst nach der Vorstellung, als die Puppenspieler dies erwähnen, drauf, dass die beiden Figuren keine Augen haben – sondern lediglich der Schatten den der obere Teil der beiden Löcher im Gesicht wirft, die Zuschauer:innen (!) Augen sehen lassen, weil sie dies in ihren eigenen Köpfen zusammen-Puzzlen.

Rund ein Jahr lang hat die Gruppe an der Entwicklung dieses Stücks gearbeitet, erzählt das Spieler-Duo im anschließenden Gespräch mit dem Publikum. „Was ihr hier auf der Bühne sehen konntet, ist ein Viertel, höchstens ein Drittel von dem was wir gebaut haben. Aber vielleicht können wir das eine oder andere ja einmal bei einem späteren Stück verwenden.“ Auch viele dramaturgischen Ideen wurden verworfen, weil die ausgedachte Szene im weiteren Verlauf nicht schlüssig gewesen wäre. Und so fantasievoll wie sie selber „Komm her!“ erarbeitet haben, so wollen sie im Idealfall, dass auch ihr Publikum nach Hause oder in die Schule geht. Sie verstehen – dem schon erwähnten Begleitmaterial zufolge – ihre Arbeit nicht nur, aber ganz besonders dieses Stückes, als Impuls fürs fantasievolle Weiterspinnen vor allem ihres jungen Publikums.

Nicht von ungefähr nannte sich die Gruppe bei der Gründung (1993 aus einer Fusion des Puppentheaters Joris Jozef und Wannepoe) „Ultima Thule“ (ab 2008 in Gent, davor in Antwerpen), weil dies schon in der Antike der Name eines Ortes war, der die Fantasie anregte. „Dichter, Philosophen und Weltreisende gaben mit Ultima Thule dem nördlichsten Land einen Namen. Die am weitesten entfernte Insel.“ (zitiert aus der Homepage der Gruppe).

Auf Wikipedia ist unter dem Begriff auch zu finden: „Am 26. Juli 2008 entdeckte ein Team, bestehend aus Brian Beatty, Friederike Castenow, Heinz und Lindy Fischer, Jörg Teiwes, Ken Zerbst und Peter von Sassen, eine Insel an der Position 83° 41’ 20.7” N, 31° 5’ 28” W. Sie war etwa 100 m lang, äußerst schmal und etwa 5 m hoch. Das Team errichtete einen Steinhaufen… Aus einem 2019 veröffentlichten Artikel von Ole Bennike und Jeff Shea geht hervor, dass seit 2008 offenbar keine Untersuchung der Geisterinseln vor der Küste mehr stattgefunden habe. Sie bewerten die Forschungssituation als mangelhaft, um feste Aussagen zur Beständigkeit der Inseln machen zu können, wofür vor allem genauere Beschreibungen und Untersuchungen von Gestein und Vegetation auf den Inseln nötig wären. Sie halten fest, dass die Inseln nicht dauerhaft an derselben Position liegen können, und vermuten anhand der Beobachtungen aus den letzten Jahrzehnten, dass vermutlich keine der bis 2008 beobachteten Inseln noch existiert.“ Womit der Begriff wieder der Fantasie gehört 😉
Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.

Der leicht schillernde Vorhang zu Beginn vermittelt ein bisschen den Eindruck einer spiegelnden Wasseroberfläche – vielleicht aber auch nur, weil demnächst das Stück „Tagebuch eines hässlichen Entleins“ über die Bühne im Pförtnerhaus gehen wird. Damit eröffnete das internationale Theaterfestival für ein junges Publikum im Vorarlberger Feldkirch seine 36. Ausgabe.
„Diario di un brutto anatroccolo“ der Factory compagnia transadriatica aus Lecce (Halbinsel Salento in Apulien, Italien), kommt ohne Worte aus. Natürlich lehnt es sich an das berühmte Märchen von Hans Christian Andersen „das hässliche, junge Entlein“ an. Für jene, die dies nicht kennen kürzest die Story: Unter den Eiern, die eine Entenmutter ausbrütet ist auch ein fremdes. Dieses Küken ist – im Gegensatz zu seinen vermeintlichen Geschwistern nicht niedlich gelb, sondern grau. Es entpuppt sich letztlich als ein Schwan. Die werden in der Regel für sehr schön gehalten. Ein wunderbares Märchen, wie das so ist mit Vorurteilen und Ausgrenzung von Außenseiter:innen!
Die Gruppe aus dem Stiefel-Absatz ziemlich nahe der Schuhsohle erzählt in wortlosem Tanz und Schauspiel aber oft mit Originalmusik von Paolo Coletta, der Tschaikowskys „Schwanensee“ zusammen mit der Choreografie von Annamaria De Filippi neu interpretiert. Stationen des Schwanen- und damit anfänglich gemobbten Außenseiter-Lebens werden nicht so sehr als Märchen, sondern als für von vielen (Kindern) erlebte Situationen, wenngleich im Schwimmvogel-Kostüm gespielt und getanzt.

Allein schon durch hier Tänzerin Francesca De Pasquale und da die schauspielenden Entleins Antonio Guadalupi, Luca Pastore, Benedetta Pati ergeben sich zwei Theaterwelten, die doch deutlich Unterschiede zeigen. Mobben sie das „fremdartige“ Kind schon gleich nach der Geburt, so zieht sich dies in einer auf uralt gemachten Schulszene weiterhin fort. Da wird die Schwänin zur „Streberin“, die mit Papierkugeln beschossen wird.
Später schlüpfen die drei Schauspieler:innen in die Rollen unterschiedlichster Passant:innen auf einer hektischen Straße in einer Großstadt – was die Geräusche verraten. Halbtot liegt Schwänin als Obdachlose (?) auf dem Gehsteig, alle hasten vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen, teils steigen sie über sie drüber. Irgendwann wirft ein edel erscheinender Mann, von seiner noch edleren Begleiterin gedrängt, dem Wesen auf dem Boden ein paar Münzen hin… Diese Szenen bergen viel Situationskomik und Humor in sich – mitunter aber Lächeln und Lachen, das im Halse stecken bleibt, angesichts der Parallelen zur echten Menschen-Welt.
Heftig – wohl für junge Kinder (das Stück ist ab 5 Jahren angegeben) durchaus möglicherweise ängstigend (im Publikum im Pförtnerhaus waren nur sehr wenige junge Besucher:innen) ist die doch recht lange Szene, die es auch im Märchen gibt, wenn Jäger auf Enten und Gänse schießen. Schüsse, Kriegslärm, blutrot gefärbte Bühne – und das eine gefühlte Ewigkeit lang.
Aber abgesehen davon, überzeugt diese Version der Verallgemeinerung des zu-sich-Stehens, des Widerstehens von Anfeindungen, des Auf und Abs an Ablehnung und Zuwendung – eine berührende Szene von Freundschaft und Liebe zwischen Schwänin und Enterich – durch die nonverbale, sehr poetisch getanzte und gespielte Performance der vier genannten Darsteller:innen; übrigens wie auch andere Produktionen der Factory compagnia transadriatica inklusiv. Und weil es in der Qualität der Darstellung keine Unterschiede gibt, wird hier auch nicht genannt, wer ohne und wer mit Behinderung agierte.
Schon noch erwähnt werden sollen die Regie von Tonio Nitto, der auch die Bearbeitung des Andersen-Märchens vorgenommen hat sowie Roberta Dori Puddus Bühnenbild – teils mit Hintergründen im Stile kolorierter Ansichtskarten mit umrahmten Schrift-Inserts wie in alten Schwarz-Weiß-Filmen sowie die Kostüme von Kostüme: Lapi Lou Lichtspiele von von Davide Arsenio.
Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.


Derzeit geht im Vorarlberger Feldkirch das 36. „Luaga & Losna“, Theaterfestival für ein junges Publikum über die Bühnen – und eine Wiese mit bespielbaren „Riesen“ aus re- besser geschrieben up-gecycleten Alt-Metallen. Im Rahmen des Festivals beschäftigt sich ein Symposion mit Theater als Teil einer humanistischen Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Dabei wird besprochen und in theaterpädagogischen Übungen darüber gearbeitet, wie Kindern und Jugendlichen Theater näher gebracht werden kann – und zwar sowohl das Zuschauen, das immer auch ein aktiver Prozess ist, als auch das Erlebnis, selbst Theater zu spielen.
Das Festival war in seinen Anfängen, also vor mehr als drei Jahrzehnten, jeweils auch ein vernetzendes Treffen der gesamten heimischen Kinder- und Jugendtheaterszene. Sogar die Geburtsstunde der Österreich-Sektion der internationalen Kinder- und Jugendtheatervereinigung ASSITEJ schlug bei „schauen & hören“ – die Übersetzung des Festival-Mottos ins Hochdeutsche.

Gerade in dieser Woche fand auch das Mediengespräch zur neuen Saison des Theaterhauses Dschungel Wien im MuseumsQuartier statt – wo einiges zur neuen Saison sowie zum 20-Jahr-Jubiläum dieses von der freien Szene erkämpften Theaterhauses für ein junges Publikum zur Sprache kam. Drei künstlerische Leiter:innen gab es bisher, Gründungsdirektor Stephan Rabl (12 Jahre lang), Corinnen Eckenstein, die von Anfang hier viel inszeniert hatte, leitete sieben Jahre den Dschungel Wien, nun startet die aktuelle künstlerische Leiterin Anna Horn, die zuvor am Burgtheater-Studio tätig war, in ihre zweite Saison.

Da Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vorzog, Theater zu erleben, musste das Mediengespräch unbesucht bleiben. KiJuKU bat dafür einen durchgängigen Dschungel-Fixstern, meist sehr bescheiden im Hintergrund, aber Herz und Hirn des Theaterhauses, die Dramaturgin Marianne Artmann zum Jubiläums-Interview.
Zunächst wollte KiJuKU wissen, wie sie selber zum Theater gekommen ist – dies ist als eigener Teil ausgegliedert – und unten gegen Ende des Beitrages verlinkt.
KiJuKU: So, jetzt aber zu 20 Jahre Dschungel Wien, was sind im Rück- und Überblick die wichtigsten Veränderungen, die du feststellen kannst / musst oder bemerkst?
Marianne Artmann: Die Vielzahl neuere Gruppen und Kollektive, die kontinuierlich professionell arbeiten – eine deutliche Qualitätssteigerung.
Am Anfang, vor 20 Jahren, war es nicht so leicht genügend heimische Produktionen zu finden, die mit den internationalen Gruppen und Produktionen vor allem aus den Niederlanden, Belgien und Skandinavien mithalten konnten. Heute braucht die Wiener Szene diese Vergleich nicht mehr zu scheuen.
KiJuKU: Inwiefern hat da der Dschungel eventuell einen Anteil?
Marianne Artmann: Wir haben als Haus den Gruppen und Kollektiven einen Basis gegeben. Vorher musste sie sich irgendwo einmieten, selber alles organisieren – von der Technik bis zur Bewerbung. Mit dem Dschungel haben sie alle eine Infrastruktur bekommen – bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit.
KiJuKU: Und vom Publikum her, welche Veränderung stellst du da fest?
Marianne Artmann: Die Gesellschaft ist viel diverser geworden – und das ist für uns nicht nur eine Frage von Themen, die auf der Bühne verhandelt werden sollen. Es stellt sich die Frage, nicht nur was, sondern auch wen zeigst du auf der Bühne? Wer inszeniert? Fühlt sich bzw. wird das Publikum repräsentiert – verschiedene Hautfarben, Kopftuchträgerinnen, andere Sprachen als Deutsch – das sind Herausforderungen, die in den vergangenen Jahren auf alle Theaterhäuser, auch auf den Dschungel zugekommen sind.
KiJuKU: Hat sich die Zusammenarbeit mit Schulen verändert?
Marianne Artmann: Mit Kindergärten klappt es gleich gut wie früher, mit Schulen ist es schwieriger geworden und das liegt an einem ganzen Bündel an Ursachen: Schulen und Lehrer:innen sind stärker belastet – vom Mangel an Personal bis zur Zunahme administrativer Aufgaben. Wobei es mit Volksschulen noch leichter ist als in der Sekundarstufe I, aber richtig zum Knochenjob ist das Ansprechen von Oberstufen geworden. Corona war da auch ein großer Bruch.
Hinzu kommt, dass etliche Pädagog:innen, mit denen es langjährige Zusammenarbeit gab, mittlerweile in Pension sind.
Wir versuchen zwar auch in die Ausbildungsschienen von Pädagog:innen zu kommen – in Pädagogische Hochschulen mit einem Vortragsformat „Alles kein Drama – Mit Schüler:innen ins Theater“ und bemühen uns an die Unis zu kommen. Aber so manche junge Lehrer:innen haben nicht zuletzt deswegen, weil sie mit mehr und anderen Medien aufgewachsen sind, nicht mehr den Bezug zu Theater.

KiJuKU: Theater als Auslaufmodell sozusagen?
Marianne Artmann: Sicher nicht, auch wenn viele – Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene und damit natürlich Pädagoginnen und Pädagogen vieles vom Handy empfangen, das analoge Erleben eines Geschehens auf der Bühne und das noch dazu gemeinsam in der Gruppe ist eine eigene Qualität. Die erfordert allerdings auch gewisse Fähigkeiten und Anstrengungen. Theater anschauen ist etwas sehr aktives. Ich muss die Zeichenhaftigkeit entschlüsseln und mit Abstraktion umgehen können – etwas, das wir alle brauchen. Es gibt einen Satz von dem ich jetzt nicht weiß, von wem er ist: Im Theater wird Welt reflektiert, ein Standpunkt entwickelt und Gesellschaft gestaltet.

KiJuKU: Hat sich die Aufmerksamkeitsspannen in diesen 20 Jahren verändert?
Marianne Artmann: Im Wesentlichen liegt sie immer bei 50 Minuten, also einer Schulstunde. Aber die ganze Zeit ist natürlich immer die Frage, kriege ich das Publikum oder nicht. Und das ist die Aufgabe der Künstler:innen. Ja, und Theater für junges Publikum muss sich immer mit dem Publikum beschäftigen!
KiJuKU: Abseits der künstlerischen Herausforderungen, fallen dir noch sonstige Veränderungen in diesen zwei Jahrzehnten ein?
Marianne Artmann: Ja, die technischen Herausforderungen sind extrem gewachsen. Vor 20 Jahren wurde zum Teil noch mit Videokassetten und CD gearbeitet. Die digitalen Möglichkeiten bringen eine tolle Qualität, haben aber auch die Kehrseite einer hohen Komplexität. Es sind nicht immer alle Systeme kompatibel. Und währen du bei einem Analogen Lichtpult eine Einschuldung von vielleicht einmal zehn Minuten hattest, erfordert die Beherrschung eines digitalen Pultes mitunter zwei Monate.
Und auf einer ganze anderen Ebene: Es ist viel, viel schwieriger, Medienvertreter:innen dazu zu bringen, sich ein Stück für Kinder oder / und Jugendliche anzuschauen und darüber eine Kritik zu schreiben, weil die Redaktionen immer weniger Journalist:innen haben.
KiJuKU: Deine Wünsche, Visionen für die nächsten 20 Jahre?
Marianne Artmann: Meine, unser aller Leidenschaft ist das Anliegen mit Theater dazu beitragen zu können, den Horizont von Kindern und Jugendlichen zu erweitern durch gutes Theater, Tanz und Performances. Ich wünsche mir, dass wir sowohl Publikum als auch Multiplikator:innen, vor allem Pädagog:innen mit unseren Stücken und Produktionen erreichen können. Und dass es uns noch mehr gelingt, die vorhandene Diversität der Gesellschaft auf und hinter der Bühne, also auch im Betrieb abzubilden, wie wir es mit der Next Generation und der digitalen Bühne hier am Haus versuchen.
An Themen gibt es darüber hinaus aber auch solche von zeitloser Relevanz wie Freundschaft, Fragen „wie wollen wir miteinander leben“ und heute vielleicht noch stärker als vorn 20 Jahren Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

KiJuKU: Try out! MAGMA und andere Formate oder auch die Theaterwerkstätten sind Teil der Nachwuchsförderung. Gab es da Veränderungen in den zwei Jahrzehnten?
Marianne Artmann: Das war von Anfang an wichtig, aber die Bühne 2, die mit ihrer flexiblen Publikumstribüne ursprünglich als Workshopraum gedacht war, wurde dann so oft von Produktionen bespielt, dass wir damit erst wirklich beginnen konnten mit der Erweiterung durch die Bühne 3 und die Studios ab 2013. Auch wenn erst Probebühne genannte Bühne 3 wieder schnell und oft zur Aufführungsbühne wurde.
KiJuKU: Du fühlst dich wohl und bist zufrieden mit deiner Rolle hier in diesen 20 Jahren?
Marianne Artmann: Es ist ein Privileg, im Dschungel Wien arbeiten zu dürfen!
KiJuKU: Danke für das anregende, intensive Gespräch.
Allein in den rund 3 ½ Jahren Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… sind mehr als drei Dutzend Berichte über Stücke, Performances und Workshops erschienen. Davor im Kinder-KURIER ein Vielfaches. Leider ist online davon nur mehr wenig abrufbar. Was gefunden wurde, ist ebenso wie die Beiträge aus KiJuKU.at hier in diesem PDF-Flipbook durchzublättern – auf Inhalt laden klicken; alternativ kann auch der QR-Code hier ge-scannt werden:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen
Bevor’s um den Dschungel selbst geht, wollte KiJuKU.at wissen: „Wie bist du selber zum Theater gekommen?
Marianne Artmann: In der achten Klassen war unsere Klasse (Gymnasium Wels) auf einer Exkursion im Linzer Landestheater. Dort konnten wir hinter die Kulissen blicken, eine Dramaturgin hat uns vieles erklärt. Da habe ich zum ersten Mal von diesem Beruf gehört. Ein Lehrer der Parallelklasse ist danach zu mir gekommen und hat gesagt: „Marianne du strahlst so!“ Von da an wollte ich diesen Beruf ergreifen. Und hab nach der Matura begonnen Theaterwissenschaften und Germanistik zu studieren – gegen ein bisschen Widerstände der Familie, die meinte, ich solle eher Lehramt studieren, das sei was Handfestes mit gesicherter Berufsperspektive.

KiJuKU: Und vom Studium in die Praxis, speziell im Bereich Kinder und Jugend – wie ging da der Weg?Marianne Artmann: Im Studium hielt Claudia Kaufmann-Freßner vom Burgtheater eine Lehrveranstaltung über Theater für junges Publikum. Da hab ich mich zum ersten Mal mit der Frage beschäftigt, was kann jungem Publikum zugemutet werden. In Erinnerung geblieben ist mir die Diskussion um das Stück „Mirad, ein Junge aus Bosnien“ vom niederländischen Theaterautor Ad de Bont (aus 1993).
In der Endphase des Studiums hatte ich mehrere Regie-Hospitanzen u.a. im Burgtheater. Dann hab ich mich auf eine Ausschreibung des Theaterfestivals Szene Bunte Wähne in Niederösterreich für die Festival-Dokumentation beworben – und wurde abgelehnt, habe aber weiter Kontakt zur Szene gehalten und durfte dann nach dem ersten Tanzfestival für junges Publikum 1998 Regie-Assistenz bei „Der Wolf und der Mond“, im Rahmen eines 3-Länder-Projekts mit Schweden und Dänemark machen. Elisabeth Orlowskyi hat die Choreografie und Jürgen Flügge die Regie für den Österreich-Part gemacht.

KiJuKU: Das war dann der endgültige Einstieg?
Marianne Artmann: Sozusagen, ich bin dann geblieben, musste im Jahr darauf fünf Wochen vor dem Festival, weil der Projektleiter abgesagt hatte, einspringen, hatte keine Erfahrung, aber hab es dann doch geschafft, alles zu organisieren. Da war ich aber eher für fast alle organisatorischen Dinge zuständig – von den Spielstätten über die Technik, die Unterkünfte, die Fahrer bis hin zu den Drucksorten.
KiJuKU: Aber nicht dein eigentliches Metier, oder?
Marianne Artmann: Aber schon danach kam ich zum Inhaltlichen, durfte Festivals besuchen, Produktionen vorschlagen – gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter, Stephan Rabl. Und als der dann zum Leiter des Dschungel Wien bestellt wurde, hat er mich gefragt, ein halbes Jahr später als Assistenz der künstlerischen Leitung hierher zu kommen.
KiJuKU: Aber noch nicht als Dramaturgin?
Marianne Artmann: Das kam dann 2006, also zwei Jahre nachdem der Dschungel 2004 den Betrieb aufgenommen hatte.

So manchen Umfragen oder „Studien“ zufolge würde das Interesse junger Menschen an Umweltthemen abnehmen. Beim jüngsten Jugend-Innovativ-Finale Ende Mai ebenso wie beim gleichzeitigen Finale des Bewerbs der Junior-Companies war eher das Gegenteil festzustellen. Egal in welcher Kategorie bei ersterem und beim zweitgenannten ebenso: Viele Projekte widmeten sich der Nachhaltigkeit. Und nun, am zweiten Tag des kinder literatur festivals im Wiener Odeon stellten Kinder aus sieben Klassen bei der Lesung von Melanie Laibl zu ihren Büchern „WErde wieder wunderbar. 9 Wünsche fürs Anthropozän“ und „Unsere wunderbare Werkstatt der Zukünfte. 99 Ideen fürs Anthropozän.“ nicht nur ihr großes Interesse an Umweltthemen unter Beweis.
Die Lesung im großen Saal mit seiner fantastischen Atmosphäre wurde eher zu einem Dialog der Autorin (Illustrationen: Corinna Jegelka) mit den Kindern – vor allem rund ums Wasser. Andauernd gingen immer mehrere Hände hoch, um etwas zu sagen, fragen, auf Fragen Antworten zu geben. Viel Wissen der jungen Besucher:innen. Bei manchen meinte sogar Laibl: „Da hab ich jetzt auch was gelernt!“ Und das obwohl sie sich für die beiden genannten Sachbücher laaaaange und intensivst mit möglichst Vielem beschäftigt hat, das wir Menschen der Erde antun, aber auch damit, wie wir Natur und Umwelt schützen und das Gleichgewicht wieder herstellen können.
Zum Abschluss spielte sie einen Song vor, für den sie sich aus dem südafrikanischen Kapstadt inspirieren hatte lassen. Weil Wasser dort knapp ist, hat die Stadt eine „Wasser-Ampel“ eingeführt. An Tagen, wo’s sehr knapp ist zeigt die Ampel gelb oder gar rot. Da sollte Wasser wirklich nur für das Allernotwenigste verwendet werden. Und um das gut zu verbreiten hatte die Stadt einen Bewerb für Songs ausgeschrieben, die nicht länger als zwei Minuten dauern sollten – nicht länger sollte geduscht werden. Und so hatte sich die Autorin für das erstgenannte Buch einen Duschsong ausgedacht – den Mia Heck, Hannah Sophie Heck und Walter Till musikalisch umgesetzt haben.
Das kinder literatur festival im Odeon Theater (Wien-Leopoldstadt; 2. Bezirk nahe dem Schwedenplatz) mit Lesungen, Workshops, Filme und natürlich Buchausstellung… läuft noch bis einschließlich 25. Juni 2024 – Details siehe Info-Box am Ende des Beitrages.

Acht Megafone stehen mit dem Schalltrichter auf dem Boden zwischen Bühnenrand und Publikumstribüne. Autoverkehrslärm aus dem Off, hupen inklusive. Sieben Kinder singen dagegen an „Schritte im Schnee“ von Sven Polenz. Spielen voraufgenommene Sager aus kleinen Lausprechern ein, die sie durch die Publikumsreihen tragen. Unterschiedliche Lieblingsgeräusche – Vogelgezwitscher, Regen auf Fensterscheiben, Schritte auf Kies… oder für manche vielleicht auch überraschend „Schulklingel“.

Irgendwann beginnen Lotte Burger, Onar Fabre, Maxim Gerginov, Matteo Lusher, Pauline Meitz, Emilia Reisinger-Bosse, Hannah Stangl, Sophie Szakasits, Franka Throm, Keara Li Rose Tromp zu flüstern und später werden sie dafür mega-laut. Dann wenn sie, die Teilnehmer:innen der Dschungel-Wien-Theaterwerkstatt „Mega-Verstärker“ sozusagen in die Stimme des Meeres schlüpfen. Wie es sich aufregt über die Verschmutzung nicht zuletzt durch Millionen Tonnen von Plastik.
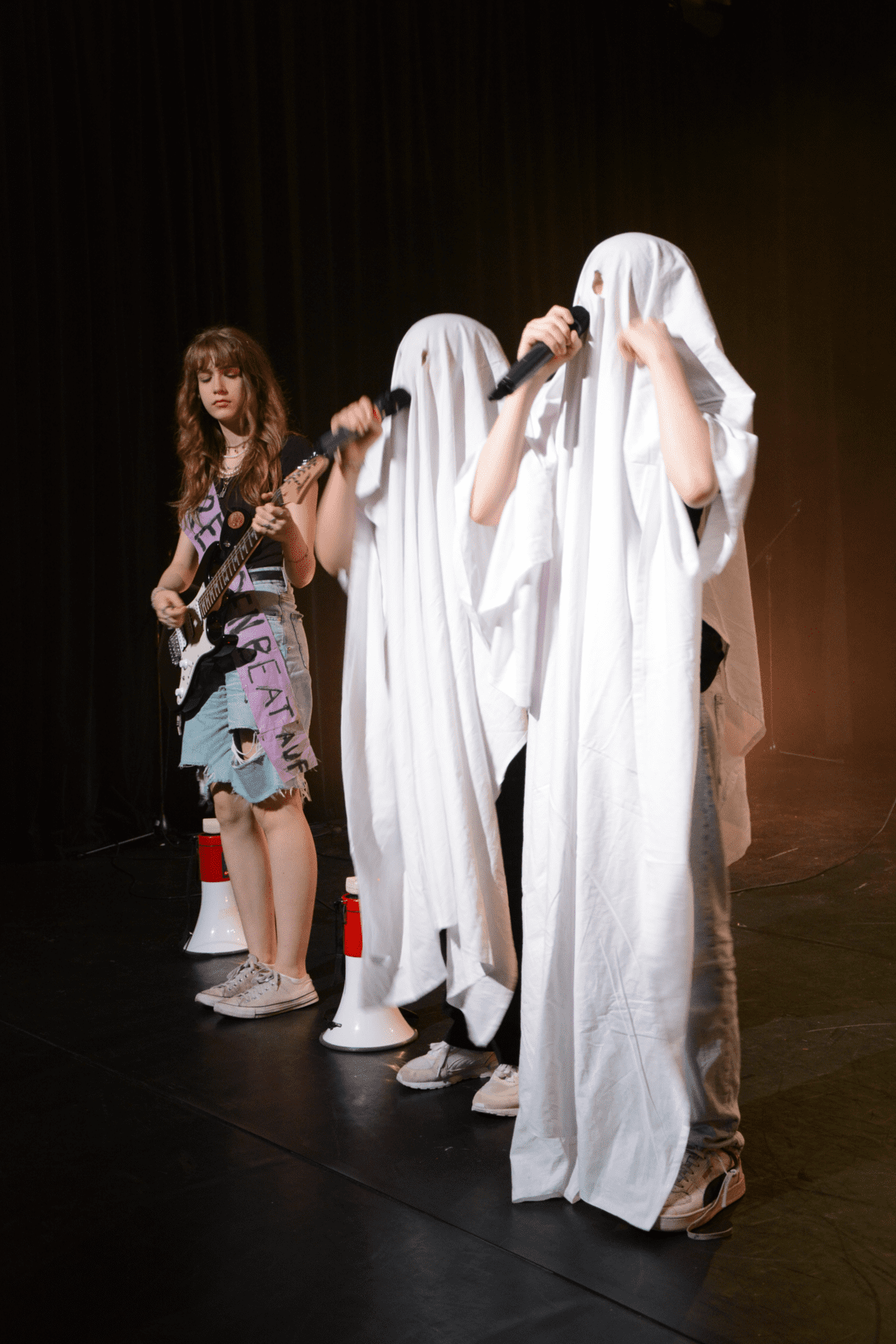
Die 11- bis 13-Jährigen haben in den vergangenen Monaten unter der Leitung von Sylvi Kretzschmar (Hospitanz: Emilie Reiter) ihre wichtigsten Anliegen verbalisiert und teils auch in Szenen umgesetzt – und schon zwei Mal Teile davon auch öffentlich präsentiert; Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat berichtet – Links unten am Ende des Beitrages.

Sie verklickern dem Publikum so manches das anders wäre, hätten Kinder das Sagen. Unter anderem gäbe es keine Kriege und Fußballplätze wären nicht aus Beton, sondern einfach Wiese.
Und wie wär’s, wenn Erwachsene ihnen zuhören würden, aber auch auf Tiere und Pflanzen achten. Und wie sollten sie als Kinder zuhören lernen, wenn sie’s viel zu selten bis nie erleben, dass ihnen und ihren Anliegen und Ansichten Gehör geschenkt wird.

Ausgelassenes fast ein wenig chaotisches Spiel auf der Bühne. Elf Kinder toben sich aus, haben ihren Spaß. Die einen laufen, verkleiden sich, andere spielen am Keyboard, auf E-Gitarren und am Schlagzeug. „Ältere Semester“ im Publikum erkennen eine der Melodien – neben Beethovens „Für Elise“ den antiautoritären Klassiker „We don’t need no Education“ aus der Rock-Oper „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd (Musik, Dramaturgie: Siruan Darbandi). Noch heute Sonntagnachmittag und Montagvormittag zu erleben.

Lola Kaja Cimesa, Lenz Eichenberg, Iris El Fehaid-Power, Sina Tobias Kananian, Sami Kiegleder, Lieselotte Leineweber, Cecilia Pail Valdés, Leo Schönwald, Thimo Temt, Ossian Trischler scheinen – wie Kinder oft im Spiel – in diesem versunken zu sein. Ganz bei sich. Da kommt eine Stimme aus der letzten Publikumsreihe. Mit versuchter Autorität „fragt“ Sasha Davydova, die künstlerische Leiterin dieser Theaterwerkstatt „The Future is in our Hands“ im Dschungel Wien, ob die Kinder auf der Bühne nicht vielleicht doch das tun könnten, was ausgemacht war.

Zwischen ja, doch irgendwie, wenngleich widerwillig und nein, sicher nicht samt bewusstem Widerspruch pendelt die halbe Stunde der Performance. Samt Vorwurf, auch belogen worden zu sein, als ihnen, den spielenden, performenden Kindern, erzählt wurde, dass im Kasino am Schwarzenbergplatz (eine Spielstätte des Burgtheaters), wo sie im März schon auf der Bühne waren, 200 Politiker:innen zugehört hätten. Dass an diesem Juni-Samstag auch Politiker:innen da wären, glauben sie aber dann doch – oder spielen glaubhaft, dass sie es meinen.

Vielleicht (zu) viele Regie-Anweisungen vermitteln den Eindruck, dass auch der gesamte Widerstand nur gespielt ist. Wenngleich in so manchen Momenten aufblitzt, dass die einen oder anderen doch auch das machen, wonach ihnen gerade der Sinn steht – also wirklich widerständisch. Wobei der starke Schluss-Satz: „Ihr dürft uns nicht vorschreiben, was wir zu wollen haben!“ aber wiederum schon ein eingelernter ist. Aber doch die Haltung der elf 7- bis 10-Jährigen ehrlich ausdrücken dürfte.

Sieben Frauen treten in Erscheinung. Alle Pädagoginnen – von Elementar- bis Nachmittagsbetreuung. Die eine oder andere vielleicht auch schon pensioniert. Wie auch immer, sie bilden Stehkreise, Reihen – nein, keine „Stirnreihe“, treten mal in den Vordergrund – einzelne oder mehrere, dann verschwinden sie sogar hinter einem Vorhang im Dunkel. Nur durch Lichtpunkte von Taschenlampen in den Fokus gerückt.

Die Performerinnen der Theaterwerkstatt „Vorhang auf: Forever Young?“ erzählen, hin und wieder spielen sie auch von Herausforderungen in ihrer alltäglichen Arbeit in Jahr(zehnt)en, Glücksmomenten, wo sie in der einen Schülerin, dem anderen Schüler „Feuer entfachen“ konnten. Von eigenen pädagogischen Ansprüchen und dem Kampf zur Um- und Durchsetzung derselben. Von der Unzufriedenheit mit dem und der Wut auf das einschränkende System, die Ignoranz von Bildungspolitik.

Sie spielen und reden aber auch vom eigenen Scheitern. Sowie von etwas, das unser Bildungssystem fast gar nicht kennt: Den Mut, Fehler machen zu dürfen – und das auch Kindern und Jugendlichen beizubringen. Und von dem, was vielleicht noch wichtiger ist, als Wissen zu vermitteln, Herzensbildung zu verbreiten. Und sie vermitteln, dass jahr(zehnte)lange Arbeit mit Kindern und Jugendlichen durchaus jung hält – und den Titel ihrer Theaterwerkstatt im Dschungel Wien rechtfertigt.

Wenngleich auch diese – wie in diesem Jahr viele der Werkstatt-Performances – mehr pädagogisch als theatral ausgefallen ist. Und diese im Speziellen am Ende von einer Schwäche vieler Pädagog:innen gekennzeichnet ist: Nicht auf das schon Erzählte, Gezeigte zu vertrauen; sondern noch einmal und immer wieder fast wie mit erhobenem Zeigefinger zu verklickern, was da jetzt an Botschaft transportiert werden soll(te).

Übrigens – da einige Stimmen aus dem Off kommen – wäre das Einholen von Stimmen von Schüler:innen nicht gerade schlecht gewesen;)
Diese Werkstatt-Präsentation gab’s nur ein Mal. Schade.

Wem gehört die Bühne? Was wird im Theater gespielt? Welche Themen verhandelt? Wer tritt auf? Wessen Geschichten kommen vor? Welche Formen? Viele dieser und weitere Fragen spielen große, ja die zentralen Rollen in der Arbeit vor allem einer der Theaterwerkstätten im Dschungel Wien, jener unter dem Titel „404 Error: Theater – Reset old Stage“, die zum Auftakt des Festivals der Werkstätten (Freitag, 7. Juni 2024) schon ihre ½-stündige Performance zeigte – einen Mix aus Schauspiel, Rap, (Kreide-)Zeichnungen und Tanz dazu. Und nochmals am frühen Abend des EU-Wahlsonntags zu erleben sein wird.

Unter der künstlerischen Leitung von Myassa Kraitt und Emily Chychy Joost rissen die „Hybrid Rebels + Gl!tch4-Team + Princess Njoku, Stella Biziyaremye, Laura Asemota, Nathalie Kinard Torres, Elias Nwankwo, Elnara Türhan, Maggie Alghraibawi“ mit und veranlassten das Publikum aber immer wieder auch zu einem nachdenklichen Innehalten – Letzteres vor allem durch aufgeworfene in den Raum – ans Publikum ebenso wie an Verantwortliche – gestellte Fragen. Wenn es etwa – in verteilten Rollen – hieß: „Meine Diagnose ans Theater: Ein nicht enden wollendes Drama, eine Tragödie, … Ein Theater, das glaubt zu wissen, was es tut, letztendlich nur Farbkleckse auf einem Programmblatt verkauft, für uns wirken sie wie Verschmutzungen unseres Bildes…
Schon die Biographie des Theaters beginnt mit Exklusion, die Bühne … für wenige … was ist das für ein arrogantes Gehabe. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr eure Arbeit geleistet habt, in dem ihr ein paar diverse Gesichter inkludiert.

Inklusion und Diversität das sind eh nur Passwörter für euch. Wo spiegelt sich das allerdings wider in eurer Struktur? Welche Themen werden gefördert, welchen Stimmen wird Gehör geboten, welchen Perspektiven gebt ihr Raum?
Oder seid’s ihr nur hier, um euch zu wundern? Und über uns zu staunen, sind wir nur Geschichten, die der Unterhaltung dienen?
Es ist an der Zeit, dass das Theater seine eigene Tragödie erkennt und beginnt, echte Veränderungen zu vollziehen, denn sonst bleibt nur eine leere Hülle die es selbst bewundert, während die Welt um sie herum gezwungen wird, andere Wege einzuschlagen…“
Wobei zwar die Mitwirkenden sehr divers sind, der Inklusion jedoch mit einem Bühnenpodest mit ziemlich steilen Stufen auch sichtbare Grenzen setzen – denn wie käme da etwa eine performende Person im Rollstuhl hinauf?

Kinder kommen mit bunten Zetteln auf Hoodies und Hosen mit Schriftzügen, manche tragen Megaphone, andere Stoffbanner. Diese entrollen sie auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Wiener MuseumsQuartier. Ein Pulk älterer Frauen mit bunten selbst gestrickten Hauben kommt die Mariahilfer Straße runter, spannt weiße Schirme auf – Omas gegen rechts ist dort größer noch zu lesen als auf vielen ihrer Sticker, die sie an Kleidungsstücken tragen.

Neben der Losung, die hier als Überschrift verwendet wurde und die auf einem Lila-farbenen Transparent zu lesen war, entrollten die Kinder auf einem grünen Stoff den Schriftzug „Das Meer hat keine Stimme. Wer vertritt das Meer?“. Ein orange-farbiges Bann ziert die Frage „Können Bienen im Parlament abstimmen?“
Kinder, Jugendliche und die „Omas“ nutzen den Welttag des Theaters für junges Publikum (20. März) um einige ihrer Anliegen zu Gehör zu bringen – mehr dazu zu hören und zu sehen im verlinkten Video.
Bei der Gelegenheit wurde auch darauf hingewiesen, dass mehr davon am Samstag (23. März 2024) im Kasino am Schwarzenbergplatz zu sehen, hören und erleben ist.
Kinder und Jugendlichen erarbeite(t)en ihre Visionen, Forderungen und Kritikpunkte in Workshops im Dschungel Wien, der hier in dieser Ecke des MuseumsQuartiers residiert, in Zusammenarbeit mit dem Burgtheater Studio. Und sie werden die nächsten Wochen und Monate noch weiter daran arbeiten und theatrale Performances im Juni hier beim Festival der Theater-Werkstätten (ab 8. Juni 2024) zeigen.
Am besagten 23. März 2024 ist außerdem ein Theaterprojekt von Ukrainer:innen und Österreicher:innen – „Menschen in Wien“ zu sehen – Details zum Programm unten in der Info-Box.

Unbeschwert, voller Leichtigkeit spielen sich die drei Tänzer durch den Raum und mit ihren Papierfliegern. Da sind Petr Nedbal, Emanuel Rüfenacht und Flamur Shabanaj sehr junge Buben, einfach Kinder, die (noch) nicht auf Rollen fixiert, in Schubladen gesteckt, wurden. Doch damit ist’s recht bald vorbei.
Schnell und stark sein, obendrein immer mehr und besser als die anderen… – Konkurrenz als patriarchalisches Prinzip noch immer mit Männlichkeit engstens verbunden. Und das trotz jahrzehntelanger intensiver Diskussionen, in mehreren Wellen erstarkter Frauenbewegung und davon ausgelöst doch auch Debatten um neue Männerbilder, insgesamt Rollen jenseits altbackener Klischees…

Kollektiv F Bern ließ sich von dem Buch „Sei kein Mann“ von JJ Bola für das jüngste Stück inspirieren. Unter dem selben Titel zeigte es das Tanzstück am Abend des internationalen Frauentages beim „jungspund“ Theaterfestival für junges Publikum. Der (lyrische) Schriftsteller in Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) geboren und ab seinem 6. Lebensjahr in London aufgewachsen, arbeitete nach seinem Masterabschluss in Kreativem Schreiben einige Jahre als Sozialarbeiter für Jugendliche mit psychischen Problemen. Doch schon als Jugendlicher hatte er sich in Tagebüchern und Gedichten mit männlichen Rollen-Zuschreibungen auseinandergesetzt.
Von dem 2019 (auf Deutsch ein Jahr später) erschienenen Buch ausgehend, arbeitete Kollektiv F Bern einerseits mit Jugendlichen in der eigenen Stadt und andererseits mit den drei Tänzern an der Verarbeitung eigener Erfahrungen sowie deren Reflexionen. Konzept, Recherche und Vermittlung stammen von Luzius Engel, die Choreografie von Vanessa Cook. Luz Gonzàlez als Live-Musikerin im seitlichen Bühnen-Vordergrund treibt sozusagen das Tanz-Geschehen an. Mirjam Berger steuerte nicht nur das Lichtkonzept zur rund einstündigen Performance bei, sondern agiert ebenfalls seitlich im Vordergrund der Bühne und setzt den jeweiligen Fokus.
Das Tanz-Trio „erinnert“ sich teils an eigene Jugend-Szenen, so bekennt einer sich schuldig, gegenüber seiner Schwester bevorzugt worden zu sein…

Me Culpa, Konkurrenz und Kampf, Reflexionen, Versprechen zur Besserung, Ansätze diese auch im Umgang miteinander zu versuchen… – noch immer ein Minderheitenprogramm. Vielleicht aber auch nicht der ideale Ansatz, um Jungs oder Männer zu einem Umdenken bzw. noch wichtiger einer Änderung von Verhalten zu bewegen?
Möglicherweise ist schon der Titel nicht ideal, lautet die wörtliche Übersetzung des englischen Originals doch „Maske ab: Männlichkeit neu definiert“, und selbst der deutsche Untertitel (Übersetzung: Malcolm Ohanwe) gibt weit mehr her als der Stück- und Buchtitel, nämlich „Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist“.
Und das ist vor allem JJ Bolas Ansatz, eigenes Erleben, Erkenntnis in der Arbeit mit männlichen Jugendlichen und der Tenor des Buches: Klassisch männliche Rollenbilder als gewaltige Einschränkung für Buben und Männer – kaum bis keine Gefühle zulassen dürfen … – das kommt in so manchen der Szenen zwar ansatzweise vor – aber insgesamt wirkt die Performance ein wenig stark pädagogisch durchzogen von erhobenem Zeigefinger.
Da hätte wenigstens ein Spur vom Zugang zur „Greulichen Griselda“ des Vorstadttheaters Basel ganz gut getan – Rollenklischees mit einem kräftigen Schuss Humor zu durchbrechen und damit in Frage zu stellen.

Wobei es auch einen kulturell eingeschränkten Blick gibt, verblüfft doch Bola in seinem Buch schon im Vorwort mit folgender Frage, die er aus eigenen Erfahrungen ableitete: „Wie konnte es sein, dass es in einem Teil der Welt völlig normal war, wenn zwei Männer sich an den Händen hielten, während die Menschen in einem anderen Teil der Welt stehen blieben und starrten?“
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.


In die Schlussphase des diesjährigen (vierten) „jungspund“ Theaterfestivals für junges Publikum im Schweizer St. Gallen fiel der internationale Frauentag am 8. März. Den fulminanten Schluss- und für viele sogar Höhepunkt setzte anderntags „Greuliche Griselda“ vom Vorstadttheater Basel. Ausgehend von dem Bilderbuch gleichen Namens von Edna Mitchell Preston (1973) entwickelten Regisseurin (Gina Durler) und Spieler:innen gemeinsam eine lustvolle und spielfreudige Version dieser „greulichen“ Variante einer Art Pippi Langstrumpf, also eines bärinnenstarken Mädchens – und einer ebenfalls sehr selbstbewussten schrägen Tante. Etliche Stücke beim Festival thematisierten andere Buben- und Männerbilder – alle von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… besprochenen Stücke am Ende des Beitrages verlinkt, „Sei kann Mann“, das direkt am Abend des Frauentages getanzt wurde, folgt erst noch.

Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Da können die Eltern noch so bemüht, liebevoll sein und versuchen, auf die Wünsche der Tochter einzugehen. „Bääääh! Sicher nicht!“ schallt es ihnen entgegen. Viel mehr noch als Ohnmacht und Verzweiflung bereitet ihnen Sorge, dass die reiche Tante des Vaters, nach der sie aus Erbschleicher-Gründen ihre Tochter benannt haben, sei enterben könnte. Da wollen sie Vanillje, das nette Mädchen aus der Nachbarschaft, beim Tante-Besuch als ihr eigenes Kind ausgeben. Doch die durchschaut den Trick und will die echte junge (Namens-)Großnichte sehen. Und genau deren aufmüpfiges, freches, unbekümmertes Wesen gefällt ihr – sehr sogar!

Erst aus der Not der abhanden gekommenen Schauspielerin geboren, wie Dramaturgin und Produktionsleiterin Ronja Rinderknecht im Inszenierungsgespräch verriet, erwies sich die Entscheidung die junge Griselda mit einer Puppe (erstmals in dieser Theatergruppe) zu besetzen als absoluter Glücksgriff. In ihrem auf hässlich designten, gleichzeitig große Sympathie ausstrahlenden Gesicht (Puppenbau und -spiel: Priska Praxmarer) be- und verzaubert sie das Publikum, zumindest den Großteil 😉 Außerdem kann sie als Puppe Dinge, die eine menschliche Spielerin nicht so leicht zustande brächte – etwa auf einem Luster turnen.
Praxmarer, die die Puppe führt, schlüpft anfangs in die Rolle einer Bediensteten in Livree. Ihr Partner als „Personal“ ist Tobias Schulze, der allerdings vor allem in der Rolle der Tante Griselda auf andere Art aber doch „griseldisch“ wirkt.
Den Reiz dieser nicht ganz 1 ¼-stündigen Produktion macht nicht zuletzt das bewusst disharmonische und doch in seiner Spielfreude harmonische Ensemble aus. Neben den schon Genannten agieren Bea Nichele-Wiggli als liebe- wie verständnisvolle, aber doch verzweifelte Mutter ebenso wie Florian Müller-Morun als gleichwertiger Vater – mit kleinen doch eher klischeehaft zugeordneten Tätigkeiten. Beide schlüpfen aber noch in andere Rollen. Sie wird zur lieblichen, oberg‘scheiten, superbraven Vanillje. Er verschwindet in einem Fell, das zu Beginn ein Mammut im Museum, später einen Teppich „spielt“ und schließlich zu einem Monster namens Gruselfies wird, pardon Griselfuß wie Griselda es gezähmt nennt.
Abgerundet wird diese Inszenierung nicht zuletzt durch die Bühne (Fabian Nichele), auf der die meisten Einrichtungsgegenstände zunächst irgendwo weit oben unter der Decke hängen, von den Spieler:innen im Bedarfsfall per Seilzug heruntergeholt und auch wieder nach oben verfrachtet werden. Ebenso überzeugen die jeweiligen Kostüme (Benjamin Burgunder).
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.


„Ich gump hüt vom grosse Schprungbrätt!“ – auf Hoch- oder Standarddeutsch „ich spinge heute vom großen Sprungbrett!“ Und zwar von 3 Metern. Darum dreht sich das knapp mehr als ¾-stündige Tanzstück.
Eine Schülerin – ziemlich einsam auf dem Spielfeld. Zwölf große Kunststoff-Kanister mit jeweils rund einem Fünftel Wasser befüllt, eine Kreide und ein Handtuch. Mit den beiden Objekten „zaubert“ sie Licht bzw. Musik herbei. Ansonsten sind kurzzeitig – aus dem Off – Kinderstimmen zu hören, wen sie jeweils für ein Teamspiel wählen; viele Namen fallen. „Natürlich“ bleibt unsere Protagonistin als Allerletzte übrig.

Und wie Tina Beyeler (Tanz und Choreografie) tänzerisch, von der Körperhaltung und mimisch agiert, sicher nicht zum ersten Mal, wahrscheinlich immer wieder.
Denen wird sie’s zeigen – und sie tätigt den oben zitierten Spruch in einem der Deutsch-Schweizer Dialekte in „Spring doch“ von Kumpane Schaffhausen (Text, künstlerische Mitarbeit: Andri Beyeler; Komposition: Sandro Corbat). Zum ersten Mal fährt sie, die offenbar sehr jung ist, allein mit dem Bus. Ziel: Schwimmbad.

Aber so easy ist das alles doch nicht. Da schwingen ganz schön viel Bammel, Angst und Zweifel mit – neben dem Trotz und Mut. Und genau dieses Hin und Her lässt die Tänzerin – in ihren teils akrobatischen Bewegungen – ob mit oder ohne die Objekte, vor allem die genannten 12 Kanister spüren, miterleben – wenngleich es vor allem jüngeren Kindern ein wenig zu lang wurde bei der Aufführung im Rahmen von „jungspund“, dem Theaterfestival für junges Publikum in der Lok-Remise von St. Gallen (Schweiz).

Ein wenig erinnert die Geschichte an das Bilderbuch von Heinz Janisch (Illustration: Ingrid Godon; Verlag: Bloomsbury K & J), das vor elf Jahren mit Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden ist.
Rita, ein Mädchen mit roter Badekappe, schickt sich an, vom 3-Meter-Brett zu springen. Schaut hinunter. Lange. Kehrt dann aber um, und steigt die Leiter hinunter – zum 1-Meter-Brett. Doch auch da springt sie nicht. Was ein Junge im Schwimmbad lautstark mit „Feigling“ kommentierte.
„Fische springen nicht von Türmen“, konterte Rita schlagfertig, schwamm davon und tauchte dazwischen. Das beeindruckte einen anderen Jungen, der am Beckenrand saß und überlegt hatte, welch beeindruckende Dinge und Menschen er schon in seinem Leben gesehen hatte. Doch nichts von dem, das vor seinem geistigen Auge dahinhuschte reichte an diesen Mut Ritas heran!
In „Spring doch“ endet die Geschichte dann doch anders – das sei aber nicht gespoilert.
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.


„Erde, wie geht’s dir?“ fragen Nora Vonder Mühll & Stefan Colombo (Theater Sgaramusch) die Kugel, die sie an einem langen von der Decke baumelnden Seil aufgehängt haben. Zuvor haben sie per Schnur und Kreide einen großen Kreis auf den Boden gezeichnet, aus einer Tasche verschieden große Bälle und so manch anderes Zeugs herausgeholt – ein Universum „erschaffen“. In und mit diesem spielen sie in „Urknall“. Das heißt eigentlich zeigten sie nur zehn Minuten daraus. „Schaufenster“ nennt sich das Format, das am „jungspund“-Abschlusstag des Theaterfestivals für junges Publikum im Schweizer St. Gallen einen Einblick in aktuelle – teils erst entstehende – Produktionen für Kinder bzw. Jugendliche geben will.

Ebenfalls – aber auf ganz andere Art und Weise laden Bharathi Mayandi Franaszek, Stephanie Müller, Matthias Nüesch von pulp.ooo auf eine Zeitreise zum Beginn wenigstens des Lebens auf der Erde ein: „Wir sind dann mal weg“ ist ein Wechselspiel zwischen menschlichen Schauspieler:innen, Figuren und der Zeitmaschine Solveig, einer Art Licht-Puppe, sowie physikalischen Experimenten mit Wasser, flüssigem Stickstoff und vielem mehr (Letzteres bei der Präsentation als Video-Einspielungen). Und der Titel deutet an, dass vielleicht auch die Frage verhandelt wird, wieweit die Menschheit mit ihrem Tun oder Unterlassen an ihrer eigenen Abschaffung und der so manch anderer Arten arbeitet.

Sehr großen Anklang fand die Performance von Annina Mosimann über das Zusammenleben von anfangs nur als Hände oder Füße auftauchenden menschlichen Körperteilen aus kleinen Klappen einer großen senkrecht aufgestellten Kiste mit Tieren wie einer Fliege, Ratte, Spinne usw. und dazu noch der Bedienung einer Loopstation und eines kleinen Tasteninstruments. „Bestiarium – Varieté der vergessenen Tiere“, nennt sie ihre Show.

An Beppo, den Straßenkehrer in Michael Endes Momo, erinnert der erste Moment in „Echo, Echo“ von theater salto&mortale. Doch hier geht’s um das Zusammenleben in einem abgeschiedenen Dorf – und das als „Eindringen“ empfundene Auftauchen eines Fremden sowie um Warnungen der Raben vor einem drohenden Bergrutsch – und das nicht-zuhören der Einheimischen.

Apropos Aufkehren und Putzen – in „Giraffenblues“ (kuckuck-Produktion) entert ein Reinigungstrupp das Museum (entstanden in Kooperation mit dem Zoologischen Museum der Universität Zürich) oder den jeweiligen Spielort. Eigentlich sollte hier ein Theaterstück stattfinden, aber… – ein Trick, den so manche Theatergruppe schon angewandt hat: Die Putzbrigade spielt einfach ein, nein DAS Stück. Und dieses nimmt Anleihe bei einer wahren Begebenheit: 1935 wurde eine in Giraffe damals in Tanganjika (heute Region zwischen Tanzania und Kenia) gefangen und in die Schweiz transportiert, wo sie in den Züricher Tiergarten kam.
„Giraffenblues“ (Regie: Roger Nydegger) rückt allerdings den Einreiseversuch unter die Lupe: Giraffe keein Problem, die lassen Mira Frehner und Andreas Peter als Grenzbeamt:innen durch. Doch den menschlichen Begleiter und Betreuer Mokassa, gespielt von Robert Achille Gwem, den wollen sie nicht reinlassen. Was vielleicht heute nicht viel anders sein könnte, oder?!

Natürlich spielen Themen wie Umgang mit Social media, Influencer:innen-(Möchtegern-)Dasein usw. in so manchen Stücken eine wichtige Rolle. Red von Merge Dance Collective ist so ein (Tanz-)Stück – noch dazu mit viel Humor. Linda Heller & Audrey Wagner tauchen in typische TikTok-Posen ein: Zack, Boom, Bäm – 100.000 Follower – oder doch nicht. Nein, wir sind doch ganz anders, wir sind ehrlich, authentisch und so weiter – oder auch das wiederum nur ein Marketing-Gag?

Noch krasser – selbstironisch und doch fast nichts anders als die Wirklichkeit so mancher TV- und Online-Shows aufnehmend, agiert Linda Hügel (Text: Fiona Schreier; Regie: Johanna Benrath) in „Das ist die Moral der Geschichte, Liebling“ (netzwerk wildi blaatere). Erst mit Riiiiesen-Mikro über die Auflösung der Moral philosophierend, wandelt sie sich zur Show-Masterin, die das Publikum auf Teufel-komm-raus animiert – und manipuliert.

Auf ganz andere Art animiert Nadja Rui als Kind Ira das Publikum – durch die Reihen spazierend, einzelne Zuschauer:innen ansprechend verwandelt sie diese beispielsweise abwechselnd vor allem in ihren Opa. „Unter Drachen“ (Text: Hanna Röhrich; Regie: Patricija Bronić) ist eigentlöich konzipiert, um in einem eigenen großen Kuppel-Zelt gespielt zu werden – auf engem Raum mit dem Publikum. Und es geht um den Tod des Großvaters bzw. die Erinnerung an ihn und seine nach und nach verloren gegangenen Erinnerungen als er noch gelebt hat.

Um (analoges) Mobbing, vor allem im Zusammenhang mit dem Vertrauensbruch einer engen Freundin dreht sich „Die Geschichte von Lena“ (Theater Spielfeld/theater fabula!), gespielt von Lisa Gartmann und Eliane Blumer.

Den humorvollen Abschluss des Schaufensters – die echte Reihenfolge unten im Info-Block (nicht hier in diesem Beitrag) performten (abwechselnd Tanz und Sprache) Lucia Gugerli und Christophe Rath von der Cie Nicole Seiler, von der auch das Konzept und die Choreografie stammt. „Encyclopedia“ versteht sich als eine solche – von Gesten, Begriffen und Bezeichnungen. So wird die eine zum Strich, Winkel, einer Statue, gleich danach zu einer gestürzten Statue, der andere zum Äffchen, einem Disco-Move on repeat, einem Hochhaus und Godzilla, der ein solches zerstört…
Follow@kiJuKUheinz
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.

Der Solist, Darsteller des 15-Jährigen Protagonisten Benni, switcht in Sekundenschnelle in die Rollen seines strengen, auf Militärdrill programmierten Vaters, der überfürsorglichen Gluckhennen-Mutter ebenso wie in die des von ihm zunächst angehimmelten Stars, des Musikers Fögi. Gleich nach dem mittlerweile Rolling-Stones-urgesteins Mick Jagger siedelt er ihn an. Und es wird mehr daraus – eine Beziehung – anfangs von beiden Seiten auf Liebe aufgebaut.
„Souhung“ heißt das Stück, das beim „jungspund“-Festival für junges Publikum in der Lok-Remise von St. Gallen (Schweiz) zu sehen war. Es basiert auf dem Roman „ter fögi ische souhung“ von Martin Frank. Im Jahr 1979 als er ihn veröffentlichte, wollte ihn kein Verlag drucken, zu skandalträchtig schien die Liebesgeschichte eines schwulen Paares. Die doch mehr als problematische Konstellation eines Jugendlichen mit einem Mitt-20-Jährigen schien weniger Thema gewesen zu sein. So publizierte der Autor damals im Eigenverlag – übriggebliebene Originalausgaben gibt’s rund um die Vorstellungen. Im Vorjahr veröffentlichte der Menschenversand Verlag das Buch neu.

„Wär meint sig wohr ische spinnsiech, s’isch aus erfunge.“ Dies ist eines der Zitate aus „Souhung“ – in der Originalsprache. Der schon genannte Spielort ist ein Hinweis – doch kein hinreichender. Der Satz – und all die anderen im Stück ebenso wie in dem Roman, auf dem es basiert – ist in Bern-Deutsch. Es handelt sich um einen der vielen, teils sehr unterschiedlichen Dialekte des schweizerischen Deutsch. Schwyzerdütsch wird von vielen als Begriff rundweg abgelehnt: „Das gibt es nicht, es gibt nur die verschiedenen regionalen Deutsch-Varianten, Hoch- oder Standard-Deutsch empfinden viele als die erste Fremdsprache, die sie mit Schuleintritt lernen.
Die Originalsprache war ein wichtiges Element für den Schauspieler Max Gnant, um dieses Stück mit der vanderbolten.production Zürich zu verwirklichen (Regie, Dramaturgie: Maria Rebecca Sautter, David Koch). Noch wichtiger aber war ihm die Story und wie sich der Autor in die Gefühlswelt eines Heranwachsenden, seine Ängste, Zweifel, Ausbruchsversuche aus den elterlichen und gesellschaftlichen Vorgaben hineindenken konnte. Durchaus auch die fast anarchistische Scheiß-dir-Nix-Sprache, die die Grundstimmung unterstreicht – auch wenn des Berndeutschen nicht mächtige Zuschauer:innen wie der Rezensent von dieser bestenfalls etwas erahnen konnte 😉

Im stark tänzerischen, teils sogar akrobatischen Schauspiel verkörpert Gnant zunächst einen verschlossenen, fast verstockten Jungen, der in Liebe – allen Anfeindungen zum Trotz – aufblüht und dann doch an der toxisch werdenden Beziehung zerbricht. Machtgefälle zwischen Star und Anhimmler einerseits, der Altersunterschied spielt dann doch eine Rolle. Aber auch der ständige Drogenkonsum, die Suche nach Sinn und Leben-wollen des Jungen (mittlerweile 17 Jahre) auf der einen und das „es hat eh alles keinen Sinn“ des zehn Jahre Älteren endet tödlich – für Letzteren. Und der nunmehrige Leere Bennis.
Das alles spielt sich in einer dichten Stunde voller Emotionen auf einer aus mehreren flexiblen Elementen ständig veränderbaren Bühne (Szenografie, Bühnenbau: Lea Niedermann) ab – und ist nicht vor fast einem halben Jahrhundert angesiedelt. Über die konkrete Story hinaus vermittelt das Schauspiel und die Inszenierung durchaus zeitlos und von handelnden Personen und Konstellationen unabhängig hautnah Suche nach Anerkennung und Liebe einerseits und die Qualen von Beziehungen mit Machtgefälle.
Ach, übrigens der oben zitierte Satz – aus dem Stück – „Wär meint sig wohr ische spinnsiech, s’isch aus erfunge“ – bedeutet übersetzt: „Wer meint, es sei wahr gewesen, spinnt, es ist alles erfunden.“
PS: Im Vorjahr erschien in Deutschland ein zwischenzeitlich auch gehypter Roman unter dem Titel „Sauhund“. Geständnis: Kenne ihn (noch) nicht, aber Sätze des Verlags (Hanser) über Lion Christs Debütroman machen schon stutzig: „München, 1983. Flori kommt vom Land und sucht das pralle Leben, Glanz und Gloria, einen Mann, der ihn mindestens ewig liebt. Er ist ein unverbesserlicher Glückssucher und Taugenichts, ein Sauhund und Optimist. … und so weiter“ Da erinnert doch so manches vom Plot her an Martin Franks „ter fögi ische souhung“;(
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.

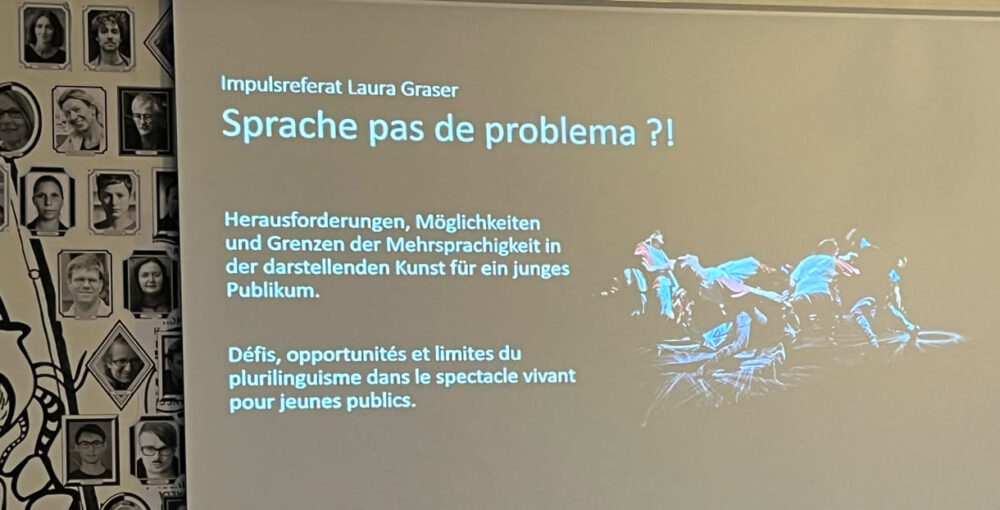
Die Schweiz – auf den ersten Blick und in vielen Köpfen wohl DAS Land der Vielsprachigkeit in Europa. Französisch, Italiens und Rätoromanisch (wobei es da mehrere Sprachen gibt) neben Deutsch – und letzteres vor allem in verschiedenen Dialektausprägungen. „Hochdeutsch ist für viele im deutschsprachigen Teil des Landes die erste Fremdsprache“, sagte ein Teilnehmer des Symposiums „Theater für junges Publikum in einem vielsprachigen Land“. Dies fand am vorletzten Tag des Festivals „jungspund“ (nicht nur) für junges Publikum statt.
Aber ist es wirklich so? Die verschiedenen Sprachen in der Schweiz seien eher strikt getrennt, voneinander abgegrenzt. Zweisprachige (Deutsch und Französisch) Städte und Orte wie Biel würden beispielsweise von St. Gallen aus „exotisch“ betrachtet und „Röschti-Graben“ wäre tatsächlich eine Art Graben zwischen Landesteilen unterschiedlicher Sprachen (die selben zwei) tönte es mehrfach.
Und so holten sich die Organisationen – neben dem Festival noch die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur in Kooperation mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Uni Bern und die Pädagogische Hochschule St. Gallen – zum interessanten Eröffnungsvortrag eine führende Mitarbeiterin von Rotondes: aus Luxemburg. Sie ist in dieser ehemaligen Lok-Remise – eine solche ist auch in St. Gallen Hauptspielort des genannten Festivals – für die Sparten Bühnenkunst und partizipative Projekte zuständig.
Luxemburgisch, Deutsch und Französisch seien überall im Land allgegenwärtig, auch in der Schule präsent, wenngleich da und dort die eine oder die andere Sprache dominiere. Mit Englisch sei eine vierte Sprache weit verbreitet, außerdem würden Erst- oder Muttersprachen mittlerweile auch gefördert. Die Hälfte er Bevölkerung komme aus anderen Ländern, in der Stadt Luxemburg sogar mehr als zwei Drittel (70%). Diese Vielsprachigkeit und Multikulturalität werde gelebt und gefördert, dennoch achte sie bei der Progammierung darauf, immer wieder auch Produktionen ohne Worte einzuladen, um gar keine sprachlichen Barrieren aufkommen zu lassen. Inklusion und sprachliche Brücken seien sozusagen die Zauberwörter, weshalb sie auch „Sprache pas de Problema?!“ zum Titel ihres Referats wählte – das sich Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auch für diesen Beitrag ausgeborgt hat. Sie selbst habe sich dazu vom Slogan des Export/Import-Kulturfestivals im belgischen Brüssel (von La Montagen Magique und Bronks) inspirieren lassen „Language – no problem!“
Zurück zur Schweiz: Dabei hat diese nicht nur vier verschiedene Landessprachen, sondern eine Pionierin der Förderung von Mehr- und Vielsprachigkeit im elementarpädagogischen Bereich. Silvia Hüsler begann selber als Kindergärtnerin vor Jahrzehnten Kinder zu bitten, Gedichte, Lieder und Geschichten aus ihren Herkunftssprachen mitzubringen. Vor allem Reime sind immer für praktisch alle Kinder spannend – oft egal in welcher Sprache. Seit „ewig“ veröffentlicht sie mehrsprachige Bilderbücher – zuletzt hat KiJuKU „Besuch vom kleinen Wolf“ besprochen – im Buch sind acht Sprachen versammelt – über die Website kann der Text in weiteren fast zwei Dutzend Sprachen downgeloadet werden.
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.

Künstlerisch verspielte Gebilde erinnern an eine Art von Zahn-, andere an Spinnräder. In Sonnenstrahlen- und anderen Formen, teils aus bunt bemalten Holzstäben sind sie neben dem Schriftzug des Festivals vor der „Lok-Remise“ angebracht. Mit Schnüren verbunden lassen sie sich an zwei verschiedenen Kurbeln zum Drehen bringen. Andere stehen in dem Halbrund der einstigen Garage für Lokomotiven.
Seit vielen Jahren beherbergt die Lok-Remise gleich neben dem Bahnhof St. Gallen (Ost-Schweiz) Zwei Theater- bzw. Veranstaltungssäle, ein Kino, einen Restaurantbetrieb. Dort gehen die meisten der Stücke beim vierten „jungspund“-Festival (nicht nur) für Kinder und Jugendliche über die Bühnen.
Die hölzernen Installationen stammen vom „Kollektiv hochhinaus“. Bei der vorigen Ausgabe, zu der Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ebenfalls für einige Tage eingeladen war, werkten Künstler:innen des Kollektivs an einem (Leucht-)Turm und luden Besucher:innen dazu ein, mitzubauen. Dieses Mal nennen sie ihr Werk „Drehereien“ und baute dafür die eingangs getriebenen „Maschinen“-Teile.
An einem Tag – Pech, es war jener an dem es schneite – durften Besucher:innen aus Holz und Schrauben bzw. Nägel „Roboter“ bauen. Die beiden Buben Liam und Joel ließen sich von dem nicht einladenden Wetter nicht abhalten, unter einer Zeltplane erfreuten sie sich daran, mit echtem, ungehobeltem Holz zu arbeiten und mit einem Akku-Schrauber Leisten zusammenzubauen. Beide verraten, dass „wir gerne basteln, aber bisher nur mit Papier oder Karton. Das hier ist das erste Mal mit Holz und richtigem Werkzeug.“
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.

Vor der Garderobe mit einigen Jacken und Kappen treffen sie zufällig aufeinander. Robert Suter, der lieber nur Robi heißt. Wieder einmal aus der Klasse geschmissen, weil er so schnell denkt und das auch lautstark zum Besten gibt. Freut die Lehrer:innen gar nicht. „I bin dus, rausgeflogen“ beginnt er halblaut vor sich hin zu dichten und das noch dazu rhythmisch – es wird zum Song.
Da landet auch Rico Hernandez auf dem gemeinsamen Gang – er aus einer anderen Klasse und weil er als Neuankömmling wenig bis nichts versteht, voll verzweifelt ist.
Beide sind Außenseiter. Und nicht nur das. Beide haben wenig, naja ehrlicherweise jeweils gar keine Freund:innen. Und noch etwas verbindet sie: Liebe zur Musik – und zwar nicht nur solche zu hören, sondern auch selber zu machen.
Und das tun Gustavo Nanez (Rico) und Dominik Blumer (Robi) auch live – mit E-Gitarre (Letzterer), E-Bass bzw. Schlagzeug der zuerst Genannte. Mehrmals im Verlauf des rund einstündigen Stücks für Menschen ab 8 Jahren beim Theaterfestival „jungspund“, dieses Stück im FigurenTheater St. Gallen (Schweiz), die meisten finden in der umgebauten ehemaligen Lok-Remise neben dem Bahnhof statt. Der Stücktitel von „Kolypan und Teatro Lata“ sei hier erst – aus guten Gründen – gegen Ende verraten.
Die Liebe zum Musikmachen (neben Computerspielen) ist die beste Voraussetzung, die andere Gemeinsamkeit der beiden zu beenden: Sie werden Freunde. Sogar durch Dick und Dünn. Heimlich schleichen sie sich in den Proberaum der Schule, der ohnehin praktisch nie genutzt wird. Außerdem schwänzen sie einen Tag die Schule und weil sie nach der Übernachtung im Proberaum hungrig sind, klaut Robi – Rico steht Wache, „weil mich aus Ausländer haben sie ohnehin immer im Auge – Lebensmittel im Supermarkt.

Intensiv üben sie Songs für das Abschlusskonzert in der Schule – und machen groß Werbung für die nun von ihnen gegründete Band. Deren Namen (der auch der Stücktitel ist – Geduld noch!) sprayen sie groß unter anderem auf die Turnsaalwand. Das allerdings gibt Zoff. Vorladung in die Direktion.
Ärger aber noch als der Zusammenschiss und die Kosten fürs Entfernen des Schriftzuges sind die nun auftauchenden gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die neue Freundschaft zerbricht.
Natürlich doch nicht. Bei der Wendung (Regie: Meret Matter; Textmitarbeit neben den beiden Spielern: Julia Kubik) zu einem doch noch Happy End schlüpfen die musizierenden Spieler in die Rollen ihrer beiden Väter – leicht anderes Gewand, andere Körperhaltung, veränderte Sprachfärbung. Doch so glatt geht’s dann doch nicht.
Sehens- und vor allem hörenswert sind die entfesselten Band-Auftritte zwischendurch und vor allem am Ende. Noch spannender – und wichtiger – ist die Entwicklung der beiden Protagonisten wie es im Untertitel heißt „From Zero to Hero“ (Von Null bis zum Helden). Und die immer wieder recht witzige Zerlegung klassisch männlicher/bubenhafter Klischees, denn heldenhaft ist unter anderem sich zu entschuldigen. Genialer Einfall für den Band- und Stücktitel: Stereo-Typen.

Hervorzuheben ist auch die recht einfallsreiche Ausstattung (Ausstattung: Sara Giancane; Bühne: Gustavo Nanez) und da wiederum vor allem die gepimpten Bikes – die hier auf der kleinen Bühne allerdings nicht ausgefahren werden konnten. Die stärksten Emotionen im vollbesetzten Publikumsraum löste die Übernachtung im Proberaum aus. Im Traum versinken beide in ihre Lieblings-Computerspiele und tauchen verwandelt als Art Zombie-Ritter auf, die einander heftig bekämpfen. Hier spielt aber auch Angst der ach so starken Jungs eine nicht unerhebliche Rolle.
Einziges Manko – das für viele Stücke in vielen Theater gilt: Wenn Spieler:innen ganz nah am Bühnenrand sehr bodennah – hier liegend – agieren: Zuschauer:innen in den hinteren Reihen sogar dieses schräg ansteigenden Publikumsraums mit – einzigartig – höhenverstellbaren Sitzen sieht dennoch (fast) nichts davon.
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.

„Wir lachen auch sehr gern über uns selber“, sagte die in Österreich wohl bekannteste Austro-Tschetschenin Maynat Kurbanova unter anderem im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Stimm*Raum“ Freitagabend (1. März 2024) im IFP (Institut für Freizeitpädagogik) von wienXtra).
Über Sprache, den mehrmaligen Wechsel der Schrift von Kyrillisch auf Lateinisch und wieder retour, die Zurückdrängung der Landessprache zugunsten der Amtssprache Russisch, was zur Folge hat, dass Tschetschenisch mittlerweile zu den vom Aussterben bedrohten Sprachen wurde, Bräuche, Witze und natürlich auch Folgen der zwei Kriege Russlands gegen das unabhängig gewordene Land, Flucht, Diaspora, Pendeln zwischen den Kulturen, Gemeinsamkeiten mit Österreich ebenso wie viele Unterschiede auch unter den hier lebenden Tschetschen:innen … gibt es mehrere Kartontafeln einer Ausstellung.
„Stimm*Raum“ lautet der Titel. Unter diesem laufen seit mehreren Jahren Kulturprojekte mit Jugendlichen. In Schreibwerkstätten verfassten junge tschetschenische Österreicher:innen oder österreichische Tschetschen:innen literarische Texte. Gemeinsam mit künstlerischen Fotos entstand daraus ein zweisprachiges Buch (Deutsch und Tschetschenisch – in kyrillischer Schrift). Im Vorjahr erarbeiteten Jugendliche ein gemeinsames Theaterstück und in diesem Jahr haben sie begonnen, an einem Film zu arbeiten.
Maynat Kurbanova leitete Schreibworkshops, drei der jungen Teilnehmer:innen – Rayana Cany, Sara und Fariza Bisaeva – lasen vor der offiziellen Ausstellungseröffnung Auszüge aus den jugendlichen literarischen Texten aus dem erwähnten Buch. Fariza Bisaeva las einen neuen Text – der in Band 2 erscheinen wird – und sich mit dem Leben in Österreich beschäftigt, das ihr die schönsten ebenso wie die schmerzhaftesten Momente beschert hat

Zwei kurze Text-Auszüge hat sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die schriftliche Veröffentlichung hier zur Verfügung gestellt: „Ich bin österreichische Tschetschenin. Also tschetschenische Österreicherin. Ich meine Österreicherin mit tschetschenischen Wurzeln. Oder doch muslimisch-tschetschenische Wienerin?…
… Gleichzeitig ein Land (Tschetschenien, Anm. d. Red.), das du Österreich, zu oft mit paar Schlagzeilen abtust, dessen Leid du nach Gebrauch instrumentalisierst, dessen Komplexität du zu selten würdigst. Und Stück für Stück, mit jedem Mal, indem du das machst, bricht mein Vertrauen in dich…“
Ein bisschen mehr ist Fariza Bisaeva im Originalton in dem am Ende des Beitrages verlinkten Video von der Veranstaltung zu hören und sehen. Wobei so manche dieser Gedanken, die auf ihren Erfarhungen und Erlebnissen beruhen für viele Menschen mit Wurzeln in vielen anderen Ländern ähnlich sind – konfrontiert mit Vorurteilen, nicht selten auch Rassismus.
Kurbanova würzte mit schwarzhumorigen Witzen, die dort auch im genannten Buch – siehe Info-Block – zu finden sind. Als Fun Fact nannte sie noch, dass Tschetschen:innen nicht ungern darauf hinweisen, dass der höchste Berg (Dakoh Kort) ihres kleinen Landes (1,3 Millionen Einwohner:innen, weniger als 16.000km2 (kleiner als die Steiermark) 4.493 Meter hoch ist – immerhin fast genau 700 Meter höher als Österreichs höchster Gipfel, der Großglockner (3.798 Meter).
Barkal – Danke für die Infos an die jugendlichen Autor:innen und ihre Mentorin!
Follow@kiJuKUheinz

Befinden wir uns in einer Wohnung? Georg kocht gerade Schwammerl-Erdäpfel-Gulasch. Oder doch eher in einem Labor? Viele kleine Pilzkulturen in mehreren Behältern auf einem Regal im Hintergrund, dazu Blumentöpfe, die auch eher nach Zuchtpflanzen wirken, Metallfolien, Wannen, Kübel, verschiedenfärbige Lichter, mehrere Monitore. Gut, die spielen nur – nach Sprachbefehl – Nachrichten ab; von einer KI-geführten Landwirtschaft, von einem bevorstehenden Prozess gegen einen Autofahrer, der eine Klima-Kleberin totgefahren hat, von geklonten Menschen in China…
Miranda kommt abgespannt von der Arbeit nach Hause. Schiebt den vorbereiteten Teller weg, klappt den Laptop auf, um nur noch schnell eine eMail schreiben zu müssen, und bittet ihren Lebenspartner genervt, diese grauslichen Nachrichten abzudrehen. Sie hatte ohnehin einen stressigen Tag, arge Verhandlung als Staatsanwältin und dann wurde ihr noch ausgerechnet der oben genannte Prozess entzogen, um ihn eher einem alten männlichen Staatsanwalt zu überantworten…

Dies ist das Ausgangsszene für „D.A.R.K. – Das All im Reiskocher“. Dies ist ein schräges, satirisches Stück rund um Klimakrise, Künstliche Intelligenz und mögliche dystopische Zukunftsszenarien der Welt, viel mehr der möglichen Vernichtung der Menschheit. Gespielt wird es nun – bis 13. Februar 2024 – im Zirkus des Wissens in Linz. Auf dem Gelände der JKU (Johannes Kepler Universität) spielt sich in diesem umgebauten ehemaligen Stadel ein Mix aus Kunst und Wissenschaft ab, meist in theatraler Form.
Georg (Max J. Modl) nennt irgendwann am Beginn als aktuelles Datum 24. August 2026. Dabei bleibt es im Lauf des Stückes nicht – wir hören als weitest in der Zukunft liegendes Datum das Jahr 2120. Was Miranda (Julia Frisch) schon ziemlich anzweifelt, ist sie doch 1995 geboren, wäre dann also 125 Jahre alt/jung (?). Und wir hören Stimmen aus dem Reiskocher. Aber nicht dieser spricht, sondern „Das All“, das sich zweitweise dort niedergelassen hat, aber auch schon mal aus Mirandas Tasche, dem Kühlschrank oder wo auch immer her ihre Sprüche loslässt (Eszter Hollosi – live in jeder Aufführung und nicht voraufgenommen eingespielt).
Achja, Georg ist Forscher an Pilzkulturen (die höchst interessante, liebevoll bis ins kleinste Detail gestaltete Ausstattung stammt von Nora Scheidl). Am Tag mit dem das Geschehen beginnt, hat er eine spezielle Kreuzung erfolgreich gezüchtet, die er für DIE Abhilfe gegen den Klimawandel hält…

Dieser ist zentrales Thema der knapp 1 ¼ Stunden – aber immer wieder in einer fast kabarettistisch-paradoxen Variante – Details seien nicht gespoilert (Text und Regie: Michael Scheidl). So viel aber schon, dass zwecks Überleben der Menschheit die KI, die mehr oder minder die Macht übernommen hat, der (Selbst-)Zerstörung ein Ende setzen, oder sie wenigstens beschränken will und dafür eine eigene Sorte „Homo Utilis“ gezüchtet hat – ein solches Exemplar tauch auf (Eric Lingens). Und bringt das Leben des Paares noch mehr durcheinander als es ohnehin schon angesichts des Streits darum, Kinder in die Welt zu setzen oder nicht, der Fall ist.

Schon verraten wird hier: Neben dem Schauspiel im durchaus skurrilen Ambiente runden noch Musik und Klang (Komposition: Martin Kaltenbrunner, Klangskulptur: Michael Kramer) und Visuals im „großen Fenster“ nach draußen (Max Scheidl) „D.A.R.K.“ ab – ein Stück, das so gebaut ist, dass es keine Antworten geben will, sondern definitiv Fragen und Beschäftigung damit richtiggehend anstößt.
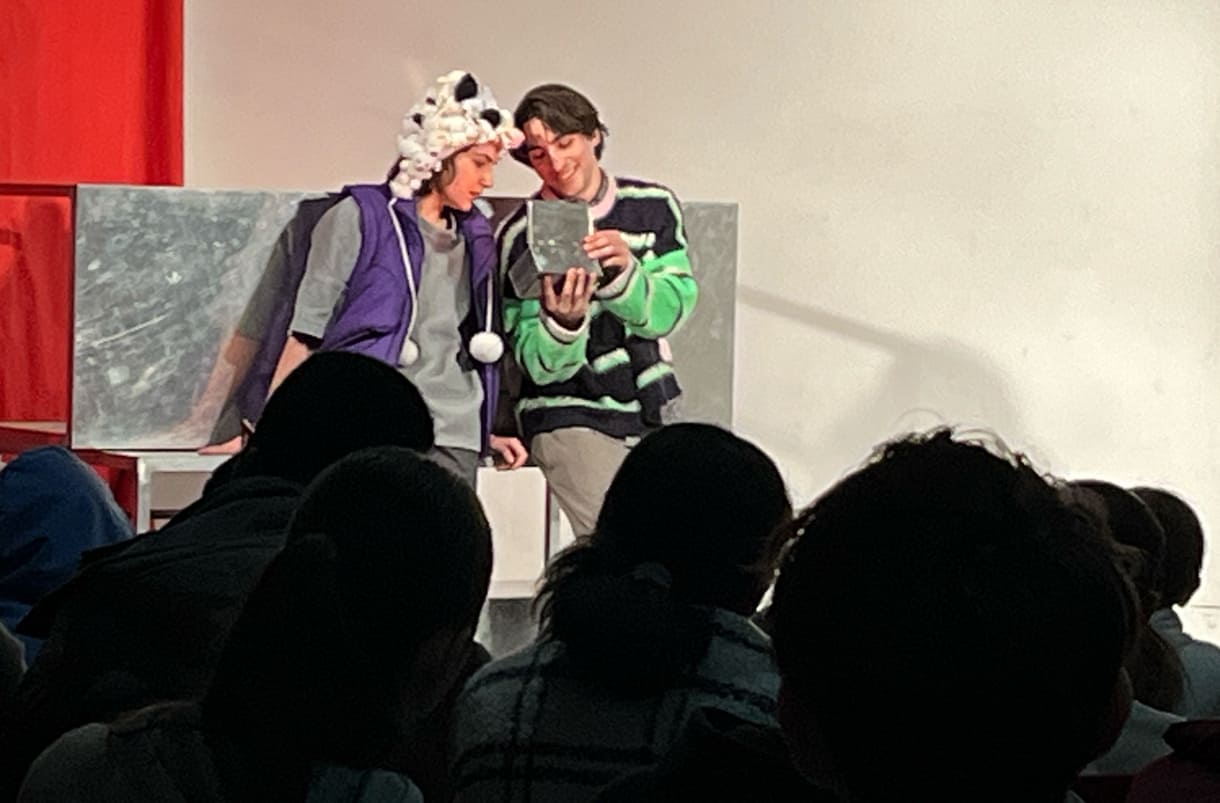
Im schwarz-grün-weiß gestreiften Pulli sitzt Emil in seinem Zimmer zwischen drei Computern plus externen Monitoren, die er alle per Markennamen nennt, dazu die neuesten Modelle zweier angesagter Handy-Hersteller. Damit noch nicht genug zählt er noch all seine Streaming-Abos auf. Nicht ganz klar ist, wieweit das real oder doch nur Wunschtraum ist. Sich vorzustellen, zwischen welchem Techno-Zeug er sitzt, bleibt der Fantasie überlassen. Die Bühne ist fast leer.
Mit Ausnahme weniger metallener Tischgestelle, die hochkant auch zu Kästen werden können und Unmengen von Silikon-Schläuchen gibt es praktisch keine Requisiten (Bühne: Julius Leon Seiler). Das ermöglicht dem knapp mehr als einstündigen Jugendstück „Abgefuckt“ auch relativ leicht mobil zu sein. Es ist nach Stücken ab sechs bzw. neun Jahren das erste ab 13 Jahren mit dem das Burgtheater Studio mobil in Schulen spielt.
Edward Lischka spielt den eingangs schon genannten/beschriebenen Emil – und später auch einen Mann namens Ulrich. Laetitia Toursarkissian schlüpft in die Rollen von Emma, einer Mitschülerin ebenso wie in die von Anna, der Ehefrau Ulrichs, sowie Emils Mutter. Als diese aber vor allem als Stimme hinter einem Paravent, hinter dem auch die Umzüge stattfinden – erkennbar durch Gewandstücke, die auf den über diese Abdeckwand hinausragenden Kleiderständer gehängt werden.
Emma erleben wir bei ihrem ersten Auftritt in einer Shoppings-Situation. Und als doch eher in sich verschlossen – äußerlich stark zum Ausdruck gebracht durch eine ihren Kopf fast verschließende Haube (Kostüme: Maria-Lena Poindl) aus vielen kleinen Kuscheltieren. Und auf der Suche nach sich, nach ihrer Linie.
Emils Mutter – die Kommunikation zwischen ihr und ihrem Sohn erfolgt praktisch nur durch die Wand, verklickert ihm bald: „Wir stürzen ab“ – keine Kohle mehr, Gerichtsvollzieher, alles weg. Emmas Eltern – Anna und Ulrich – kaufen für die Konfirmation der Tochter ein – riesiges Gartenfest, 70 Gäste. Und doch schwingt mit: So viele Kohle ist nicht da. Anna spricht zwar von Bildungskarenz (hier immer -Urlaub genannt), aber zwischen den Zeilen klingt da eher Job-Verlust durch.
Soweit die Ausgangsgeschichte des Stücks, das Julie Maj Jakobsen nach einer Geschichte von ihr und Petrea Søe auf Dänisch (Übersetzung: Franziska Koller) geschrieben und Tobias Georg Jagdhuhn für das Burgtheater inszeniert hat. Armut, die in den Mittelstand eindringt – und das auf recht nachvollziehbarer Ebene wird hier thematisiert. Auch samt der Scham und dem Verschweigen. Anna verheimlicht ihre Kündigung zu Hause, Emil wird aggressiv als Emma ihn darauf anspricht, dass die ganze Schule über den Gerichtsvollzieher in seinem Zuhause redet.
Womit Auswirkungen der finanziellen Abwärtsspirale auf die psychische Verfassung der davon betroffenen in dem Fall Jugendlichen nachvollziehbar dargestellt und von den beiden Schauspieler:innen mit-erlebbar wird.
Vielleicht ein bisschen aufgesetzt, wenngleich natürlich ein wenig Hoffnung gebend, wirkt die Annäherung von Emma und Emil am Ende.
Jedenfalls ist es den beiden Schauspieler:innen aber gelungen die meisten Schüler:innen dreier Klassen (zweier sechster und einer dritter) im Gymnasium Diefenbachgasse (Wien 15) die Theaterstunde bei der Stange zu halten. Trotz dessen, dass in den hinteren Reihen jene Szenen kaum bis nicht zu sehen waren, die auf der Bühnenfläche ganz vorne und am Boden gespielt werden.
„Das Stück war ziemlich interessant, man konnte sich gut in die Situation der Figuren hineinversetzen“, meint Anisa nach der Vorstellung zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Beim kurzen Publikumsgespräch zuvor war es vor allem um technische Fragen gegangen – woraus sind die Schläuche, wie kann man sich so viel Text merken. Anisa hob auch die Soundeffekte (Musik: Gabriel Wörfel) hervor und meinte im Gegensatz zu anderen Theaterstücken, die sie bisher mit der Schule gesehen hat, „war das hier jetzt moderner“.
Batoul fand: „Das was in dem Stück passiert war nahe an dem was es in Wirklichkeit gibt, wie es manchen Jugendlichen geht.“
Ryan hat einen Bruder „der auch Theater spielt. Aber so etwas hab ich bisher noch nicht gesehen. Es hat mir sehr gefallen, dass man sich sehr viel selber vorstellen konnte, weil sie die Sachen, von denen sie erzählen, nicht wirklich sieht, sondern nur diese vielen Schläuche.“

Ein Soft-Start zieht das Publikum, das an den vier Wänden rund um das jüngste Mash-up von „das.bernhard.ensemble sitzen wird, schon beim Betreten der White Box im Wiener Off-Theater ins Geschehen. Schräge Figuren wandern, kriechen, umher, nähern sich den Zuschauer:innen, werden von einem Kollegen davon aber immer wieder abgehalten. Seit Jahren verbindet das Ensemble – meist nach einer Idee von Mastermind Ernst Kurt Weigel – einen Theater- mit einem Filmklassiker zu einer höchst intensiven theatralen Performance, selten auch mit Video-Einblendungen. Wie aber meist liegt auch dieses Mal die alleine Konzentration auf analoges, Live-Schauspiel mit starkem körperlichem Einsatz.
„Medea“, dritter Teil der Trilogie „Das golden Vlies“ von Franz Grillparzer stand Pate für den Theater-Ausgangspunkt. Meist bekannt als Kinder-Mörderin, liegt in manchen Versionen der Schwerpunkt der Interpretationen auf dem Mobbing gegen die Zugewanderte. Oder auch darauf, dass sie sich an Iason rächen will, dem zuliebe sie das Goldene Vlies klaut und mit ihm und den Argonauten aus Kolchis abhaut, der sie dann aber zugunsten der Tochter von König Kreos verlässt.
Hier war’s was anderes. „Bei der Beschäftigung mit dem Medea-Stoff hatte ich sofort diese Roadmovie-Assoziation des mordenden Liebespaares. „Bonnie und Clyde“, „Wild at Heart“, „True Romance“ waren sofort präsent und natürlich auch NBK“, schreibt Weigel im Programmheft. Mit NBK meint er „Natural Born Killers“, einen Film von Oliver Stone nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino. In einem Lokal im US-Bundesstaat New Mexico richtet Mickey ein Gemetzel an, nachdem ein Gast seine Freundin Mallory belästigt hat. Das Ungewöhnliche: Am unteren Bildrand ist eine Pistole eingeblendet – wie bei einem Ego-Shooter-Computerspiel – und das 1994.
Im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erzählt Weigel noch, dass er sich noch etliche andere Medea-Versionen reingezogen habe. Aber es blieb bei der Grundstimmung: Vermixung der Zeit, in der das Paar gemeinsam unterwegs ist mit jener der Flucht des eben genannten Paares aus dem Film.
Auf dieser Flucht bringen M & M Dutzende weitere Menschen um. In Rückblenden stellt sich obendrein heraus, dass Mallorys Vater die Tochter unzählige Male sexuell ausbeutet, die Mutter schaut weg… Neben den Morden spielt in dem Film nicht zuletzt die mediale Sensationsberichterstattung über die Taten einer- und die polizeiliche Verfolgung andererseits eine große Rolle.
Und das mixte „das.bernhard.ensmeble“ zu einer heftigen, zweistündigen, immer wieder aber auch satirisch distanzierten/distanzierenden Performance zusammen. Die Originalnamen aus dem Film und dem Stück werden verändert – Mae (umwerfend: Rinu Juniku) und Jay (heftig: Andrzej Jaślikowski) statt Medea und Iason etwa – und alles als Theaterprojekt in einem Gefängnis angesiedelt, dessen Direktor Kajetan Dick sozusagen auch die „Show“ auf der Bühne dirigiert.
Als besessener und skurpelloser Kommissar Scagnetti (der auch im genannten Film so heißt) agiert Matthias Böhm, der auch den ekelerregenden, gewalttätigen Vater spielt. Als völlig schräge Figur hoppelt Yvonne Brandstetter als Hase durch die Szenen. Dazu gesellen sich noch die – wie alle ja ständig von allen Seiten beobachtet werdenden und damit immer präsenten Spieler:innen Anja Štruc (Gefängnis-Seelsorgerin Kreusa bzw. Geisel des mörderischen Duos sowie Jula Zangger als Schamanin und u.a. wegschauende Mutter).
Für Bühne mit so manchen absurd erscheinenden Utensilien sowie Kostüme zeichnete Julia Trybula, für die ausgefeilte Choreografie- wenn Menschen von allen Seiten zuschauen – sorgte Leonie Wahl. Wie immer schuf Bernhard Fleischmann Kompositionen und die den Szenen angepasste Musik. Und: Ernst Kurt Weigel sitzt als Regisseur erstmals bei einem Mash-up von „das.bernhard.ensemble“ am Spielfeldrand statt mitten im Geschehen zu agieren.

Als Spielzeugfiguren verkleidete Schauspieler:innen liegen, sitzen, kugeln sozusagen auf dem Boden herum, eine steht. Sie spielen den lebendig werdenden Inhalt einer Blechkiste der Jugendlichen Sari (Dinda Daniar Darussalam). Diese hält die Box auf ihrem Schoß, sinniert und fasst den Entschluss – im heftigen Streit mit ihrer Mutter Nastja (zweisprachig und recht resolut: Vanda Sokolović) -: Ich halt’s in diesem Land voll Armut und Krieg nimmer aus, ich geh.
Sie habe über Internet einen Mann kennengelernt, der ihr versprochen hat, wenn sie zu ihm in sein Land komme, dann könne sie dort arbeiten, gutes Geld verdienen und alles haben. Und sie werde der Mutter auch regelmäßig Geld schicken.

Wobei das alles in „S[ch]till here“ wie das jüngste Stück von „Die Fremden“ heißt, „nur“ gespielte Annahmen sind. Denn Dinda Daniar Darussalam sagt in ihren ersten Worten: „Sagen wir, ich bin Sari…“. Solche Passagen werden sich später – von anderen gesagt – im Laufe der nicht ganz zwei Stunden (eine Pause) wiederholen. Damit heben die elf Schauspieler:innen – allesamt Laien, viele schon seit Jahrzehnten bei der Theatergruppe „Die Fremden“ (1992 gegründet) – die Geschichte einerseits irgendwie ins Fiktive. Und das obwohl viele der Szenen auf Erlebnissen der Mitwirkenden der Theatergruppe basieren – nur die heftigste Einzelheit, die hier aber nicht gespoilert werden soll, musste niemand am eigenen Leib erleben. Andererseits deutet dieses „sagen wir, ich bin…“ auch an, was ganz am Ende als Schlusswort nach dem Schauspiel dem Publikum mit auf den Weg gegeben wird: Saris Schicksal ist nur eines von Millionen, das rechtlose, nicht „gesehene“ Arbeitsmigrant:innen, erleiden.
Denn darum dreht sich das Leben im neuen Land mit ach so viel versprochenen Möglichkeiten: Ein Hotel, das demnächst (wieder) aufsperren soll, braucht billige Mitarbeiter:innen. Die ordert sie über eine Agentur. Und dort werden den angeheuerten sehr arbeitswilligen Arbeitsmigrant:innen gleich einmal die Papiere weggenommen. Das Hotel zahlt die Beschäftigten nicht direkt, sondern an die Agentur, die einen Gutteil des Geldes einbehält und lediglich Taschengeld auszahlt…

Soweit die Grundgeschichte. Zwischen – manche im Publikum sogar zu Tränen – rührenden Momenten und heiter-ironischen bis herzhaft lustigen Momenten nehmen die insgesamt elf Schauspieler:innen (Regie und Leitung wie immer Dagmar Ransmayr) das Publikum in eine (fast) unbekannte arge Schattenwelt mit. Mit wenigen, wandelbaren Requisiten – hauptsächlich kleine und größere Kübel – zaubert das Ensemble eine Hotellobby ebenso wie ein altes Auto (Klappstühle und vier liegende Kübel als Räder). Diese „Fahrt“ mit Ali (Besmellah Jafari), der keinen Führerschein, aber wenigstens den Pass von wem anderen hat, und Nastja, die keinen Pass hat – aber immerhin muss eine Grenze überwunden wird – ist sehr skurril und gehört zu jenen mit den meisten Lachern.
Flache Blechschachteln dienen als Smartphones oder Tablets, was mehr Charme versprüht, als würden sie mit echten oder funktionslosen Handy-Dummys (wie häufig auf Bühnen) spielen.

Wunderbar die mehrfache Verwandlung jener fünf Schauspieler:innen, die einerseits in die Rollen von Spielzeugfiguren schlüpfen – Tanzschwein (Sofie Leplae), Hexe (Katerina Rumenov Jost), Katze (Yasmin Navid), Bär (Armen Abisoghomyan), Einarmiger (Markus Payer), Roboter (Garegin Gamazyan) – und andererseits das Hotel bevölkern: Als windiger Chef, der zwielichtige Geschäfte macht, als Rezeptionist, der sich für alles andere zu schade ist, als überforderte Managerin, als Aufseherin über die Putzkräfte und ihre aufmüpfige Tochter Mona (Yasmin Navid) sowie als Haustechniker, der zwar vieles kann, dem aber so ziemlich alles „wurscht“ ist, er hat ja nur mehr kurz bis zur Pensionierung.
Das Duo Mme Olivia vs Mona (herzhaft aufmüpfig: Yasmin Navid) ist fast eine Parallel zu Nastja und Sari.

Ein heftig-berührender Abend, der dennoch Raum zum Verschnaufen und immer wieder auch Lachen lässt, vor allem aber ein kaum thematisiertes Segment von Schattenwirtschaft mit sklavenähnlichen Zuständen beleuchtet. Gekonnt und leidenschaftlich gespielt und – was auf Theaterbühnen insgesamt noch viel zu wenig zu hören ist – auch mehrsprachig. Immer wieder bringen die Schauspieler:innen Sätze, manche auch viele, in jenen Sprachen, die sie neben Deutsch beherrschen, auch ein, u.a. BKS (Bosnisch / Kroatisch /Serbisch), Farsi bis zu Wiener Dialekt etwa in Arik Brauers „hinter meiner, vurder meiner siech i nix…“

Verdienter heftiger, langanhaltender Applaus als Belohnung für die zuvor erlebten 1 ¼ Stunden „Land ohne Land“. Mit diesem Stück eröffnete das nunmehr dritte „E Bistarde/ Vergiss mein nicht“-Festival. Theater und Musik, von Roma-Künstler:innen geschaffen, ist – diesmal im Dschungel Wien – noch bis zum 9. November 2023 zu erleben.

Die Internationalität dieser Volksgruppen brachte nicht zuletzt der sich an die erwähnte Stück-Premiere – Besprechung in einem eigenen Link am Ende dieses Beitrages – anschließende mitreißende musikalische „Wander“-Auftritt des Quartetts von „Trubači Austrija“ zum Ausdruck. Erst im Theater-Foyer und dann im Hof spielten die Musiker auf drei Blasinstrumenten und einer Trommel so auf, dass viele richtiggehend zum Mittanzen mitgerissen wurden. Die Bandbreite reichte unter anderem von der Roma-Hymne „Djelem Djelem“ über das hebräisch/jüdische Volkslied „Hava nagila“ bis zum besonders durch italienische Partisan:innen im antifaschistischen Widerstand berühmt gewordene „Bella Ciao“ – die allesamt, wie auch die anderen Musikstücke Freude am Leben ausstrahlen.

Kosa und ihr jüngerer Bruder Aca leben seit mehr als 30 Jahren in Österreich, suchen um die Staatsbürgerschaft an, aus Reisetaschen packen sie Ordner voller Dokumente aus, überreichen diese der grummelnden, grantelnden, abwehrend und abwertenden Beamtin. Obwohl sie keinen Blick hineinwirft, zweifelt sie gleich einmal an, ob das wirklich alles vollständig ist. Erteilt Anweisungen, dass sie sich eine Kopierkarte in Stock x holen, diese in y aufladen und obendrein Summe z zu zahlen hätten.
Im Publikum gequältes, lautstarkes Lachen jener Zuschauer:innen, die offenbar eigene Erfahrungen mit der MA35 haben.
Doch bevor die Geschwister – Kosa (Valentina Eminova) und Aca (Sebastian Malfer) endgültig in den Besitz eines österreichischen Passes kommen können, müssen sie die Entlassung aus der serbischen Staatsbürgerschaft erwirken. Am leichtesten, so scheint es, wenn sie’s vor Ort selber tun. Wo sie auf einer zwar viel gestyltere aber nichts desto trotz ebenso ignorante Beamtin treffen.
Soweit die Rahmenhandlung von „Land ohne Land“, mit dem am Totengedenktag (1. November) das dritte Internationales Roma-Festival „E bistarde 2023 | Vergiss mein nicht“ im Dschungel Wien eröffnet worden ist. Simonida Selimović, gemeinsam mit ihrer Schwester Sandra, Gründerin dieser Veranstaltungsreihe mit vor allem Theater und Konzerten, hat das Eröffnungsstück geschrieben und auch Regie geführt.
Zu den sarkastisch, bitterbösen Amts-Szenen (Beamtin: Franziska Adensamer, die auch Svetlana, die Cousine der beiden spielt) gesellt sich noch ein Rückgriff auf eine der Corona-Phasen. In so manchen Ländern wie Serbien oder Rumänien wurden Angehörige der Volksgruppe der Roma noch mehr als üblich diskriminiert. Sie wurden beschuldigt, Überträger:innen zu sein mit Ausgangsverboten oder Gefängnishaft belegt. Was im Stück die Situation nochmals verkompliziert, können die Geschwister nun nicht einmal zurück nach Österreich wo Svetlana Kosas beide Kinder (Dominic Moldovan und Samuel Rosegger in Video-Einspielungen) betreut.
Valentina Eminova stellt als Kosa immer wieder dieses ganze System nationaler Grenzen und einschränkender Bestimmungen in Frage und bricht daraus aus – mit bunter „Daten“-Brille und -Handschuhen surft sie in eine virtuelle Welt – die schließlich riesengroße auf einen vorgezogenen dünnen Vorhang projiziert wird. Schon davor wurde aus den schauspielenden Figuren hin und wieder Avatare, die sich zu unendlichen Vervielfachungen ausweiteten. Nun läuft die digitale Kosa durch grenzenlose Landschaften, in der immer wieder Bilder, teils auch Videos aufpoppen von Roma-Vorkämpferinnen wie der in Österreich doch recht bekannten Ceija Stojka, die mehrere Konzentrationslager der Nazis überlebte und als eine der allerersten darüber zu malen, schreiben und sprechen begann. Aber auch – bei uns weniger bekannten – aus Rumänien, Schweden, USA…
Diese digitale Landschaft gegen Ende ist aber viel mehr, sie wird als Konzept schon früher im Stück angesprochen: Was wäre, wenn alle Rom:nja, Sinti:zze, Lovara… eine digitale Identität in einer gemeinsamen, grenzenlosen virtuellen Welt hätten, sozusagen einen – wie er mehrmals eingeblendet wird – Roma-Pass, eben ein „Land ohne Land“. Womit sich der Bogen zum Beginn des Stückes schließt. Da wird die bekannteste Suchmaschine eingeblendet und nach dem Online-Kauf eines digitalen Landes gesucht – wobei dabei natürlich Metaverse aufscheint 😉
Das ca. 1 ¼-stündige Stück verbindet äußerst gelungen realsatirisches Schauspiel mit Live-Musik durch die beeindruckende Fagott-Bläserin Stefanny Leandro Aguilar, die mal untermalend, dann wieder zentral aufspielend fast durchgängig Klangteppiche webt mit Spitzen-Auftritten sowie Video-Einspielungen (neben den beiden schon genannten Kinder noch Radica Savić als u.a. Kaffee-Sud lesende serbische Tante) und ins Digitale ausgelagerter Utopie (Visual Art: Joanna Zabielska; Kamera & Cut: Laura Moldovan). Gerade letztere verschafft angesichts der in den vergangenen Jahren und Wochen noch heftigerer aufgeflammter brandgefährlicher nationaler Konflikte ein wenig sehnsüchtige Hoffnung.
Etwa zwölf Millionen Roma leben im europäischen Raum. Auch wenn sie keine homogene Gruppe sind, sondern vielfältige Lebensstile pflegen, werden viele von ihnen sozial nach wie vor ausgegrenzt oder nicht wahrgenommen. Doch „Wir sind da, wir zeigen uns, wir lassen nicht zu, dass man vergisst, dass es eine Geschichte gibt, die uns seit Jahrhunderten verfolgt, und dass wir nichts davon wissen. Wir sind so viele und wir sind so unterschiedlich.“
Das Festival „E Bistadrde/ vergiss mein nicht“ gibt den Rom:nja und Sinti:zze durch Theater und Kultur eine Stimme: „Es ist notwendig, einander, Roma und Nicht-Roma, zu kennen und anzuerkennen, um unsere historischen kulturellen Unterschiede zu versöhnen“, sagt Simonida Selimović-Rosegger, Gründerin des Roma Theatervereins Romano Svato. „Wir haben eine Auswahl an Shows zusammengestellt, die sich um aktuelle Themen und Ästhetiken drehen, die in der Dokumentation der Realität und der Mikrogeschichte verwurzelt sind.“ „E Bistarde“ hat eine klare soziale Botschaft in Bezug auf Bildung, Bewusstsein und Stärkung einer positiven Identität. Ihre kulturelle Vielfalt über und mit Roma arbeitet darauf hin, das Zusammenleben innerhalb der Roma-Gemeinschaften sowie außerhalb zwischen der Nicht-Roma-Mehrheit und den Roma-Gemeinschaften zu harmonisieren.
Übersicht über die weiteren Auftritte in der Info-Box. Und es wird – natürlich – weiter ausführlich hier berichtet.

Bevor hier auf das – oftmals akrobatische – Tanztheaterstück „KINGX & QWEENS“, derzeit noch bis 10. Oktober 2023 sowie an drei Tagen im Juni 2024 zu erleben, eingegangen wird, ausnahmsweise eine Beobachtung des Publikums: Die Tribünen vollbesetzt mit Jugendlichen, die die 1 ¼ Stunden gebannt dabei sind, am Ende sprichwörtlicher (fast) never ending Applaus. Eine Gruppe klatscht sogar noch Minuten nachdem alle anderen – inklusive der Künstler:innen – den Saal 1 (den größten im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für vor allem junges Publikum im MuseumsQuartier) verlassen haben.

Die Performance, die Maartje Pasman, Futurelove Sibanda und Joseph Tebandeke, auf die Bühne zaubern, ist magisch. Oftmals unglaubliche Bewegungen am Boden, auf großen blauen Wasser-Kanistern, auf – und mit – Stangen sowie Krücken. Beflügelt von der dafür geschaffenen Musik von Karrar Alsaadi scheint das Trio nicht selten als wäre es auf einer Weltraum-Station, in der die Schwerkraft sozusagen außer Kraft gesetzt ist.
Schweben und Fliegen drängt sich in so manchen Szenen als Bild in den Kopf. Alles ist sozusagen möglich – das steckt irgendwie auch in der – aufs erste vielleicht merkwürdig wirkenden – Schreibweise des Stücktitels, wo das Plural-S der englischen Version von Königin durch ein X und in der Königinnen-Version das U durch ein Doppel-U, also ein W, ersetzt sind. Vielleicht auch mit ein bisschen Anspielung auf Querness. Aber auch an das Bild einer dreizackigen Krone.

Einer Krone, die auch mehrfach in den auf einen blauen Stoff im Hintergrund projizierten Videoanimationen (Luciana Bencivenga) auftaucht und nicht selten fliegt. Und die ebenso wie die auftauchenden Figuren und Objekte Anleihe nimmt bei den Bildern von Jean-Michel Basquiat (1960 bis 1988), einem US-amerikanischen Künstler, der als kleines Kind Stammgast in einem Kunstmuseum (Brooklyn), dreisprachig war und in einer Band spielte und malte – und früh damit Erfolg hatte. Mit 21 Jahren war er – als bis heute jüngster – Künstler bei der weltberühmten documenta. Die Krone setzte Basquiat in seinen Bildern genau nicht Herrscher:innen auf die Häupter, sondern unterschiedlichsten Menschen – gleichsam als Zeichen, dass sie ihr Leben selbst bestimmen.

Genau dieses Gefühl der Selbstermächtigung in allen möglichen und auch (scheinbar) unmöglichen Lagen bringen die drei Tänzer:innen in praktisch jeder der Szenen zum Ausdruck – und auch ein starkes Miteinander. Auf der Projektionswand erscheinen hin und wieder auch Fragen, etwa, ob es auch möglich ist, alleine glücklich zu sein. Das Trio – auch wenn es Szenen gibt, in denen alles andere als Harmonie gespielt und getanzt wird – vermittelt dennoch ein unbedingtes Plädoyer zu sozialer Gemeinschaft.

Neben Basquiat war – zumindest für eine der Anfangs-Szenen – auch ein Bild aus dem Jahr 1889 (!) aus Damaskus (Syrien) eine optische Inspirationsquelle, das Kostümbilnder Kareen Aladhami ins Team von KingX und KWeens mitgebracht hatte. „Samir und Abdullah“ zeigen den gelähmten Kleinwüchsigen, christlichen Samir im Huckepack auf dem Rücken seines blinden muslimischen Freundes Abdullah (Quelle: Pädagogischen Begleitmaterial zur Produktion). Und so tanzt Maarte Pasman mit Joseph Tebandeke (der gemeinsam mit Corinne Eckenstein auch choreografierte und die Show konzipierte) bei ihrem ersten Auftritt auf die Bühne. Da singt Futurelove Sibanda auf einem aus den oben schon genannten Kanistern aufgeschichteten Thron beeindruckend den ganzen Raum erfüllend.

Tebandeke lässt in seinen kraftvollen Tänzen mit Hilfe von Krücken, den besagten Kanistern oder auch seinen Mittänzer:innen weitgehend vergessen, dass ihm diese Hilfsmittel erst viele seiner Bewegungen erlauben (Polio-Infektion in seiner Kindheit). Er schildert übrigens in einer Szene Erlebnisse von Flugreisen aus seiner Heimat Uganda, wo er Teil der „Splash Dance Company, Kampala“ sowie der „Dance Revolution East Africa“ ist, nach Europa. Nicht selten meinen sie bei der Passkontrolle, wenn sie als seinen Beruf Tänzer lesen, er solle ihnen doch dann was vortanzen.

Futurelove Sibanda, Tänzer und Sänger, der seit vielen Jahren hierzulande von unzähligen Produktionen bekannt ist, in Wien lebt und seine ersten Auftritte mit der Gruppe IYASA aus Simbabwe hatte, erzählt in der Szene seiner persönlichen Geschichte u.a. die nach der Suche nach seinem Vater, der sich vor Futureloves Geburt davongemacht hatte, und als er ihn gefunden hatte, erkannte: Der passt nicht in unsere Familie – was er mittels eines Kanister-Turms schauspielerisch darstellte.

Maartje Pasman rührte mit ihrer Erzählung, die sie mit folgenden Sätzen begann: „Wer bin ich in dieser Welt und warum schreie ich nicht?“ Dabei weinte sie bitterlich sozusagen in einen der Kanister. Joseph schnappte sich den über ein Band mit diesem verbundenen zweiten Kanister und lauschte den Erzählungen aufrichtig. Sozusagen ein Mega-Bechertelefon. Doch Pasman schrie und weinte nicht über den aktuellen Zustand der Welt, sondern, dass sie ihre Vorfahr:innen mit deren Wurzeln in Indonesien nicht kennenlernen durfte. Sibanda tanzt herbei, um die tieftraurige Kollegin in die Arme zu schließen und zu halten. Vielleicht die berührendste Szene des Stücks.

Der mitreißende Schluss-Song – und wohl auch der Titel der Performance – sind inspiriert vom Song „Kings & Queens“ (aus dem Album Heaven & Hell/Himmel und Hölle) von Ava Max (2020) – mit einigen wenigen Umdichtungen. So beginnt der Song in der Version der von Corinne Eckenstein neu gegründeten Gruppe Unusual Beings (Ungewöhnliche Wesen) in Kooperation mit der schon genannten Dance Revolution East Africa und dem Dschungel Wien, damit: Wenn alle Könige und Königinnen auf den Thron gesetzt würden…“, während das Original nur davon träumt, dass die Könige ihre Königinnen auf dem Thron hätten…

„Wie schaut’s denn da aus? Wenn das so ist, brauch ich in meinem Zimmer auch nicht mehr aufräumen!“, wundert Mila sich, als sie auf den Dachboden kommt. Eigentlich wollte sie nur nach einer Schnur suchen, um ihren Flugdrachen steigen lassen zu können. Und was ist da? Schachteln, Kisten, Durcheinander. Viel Zeugs. Alles Mögliche, nur nicht die Schnur. Hinter einem schwarzen Vorhang entdeckt sie sogar eine – nie zuvor gesehene – Tür. Und dann fängt die noch an zu sprechen, später singt sie sogar noch.

Was noch viel schräger ist, irgendwie scheint die Tür mit Mila seelenverwandt zu sein: Viel und schnell reden, immer die Klappe offen … Neugierig und quirlig wie das Kindergartenkind ist, öffnet sie natürlich die Tür – und findet jedes Mal etwas ganz anderes dahinter – Wald, Müllhalde, See – samt schwimmendem großen Fisch, den sie vor dem Angelhaken rettet -, einen langweiligen, leeren Raum und dann wieder das Weltall mit leuchtenden Sternen.

Und so wird aus dem ¾-stündigen immer wieder witzigen Stück „Die komische Tür“ (Text: Lukas Schrenk, Musik und Regie: Nils Strunk) mit dem Duo Emilia Rupperti (Mila) und Philip Leonhard Kelz (Türstimme und verschiedene auftretende Figuren vom Fisch über die Vermesserin bis zum Eisverkäufer) im Dschungel Wien ein Ausflug in Fantasiewelten (Bühne: Anna Reichmayr; Kostüme: Anne Buffetrille), wie sie sich viele Kinder ausdenken. Und dabei auch mit Gegenständen ins Gespräch kommen.

Die hier auf dem Dachboden abgestellte „komische“ Tür, weil sie so gar nicht „normal“ ist, bestärkt Mila in der Art wie sie ist. Und gibt ihr obendrein fast poetisch formulierte Tipps – vergleicht die wechselnden, mitunter aufbrausenden Gefühle mit einem Flugdrachen, den sie durchaus steigen und hoch fliegen lassen kann. Aber wenn sie ihn an der Schnur hat, kommt er ihr schließlich nicht zu sehr aus 😉

Zwei Tage bevor in Klagenfurt der Prozess um einen großangelegten Betrug mit Kryptowährung (EX W Wallet) mit acht Angeklagten, 300 Seiten Anklageschrift und rund 40.000 Betrogenen begann, startete im Wiener Theater Drachengasse ein äußerst humorvolles Stück über den allerersten „Pyramiden“-Spiele: „Herr Ponzi sucht das Glück“. Also Fortsetzung der „Glückssträhne“ nach „Beyond Häpiness“ in einem Teil des Semper-Depots und einer Horoskop-Geschichte („Obstacles in our sky“) im Dschungel Wien. Und in der Drachengasse geht’s gleich kommende Woche weiter im zweiten Theaterraum mit „Glückskind“ von Melike Yağız-Baxant, ausgehend von der Basis ihres Textes, der vor zwei Jahren mit einem der Exil-Literaturpreise belohnt worden war.

Den Herren gab es wirklich – unter den Namen Charles Ponzi, aber auch mit den Vornamen Carlo, Carl, zeitweise trat er unter dem Namen Charles P. Bianchi bz. Später als Charles Borelli auf. Geboren im italienischen Parma (1882) wanderte er 1903 in die USA auf, weil – so die Legenden, dort das Geld auf der Straße liege. Angeblich mit lediglich 2 Dollar und 50 Cent angekommen. Zum Tellerwäscher und anderen derartigen Jobs schaffte er es schnell. Das mit dem großen Geld sollte aber noch lange auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit landete er – aufgrund eigener oder anderer Betrügereien in Gefängnissen der USA und Kanadas.
1920 dann die große „Stunde“ des Herrn Ponzi. Zunächst wollte er mit den Preisdifferenzen von Antwortscheinen zwischen Europa und den USA ein Geschäft machen, was so nicht klappte.

Bis er auf die Idee kam, dafür Anteilsscheine mit der Aussicht auf hohe Gewinne – Verdoppelung in 90 Tagen – zu verkaufen. Was anfangs funktionierte – wie bei den meisten Pyramidenspielen; in seinem Fall nicht zuletzt, weil Reiche, die ihr Geld nicht so wirklich brauchten, es im System ließen, um höhere und noch höhere Gewinner in der Zukunft zu lukrieren. Kurzfristig wurde Ponzi zum Vielfach-Millionär – bis der Betrug aufflog – und er (wieder einmal) im Gefängnis landete. Um danach zu weiteren Betrügereien anzusetzen, letztlich aber 1949 in der Armenabteilung eines brasilianischen Krankenhauses fast blind un halbseitig gelähmt starb.
Sein Trick wurde so berühmt, dass solche Ketten- zw. Pyramidenspiele teilweise noch heute als Ponzi Scheme bezeichnet werden. Außerdem wurde der Erfinder dank einer gewissen romantischen Verehrung, weil er sozusagen ein wenig umverteilt hatte, zum Mythos.

Stefan Lasko und Roman Blumenschein waren zufällig auf diese Geschichte gestoßen, Lasko begann zu recherchieren, vertiefte sich in die Biographie Carlo Ponzis, fand viele viel weniger bekannten (Neben-)Geschichten. Unter anderem jene darüber, dass er viel Haut spendete, um einer Krankenschwester mit großflächigen Verbrennungen zu helfen. Und nicht zuletzt
über die große Liebe Ponzis zu Rose Gnecco. Die beiden heirateten ungefähr zu der Zeit als die große Ponzi-Masche begann, ließen sich scheiden als er ins Gefängnis kam – und schreiben sich aber bis zu seinem Lebensende (Liebes-)Briefe. Deshalb vepassten sie dem Stück auch einen Untertitel „oder L’amore ai tempi del dollaro“ (Liebe in der Zeit des Dollars).

Lasko schrieb das Stück und führte Regie, Blumenschein schlüpfte in die Rolle des Dandy-haften Charmeurs und Um-den-Finger-Wickler Ponzi. Agnes Hausmann spielt nicht nur Rose, sondern switchts blitzschnell in gut ein Dutzend Rollen – Ponzis Mutter, einen Mafioso, der Mithäftling Ponzis war, Zöllner, und, und, und.
Dritter im Bunde auf der Bühne ist Stefan Galler als Live-Musiker. In der Art eines Bar-Pianisten entlockt er dem „getarnten“ Keyboard unterschiedlichste die jeweilige Stimmung untermalende bis hervorhebende Klänge. Zu Beginn mit Anklängen an die Melodie aus den italienischen Zeichentrickfilmen „Herr Rossi sucht das Glück“. Hin und wieder schlüpft er auch in die eine oder andere Nebenrolle.

Bühnenboden und -wände (Bühne, Dramaturgie: Sebastian Schimböck) sind schon Beginn an mit diversen Kreideschriften verziert, die während des nicht ganz 1 1/2 -stündigen Spiel immer wieder ergänzt bzw. verändert werden – mit so manchem (Wort-)Witz, wenn Blocton im US-Bundesstaat Alabama als alla Parma geschrieben wird. Oder die unterste Stufe für die Publikumstribüne mit „Stairways to heaven“ (Treppe zum Himmel) beschriftet ist.
Die – zwischen den beiden Publikumstribünen des Theaters Drachengasse – ungefähr dreieckige Bühne strahlt das Flair zwischen Bar und Mafiafilm-Hinterzimmern aus – alles mit einer fast durchgängig präsenten Note von Schmäh und einer gewissen Sympathie für den tragischen Helden; oder wie es der Autor beim Mediengespräch vor der Premiere nannte, „vielleicht habe ich mir den Herrn Ponzi auch ein wenig schöngeschrieben“.
Und nicht zuletzt atmet die Aufführung auch eine Ebene mit, dass vielleicht gar nicht das große Geld jenes Glück war, nach dem Ponzi zeitlebens strebte, sondern – siehe Untertitel mit L’amore …

Ein Halbrund – Stadt- oder Schlossmauer in hellblau mit Wolken verziert – mit fünf Toren bildet den Hintergrund der Bühne für „Wind“. Um den drehen sich die 55 Minunten. Die drei Tänzer:innen, die das Stück auch entwickelt haben, – Michèle Rohrbach, Martina Rösler, Ives Thuwis – schlüpfen in die Rolle unterschiedlichster Winde. Mal schweben, dann wieder wirbeln sie über die Bühne, mal miteinander, dann wieder gegeneinander. Poetisch formulieren sie Gedanken, die – hätten Winde Hirn und Sprache – von diesen stammen könnten. Intensiv haben sie sich mit dem „Atem der Erde“ beschäftigt und sich in das ständige Wehen, das den Globus umzieht, hineinversetzt. Und nehmen auf diese gedankliche ebenso wie gefühlte Reise das Publikum mit – mal sanft und leise, dann wieder wild und sozusagen mitreißend.
Formwandler, der ich bin,
Aus dem Stück „Wind“ von makemake produktionen
hellblau unsichtbar.
Die Menschen sehen mich nicht,
aber sie sehen, was ich tue.
Zu diesem jüngsten Stück der (Tanz-)Theater- und Performance-Gruppe makemake produktionen – Text und Dramaturgie: Anita Buchart – gehört, auch wenn er oft am Rande steht oder sitzt gleichermaßen der Livemusiker (Saxofon und Keyboard) und Komponist Lukas Schiemer dazu. Das Quartett erzeugt in der nicht ganz einen Stunde ein Loblied, ja ein „Anhimmeln“ an den Wind, auch wenn uns der manches Mal lästig oder gar in Form von gewaltigen Wirbelstürmen grausam sein kann. So vielfältig Winde auch sein können, immer sind sie selbst unsichtbar, aber ihre (Aus-)Wirkung wird durchaus augenscheinlich. Und Wind vermag die Form von Gegenständen teils beträchtlich zu verändern.
Im Laufe der Performance erzählen die Tänzer:innen auch so manche Mythen, wie sich Menschen die Entstehung von Winden zusammengereimt haben. Aber auch so – im Rückblick betrachtet – eigenartige Vorgangsweisen der Menschheit, wie sie einerseits Wind auszuschalten versucht und andererseits ihn maschinell wieder herstellt, wenn sie Luftzüge braucht. Warum Wäschetrockner, wenn Wäsche auch in den Wind gehängt werden kann, beispielsweise. Oder das Verschwinden von Windmühlen, um seit noch gar nicht allzu langer Zeit wieder Windräder zu errichten, um Energie zu gewinnen…
Die Performance, mit der die neue Spielzeit im Dschungel Wien – in dem Fall für die Jüngsten (ab 5 Jahren) eröffnet wurde, liefert über das Beschriebene hinaus noch wunderbare Bilder – etwa mit luftgefüllten Folien oder 2 Kubikmeter Korkgranulat, das wirkt, als würde der Tanzboden mit Erde bedeckt und es ums Verwurzeln von Bäumen und viel lustvolles Spiel in derselben gehen. Als das Trio diese Granulat verteilte, reif ein Kind im Publikum: „Ich will auch…“
Der Eröffnungs-Samstag brachte in der Folge noch ein Stück ab 15, den U20-ÖSlam (Meisterschaft im Poetry Slam) und nicht zuletzt einen mehr als mitreißenden kurzen Auftritt des PowerDuos EsRap – weitere Artikel folgen hier.

Dass Menschen mit intensivem Blick auf ihr SmartPhone durch die Stadt gehen, hin und wieder stehen bleiben, ohne sich umzuschauen oder auf anderes zu achten als die Töne aus ihren Kopfhörern in welcher Form auch immer, ist nichts Besonderes. Selbst wenn sie in kleineren Gruppen vor einem Gebäude stehen lassen, hin und wieder auf dieses, dann wieder aufs Handy-Display starren – eher alltäglich. Vielleicht hören sie noch Infos zum Gebäude oder darüber, was in diesem alles passiert ist oder sein könnte.
Nun, zwischen 25. August und 3. September 2023 (vorerst) könnten es Teilnehmer:innen von „The Orlando Project“ sein. Du könntest/Sie können auch selber bei diesem (digitalen) künstlerischen Spaziergang mitmachen. Ausgehend von dem Roman „Orlando“ der berühmten britischen Schriftstellerin Virginia Woolf (1882 – 1941) haben Ece Anisoğlu und Julia Pacher – mit einer Reihe weiterer Künstler:innen (siehe Info-Box) ein komplexes digitales Theaterprojekt ausgedacht, konzipiert und organisiert.

An fünf – bewusst ausgewählten – Stationen sind auf den Displays über eine eigens dafür programmierte (noch nicht öffentliche) App digitale Kunstwerke zu sehen und mindestens genauso wichtig neu geschriebene Texte zu hören (in vier der fünf Stationen, in einer auf Englisch). Diese sind von Passagen des Romans an, in dem die Autorin einen breiten historischen Bogen baute. Denn ihr Orlando, der als junger Mann im 16. Jahrhundert zur Zeit von Königin Elisabeth, der Ersten, aufwächst, lebt deutlich mehr als 300 Jahre; zumindest bis ins Erscheinungsjahr des Romans 1928. Da fährt sie – denn irgendwann dazwischen wacht Orlando eines Tages als Frau auf – Automobil.
Diese Verwandlung von Orlando, der/die übrigens Autor/in ist und eine Biographie schreibt – gut 100 Jahre bevor genderfluid verbreitetes Thema wurde, war der inhaltliche Ausgangspunkt für das Künstlerinnen-Duo, das sich bei der gemeinsamen Arbeit im Theater in der Josefstadt kennengelernt hatte – Julia Pacher im Bereich Regie, Ece Anisoğlu als Bühnenbildnerin. „Dass diese Verwandlung schon vor 100 Jahren in der Literatur stattgefunden hat, hat uns beiden sehr gut gefallen“, sagt Erstere im gemeinsamen Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… Der Schreiber dieser Zeilen durfte bei einer Preview eine Woche vor der Premiere die Tour vom Schwedenplatz bis zum MuseumsQuartier mitmachen, es war – in der Theatersprache – die Hauptprobe 2. Als sie an diesem Projekt zu behirnen begonnen haben, so setzt Ece Anisoğlu fort, „wollten wir von Anfang an ein neues Format, eine neue Ausdrucksform schaffen. Wie können wir mit Hilfe von Augmented Reality, einem Bereich in dem ich schon jahrelang arbeite, Theater neu erzählen.“

Und deswegen lud das Duo in der Folge unterschiedliche Künstler:innen aus verschiedensten Sparten ein – vom Text-Schreiben über Video- und Visual Art (Kunst), Erzählkunst, Tanz und Performance. Ausgehend von jeweils einer der von uns ausgewählten Roman-Passagen „haben wir uns gemeinsam mit den dafür gesuchten Künstler:innen überlegt, wie die Geschichte vielleicht anders ausgedrückt werden könnte in Kombination von Text, Storytelling, Musik, Stadtbild, digitaler Kunst, die vielleicht Türen öffnen zu einer anderen Realität oder Sichtweise.“ (Ece Anisoğlu)
„Wir kommen beide aus dem klassischen Theaterbereich und wollten größer denken, und stärker interdisziplinär denken.“ (Julia Pacher)
„Mit dieser Digitalität können wir einerseits sozusagen den Bühnenraum stark erweitern, aber auch eine andere Wahrnehmungsebene erzeugen. Es war auch für uns selbst interessant zu entdecken, wie wir damit eine Magie oder Illusion erschaffen können. Die Stadt, die Gebäude haben schon eine Geschichte. Wir erzeugen künstlich etwas Zusätzliches.“ (Ece Anisoğlu)
Die beiden hatten die Idee schon vor der Pandemie, letztere erleichterte nur die Realisierung stark, weil es neue, zusätzliche Mittel aus dem Kunst- und Kulturbudget des Bundes für digitale Formate gab. Aus 800 Einreichungen in diesem „Topf“ wurden 26 ausgewählt und gefördert – eines davon ist „The Orlando Project“, weshalb die Tour für Kunst-wanderwillige kostenlos ist.
Die Texte wurden/werden in die Jetztzeit geholt, neu interpretiert, insbesondere aus heutiger Sicht doch längst problematische Sichtweisen von vor 100 Jahren werden zurechtgerückt. Die analoge Wanderung zu realen Orten und Gebäuden aus unterschiedlichen Epochen, erweitert um digitale Kunstwerke, dauert rund 1 ½ Stunden, beginnt mit kleinen virtuellen Kunst-Fenstern auf dem Display in der Griechengasse oberhalb des Schwedenplatzes, führt zu sehr fantasievollen 3D-Bäumen im Schweizerhof des Hofburgareals, zu denen der Text von den Gedichtschreib-Versuchen Orlandos über eine Eiche erzählt.
Station 3 führt zur Rückseite des Weltmuseums. Orlando ist in Konstantinopel, wo eines Nachts die Geschlechtsverwandlung stattfindet. Und sich sozusagen Unisex-Pluderhosen angezogen. Allerdings galt es für sie nun, sich mit der neuen Lage auseinander zu setzen…
Station vier beim Rosengarten im Volksgarten bringt einen Ausflug in ganz andere Welten – begleitet von einer Opernarie und der Abschluss im MuseumsQaurtier an der Seitenfront zum Architekturzentrum eröffnet eine völlig neue Dimension dieser Fassade im von Mariya Peleshko produzierten, von Manuel Biedermann animierten Video einer Performance der Drag Queen, Comedian, Mode-Kunst-Performerin Metmorkid (Mix aus Metamorphose/Verwandlung, Orchidee und Club Kid-Kultur.
Viel mehr sei jetzt aber nicht verraten – höchstens noch: Die Lektüre des Romans kann hilfreich sein, ist aber keinesfalls Voraussetzung, die hier eingangs beschriebene Grundsituation reicht. Und es ist jedenfalls empfehlenswert, sich auf die ohnehin recht kurzen (vier bis sechs Minuten) Videos und Texte einzulassen, um wirklich in diese Welten eintauchen zu können. Aber dann ist es ein spannendes, interessantes anderes Erleben von Verschmelzung von Stadt, Theater, Video, Audio, Performance in einer multimedialen Erzählung.

Wer bin ich? Bin ich vielleicht wie du? Oder gibt’s mich gar doppelt – einmal in klein, aus Schokolade oder als Eiswürfel? Beim künstlerischen Schaffen tauchen Jung- und Jüngst-Studierende an der kinderunikunst „nebenbei“ auch ins Philosophieren ein.
Klingt, pardon liest sich der Anfang vielleicht ein wenig verwirrend, so wird das natürlich hier in diesem Beitrag – mit vielen Fotos und einigen Videos – doch aufgelöst. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … besuchte nach dem Auftakt der Kinderuni Wien auch das kreative Gegenstück an der Universität für Angewandte Kunst am Oskar-Kokoschka-Platz, wo sich das künstlerische Schaffen der jungen Student:innen in der zweiten Woche konzentrierte. In der Woche davor waren andere Kunst-Unis und -Einrichtungen in Wien und Niederösterreich „Spiel“Orte der kinderunikunst – mit insgesamt rund 3000 Plätzen in 153 Kursen, Workshops, Ateliers plus vier Online-Lehrveranstaltungen.
Nun also zunächst zu den ersten Fragen. „Vorhang auf!“ heißt es die ganze Woche in einem Theater-Workshop. Mira Lobes und Susi Weigels „Das kleine ich bin ich“, das es auch in vier-, drei- und zweisprachigen Versionen gibt (zuletzt im Vorjahr auf Deutsch und Ukrainisch erschienen) bildet die Basis für das Stück, das die Kinder mit den Lehrenden (Anne und Julija) erarbeiten. Aber nur die Grundlage. Nilpferd wollte niemand sein und so dachten sich die Student:innen für diese Begegnung des Wesens das alle Tiere fragt, wer es sein könnte, Schildkröten aus. Statt Kühen gibt es Füchse und aus den Fischen wurden Orcas. UND es gibt zwei Wesen, die gemeinsam das kleine ich bin ich spielen: Frederica und Emma. Erstere erzählt Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… : „ich spiel gern Theater, wegen Corona sind in der Schule die Aufführungen jahrelang ausgefallen, in der vierten Klasse ist dann nicht mehr viel übrig geblieben. Hier hab ich die Chance gehabt, endlich eine Rolle mit viel Text spielen zu können. Das wollten auch andere, am Anfang waren’s sogar drei, aber jetzt spielen die Emma und ich die Hauptfigur, die auf andere Tiere trifft.“
Bei den anderen springen und laufen bei der Probe, die der Reporter sehen, filmen und fotografieren darf, vor allem die Pferde – Nora, Meta, Carla, Grete und Nives – lustvoll im Kreis. Bevor sie den beiden Suchenden sagen, dass diese keine Pferde sind. Am Ende – so viel darf schon verraten werden, weil es ohnehin keine Abschlussveranstaltung mit Präsentationen gibt, rufen alle laut, selbstbewusst und voller Lust, die Erkenntnis: Ich bin ich. Vielleicht sogar in mehreren Sprachen 😉
„Oder gibt’s mich sogar doppelt?“ – diese am Anfang gestellt dritte Frage bezieht sich nicht darauf, dass es zwei kleine Ich bin ichs gibt, sondern auf einen ganz anderen Workshop, einen aus dem Bereich Architektur namens „Gemacht aus Schokolade“. Bence, Janna und Luca scannen die einzelnen kinderunikunst-Student:innen dreidimensional, lassen die Köpfe aus weißem Filament ausdrucken. Und dann arbeiten die Kinder mit kleinen Zangen und Feilen, um die Stützpfeiler des 3D-Drucks weg zu zwicken, -feilen und den kleinen Kopf, dessen Gesichter wirklich gut zu erkennen sind, freizulegen. Ob das nicht ein komisches Gefühl sei, sozusagen am Ebenbild des eigenen Kopfes herumzufeilen, will der Journalist wissen. „Irgendwie fühlt sich der kleine Kopf wie ein Zwilling von mir an und ich hätte nicht gern, dass meine Schwester auf meinem Kopf herumfeilt“, lächelt Johanna Lani und schickt noch gleich die Erklärung nach, dass ihr zweiter Vorname Hawainisch sei und Himmel bedeute. Während sie und Flora ihre Gesichter freikriegen, suchen die Lehrenden mit dem letzten ausgedruckten Kopf, zu wem der kinderunikunst-Studenten der gehört, denn dass es sich um einen Bubenkopf handelt, haben sie schon herausgefunden.
Die kleinen Köpfe sind aber gar nicht das Endprodukt des Workshops, erklärt Bence. In der Mittagspause sägt er von einem langen Rohr lauter kleine Stücke ab und baut sie auf einer Platte auf. Mittlerweile pickt in jeder der kurzen Rohr-Stücke je ein Kopf, er rührt lebensmittelechtes Silikon mit einem „Vernetzer“ an, zwei der Kinder-Studentinnen lösen ihn beim Rühren ab. Die zähe Flüssigkeit wird in die Rohre rund um die 3D-Köpfe gegossen. Und muss über Nacht trocken und fest werden. Dann können die Kinder die Abguss-Formen ihrer Köpfe selber mit flüssiger Schokolade füllen oder zu Hause mit Wasser und ins Tiefkühlfach stellen um Eiswürfel, natürlich nicht-würfel, sondern Eis-Köpfe zu haben – oder was auch immer – jedenfalls mit ihrem eigenen Antlitz 😉
Fast klassisch, aber in ihren eigenen Fantasiewelten malen die Kinder mit Golnaz in „Faszination Illustration“ – mit abstrakten Wellen- oder Kreisformen erschaffen sie ihre Bilderwelten, die in den „warmen“ Farben sind schon fertig und liegen zum Trocknen auf dem Boden, nun sind die kälteren, die Blautöne dran…
Im Raum daneben spielt Farbe auch eine Rolle, aber nur eine unter vielen. Hier sind Mina, Livia, Sebastian und ihre Mitstudent:innen an der „Materialerkundung durch Malerei“. Mina hat vor sich einen aus Gips gegossenen kreisförmigen Hügel, den sie bemalt. Sie freut sich vor allem, „dass wir hier machen können, was uns einfällt und nicht wie in der Schule, was uns gesagt wird und dann schauen alle Bilder gleich aus. Kunst ist doch, wenn jede und jeder was Eigenes schafft!“ Und so werken die einen einfach drauflos und schauen, was dabei rauskommt, andere gehen nach Plan vor. Sebastian, der seine Kreativität auch schon vorher bei seinem kinderunikunst-T-Shirt ausgelebt hat, in dem er einen der Kurzärmel zerschnitten, verflochten und verziert hat, schneidet nun an einem Hasengitter, das er an eine kreisrunde Holzscheibe montiert hat und erklärt: „Das wird ein Vogelhaus. Ich bastle gerne, auch wenn ich finde, dass das nicht meine Stärke ist“, was angesichts seiner Geschicktheit doch verblüfft.
Zwei Tische bohren abwechselnd zwei der Kinder – der eine an einem Holzwürfel, damit er ihn bei seinem aus Holz und Gips gebauten Objekt auf ein wegstehendes Teil draufstecken kann, der andere an einem geringelten Kunststoffschlauch, der aus seiner Holz-Gips-Ablagefläche „wächst“.
Viel gemalt – aber ohne direkt mit Pinsel – wird auch noch in einem weiteren Workshop, in den Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… kurz hineinschaut. „Ich brauch doch keinen Pinsel“ läuft übrigens zweisprachig – Deutsch und Ukrainisch – ab. Pinsel werden höchstens dazu verwendet, Farbe aufs Papier zu spritzen, aber ansonsten wird viel mit in Farbe getunkten Fingern oder kräftigen Farbtuben selbst gearbeitet, sodass teils dreidimensionale Farbberge entstehen.
Die Bandbreite der künstlerischen Betätigungsmöglichkeiten bei der kinderunikunst ist riesig. Da dürfen natürlich Computer nicht fehlen. Vor großen Bildschirmen programmieren bei „Kunst mit Code“ die Student:innen meist kleine Spiele mit Scratch. Für die meisten ist diese bausteinartige Programmier-Tool schon aus der Schule bekannt – aus Informatik, digitaler Grundbildung oder wie in der Schule von Oskar und Nils wo es sogar ein Freifach Coding gibt. Nils erzählt dem Reporter: „Ich hab schon 76 Spiele programmiert, aber nur zwei hab ich veröffentlicht – als Nilgra.“ Haibecken und ein Geschicklichkeitsspiel kannst du auf der Scratch-Site finden und spielen.
Während die meisten zu Figuren und Objekten aus dem großen Angebot von Scratch greifen, zeichnet Oskar auf dem Computer Figur sowie Werkzeuge für sein Spiel „Hau den Putin“ selbst. Während des KiJuKU-Lokalaugenscheins arbeitet er gerade in einer stark vergrößerten Ansicht an dunkle- und hellgrauen Pixel für einen Schlaghammer.
Am Computer vor ihm programmiert die viersprachige Jana – Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch – ein Spiel, in dem eine Katze möglichst die durch die Luft fliegenden roten Herzen fangen muss/soll/kann/darf 😉
Wieder zurück zu handfesteren Materialien. Stolz hält Max dem Reporter, der auch fotografiert, seine Halskette in die Kamera, die er hier im Workshop „Aus Alt mach neu“, der jeden Tag unter einem anderen Motto steht, gebastelt hat. An diesem Tag stand Schmuck auf dem Programm. Knöpfe, Kügelchen, Schnüre, Draht und viele andere Materialien standen den Kindern zur Verfügung. Nachdem Max den Bann gebrochen hatte, kommen viele der Kinder-Student:innen und präsentieren Ohrringe aus alten Kaffeekapseln, Ringe, Armbänder, Ketten – und immer wieder eigenhändig aus Papier gefaltete Schuck-Schachteln – mitunter mit sauberen Putzschwämmen ausgelegt, in die sie die Drähte der kreierten Ohrringe einhängen. Manche Schmuck-Teile haben sie aus lackiertem Draht angefertigt, den sie sich nun von Claudia-Eva, der Workshopleiterin mit einem Heißkleber beispielsweise auf kleine Kunststoff-Schmetterlinge picken lassen, die wiederum auf Haarspangen oder andere ihrer hergestellten Schmuckteile draufkommen.

Bevor „Der Stoff, aus dem man Träume macht“ sich in knapp 1 ¼ Stunden dem übertragenen Sinn widmet, präsentiert sich die spätere gleichnamige Vorstellung von Zenith Productions für Theater und Musik sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes verträumt-stofflich: Zwischen den Publikumsreihen vor der Holz-Tribüne unter dem großen alten Baum im kleineren Innenhof des Wiener Volkskundemuseums stehen fahrbare Holzteile mit lilafarbenen Stoffen umwickelt, die sozusagen jeweils kleine Zellen bilden.
Das ganze Gebilde wiederum ist von zarten, durchsichtigen gitterartigen Stoffbahnen umhüllt. In diese „Zellen“ begeben sich als es dann wirklich (fast) losgeht, die meisten der Schauspieler:innen, schminken sich dort, führen letzte Aufwärmübungen durch und reden wie sie sonst vielleicht auch vor dem Aufritt bei den letzten Handgriffen an Kostüm und Maske.
Wer sich kurz umdreht, sieht im Eingangsbereich des Museums-Hofes einen gebückten, alten Mann in weitem Mantel mit dickem Buch unterm Arm. Der kommt langsam auf die Menschen unter den Vorhängen zu. Diese öffnen ihre „Verschläge“, wandern mit den fahrbaren Holzteilen in Richtung Bühne. Ebenso der Mann mit dem Buch.
Dieser, Kari Rakkola, von dem das Konzept und die Regie sowie – gemeinsam mit Roland Bonimair – die Bühnenfassung zu dieser Märchenstunde stammt, beginnt aus dänischem Original des Dichters Hans Christian Andersen zu lesen, teils mit Schwedisch gespickt. Und es taucht die verbindende Figur des Abends auf, eine junge Frau in weißem Kleid und nur in Socken – „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen“ (Linda Pichler). Natürlich mit riesigen Streichhölzern in der Hand. Und sonst nichts – bis ihr die sterbende Großmutter (Deborah Gzesh, die wie alle ihre Kolleg:innen mit Ausnahme Pichlers) in gefühlt mindestens ein Dutzend verschiedener Rollen schlüpft), überdimensionale Stoff-Schlapfen überlässt.
Wohlhabendere Bürger:innen, die sie um milde Gaben bittet, wimmeln sie mit häufig gehörten, gängigen ab: „Geb dir nix, das wäre gar nicht gut für dich“, „gemein, dass dich deine Eltern betteln schicken“… – ausgerechnet von jenen werden ihr solche Sätze an den Kopf geworfen, die ihr gerade noch die Schlapfen weggenommen haben! Die schon genannte Gzesh verwandelt sich nun in eine Sängerin, die mit einem bekannten jiddischen Lied über bitterste Armut, die Atmosphäre des Mädchens mit den Schwefelhölzern vom Einzelschicksal auf ein gesellschaftlich verbreitetes Phänomen erweitert.
Das Andersen-Märchen über das Mädchen mit den Schwefelhölzern wird zum Türöffner anderer Märchen. Jedes Mal, wenn die zu ebener Erd auf den kalten Steinen wandernde Schauspielerin ein Streichholz anzündet, öffnen sich oben auf der Bühne zwei der fahrbaren Holzwände. Vinzent Gebesmair, Deborah Gzesh, Kari Rakkola und Karoline Sachslehner spielen Kürzestversionen oder zentrale Szenen eines von mehreren Andersen-Märchens. Dazu zählen die bekannten vom „standhaften Zinnsoldaten“ mit nur einem Bein und natürlich „Des Kaisers neue Kleider“, in dem Betrüger dem aufgeblasenen Herrscher ein Nichts von Gewand als das prachtvollste verkauften, der Hofstaat sich nicht traute, die Wahrheit zu sagen. Das Kind aus Andersen Märchens ist in dem Fall das Mädchen mit den Schwefelhölzern, das „aber der ist ja nackt“ als Einzige zu sagen wagt.
Wie in einigen der Jahre zuvor, in denen Zenith Productions für Theater und Musik diesen idyllischen Hof bespielte – das Museum soll renoviert werden und der Hof damit für einige Jahre nicht zur Verfügung stehen – wird das schauspielerische Geschehen, immer wieder auch mit Stoffpuppen-Szenen, auf und rund um die Bühne mehr als nur untermalt von Live-Musik. Muamer Budimlić spielt praktisch durchgängig atmosphärische Klänge, die von schon genannten jiddischen Liedern über finnischem schamanistischem Rock bis zu Johann Sebastian Bach, Dada und Tango reichen. Und heuer bedient er, wenn er nicht mit Tasten und Knöpfen seines Akkordeons Melodien erzeugt, per kleiner Fernbedienung noch eine „Traummaschine“. Paul Skrepek hatte eine skurrile aus unterschiedlichsten Elementen bestehende fahrbare mechanische Klangmaschine mit Walzen und Nägel, Federn und Blaseblag und noch allem Möglichem gebaut, die klimpert und bläst, trommelt und pfeift – und das Traumthema wunderbar ergänzt.
Der Abend bringt darüberhinau weniger bekannte Märchen – „Der Tannenbaum“, der endlich groß sein will, um ein Schiffsmast oder in dieser Version ein Maibaum werden zu können und sich freut, wenigstens als Weihnachtsbaum gefällt zu werden. Aber bald nach dem Fest aussortiert wird. Rakkola griff auch Motive aus „Ove Lukøje“ (Ole Luk-Oie) auf und baute als einziges Grimm’sche Märchen „Die Sterntaler“ ein.
Letzteres ist die einzige Szene, in der sich das Schwefelholz-Mädchen in eine andere Protagonistin verwandelt – und aus der Armut kommt indem es die vom Himmel fallenden Sterne als Taler auffängt. Als himmlischen Lohn dafür, dass es zuvor als armes Mädchen das letzte Stück Brot mit anderen Armen ebenso teilt, wie Mütze, Hemd und Rock. Während es als Mädchen mit den Schwefelhölzern von Wohlhabenderen ja sogar um die eigenen großen Filzpantoffel gebracht wurde wie oben beschrieben. Mit diesem Bogen entkommt der traumwandlerisch-märchenhafte Abend auch der Gefahr der Romantisierung von Armut, weil das Mädchen ja mit jedem Feuerchen aus einem der Streichhölzer eine neue farbenfrohe Geschichte gesehen hat. Zu sehen – meist rund ums Wochenende bis 23. Juli 2023 – Details, siehe Info-Box unten am Ende des Beitrages.

Während noch gehörig an der selbstfahrenden, vollautomatischen Linie U5 in Wien gewerkt wird (ab 2026), gibt es kurzzeitig die „Linie Q“. Die führt in den Abgrund – oder Abgründe? Es handelt sich bei ihr um einen Mix aus Schauspiel, Performance, digitaler Schnitzeljagd, Elementen aus Escape-Room-Spielen, bezeichnet sich selbst aber – zu Recht – als „No-Escape-Room“ – mit ziemlich doppelbödiger Bedeutung.
Die erste Challenge für die interaktive Performance ist, den Veranstaltungsort zu finden. Die reine Ortsangabe würde schon eine ziemliche Herausforderung sein: In einem Teil der alten Wirtschaftsuni zwischen Spittelau (U4/U6) und dem Franz-Josephs-Bahnhof, dem sogenannten Magazin, steigt „Linie Q“ noch bis einschließlich 1. Juli 2023. Dieses erste Problem lösen die Veranstalter:innen mit einer Skizze auf der Homepage sowie vor Ort mit Plakaten und gelben Klebezetteln mit Pfeilchen.

Challenge Nummer 2: Der einzuscannende QR-Code, der für das erste Level des „No-Escape-Room“-Games erforderlich ist, um mitmachen zu können, führt nicht in jedem Browser zum Ziel. Aber auch da schaffen die Mitarbeiter:innen der Koproduktion von „Over 10.000“ und WuK performing arts Abhilfe: Sie unterstützen im Empfangsbereich beim Switchen bzw. Installieren der erforderlichen Ressourcen. Und wenn’s gar nicht klappen sollte oder jemand ohne Smartphone kommt, so gibt es eigens dafür bereitgehaltene Leihhandys.
Und dann geht’s auf. Oder doch nicht. Alle – die Teilnehmer:innen-Zahl ist auf knapp zwei Dutzend begrenzt – sind startbereit, die Spielleiterin Victoria Halper im schwarzen Arbeitsoverall kommt mit einem bedauernden Lächeln auf den Lippen: „Sorry, we are closed“, es gäbe Probleme mit dem Strom. Doch das glaubt ihr keine und keiner. Also geht’s doch los. In den ersten großen sehr dunklen Raum. Nun treten die Smartphones und das installierte Spielzeug in Aktion. Mit diesem gilt es megagroße QR-Codes zu scannen – die führen dich jeweils zu einem „Ticket“ für eine der Linien – rot, grün, braun… mit einer grafischen Streckenführung. Aber die ist nebensächlich. Nun gilt es, kleinere QR-Codes der jeweiligen Farbe zu finden. Damit landest du auf deinem Screen bei Fotos oder (Online-)Zeitungsartikeln über aktuelle Umwelt- und andere Probleme – von der Ölindustrie, die die Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm al-Scheich mit mehr als 600 Vertreter:innen gleichsam gekapert hat über gestiegene Energiepreise, die Inflation generell und viele mehr bis zu Gefahren Künstlicher Intelligenz.

Und die ist generell Teil der gesamten Performance. Denn Teile der Texte in den nicht ganz zwei Stunden haben sich die Künstler:innen (Konzept & Regie: Kai Krösche, Konzept & Ausstattung: Matthias Krische) von Chat GPT schreiben lassen. Übrigens auch einen Großteil des nachträglich verteilten Programm-Heftes; andere Texte stammen von Emre Akal bzw. James Stanson. Über Künstliche Intelligenzen ließen sich die Künstler:innen aber auch Bilder und Videosequenzen bauen sowie Entwürfe für die Kostüme erstellen. Und mit einer dieser Tools, die in den vergangenen Monaten rasant weiter entwickelt worden sind – was das Konzept dazwischen stark verändert hat – werden sogar Texte, die der Schauspieler und Musiker Simon Dietersdorfer eingesprochen hat in den Stimmen eines alten Mannes, zweier Frauen und eines Kindes.

Nach diesem Exkurs über das Zusammenspiel von kreativen Menschen und digitalen Werkzeugen auf der Höhe der Zeit zurück zur Performance. Neben der Informations-Schnitzeljagd über QR-Codes entlang der verschieden-farbigen Linien spielt sich auf dieser ersten Ebene in den Monitoren ein filmisches kleines Drama ab: Die U-Bahn fährt und fährt und der Protagonist als Fahrgast sollte schon längst am Ziel sein, tut es aber nicht. Zu dieser Story ließen sich die Macher:innen von Friedrich Dürrenmatts dystopischer, absurder Kurzgeschichte „Der Tunnel“ inspirieren – wie sich im Programmheft anmerken. In dieser checkt ein 24-jähriger Student, dass der Tunnel auf der Strecke, die er oft benutzt, an sich sehr kurz ist, an diesem Tag aber nicht und nicht enden will. Er kämpft sich vor bis zum Zugführer und mit diesem zur Lokomotive, die fahrerlos in den dunklen Abgrund rast. Dürrenmatt ließ in der ursprünglichen Fassung (1952) die Geschichte mit dem Satz enden: „Was sollen wir tun“ – „Nichts (…) Gott ließ uns fallen, und so stürzen wir denn auf ihn zu.“ In einer zweiten, 1978 veröffentlichten und mittlerweile verbreiteteren Fassung fehlt der letzte Satz; die Geschichte endet mit: „Nichts.“ (Quelle: wikipedia).

Hier führt das Rasen in den Abgrund zunächst nur die Stufen eine Ebene hinunter – die Performance ist – überall aber auch angekündigt – nicht barrierefrei. Hier finden sich Zelte und Zeltwände als mehr als halboffene Unterschlüpfe. Natürlich mit weiteren QR-Codes und Video- und Audio-Erzählungen – mit den oben schon erwähnten künstlichen, aber natürlich klingenden, Stimm-Verzerrungen, aber halbwegs gemütlichem Verweilen mit einem Mittelding aus Camping- und Notausrüstung bis der Satz fällt: „Die Zeit der Menschen ist vorbei!“

Worauf es nochmals abwärts geht, noch ein Stockwerk runter: In einer Art düsterer Großraum-Disco „predigt“ ein Mensch mit glitzernder Maske in rhythmischer, teils fast rappender Sprache an einem DJ-Pult die (Umwelt-)Sünden der Menschen wie in einer Art Jüngstem Gericht. Allerdings ist der Raum selbst an Wänden und Decke – nur der Boden nicht – mit Unmengen von Alufolie ausgekleidet. Vielleicht der sichtbare Ausdruck dafür, wie Anspruch und Wirklichkeit in Sachen Umweltschutz oft sehr weit auseinanderklaffen?
Wobei der Text in diesem Abschnitt aus Menschenhirn und -hand und nicht von einer KI stammt 😉
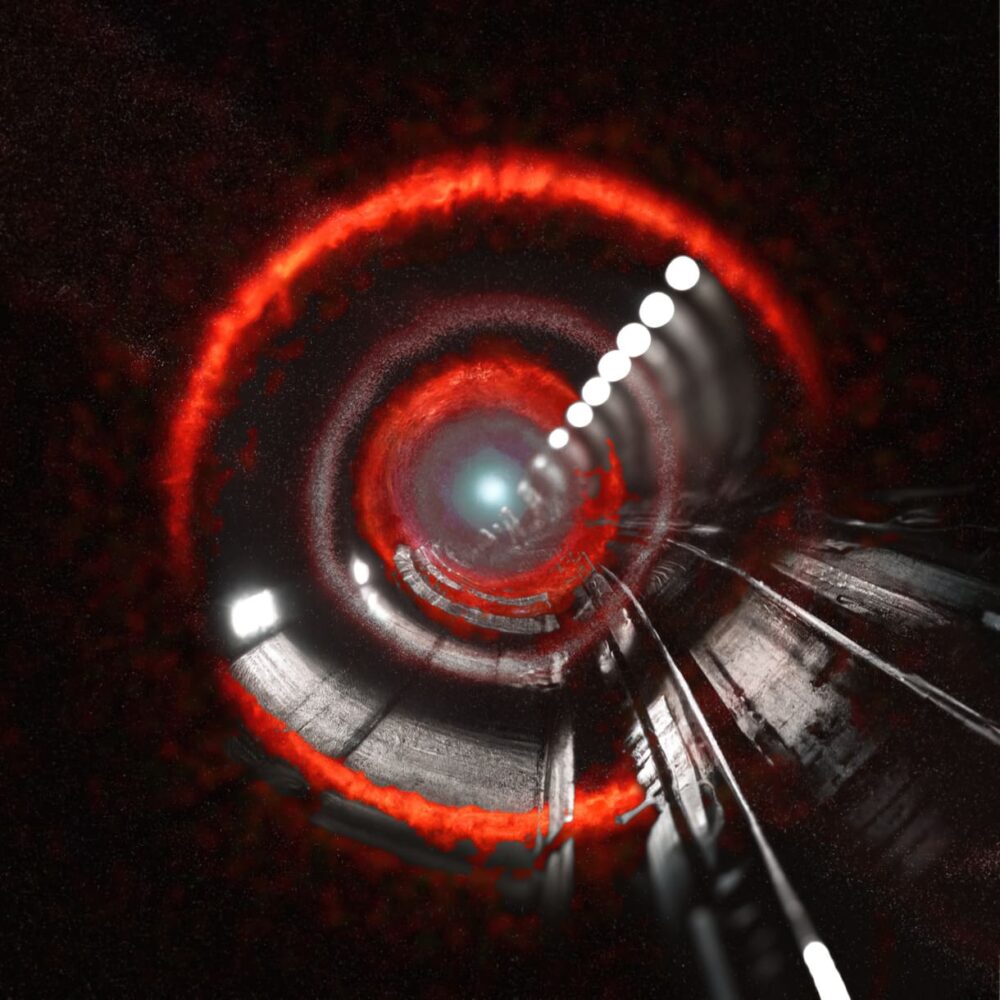

„Hör auf, unsere Karriereleiter zu essen! Du Holzkopf!“, sagt die Sockenpuppe Chisèl auf der kleinen Nebenbühne zu ihrem Sockenpuppen-Partner Hazel. Die Hände, um sie zu bewegen leiht ihnen Michael A. Pöllmann. Es sind sozusagen mit die ersten Worte und Bewegungen in diesem neuen Marionettentheater in der Oberpflanz (Deutschland). Dabei handelt es sich um das allererste feste Theaterhaus in Schwandorf, einer immerhin 30.000 Einwohner:innen-Stadt. Eigentlich liegt das Theater in Fronberg, das mit seinen nicht ganz 2000 Menschen seit 50 Jahren zu Schwandorf gehört (seit einer Gebietsreform 1972).
Wenig später begann der Schwandorfer Kunstlehrer Raimund Pöllmann mit Marionetten-Figuren, die er mit Schüler:innen im Werkunterricht und seiner Frau Christine baute, Stücke rund um Weihnachten zu spielen – meist im Dachgeschoss der „Kebbel-Villa“, dem Oberpfälzer Künstlerhaus, das gleich neben dem neuen Theater liegt.
Michael, meist Micha genannt, wuchs in Schwandorf, wohin die Pöllmanns gezogen waren, um vom Schulamt gemeinsam Stellen als Lehrer:innen zu bekommen, auf. Und war von Klein auf mit den Figuren, die an Fäden hängen und mit den Händen über hölzerne Kreuze bewegt werden, vertraut. Als Jugendlichen zog es ihn jedoch raus aus der Kleinstadt, zunächst nach Ulm zum Schauspielstudium. Und später nach Wien. Obwohl er selbst auf der Bühne spielte, zog es ihn später wieder zum Spiel mit Figuren und Objekten, die vor allem Scarlett Köfner designt und baut. Gerne arbeiten Scarlett Köfner und Michael Alexander Pöllmann in internationalen Koproduktionen z. B. mit den slowenischen Puppenbauer:innen Aleksander Andželović, Darka Erdelji und Primož Mihevc Köfner vom Puppentheater Maribor.
2019 übernahm Micha die Leitung des Schwandorfer Marionettentheaters und als die ehemalige Bankfiliale neben dem Künstlerhaus frei wurde, gelang es den Puppenbauer:innen den Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung für die Idee eines fixen, wie schon geschrieben, ersten Theaterhauses zu begeistern. Gespielt wird – ein breites Spektrum von Stücken – auf Wunsch der Puppenspieler:innen aus Schwandorf werden aller Voraussicht nach auch wieder alte Stücke der Eltern aufgenommen – immerhin gibt es dazu einen Fundus aus einigen Hundert Figuren. Pöllmann und Köfner verlegen ihren Lebensmittelpunkt aber nicht aus Wien nach Schwandorf, sondern kommen, um blockweise im neuen Theter in der Oberpfalz zu spielen und Workshops zu geben – ins Marionettenspiel aber auch in Upcycling.
„Pinocchio war als Eröffnungsproduktion aufgelegt. Wenn aus einem Stück Holz eine lebendige Figur wird, gibt’s nichts Besseres für ein Figurentheater“, so Pöllmann zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Auf Einladung des neuen Theaters reiste kijuku.at nach Schwandorf, um zu berichten.
Pöllmann und Köfner bauten aber nicht nur die Puppen und Objekte für das Stück, sie bauten auch das einstöckige Bankhaus in ein Theater um, vor allem der Raum über der Bühne ist ausgetüfelt. Von hier aus ziehen die Spieler:innen, teils ehemalige Schüler:innen von Pöllmann senior, der heuer 85 Jahre wird, die Fäden. An diesen hängen u.a. mehrere Pinocchios – einer sogar mit einem Spezialmechanismus, mit dessen Hilfe die Nase aus dem Kopf weit rausgefahren werden kann. Das Wachsen der Nase beim Lügen gehört einfach zu dieser klassischen Figur, die Carlo Collodi erfunden hat.
Ansonsten hat Michael A. Pöllmann eine doch eigene Version nach dem Original entwickelt, die zwar entlang der bekannten Geschichte aber mit fantasievolleren Ausflügen und Abweichungen erzählt. So wird die Fee praktisch zu so etwas wie der Mutter Pinocchios oder zumindest der Lebensgefährtin des Tischlers Gepetto, der ja doch der Vater des lebendig gewordenen hölzernen Jungens ist.
„Ein bisschen eigen sind wir schon, wir drei“, sagt Gepetto kurz vor Schluss.
„Fee: Wieso eigen? …
Pinocchio: Ein alter Träumer, eine blaue Fee und eine lebendige Holzpuppe.
Gepetto: Tja, normal ist anders.
Fee: Nein, anders ist normal.
Gepetto: Sind wir eben eigen. Normal eigen.
Pinocchio: Wie auch immer, Hauptsache zusammen…
… Fee: Ihr seid die allerschrägsten Typen dieser Welt..
Alle (3): Wir sind die besten Ruhestörer auf der Welt.“
Die eben zitierte Passage gegen Schluss des rund 1 ½-stündigen Stücks bringt stark den kompletten Bruch mit dem Grundtenor des Originals als Art „Erziehungsroman“ zum Ausdruck. Der schlug/schlägt sich nicht zuletzt in dem eher diskriminierenden Namen nieder, steht doch Pinocchio eher für Dummkopf (pinco = Dummkopf). Hier aber wird die Neugier des kleinen Jungen gefeiert und (nicht nur) sein Anders-Sein!
Zu den Abweichungen bzw. Erweiterungen gehört auch das schon eingangs zitierte Holzwurmpärchen als witzige Side-Kicks, die auf der kleinen Nebenbühne beginnen, mehrmals zwischendurch auf der großen Marionettenbühne in Erscheinung treten, mitunter das Geschehen in der Pinocchio-Geschichte kommentieren. Vor allem aber unterhalten sie sich über wertvolle Nahrung im hölzernen Theater, wobei Hazel (Haselnuss) sich von der französisch ausgesprochenen Variante des englischen Begriffs für Meißel (chisel) einbremsen lassen muss.
Die Stimmen – von Schauspieler:innen eingesprochen – kommen sozusagen vom Band. Das Marionettentheater gab darüberhinaus Musik in Auftrag, die Nele den Broek komponierte und die Liedtexte sang. Der erste Song orientiert sich an Bert Brechts und Kurt Weills „Dreigroschenoper“ – auch da die ersten Zeilen – von der Ausruferin Lucinola fast aufgelegt: „Und Gepetto hat ein Messer und das trägt er in der Hand…“
Compliance-Hinweis: Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wurde vom Marionetten Theater Schwandorf auf die Reise und den Aufenthalt in dieser Stadt eingeladen.

„Wenn wir der Erde etwas wegnehmen, müssen wir ihr auch etwas zurückgeben. Wir und die Erde sollten gleichberechtigte Partner sein. Was wir der Erde zurückgeben, kann etwas so Einfaches – und zugleich so Schwieriges – wie Respekt sein.“ Dieses Zitat von Jimmie C. Begay, vom Stamm der Navajo, einer der indigenen Gruppen oder First-Nations aus Nordamerika setzten Schüler:innen der HLW (Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe) aus Šentpeter/ St. Peter gemeinsam mit dem Slowenischen Kulturverein/ Slovensko prosvetno društvo Rož (SPD Rož) in Szene. Als zwei einander verfeindete Gruppen begannen sie mit weißen bzw. schwarzen Sesseln auf der Bühne der Kammerlichtspiele, eines Theaters in Klagenfurt bzw. Celovec wie die Kärntner Landeshauptstadt auf Slowenisch heißt.
Diese und einige andere (Schul-)Gruppen stellten Auszüge aus ihren Projekten im Rahmen von „Schule-Jugend-Theater/ Šolsko-mladinsko-gledališče“ im Rahmen eines internationalen inklusiven Theater-Treffens kurz vor dem Muttertag 2023 vor („Europäische und internationale Partnerschaften zur Entwicklung von Fertigkeiten zur sozialen Inklusion mittels Kreativität und Kunst“). Und damit wurden neben den beiden schon erwähnten Kärntner Landessprachen Deutsch und Slowenisch noch eine dritte sichtbar: Gebärdensprache.
Letztere wurde – neben der Live-Simultan-Übersetzung vor allem in einem Projekt mit einem fast unaussprechlichen Titel sichtbar: FeOSiMgSNiCaAl. Wer in der Schule schon Chemie hatte, könnte draufkommen. Es handelt sich um die Zeichen für die chemischen Elemente Eisen (Fe), Sauerstoff (O), Silizium, Magnesium, Schwefel, Nickel, Cadmium und Aluminium. Sie kommen am häufigsten auf der Erde vor. Einige der Schüler:innen dieses Projekts der Mittelschule 5 Klagenfurt-Wölfnitz / Srednja šola 5 Celovec-Golovica sowie der Volksschule 20 Klagenfurt-Viktring /Ljudska šola 20 Celovec-Vetrinj hatten die Kurzbezeichnungen auf ihre T-Shirts gemalt und zeigten in Gebärdensprache den vollen Wortlaut, den sie in Lautsprache wiederholten.
Der Umgang der Menschen mit unserem (Heimat-)Planeten und die drohende Zerstörung der Lebensgrundlagen desselben – für uns, aber auch viele Tiere und Pflanzen – war das Generalthema für diese Projekte zwischen Schule und (Theater-)Kunst). Der passende Titel wie er schon von vielen Demos der Bewegung Fridays für Future bekannt und doch hier abgewandelt wurde: „Es gibt keinen Plan(eten) B“/ „Plan(eta) B ni“. Dafür aber (er)fanden Kinder und ihre Pädagog:innen aus der VS Klagenfurt 1 / LŠ Celovec 1 sowie des Montessori Kindergartens Bunte Knöpfe / Montessori vrtec pisani gumbi den „Planeten E“ – für Erde, einmalig, einzigartig! Sie setzten dies in einen fantastischen Film um, in dem sie in wenigen Sekunden die Entstehung des Uni-was?, des Universums vom Urknall weg recht witzig schildern und einige sich in die Montur von Wissenschafter:innen in Labors begeben, die an umweltverträglichen und nachhaltigen Antrieben „forschen“. Für Schmunzeln bis Staunen sorgte ihr Zeichentrick-Antwort auf die selbstgestellte Frage, ob es Außerirdische gibt: „Zuerst schickten die Menschen einen Hund ins Weltall, das war damit der erste Außer-Irdische!“
Mit den Planeten unseres Sonnensystems setzten sich auch Kinder der Volksschule Nötsch / LŠ Čajna auf der Bühne auseinander. Wobei in dem Projekt „Katz im Sack III, Der Planet (B) auf dem Spiel“ gemeinsam mit der VS Bad Bleiberg / LŠ Plajberk pri Beljaku sowie der Mittelschule Nötsch-Bad Bleiberg / NSŠ Čajna/ Plajberk pri Beljaku und dem Bergmännischen Kulturverein Bad Bleiberg / Knapovsko kulturno društvo Plajberk pri Beljaku auch der alte vor 30 Jahren stillgelegte Blei-Bergbau mit ehemaligen Minenarbeitern zur Sprache kam. In diesem Projekt treffen wir auf einen „neuen Planeten“, den namens K – für Kinder.
„Lalü lala“ – die Sirenen eines Rettungsautos sind zu hören, als eine fast wildromantische Flusslandschaft im Bild zu sehen ist. Der Film dokumentiert das Projekt „Last Call“ (letzter Aufruf) des Lehrgangs der Kärntner Volkshochschulen / Koroška ljudska univerza) zur Nachholung des Pflichtschulabschlusses sowie von Schüler:innen der SOB (Schulen für Sozialberufe Wolfsberg – Šola za socialne poklice Volšperku). Die Jugendlichen machten sich auf und sammelten leere Getränkedosen, Plastikflaschen und anderen in der Natur weggeworfenen Müll – und beklebten damit einen riesigen aufgeblasenen Ball (Durchmesser: 2,5 Meter) als Symbol für unsere vermüllte Weltkugel, die nun in einem leerstehenden Geschäftslokal in der Kärntner Landeshauptstadt zur abschreckenden Besichtigung ruht.
Gemeinsam mit der neuebuehnevillach / neuebuehnevillach Beljak machten sich Jugendliche der Sportmittelschule Villach Lind / Srednja športna šola Lipa pri Beljaku auf ins Görschitztal. Erkundeten die Natur und ließen sich zunächst zum Thema Umwelt recht allgemein befragen. Unbeeinflusst sagten sie – in der filmischen Dokumentation gezeigt – ihre Meinung. Dann ging’s konkret um den vor fast zehn Jahren hier stattgefundenen Umweltskandal. HCB (Hexachlorbenzol), ein Wirkstoff, der Pilze oder ihre Sporen abtötet oder ihr Wachstum verhindert, wurde aus einer ehemaligen Deponie der Donau-Chemie freigesetzt, versuchte Grundwasser und in der Folge Nahrungsmittel. Und wurde zumindest monatelang von den Behörden verschwiegen.
Wo holten sich die Schüler:innen Informationen darüber – das war ein Teil des Projekts. Die meisten gaben an, aus dem Internet, ein paar hatten auch ihre Eltern befragt, sie selbst waren damals ja noch deutlich zu jung (aufgeflogen im Jahr 2014). Davon ausgehend ist im Film zu sehen, wie der Lehrer die Jugendlichen fragt, wo sie sich am informieren – bei Eltern, Lehrer:innen oder im Internet. Bei Letzterem gingen die meisten Arme in die Höhe.
Von da her schlug bei den filmischen Präsentationen im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung am Vormittage – bevor die oben schon geschilderten Szenen in den Kammerlichtspielen gezeigt worden sind – der Projektleiter von Schule-Jugend-Theater Šolsko-mladinsko-gledališče, Herbert Gantschacher, der gemeinsam mit dem u.a. für Bildung zuständigen Landesrat Daniel Fellner Urkunden an die beteiligten Schüler:innen und Lehrer:innen verteilte, den Bogen zum Thema im kommenden Schuljahr: Fake News.

Die Gäst:innen des schon genannten inklusiven Theater-Treffens – aus Polen, Israel, Schweden, Belgien, Deutschland und Österreich – ließen sich nach den Präsentationen der Schüler:innen und diversen Besichtigungen vor allem auf einen Workshop ein in dem sie Augen verbanden, Ohren zustöpselten und „blind“ und gehör-beeinträchtigt Gegenstände auf einem Tisch zu erkennen trachteten und im Gänsemarsch – Hände auf Schultern der jeweils davorstehenden Person – sich durch den Raum und Gang eines Gebäudes führen ließen.
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung konnte/kann nur erfolgen, weil Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … im Rahmen des EU-Projekts „Europäische und internationale Partnerschaften zur Entwicklung von Fertigkeiten zur sozialen Inklusion mittels Kreativität und Kunst“, in dem Österreich von „ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt/Salzburg/Wien, Österreich)“ vertreten ist, auf die Reise nach Klagenfurt eingeladen worden ist.

„Die härtere Komödie“ – so bezeichnet das Internetlexikon wikipedia „Muttertag“, den mittlerweile zum Kult gewordenen Film, der (fast) jedes Jahr rund um diesen zweiten Sonntag im Mai im österreichischen TV läuft und heuer seinen 30. Geburtstag feiert. Dass rund zwei Jahre vor dem Film dieses nummernkabarettistische bitterböse Stück mit überzeichneten Klischee-Figuren ein Bühnenwerk der Gruppe Schlabarett (Eva Billisich, Alfred Dorfer, Roland Düringer, Andrea Händler, Reinhard Nowak) war, weiß kaum noch wer. Auch nicht, dass der danach gedrehte Low-Budget-Film in den Kinos eher floppte.
Aber auch Kottan oder Mundl hatten anfangs alles andere als Erfolg. Die Bekanntheit des Kultfilms im Fernsehen und seine jährliche Wiederholung lockt(e) auch viele Zuschauer:innen ins Theater Forum Schwechat. Seit der Premiere beschert „Muttertag“ dem Theater knallvolle Publikumsreihen und Vorbestellungen. Noch wird (ca. 2 Stunden, eine Pause) bis 24. Mai gespielt – und es gibt nur mehr Restkarten.
Jene Altersschichten, die den Film – viele sicher mehrfach – gesehen haben, kommen mitunter schon mit dem einen oder anderen Spruch daraus ins Theater wie „I sog’s glei, i waor’s ned!“. Spätestens bei den Verabschiedungen wird das „Wiedaaschauauaun“ entsprechend lang gezogen mit einem sarkastischen Unterton – aufgefrischt durch die Aufführung, die auch einige jüngere Zuschauer:innen ins Theater lockt, die bei der Geburtsstunde des Kabarettprogramms noch gar nicht auf der Welt, meist nicht einmal noch geplant waren.
Das Bühnenstück in Schwechat spielt nicht 1:1 den Film, aber auch nicht die alte Kabaretttheater-Version nach, orientiert sich aber sehr daran, auch am Ablauf als aneinander gereihte Nummern, die dennoch einen dramaturgischen Bogen ergeben. Das alte Postamt mit Wählscheiben-Telefon und gleichzeitig Sparkassa feiert ebenso fröhliche Urstände wie das Treffen der Jungschargruppe mit den pubertierenden Jugendlichen und der strengen auf Seriosität bedachten Gruppenleiterin oder der Drogeriemarkt, in dem die Frau Neugebauer vom Detektiv als Ladendiebin entlarvt wird, während ein anderer „Konsument“ mit prall gefülltem Mantel „nur schauauaun“ war. Als Abschluss und sozusagen Höhepunkt die „Muttertagsfeier“ von Ehemann, Sohn und Opa für „Trudl“ Neugebauer auf dem Balkon der Gemeindwohnhausanlage Schöpfwerk (im Film, in Wien-Meidling). Wo alles aus dem Ruder läuft. Und gut und gern auch gespoilert werden könnte, ist doch den meisten alles bekannt. Aber vielleicht gibt’s doch die eine oder den anderen, wer’s noch nicht weiß, und trotzdem auch noch Spannungsmomente erleben möchte – daher seien die Eskalationen doch nicht verraten!
Zu sehen und erleben sind – in der Regie von Andy Hallwaxx: Die künstlerische Leiterin des Theaters, Manuela Seidl, die die legendäre Postbeamtin, die eher auf Sperrschluss pocht, die Jungscharleiterin sowie Trudl, die Ehefrau, Mutter und Schwiegertochter der Familie Neugebauer spielt. Evelyn Schöbinger, mit der alle Männer gern eine Affäre hätten/haben, wird von Adriana Zartl verkörpert, die u.a. auch in die Rolle einer der Jungschar-Jugendlichen schlüpft.
Hubert Wolf – der wie seine Kolleg:innen und wie seinerzeit die Ur-Besetzung viele Rollen dasrstellt, überzeugt vor allem als Opa Neugebauer mit (vorgegebener) Schwerhörigkeit, (gespielter) Senilität und bitterböser Wehr gegen die drohende Abschiebung ins Heim sowie das Auseinanderfliegen der Familie. Seinen Enkel Mischa und damit Sohn von Trudl und Edwin Neugebauer gibt Olivier Lendl, der u.a. auch den Dieb mit weitem Mantel, der „nur schaut“, spielt.
Last but not least zu nennen ist Reinhard Nowak, der auch schon in der Original-Partie vor 32 Jahren auf Bühnen und dann zwei Jahre später im Film dabei war – und hier in seine alten Rollen schlüpft, vor allem den Kaufhausdetektiv Übleis sowie Edwin Neugebauer, der auf braver Ehemann tut und dennoch eifersüchtig auf seinen Kumpel Garry ist, der mit Evelyn Schöbinger – so wie er selbst – eine Affäre hat.
Gerade die Balkonszene am Schluss lässt trotz ihrer bitterbösen Ironie die Frage aufkommen, ob hier (Geschlechter-)Rollenklischees lächerlich bloßgestellt oder gar „nur“ lustig weitergetrieben werden?
Wie auch immer: Im Programmzettel zu „Muttertag“ kündigt Theater Forum Schwechat an: „Wir schreiben eine Fortsetzung – Vatertag – die Frauen schlagen zurück. Realsatire: Was die Männer können, können die Frauen schon lange und wenn sich der Opa auf den Willi setzt, macht die Oma ihn mit ihren Gesangskünsten fertig. Eine Antwort auf Muttertag, nur über 30 Jahre später! Alles hat sich geändert, die Emanzipation hat Einzug gehalten, es wird gegendert, was das Zeug hält, aber haben wir uns tatsächlich weiterentwickelt?“
Sogar die Premiere ist schon angekündigt: 4. Mai 2024, 20 Uhr

Schon im Hintergrund eine Art Schnürl-Vorhang – aus lauter aneinander geknüpften Plastikflaschen und an einem seitlichen Bühnenrand stehende aufblasbare Sitzmöbel deuten das Problem an, um das sich „Es zieht!“ drehen wird. 14 Kinder und junge Jugendliche bespielen – eingebettet in eine Geschichte rund um eine Party – das Thema Plastik(müll).
Die jungen Darsteller:innen haben mit ihrer Regisseurin die ganze Saison in einer der vier Theaterwild:Werkstätten – wie die anderen drei – das Stück gemeinsam erarbeitet. In dieser Werkstatt namens „Wildwuchs“ haben sie sogar für das Bühnenbild und die Requisiten gesammelt – die Flaschen – im Laufe der rund 50 Minuten werden fast Unmengen von solchen auf die Bühne rollen und fallen.
Auswirkungen dieser Vermüllung auf die Welt(meere) spielen sie in verschiedenen Szenen, die – durch Blacks getrennt – ins Party-Spiel eingebaut sind. So schwimmen die meisten der jungen Theaterleute als Fische über die Bühne und beißen sich an Plastikstücken – von anderen gespielt – tot.
Aber auch die Party selbst – mit Freund- und Feindschafften, dem Auftreten unterschiedlichster Typ:innen – einer Hilfsbereiten ebenso wie zweier reicher Schwestern, die allen zeigen wollen, was sie sich alles leisten und sozusagen auch die Welt kaufen könnten – hat einen bitterbös-sarkastisch-witzigen Höhepunkt: Eine der Gäst:innen bietet Luft in Sprayflaschen an, dafür gibt’s kein Trinkwasser mehr und das regionale Bio-Buffet bleibt praktisch unangetastet.
Trotz der Schwere der Themen ist „Es zieht!“ – der Titel klärt sich erst am Ende und soll hier natürlich nicht verraten werden – wird das Stück recht witzig werden – Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte eine der letzten schon durchgängigen Proben sehen, weil zur Aufführungszeit nicht anwesend. Für den Humor sorgen einerseits der Spielwitz der jungen Darsteller:innen als auch die überspitzt präsentierten zugespitzten Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Erde, von der es keinen Ersatz also keinen Planeten B gibt. Dass sich das Publikum aber nicht nur gedanklich damit auseinandersetzen soll, dafür sorgt ein aktionistisches Ende – das natürlich nicht gespoilert werden soll.
Auch die anderen drei Theaterwild:Werkstätten im Theaterhaus für junges Publikum haben sich intensiv mit der Klimakrise auf Menschen und Natur auseinandergesetzt. Die szenischen Ergebnisse der monatelangen Workshops sind nun beim Festival – bis 12. Mai 2023 (manche aber nur bis 6. bzw. 9. Mai) zu erleben – siehe Info-Box.

Sarah-Ann Neugebauer und Marie Keller stehen mit fetten Kopfhörern auf den Ohren vor einer der seitlichen Türen des gerammelt vollen Publikumssaals im Theater Akzent. Als Geschwister Laskera und Lesina beginnen sie zu schwingen. Offenbar hören sie tanzbare Musik. Der große rote Bühnenvorhang ist noch zu. Nun kommt Musik – offenbar jene, die die beiden schon über ihrer Kopfhörer vernommen hatten, auch aus den Lautsprechern, die beiden tanzen durch die Gänge zwischen den Zuschauer:innen-Blöcken, nähern sich der Bühne, auf der ein gelbes Seil wie eine Schlange liegt. Die beiden betreten die Bühne, der Vorhang öffnet sich und gibt die Blicke frei.
In der Mitte auf einem Podest steht eine weißgekleidete Frau mit urururur….langen „Haaren“, goldgelben, die sich links und rechts auf der Seite der Bühne bis zum vorderen Bühnenrand über den Boden schlängeln. Sara Willnauer stellt sich als Hüterin der Zeit vor – begleitet von etlichen ebenfalls weiß gekleideten Tänzerinnen und Tänzern. Das Spiel kann nun voll beginnen. „Der Goldene Faden“ heißt die aktuelle Produktion der inklusiven Tanzstudios „Ich bin O.K.“, die am Welt-Down-SyndromTag (21. März) ihre erste Aufführung vor Publikum erlebte, die Vorpremiere vor viiiielen Schülerinnen und Schülern. Die spendeten immer wieder spontan auch zwischendurch Szenenapplaus. Und nach rund eineinhalb Stunden als manche schon das vermeintliche Ende empfanden „Zugabe! Zugabe!“-Rufe. Was die Tänzer:innen insofern gaben, weil das Stück noch eine ¼ Stunde weiterging.
Die beiden – eingangs genannten – Geschwister führen durch das Stück, das die Kinder und Jugendlichen in einem wochenlangen Prozess selbst entwickelt hatten. Alles dreht sich um Streit. Immer und immer wieder geraten – ausgehend von Königin (Stephanie Platzer) und König (Severin Neira) Kinder, Hofstaat und alle aneinander, mehr oder minder heftig. In einer langen, abenteuerlichen Reise gelangen die Geschwister, die selber auch anfangen zu streiten in ein Labyrinth, das sie durchqueren müssen, um den magischen Kristall zu finden. Mit dem können Streithansl und -Gretl, sprich Königin und König, sie grün, er lila gekleidet, in die Zukunft schauen, wie sie der Streit zu Gewalt und Krieg weiterentwickeln würde.
Doch so schnell lernen sie nicht daraus. Es kommt zu mehreren Rückfällen ins alte Verhaltensmuster bis sie … – natürlich gibt es ein Happy End – gefeiert mit einem Friedensball, nachdem das Monarch:innen-Duo sich zuvor noch einmal gestritten hat ob Friedensfest oder Versöhnungsball. Ach ja, und die Geschwister befreien die beiden auch von ihren Kronen, die nun reihum alle paar Augenblicke wer anderer auf dem Kopf trägt – kein herrschendes Paar mehr, sondern gemeinsam bestimmen alle mit.
Weitere Aufführungen bis 30. März sowie zwischen 17. und 23. April 2023 im Theater Akzent – siehe im ausführlichen Info-Block, in dem auch alle Mitwirkenden auf und viele hinter der Bühne angeführt werden.
Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat schon ausführlich von einer Probe berichtet – zu diesem Bericht und einem Interview mit einer Darstellerin, die in mehrere Rollen schlüpft, hier unten.

Eine große runde Scheibe schwebt im Hintergrund über dem Geschehen. Zwei gemalte f-Löcher (die Form der Schalllöcher von Streichinstrumenten) erinnern hier in ihrem Zusammenspiel entfernt vielleicht an ein Herz. Oder die Flügel eines Schmetterlings. Darunter begrenzen zwei gebogene Wände die kleine große Welt von Eva, ihrem nur fallweise in Erscheinung tretenden und doch präsenten Ehemann Viktor. Und vor allem Evas Mutter, Charlotte Andergast.
Letztere kommt – nach sieben Jahren erstmals – ihre Tochter besuchen. Und wie. Sie fährt glich mit einem riesigen Koffer, der gleichzeitig zum Bett und einer Art liegendern Telefonzelle wird (Bühne: Raoul Rettberg, Produktions-Assistenz: Alice Gonzalez-Martin) auf. Durchgestylt (Kostüme: Anna Pollack) ist die weltberühmte Konzertpianistin Andergast (Brigitte West) eine Erscheinung. Alles ist Bühne für sie. Die Tochter (Dana Proetsch) eher Statistin.
Das Verhältnis zwischen den beiden ist das bestimmende Thema von „Herbstsonate“. Erstmals ist dies nun als Stück im Wiener Theater Spielraum zu erleben. Grundlage ist das literarische Drehbuch von Ingmar Bergman, dessen gleichnamiger Film vor 45 Jahren erstmals im Kino zu sehen war – es war der letzte Film, in dem Ingrid Bergman (Charlotte) spielte, in der Rolle ihrer Tochter Eva war Liv Ullmann zu sehen, die übrigens eine Zeitlang mit dem Filmregisseur verheiratet war.
Als Gerhard Werdeker, Co-Leiter des Theaters Spielraum (Wien-Neubau), den Film damals sah, „wusste ich, daraus will ich einmal ein Stück machen. Manche Idee brauchen Zeit für die Umsetzung. Und die richtigen Schauspieler:innen, in dem Fall vor allem für die Rolle der Charlotte“, verriet er am Rande einer der letzten Proben Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…
Es ist übrigens das erste Mal, dass dieses Theater ein Stück nach einem Film produziert. Ansonsten sind es vorhandene, oft ein wenig in Vergessenheit geratene, Theaterstücke oder literarische Texte, die die Basis für die Stücke hier bilden – praktisch immer mit einem auch in die Gegenwart reichenden wichtigen gesellschaftspolitischem oder gesellschaftlichem Thema. Hier nahm sich Werdeker, der das Stück inszenierte, übrigens die englische Übersetzung des Drehbuchs und das schwedische Original her, um daraus die viel getreuere Spielfassung als die vorhandene deutsche Übersetzung, zu schreiben.
Charlotte rauscht an nachdem ihr Lebensgefährte Leonardo gestorben ist. Die Tochter hat zwar Angst vor dem Zusammentreffen nach so langer Zeit, freut sich aber trotzdem. Freude auch bei der Mutter, aber nur gespielte. Gleichzeitig strahlt sie aus, dass ihr dieser Besuch lästig ist. Zuhören kann und will sie ohnehin schwer. Gibt es überhaupt jemanden außer ihr?
Sehr krass auch jene Szene relativ zu Beginn des Besuchs, in der Charlotte ihre Tochter bittet, am Klavier zu spielen. Während – aus dem Off – Frédéric Chopins Prélude Nr. 2 in a-moll ertönt, schafft es Brigitte West in der Rolle der Charlotte mit allerhand Grimassen mehr als überdeutlich zu signalisieren, wie ihr das Spiel der Tochter missfällt. Aber auch jede andere nur halbwegs bemüht nette Floskel konterkariert sie durch ihre Körpersprache und Mimik. Einfach arg, fast unerträglich spielt West das – wenngleich doch mit einer leichten Nuance von Distanzierung. Aber doch so heftig, dass sich insbesondere die Mitspielerin nach der gelungenen Hauptprobe, die der Journalist besuchen durfte, bemüßigt sah, zu versichern: „In Wahrheit ist die Brigitte wirklich eine ganz liebe Kollegin“. Und alle anderen – vom Regisseur bis zur Theater-Co-Leiterin Nicole Metzger, die in diesem Fall das – wie immer umfangreiche, hintergründige – Programmheft gestaltet hat, pflichteten ihr bei.
Allein schon die Tatsache, dass Eva ihre Schwester Helena aus dem Behindertenheim nach Hause geholt hat, nervt die Mutter. Diese Tochter tritt übrigens immer nur indirekt – durch den leuchtenden Mond – das Licht (Tom Barcal) verwandelt den eingangs beschriebenen Kreis zu einem solchen sowie den Erzähler auf. Den verkörpert – ebenso wie Evas Ehemann Viktor -, Christian Kohlhofer.
Natürlich schaukelt sich die Situation auf. Nach und nach ringt sich Eva durch, zu sagen, wie sie als kleines Kind und später als Teenager die Mutter erlebt hat. In einer Szene sagt sie klipp und klar: „Ich weiß nicht, was schlimmer war: die Zeit, die du zu Hause warst und Ehefrau und Mutter gespielt hast oder die Zeit, wenn du auf Tournee warst.“
Zunehmend traut sich die Tochter die Mutter dafür anzuklagen, was sie erleiden musste – und dabei leidet sie die Ignoranz, die psychische Vernachlässigung nochmals durch, was Dana Proetsch insbesondere in einem der längeren Monologe auch definitiv spüren lässt.
Doch wirklich berühren lässt sich die Mutter davon nicht. Es wird ihr nur zunehmend unangenehm, so dass sie einfach früher wieder abhauen will. Dafür ruft sie ihren Agenten an, der möge doch ein Telegramm schicken, in dem ein gaaaanz wichtiger neuer Termin für die Pianistin anstehe. Und obwohl Eva offensichtlich dieses Telefonat unabsichtlich mitbekommt, fühlt sie sich am Ende schuldig, die Mutter vertrieben zu haben – fast das Drama eines begabten Kindes, wie es die populärwissenschaftliche Psychologin und Autorin Alice Miller immer wieder nannte, wenn Kinder zwanghaft unausgesprochen Wünsche ihrer Eltern (über-)erfüllen.

Vierundachtzig (84) – hat sich als DIE Zahl für Dystopien etabliert. Weil George Orwell seinen Roman „1984“ über einen auf totale Überwachung und schönfärberische Umbenennungen basierenden Staat 1948 fertig geschrieben hatte, verwendete er den Zahlendreher für seinen Titel. Vor knapp einem Jahrzehnt veröffentlichte Jostein Gaarder (bekannt nicht zuletzt von „Sofies Welt“) „2084 – Noras Welt“, das er in einem Interview mit dem hier schreibenden Journalisten und zwei jugendlichen Schnupperschülerinnen „nicht meine bestes, aber mein wichtigstes Buch“ nannte. Klimawandel, dystopische Vorstellungen vernichteter Natur und ein Brief aus der Zukunft an die vor zehn Jahren lebende Urenkelin Nora, um aufzurütteln – Link zu diesem Artikel am Ende dieses Beitrages.

Nun switchen wir mit „Theater Ansicht“ ins Jahr 4084 zur Performance „Coming Soon“. In den Ottakringer SoHo-Studios (Details siehe Info-Block) spielen, singen und tanzen zwei Darsteller:innen in goldenen großen „Babystramplern“ (Christoph-Lukas Hagenauer und Johanna Ludwig) und in der selben Farbe geschminkt zwischen künstlerischen Ausstellungsobjekten und Bildern von archäologischen Ausgrabungen unserer Gegenwart. In federnden Gängen und einer mit englischen Einsprengseln irgendwie vorarlbergisch gefärbten Sprache, begrüßen sie das Publikum und beziehen es in der Wanderung zwischen den Bildern und Skulpturen immer wieder mit ein.
Die Besucher:innen sind Menschen aus der mehr als 2000 Jahre zurückliegenden Vergangenheit, also der Jetztzeit. Lange tiefgefroren, eben wieder aufgetaut, sollen sie für die beiden Forscher:innen das Mysterium erklären, haben sie den Planeten zerstört (Ökozid) oder konnten sie das doch aufhalten?
Wobei dieses „Vehikel“, um auf die aktuelle umweltzerstörerische Handlung – eines Teils der Menschheit vor allem des globalen Nordens – aufmerksam zu machen, aufzurütteln, zum Handeln, um die Klimakatastrophe zu verhindern, vielleicht doch ein bisschen zu pädagogisch kommt (Konzept und Co-Regie: Julia Meinx, Flo Staffelmayr). In mehr als 2000 Jahren wird es wohl zu sehen, merken, erleben sein – was der Menschheit ge- oder misslungen sein wird. Die Anstupser zum Nachdenken sind hin und wieder aber auch ironisch verpackt.
Als dritte im Bunde schieben die beiden eine – nicht gold-gefärbte – Kollegin (Katja Herzmanek) in einem durchsichtigen Kobel – von den Theaterleuten „Mama-Mobil“ (als Gegenstück zum päpstlichen Papa-Mobil) genannt – ins Geschehen. Die aus ihrer Vitrine vor allem fast ohrwurmartige Songs liefert, die draußen aufgenommen werden und mitunter recht sarkastisch den Weg in den Weltuntergang besingen. Aus dem Ton-Regiepult im Hintergrund löst sich gegen Ende auch die Musikerin und Co-Regisseurin Julia Meinx, um mitten im Geschehen einen Song mit Gitarre zu begleiten.
Das Publikum wird immer wieder direkt angesprochen, in 1, 2 oder 3-Manier gebeten sich zu entscheiden – etwa ob die Welt an Kriegen, Krankheiten oder der Klimakrise zugrunde gehen werde. Wobei die Welt, der Planet wird so und so noch Milliarden Jahre überleben – die Frage ist nur, ob mit Menschen oder ohne – und damit einer Reihe von Tierarten, die wir, wie schon viele, mit-ausrotten.
Interview mit Jostein Gaarder – damals noch im Kinder-KURIER

Itzik Hanuna ist ein Schauspieler im Theater Na Laga’at in Jaffa, dem südlichen, arabischen Teil von Tel-Aviv (Israel). Und das seit Langem, obwohl der 59-Jährige in dieser Profession erst ein Spätberufener ist. „Eigentlich wollte ich gar nicht Schauspieler werden, aber das Theater hat mich vor vielen Jahren gefragt. Und ich hab dann doch zugesagt“, erzählt er den Vertreter:innen des internationalen Projekts, das sich mit Inklusion durch Kreativität und Kunst beschäftigt (Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat mehrfach berichtet – Links unten am Ende dieses Berichts).

Der 59-Jährige stellt im Workshopraum des Theaters den Teilnehmer:innen aus Schweden, Belgien, Polen, Deutschland, Österreich und natürlich Israel (aber die kannten ihn und das schon) sein erstes Buch vor. Mit den Fingern streicht er über die weißen Seiten mit erhabenen Punkten – in Braille-Schrift. Hanuna wurde blind geboren. Im Alter von ungefähr elf oder 12 Jahren verlor er aufgrund einer Meningitis-Erkrankung auch sein Gehör. Die Lautsprache hatte er da natürlich schon lange verwendet. Aber wie kommen Fragen, wie anderes Gesagtes an ihn?
Dazu entwickelten er und das sehr auf Inklusion bedachte Theater eine eigene Sprache. Neben ihm sitzt bei der Buchpräsentation Neta Yona von Na Laga’at und tippt auf die Handrücken des Schauspielers – und Autors. Im Gegensatz zum Lormen, das oft von Taubblinden zur Kommunikation mit anderen verwendet wird, nicht auf die Hand-Innenflächen, sondern außen. Da Itzik Hanuna sein Leben lang schon in Braille las und schrieb, erfanden er – und seine Kolleg:innen eine Art getastete Braille-Schrift auf beide Handrücken – Glove-Language Handschuh-Sprache) nannte das die Theatermanagerin Efrat Steinlauf.

Wie schon im Artikel „Vom Mitleid zur Bereicherung“ angeführt, versteht sich Na Laga’at als inklusives Kulturzentrum – auf Augenhöhe von Menschen mit und ohne Behinderung(en) -, mit 70 der 100 Beschäftigen, die gehörlos, blind oder beides sind. Und dies auch in Leitungsfunktionen, u.a. fast „natürlich“ in der Abteilung für Accessability (Zugänglichkeit). Es soll nicht nur in den Vorstellungen und Workshops fürs Publikum, sondern auch im eigenen Betreib auf Barrierefreiheit und Inklusion geachtet werden. Und so bot das gastgebende Theater den internationalen Gäst:innen auch einen Workshop in israelischer Gebärdensprache an – denn, was viele oft nicht wissen, Gebärdensprachen unterscheiden sich auch – oft nicht so stark wie Lautsprachen aber doch.
Parallel zum oben genannten EU-Projekt fand in dem Theaterhaus am alten Hafen von Jaffa- Tel-Aviv ein – aus einem anderen EU-Projekt unterstütztes Festival – Theater ohne Grenzen – statt – auch darüber berichtete KiJuKU schon. Und eine Diskussion und Präsentation verschiedener Theater- und Kulturprojekte mit unteschiedlichen, durchaus auch gegensätzlichen Zugängen. So setzte die Leiterin des schwedischen Riksteatern-Crea, Mindy Drapsa, auf ausschließlich gehörlose Künstler:innen und bezeichnete gehörlose Schauspieler:innen, die mit hörenden Regisseur:innen arbeiten würden als Marionetten. Der Vertreter aus Österreich, Gründer und Leiter von Arbos – Gesellschaft für Musik und Theater, Herbert Gantschacher hingegen sprach sich für die gleichberechtigte Zusammenarbeit hörender und gehörloser Künstler:innen aus.
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung konnte/kann nur erfolgen, weil Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … im Rahmen des EU-Projekts von ARBOS auf diese Reise eingeladen worden ist.
und hier
Bevor die Vorstellung beginnt, wird kurz ein Podest vor die Eingangstür in den Theatersaal aufgestellt. Zwei Leute besteigen es, Yaroslav Bernatsky hält aus einer Mappe groß gedruckte Wörter in Hebräisch und Englisch in Richtung der versammelten Zuschauer:innen, Alaa Arafeh übersetzt Willkommen, Bitte, Danke, Applaus und den Namen des Theaters und Inklusionszentrums Na Laga’at in (israelische) Gebärdensprache. Die ist hier in der ehemaligen Lagerhalle am alten Hafen von Jaffa allgegenwärtig.
Gehörlose ebenso wie blinde Schauspieler:innen und Tänzer:innen performen hier praktisch täglich. Ausgehend von einer Gehörlosen-Theatergruppe vor fast 20 Jahren entwickelte sich das Theaterhaus, das zuerst nur für die eigene Community ein wichtiger Treffpunkt war, bevor es unter neuer Leitung sich bewusst nach außen öffnete. Immer wieder kommen Besucher:innen vielleicht mit einer mitleidsvoll-gönnerhaften Einstellung zu Vorstellungen und verlassen mit Schamgefühl über die eigenen Vorurteile einer- und bereichert durch eindrucksvolle Aufführungen andererseits das Theaterhaus.
Mit manchen Aufführungen tourte das Theater durch mehr als die halbe Welt, Stücke wurden von mehr als einer Million Menschen gesehen. Famos „Brot“, in der ausgehend vom Bibelspruch, dass „der Mensch nicht vom Brot allein lebt“ der gesamte Vorgang vom Herstellen des Teigs bis zum Backen des Brots live auf den Bühnen vor sich geht. Die anfangs mit Masken auftretenden Schauspieler:innen – und in dem Fall auch Bäcker:innen – nehmen diese einzeln dann ab, wenn sie über sich und ihr Leben erzählen. Und mit dem Öffnen des Ofens gegen Ende erfüllen sie die Theaterräume jeweils auch noch mit dem Geruch des gebackenen Brotes – und laden (nicht bei Corona-Beschränkungen) das Publikum ein, auf die Bühne zu kommen., Brot zu kosten und mit den Künstler:innen ins Gespräch zu kommen.

Zu den ergänzenden Einrichtungen bei Na Laga’at gehört längst auch ein Restaurant, seit ein paar Jahren auch eines „im Dunklen“ – von außen in Form eines Schiffes -, Workshops in (israelischer) Gebärdensprache, die u.a. von vielen Schulklassen in Anspruch genommen werden. Seit ungefähr einem Jahr läuft auch eine eigene Schauspielakademie, um weitere Bühnenwillige professionell ausbilden zu können. Von den rund 100 Beschäftigen des Zentrums sind mehr als zwei Drittel (70) gehörlos, blind oder beides). Übrigens mehr als die Hälfte (60%) des jährlichen Budgets von umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro werden durch Eintritte, Workshop-Gebühren, im Restaurant usw. verdient, ein Fünftel steuert die öffentliche Hand bei, die anderen fehlenden 20 % müssen über Spenden aufgebracht werden.
Na Laga’at – auf Deutsch „bitte berühren“ ist Teil eines internationalen Projekts mit dem etwas sperrig klingenden Titel der „Europäische und internationale Partnerschaften zur Entwicklung von Fähigkeiten und sozialer Inklusion mittels Kreativität und Kunst“ (European partnership for the development of skills and social inclusion through creativity and arts). Theater- und Kulturgruppen bzw. Institutionen aus Polen, Belgien, Schweden, Österreich und Israel arbeiten in diesem von der EU geförderten Projekt zusammen, treffen einander in den beteiligten Städten, um Erfahrungen auszutauschen. Über jenes im polnischen Łódź hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… im Herbst des Vorjahres schon berichtet – Link unten am Ende des Beitrages. Die anderen beteiligten Kulturinitiativen und -einrichtungen sind: Poleski Osrodek Sztuki, Instytut Tolerancji w Łodzi (Łódź, Polen), Theater Van A tot Z (Antwerpen, Belgien), Possible World, Norrköpings Stadsmuseum (Sweden), ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt/Salzburg/Wien, Österreich) und in diesem Fall dem gastgebenden Na Laga’at (Jaffa, Israel).
Zurück zum aktuellen Treffen in Jaffa, dem südlichsten und ältesten Teil von Tel Aviv (Israel): Am frühen Abend war im Workshopraum die Tanzperformance „Hirten“ (Sheperds) zu erleben. 13 Tänzer:innen – davon nur fünf Sehend – bewegten sich erst vorsichtig, dann mitunter immer wilder durch den Raum, „sahen“ einander durch Berührung, sanftes gegenseitiges Abtasten ihrer Gesichter. Fanden Geborgenheit in kleineren und größeren Gruppen, die sie auch wieder verließen, um allein oder zu zweit auf Erkundungstour zu gehen. Viele verwandelten sich – auf allen Vieren – in Tiere, die von den Hirt:innen behütet werden. Aber nicht nur. Eine (blinde) Hirtin vertraute ihren „Schafen“, die sich zu einem gemeinsamen Hügel zusammengestellt hatten, derart, dass sie sich rücklings darauf legte und tragen ließ.
So nebenbei sei darauf hingewiesen: Inklusion ist mittlerweile zu einem Wort, einem Begriff geworden, der seit einiger Zeit scheint’s in fast aller Munde ist. Aber… naja, was Praxis und Umsetzung betrifft, ist noch – um’s charmant auszudrücken – viel Luft nach oben. Erst kürzlich wiesen Aktivist:innen und Organisationen darauf hin, dass die vielleicht bekannteste Aktion in Österreich, die sich das Thema Menschen mit Behinderung auf ihre Fahnen heftet, „Licht ins Dunkel“ noch immer eher das Bild von Mitleid heischen und über den Kopf streicheln vermittelt. Dabei hatte schon vor weit mehr als zehn Jahren Betroffene mit der „Nicht ins Dunkel“ genau diese Haltung massiv kritisiert.
Aber, hier soll gar nicht gejammert, sondern die Berichterstattung über das oben genannte internationale Projekt fortgesetzt werden – weitere Berichte folgen.
Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung konnte/kann nur erfolgen, weil Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … im Rahmen des EU-Projekts von ARBOS auf diese Reise eingeladen worden ist.
und hier

Zum 16. Mal werden die besten heimischen Kinder- und Jugendtheaterstücke sowie darstellerischen Leistungen, Musik bzw. Ausstattung ausgezeichnet. Stella heißen diese Awards der Österreich-Sektion der internationalen Kinder- und Jugendtheatervereinigung ASSITEJ. Im Frühjahr wurden die Nominierungen für Stella.Darstellender.Kunst.Preis bekanntgegeben. Die Verleihung steigt am 7. Oktober in der Burgtheater-Spielstätte Kasino am Schwarzenbergplatz.
Vom 1. Oktober an sind in einem Festival die nominierten Stücke in den Spielstätten Dschungel Wien, Burgtheater und WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) zu sehen, eines in Linz und ein anderes mehrfach in Schulen – Link zum Festivalplan unten am Ende des Beitrages.
Nach – hoffentlich – einigermaßen überstandener Pandemie findet das Festival bei dem möglichst viele der acht nominierten Stücke auf verschiedenen Wiener Bühnen – Dschungel Wien, WuK sowie Burgtheater – gezeigt werden, ab 1. Oktober 2022 statt – samt Side-Events wie Diskussionen, Begegnungen mit den Juror:innen usw. Hier die Liste der Nominierten – bei den Stücken entweder mit Kürzest-Beschreibungen oder bei vielen, die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … schon gesehen hat, mit Links zu den Rezensionen
* „Schnaufen“ vom Mezzanin Theater in Koproduktion mit der TanzCompanyELLA; ab 4 Jahren; Steiermark; ein Tanztheater über das Alleinsein und die Wiederentdeckung der Leichtigkeit des Lebens miteinander
* „Hilfe! aber: … das Knistern, wenn man Wasser in einen Tontopf mit trockener Erde gießt“ von Material für die nächste Schicht; ab 6 Jahren; Kärnten; ein performatives Chaos, in dem das Scheitern an der Tagesordnung steht – oder eben nicht: es wird gelebt und versucht andere zu unterstützen und gemeinsam etwas zu schaffen. Immer wieder von neuem.
* „Ich, Ikarus“ vom Burgtheaterstudio; ab 9 Jahren; Wien
* „Zwei Tauben für Aschenputtel“ vom Jungen Landestheater Linz; ab 6 Jahren; Oberösterreich; in dieser Version des bekannten Märchens wird Aschenputtel frech, mutig und lässt sich nicht so von den Schwestern und der Stiefmutter unterdrücken.

* „Else (ohne Fräulein)“ vom Vorarlberger Landestheater; ab 13 Jahren; Arthur Schnitzler stürzte Fräulein Else vor beinahe 100 Jahren in Konflikte, die auch heute noch eine Menge unbequemer Fragen aufwerfen. In dieser Version ist Else eine in der Gegenwart lebende junge Frau zwischen medialem Körperkult und Selbstverwirklichung, zwischen dem Streben danach, im Leben wahr- und ernstgenommen zu werden, und dem jugendlichen Drang zur Rebellion.
* „Mädchen wie die“ vom Burgtheaterstudio; ab 13 Jahren; Wien
* „Kohlhaas – Moral High Ground“ von Follow the Rabbit; ab 13 Jahren; Steiermark
* „Lover`s Disco(urse)“ von VRUM Performing Arts Collective, Dschungel Wien & KLIKER Festival; ab 15 Jahren
Die Jury – Felicitas Biller, Christoph Daigl, Christian Ruck und Yvonne Zahn – hat sich für 23 Nominierungen in 5 Kategorien sowie einer Sonderkategorie entschieden – von 18 unterschiedlichen österreichischen Theatergruppen/-häusern/-festivals aus acht Bundesländern, die im Jahr 2021 zu sehen waren. Gesichtet wurden rund 120 Produktionen aus ganz Österreich – aufgrund von der Pandemie notgedrungen viele Stücke nur als Video-Aufzeichnungen.
Neben den acht Produktionen nominierte die Jury noch für
* Lisa Rothhard in „Iason“; Next Liberty; Steiermark
* Raphael Kübler in „Eine Weihnachtsgeschichte“; Tiroler Landestheater Innsbruck
* Sofia Falzberger, Alduin Gazquez, Kerstin Jost, Adrian Stowasser als Ensemble in „#schalldicht“; Theater Phönix; Oberösterreich
* Lena Hanetseder, Florentine Konrad, Antonia Orendi, Maria Prettenhofer als Ensemble in „NAH“; TaO! Theater am Ortweinplatz; Steiermark
* Michael Haller für Bühne in „BLUB. Eine Reise in die Tiefe“; Theater.NUU; Wien
* Sigrid Wurzinger für Bühne und Kostüm in „Die lachende Füchsin“; TOIHAUS Theater; Salzburg
* Thomas Garvie, Oliver Stotz und Wolfgang Pielmeier für die Bühne und Ausstattung in „Nachts“; VRUM Performing Arts Collective; Wien
* Vincent Mesnaritsch für die Bühne in „In 80 Tagen um die Welt“; Schauspielhaus Salzburg
* Gudrun Plaichinger, Raúl Rolón und Yoko Yagihara „Tempo Tempi“; TOIHAUS Theater; Salzburg
* Steffi Baron-Neuhuber in „Über Piratinnen – Geschwestern der See“; Töchter der Kunst & Radical Kitsch Ensemble; Niederösterreich
* Robert Lepenik und das Ensemble in „NAH“; TaO! Theater am Ortweinplatz; Steiermark
* Peter Plos und Andreas Grünauer Ensemble in „MeinAllesaufderWelt“; Kollektiv kunststoff; Wien

Außerdem schlägt die Jury drei Produktioen vor für einen
* „Kalaschnikow – mon amour“; Dschungel Wien; ab 14 Jahren
* „MeinAllesaufderWelt“; Kollektiv kunststoff; ab 16 Jahren; Wien
* „Jakob im Kleid“; Salzburger Landestheater; ab 10 Jahren; mobile Produktion vor allem als Klassenzimmertheater; offenkundig – wenngleich leider nicht ausgewiesen – offenkundig inspiriert vom Jugendbuch David Williams‘ „Kicker im Kleid“ und dem Bilderbuch „Jo im roten Kleid“. Übrigens war eine Tanztheaterversion des Grazer Mezzanintheaters frei nach diesem Buch von Jens Thiele schon 2017 für einen Stella nominiert.
Stella22_Programmheft_Timetable

Was wäre, wenn wir einen Tag lang den ganzen Mist den wir produzieren, eigentlich meistens „nur“ kaufen – als Verpackung von Lebensmitteln und Konsumgütern, nicht wegwerfen, sondern mit uns rumschleppen müssten? Dieses Gedankenexperiment setzte einst der US-amerikanische Aktivist für eine (klima-)gerechtere Welt Rob Greenfield (so heißt er wirklich!) in eine Aktion um. Er sammelte den Müll eines Monats, reinigte ihn und band ihn sich rund um seinen Körper. Damit wanderte er durch Städte, um die großen Mengen Abfall jeder und jedes Einzelnen innerhalb von 30 Tagen anschaulich zu machen.
Dieses Bild eines Trashman, Trashformer bringt die Tanz-Company Two in One auf die Bühne des Kinder- und Jugendtheaterhauses Dschungel Wien. In „Die Insel“, ausgedacht und inszeniert von Ákos Hargitay tanzt Łukasz Czapski in solch einem Müll-Anzug. Und das schaut ganz arg monströs aus, schränkt ihn auch kräftig in seiner Bewegungsfreiheit ein. Hin und wieder verliert er im Tanz, der fast an eine Art Roboter erinnert, das eine oder andere (gereinigte) Mist-Stück auf der Tanzfläche. Dass diese ausschließlich von seiner Tanzpartnerin Elda Gallo, die nicht so voluminös, sondern „nur“ aus umgeschneiderten Werbeanner gekleidet ist, eingesammelt werden…? Im besten Fall eine kritische Darstellung, dass (noch immer) oft Frauen für die Aufräumarbeiten hinter Männer-Mist zum Einsatz kommen.
Die Tanz-Passage in Re- und Upcyling-Kostümen (Norma Fülöp) ist der zentrale Teil des Stücks, das ansonsten noch so manches an Informationen – und Poetisch-Atmosphärischem (Musik, Klanginstallation: Gammon; Dramaturgie, Assistenz: Michaela Hargitay) umfasst. Da sind vor allem auch die beeindruckenden Foto- und Video-Einblendungen: Vom futzi-winzig kleinen blauen Punkt im großen Universum, der sich beim heran-Zoomen natürlich als unsere Heimat, der Planet Erde, entpuppt bis zu Blicken in ferne Galaxien, oder auf die erschreckende Temperatur-Anstiegs-Grafik. Oder ein Graffiti der berühmtesten Jugendlichen der Welt, Greta Thunberg – zu Zitaten von ihr.
Über Bilder – jene, die zu sehen sind aber auch die, die sich in den Köpfen der Zuschauer:innen ergeben – vermittelt die mehr als ¾-stündige Performance Wissen und Gefühl: Wir sollten dringend achtsam(er) mit der Welt umgehen. Da hätte es das Einleitungs-Video von Mastermind Ákos Hargitay – jedenfalls nicht in dieser Länge – gebraucht. In diesem sinniert er beim Nassrasieren (übrigens in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Öl-Krise wieder populär geworden), dass in den Pandemie-bedingten Lockdowns ein Runterfahren von Vielem wie Fliegen, Verkehr usw. möglich wurde, und … Highlight in diesem Schwarz-Weiß-Video vor Spiegeln, in denen der Protagonist praktisch isoliert mit sich selbst redet ist allerdings die Selbstironie. Durch einen Anruf seiner Frau kommt er drauf, dass er schon Unmengen Wasser vergeudet hat, da er beim Rasieren die Leitung laufen hat lassen 😉
Ergänzt „Fridays for Future“ durch „Everyday for Future“ ist die Botschaft des – streckenweise auf Englisch gespielten Stücks – weitere Aufführungsserie im April 2022.


Vorbei am Heeresgeschichtlichen Museum, weiter am Rande des riesigen Geländes Arsenal liegen die von Art for Art. Bekannt vor allem dafür, dass hier für die Bundestheater Kulissen, Requisiten gebaut, Kostüme geschneidert werden, eben Kunst für (Bühnen-)Kunst angefertigt wird. Hier gibt es auch Proberäume.
In einem solchen fällt beim Besuch einer Probe von „Zoes sonderbare Reise durch die Zeit“ vor allem eine riesiger Kleiderberg im Mittelteil der hohen „Bretter, die die Welt bedeuten“ auf. Davor ein Haufen Kunststoffteile, aufs erste einmal als „Klumpert“. Allerdings nicht ganz versteckt auch ein kunstvoll gestaltetes Objekt, das an eine Sauerstoffflasche für Taucher:innen erinnert.
Nach und nach trudeln Schau- und Figuren-Spieler:innen in den Proberaum, begeben sich auf die hohe Bühne vor der eine laaaaaaaaaaaaange Tischreihe steht, an der Regisseurin, Regie-Assistentin, Übersetzerin – Das Stück ist ursprünglich englisch und in dieser Sprache kommuniziert auch die Britin mit dem Team -, Souffleurin Platz genommen haben.
Aufwärmen ist angesagt. Im Gegensatz zu vielen anderen Theater(gruppen) scheint hier niemand den Ton dafür anzugeben. Das Bühnen-Team lockert Körper(-teile) zwar im Kreis, aber eher selbstbestimmt – natürlich aufeinander eingehend und reagierend. Schließlich geht’s bei einem Stück ja nicht nur daran, dass alle Muskeln gelockert, alle Beine, Arme usw. aufgewärmt sind, sondern der Kopf sich nicht nur als Körperteil entsprechend der Szene dreht und bewegt, sondern Text aus dem Mund kommt und aufeinander reagiert wird, um miteinander agieren zu können…
So, bevor’s nun weiter zu Eindrücken von der Arbeit an Szenen geht, zunächst einmal knappest zusammengefasst, worum sich das Stück dreht. Die Hauptfigur sieht sich 100 Jahre in die Zukunft versetzt, auf eine Insel – voller Plastik. Aus dieser Erfahrung – Lebewesen, die zu einem Großteil aus Kunststoff bestehen – will/muss sie zurück in die Gegenwart, um zu warnen, aufzuklären, zu retten …
Ein Stück mit dringender Aufforderung, ihr dabei zu helfen, sozusagen zu verstärken, was Fridays For Future seit rund drei Jahren, „Plant für the Planet“ seit fast 15 Jahren, Wissenschafter:innen seit Jahrzehnten machen. Nachdem bisher – wie derzeit zu befürchten bei Cop26, der 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen, im schottischen Glasgow, – viel zu wenig getan wurde/wird, um den Planeten als Lebensraum für Menschen und viele Tiere zu bewahren, will auch dieses Stück mithelfen. Dazu mehr im Gespräch mit der Co-Autorin (gemeinsam mit Jimmy Osborne) und Regisseurin Sue Buckmaster – hier unten.
So, jetzt aber, rauf auf die Bühne. Zwischen dem schon oben beschriebenen Kleiderberg – vieles aus Mikroplastikfasern –, den Kunststoffteilen und einer hölzernen Waschmaschine – deren Trommel das Portal für die Zeitreise ist, trifft Zoe (Safira Robens) auf Tupperware (Dorothee Hartinger) und Oil Man (Wolfram Rupperti) – und auf einen Pelikan. Wie und wo der auftaucht – das ist ein Geheimnis, das auf Wunsch nicht nur der Regisseurin noch geheim bleiben soll. Jedenfalls müssen sich die Schauspieler:innen mit dem – von Figurenspieler:innen (Teele Uustani, Maximilian Tröbinger und Stellan Torrn) bewegten großen Vogel „anfreunden“. Ihre Bewegungen mit ihm abstimmen.
Schrittweise nähern sich Robens, Hartinger und Rupperti dem von den jeweils zwei aus drei (Uustani, Tröbinger und Torrn) geführtem, gehaltenem, getragenem Kunststoffwesen an. Ganz zufrieden zeigt sich Buckmaster trotz immer besserer Synchronisierung nicht. „Lassen wir doch einmal den Pelikan weg“, schlägt sie vor, dass Schau- und Figuren-spieler:innen alleine miteinander agieren. „Wir müssen in ein gemeinsames Atmen kommen“, gibt sie dem Sextett auf der Bühne mit auf den (Flug-)Weg. Schritt, Schritt, Schritt, Arme ausbreiten wie Flügel. Immer und immer wieder. Nach einigen Wiederholungen stellt sich der gewünschte Effekt ein: Wie ein fast riesiges gemeinsames Lebewesen bewegen und atmen die Bühnen-Akteur:innen. Und jetzt mit dem Vogel. Juhuuu, es klappt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen