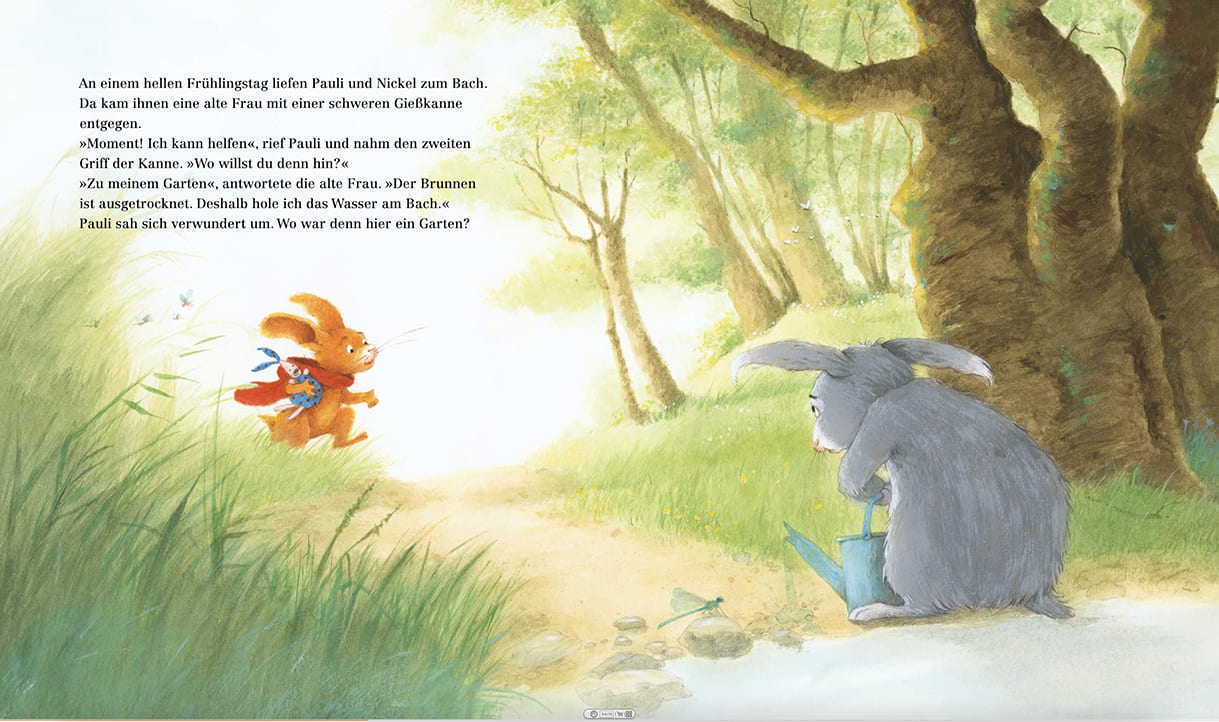
Pauli, ein mittlerweile dank seiner Erfinderin, der Autorin Brigitte Weninger, schon ganz schön berühmtes Kaninchen, ist im jüngsten Abenteuer zu Beginn rasend schnell mit seinem Kuschel-Nickel unterwegs in Richtung Wald. Illustratorin Eve Tharlet lässt ihn fast über den Boden fliegen.
Plötzlich stoppt Pauli, denn er sieht, wie eine alte graue Häsin eine schwere Gießkanne schleppt. Sofort bietet er seine Hilfe an, um den Wasserbehälter gemeinsam zu tragen. Wundert sich aber als Elise sagt, dass sie den Garten gießen will. Weit und breit sieht der Titelheld keinen solchen.
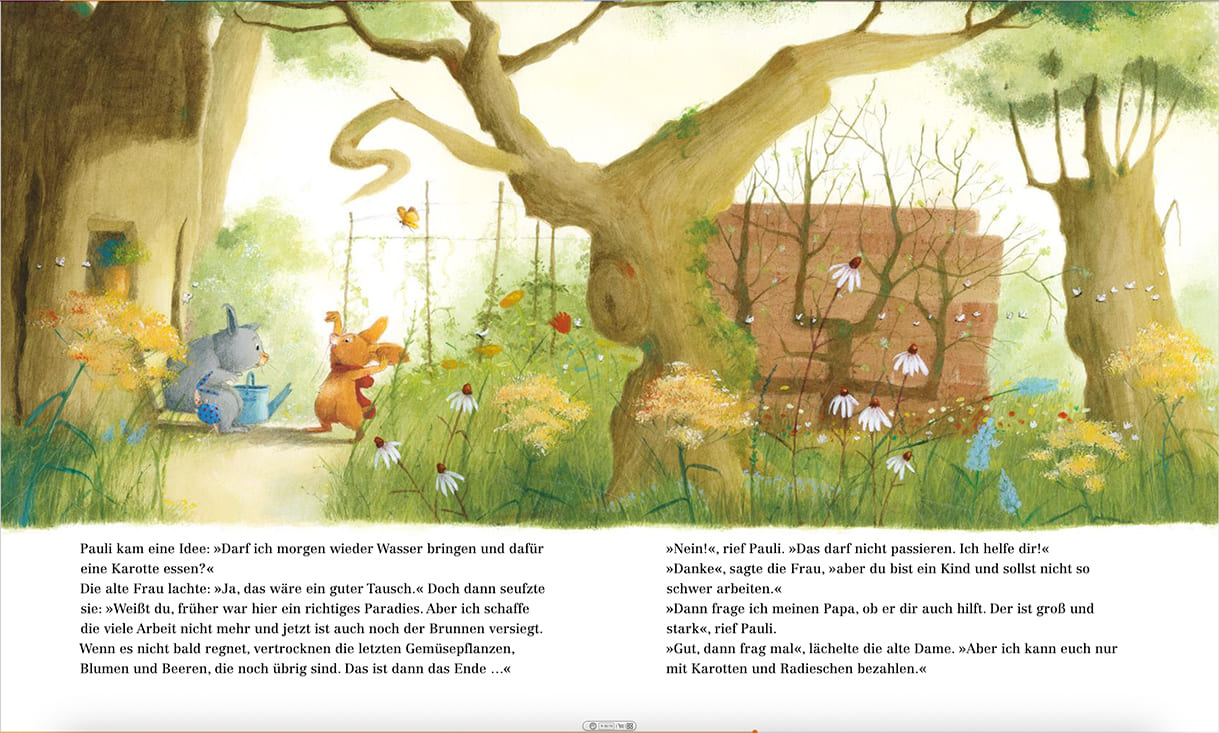
Hinter einem verwitterten Holztor liegt der alten Häsin verwilderter Garten. Da packt nicht nur Pauli mit an, sondern nach und nach organisiert er auch den „Rest“ seiner großen Familie. Im Team richten sie den Garten her. Als Belohnung gibt’s Karotten und Radieschen.
Nein, es gibt keine Wendung, keinen Streit, nur noch später die Herausforderung eines Hochwassers. Aber auch diese lässt die Autorin, vormals zwei Jahrzehnte lang Elementarpädagogin, die Kaninchen gemeinsam meistern. Weshalb das Buch folgerichtig nach dem ersten Teil des Titels (mit dem Namen der zentralen Figur, der Weninger schon viele Geschichten gewidmet hat), „Ein Garten für alle“ heißt.
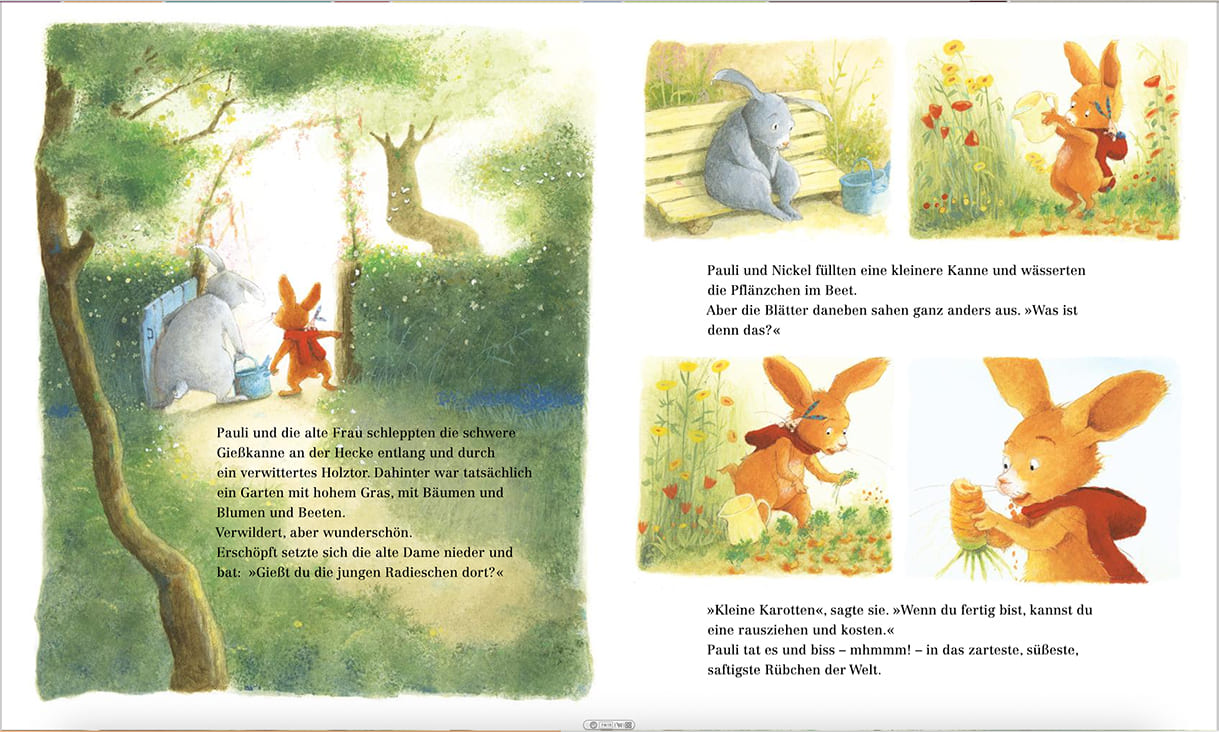
Auch wenn hier jetzt schon sehr viel gespoilert wurde – dieses Bilderbuch – übrigens auch als Hör-Datei von der Verlagsseite runterzuladen – lebt weit darüber hinaus von vielen kleinen Einzelheiten in der Erzählung ebenso wie den detailverliebten Zeichnungen.
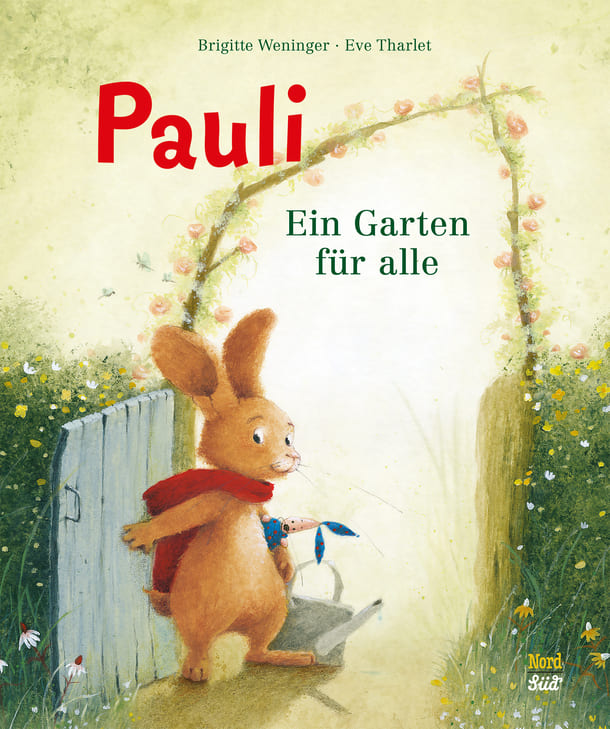
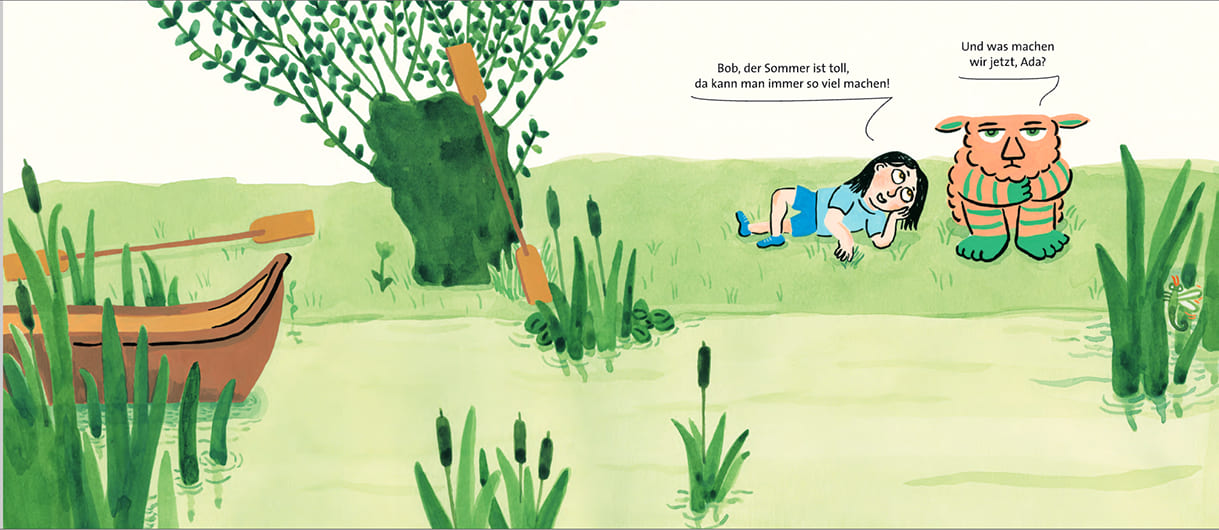
Fast alles in diesem Bilderbuch spielt sich in einem Kajak ab. Ein Boot, gezeichnet von Magali Bardos, das vorne und hinten glich ausschaut. Mit diesem machen sich Ada und Bob, ein Mensch und ein Tier, die beide zu Beginn auf einer Wiese am Ufer eines Flusses liegen, auf die Reise.
Ganz so einfach ist das Paddeln aber nicht, aber dann gleiten sie übers Wasser, freuen sich am Vorwärtskommen und der Landschaft. Klar, so einfach kann’s nicht bleiben, jedes Buch braucht Abwechslung und Spannung. Dafür sorgt Ada. Nicht immer zur Freude von Bob. Die Last des Paddelns ist auch – nicht nur aus der Sicht von Bob – offenbar nicht fair verteilt. Ada spielt sich als Chefin auf und so kommt’s zu durchaus heftigen Streitereien. Und damit – so viel darf schon verraten werden, bist du auf der letzten Seite.

Da ließ sich Autorin Clémence Sabbagh (aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel) was Besonderes einfallen: „Lies die Geschichte noch einmal – jetzt aber rückwärts“, lautet der allerletzte Satz. Sozusagen wie die Form des Bootes, weshalb das Buch auch „Kajak – Eine Geschichte in zwei Richtungen“ heißt.
Eine witzige Idee, funktioniert nur nicht ganz – denn erstens musst du auf manchen Seiten dann doch zuerst den Text auf der rechten statt in umgekehrter Reihenfolge auf der linken lesen. Und zweitens, kennst du ja sowohl den Anfang als auch das Ende.
Andererseits: Es könnte auch sein, dass du den beiden – wieder am Beginn – eine zweite Chance schenkst und dir selber ausdenkst, wie die zweite Kanu-Reise verlaufen könnte.

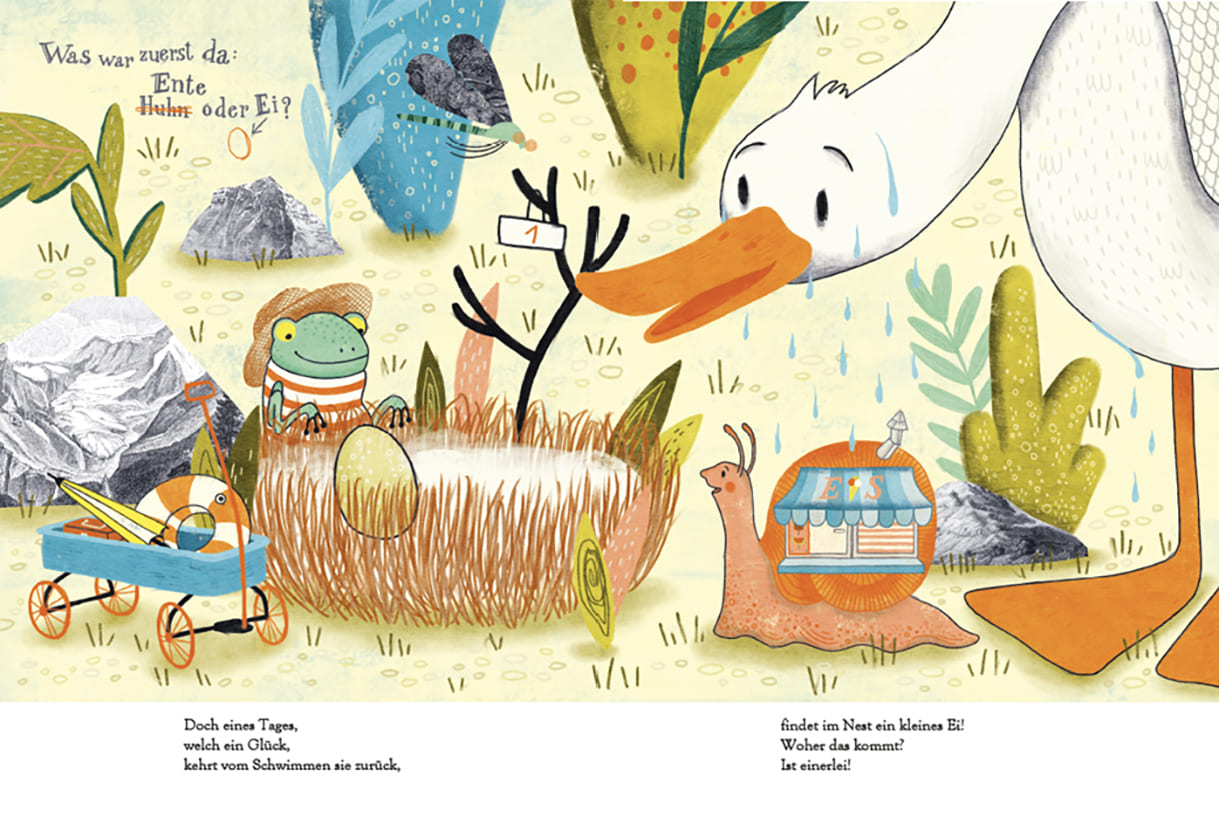
Schade, leider verrät der Titel des Bilderbuchs schon alles. Aber der Reim „Henne Jenne“ ist natürlich zu aufgelegt, drängt sich auf. Nachdem aber schon der Buchtitel so, dann brauch sich diese Besprechung nicht vor Spoilern fürchten, es gibt ja das Überraschungsmoment nicht.
Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Du als Leserin / Leser bzw. Bildbetrachter:in und beim Zuhören, wenn dir das Buch vorgelesen wird, weißt daher schon, dass aus dem Ei, das eines Tages im Nest der Entenmutter liegt, eben kein kleines Entlein, in dem Fall auch kein Schwan wie in Hans Christian Andersens „Das hässliche Entlein“ entschlüpft, sondern ein junges Huhn.
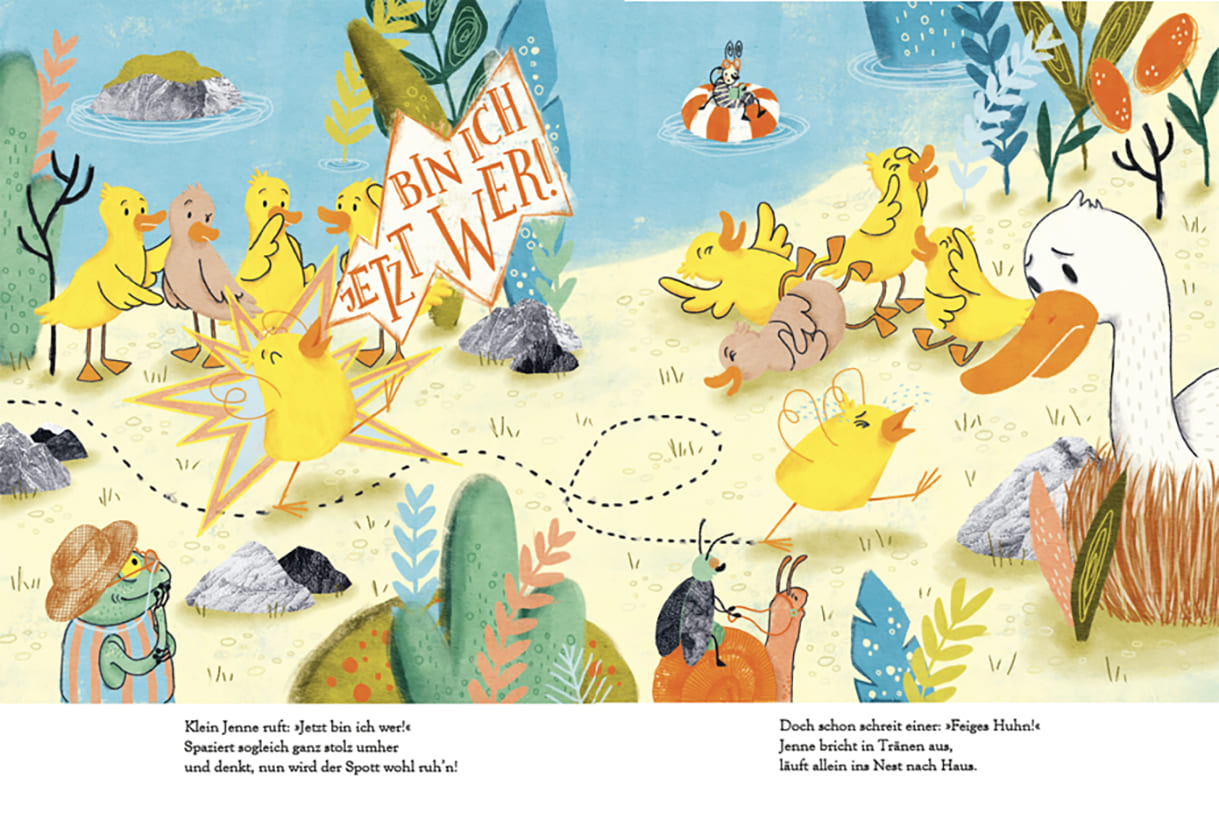
Bald ist das kleine Federvieh – und mit ihm seine „Mutter“ – von Sprüchen aus der Umgebung konfrontiert: „Seltsame Füße“ und erst „der Gang“… Außerdem will es nicht und nichts in Wasser, fliegen kann es auch nicht… Lauter Eigenschaften, die es zum Spott seiner Umgebung machen.
Wir aber wissen ja, es ist eine junge Henne – das erfährt Frau Ente von der Eule. Und stolz entfährt es Jenne, so nannte die Ente „ihr“ Junges schon zu Beginn, jetzt endlich zu wissen, wer es ist. Ähnlich widerfährt’s dem „kleinen Ich-bin-ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel ja erst gegen Schluss.

Doch Autorin Cornelia Travnicek, die sich schon im Jugendbuch „Harte Schale, Weichtierkern“ hervorragend in eine Außenseiterin hineinversetzt hat, beendet mit dieser (Selbst-)Erkenntnis das Buch noch lange nicht. Dass sie nun weiß, Henne zu sein, hindert die anderen Tiere nicht, sich über sie lustig zu machen – „feiges Huhn“ kriegt Jenne zu hören.
Was und wie der sozialen Mutter Ente einfällt, um ihr Junges auch dagegen zu stärken – nein, das sei nun hier wirklich nicht aufgedeckt, eine überraschende Wendung bleibt ja noch.
Schon verraten werden darf, nein soll sogar, dass die vielen bunten Zeichnungen von Raffaela Schöbitz den Text nicht nur illustrieren, sondern viel mehr zu entdecken anbieten, so manches, das beim ersten Mal vielleicht sogar übersehen wird. Und wie beispielsweise bei der in einem der Bilder gestellten Frage, „Wie klingt ein zerbrechendes Herz?“ trotz der schon angebotenen Comic-Sprachen-Ausdrücke „Pling?“, „Klonk?“ und „Krrrack?“ noch viel Raum für Weiter-Fantasieren offen lässt.
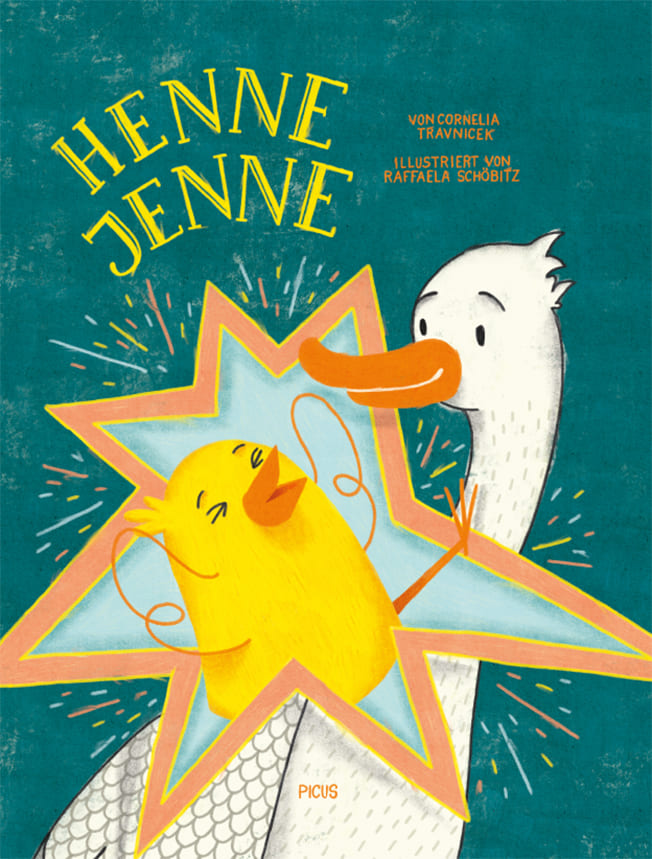

Wild, aufgeweckt, neugierig voller Entdeckungsdrang – das war auch Ida. Alles wollte sie wissen und erforschen, vor allem in der Natur. Sie war mit ihren Brüdern auf „Expeditionen“ und sammelte Insekten. Das war vor mehr als 200 Jahren in Wien und sie hieß mit Nachnamen Reyer – das kommt erst ganz hinten im (Bilder-)Buch „Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf“.
Vorne dreht sich alles inmitten kunterbunter Bilder, die sehr viel zum Schauen und Entdeckten bieten, um dieses besondere, aber grundsätzlich vielleicht um jedes Kind. Und auch das Schicksal vieler Mädchen, nicht selten sogar heute. Hier taugte der Mutter die Lebendigkeit der Tochter nicht so wirklich, sie sollte ein biederes, angepasstes Mädchen, später eine Frau werden, die heiratet und Kinder kriegt. Dem ordnete sie sich unter, wurde zu Frau Pfeiffer.
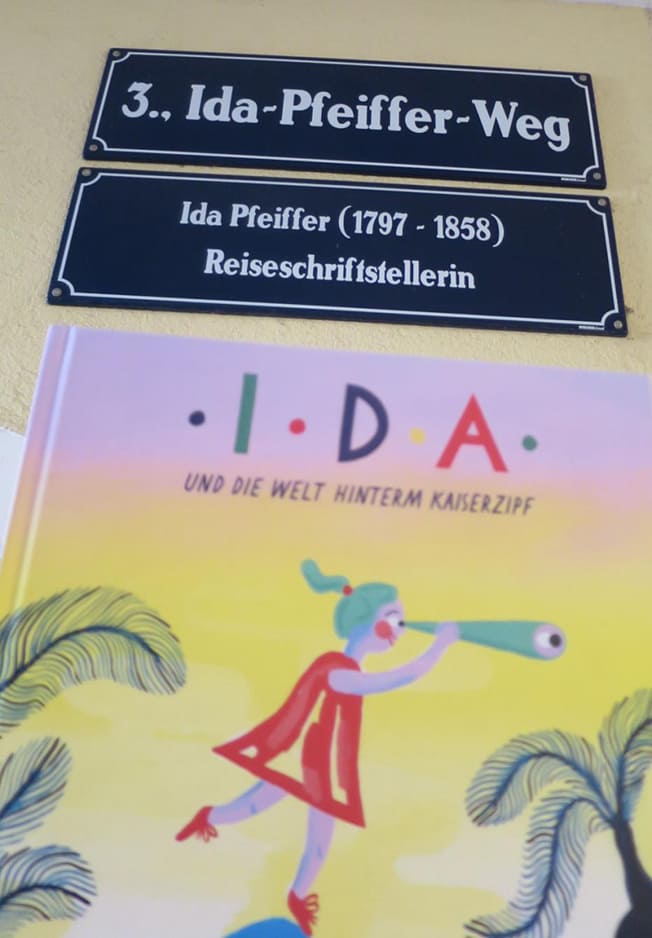
Aber als ihre beiden Söhne erwachsen waren, erwachte in ihr wieder der alte Forschungsdrang – und sie machte sich auf, die Welt zu erkunden. Zwei Weltreisen mit viele Entdeckungen und Erkenntnissen – eine Zeitlang lebe sie bei einer indigenen Gruppe auf einer indonesischen Inselgruppe. Vieles aus ihren Er-fahrungen verarbeitete sie zu mehreren Büchern und wurde bekannte Reiseschriftstellerin.
Aber auch wenn du vielleicht, sogar wahrscheinlich wie sehr viele Menschen, von dieser Frau noch nie gehört hast, kannst du mit diesem Bilderbuch von Linda Schwalbe selber auf eine spannende, Entdeckungsreise gehen – selbst beim 17. Mal Durchblättern werden dir vielleicht noch immer wieder neue Details auffallen.
Erstveröffentlicht damals noch im Kinder-KURIER
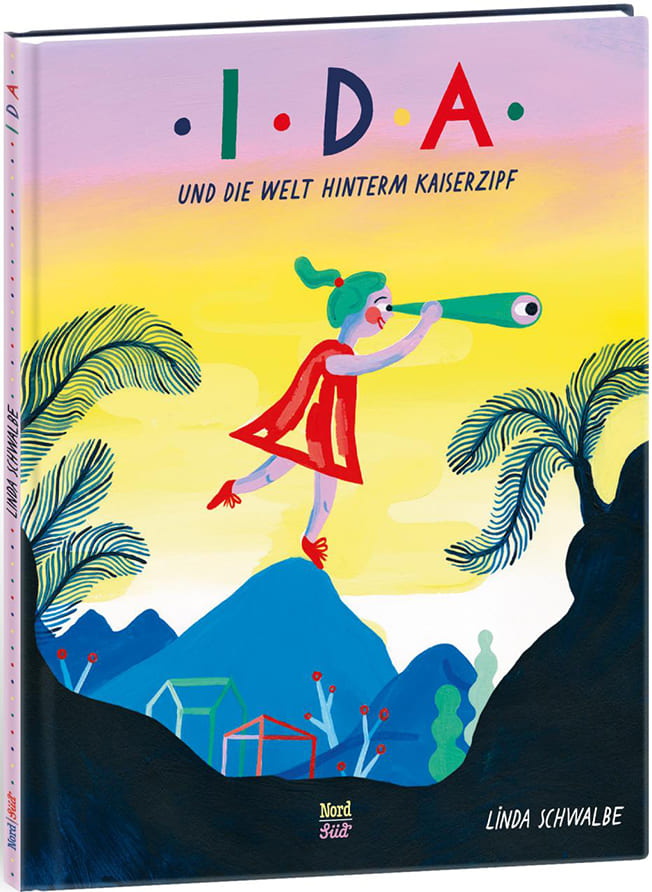

„Ich bin groß, deshalb muss ich viel essen“, meint der Bär.
„Ich bin klein und muss noch wachsen“, entgegnet das Wiesel.
So begründen beide, weshalb sie jeweils zwei der drei zubereiteten Pilze kriegen sollten und das für gerecht halten.
Bär und Wiesel leben wie ein Ehepaar oder Geschwister (?) zusammen. Sie scheinen einander offensichtlich sehr zu mögen. Doch immer wieder kommt es zum Streit. Gründe dafür sucht und findet Autor und Illustrator Jörg Mühle für seine Bilderbücher im Alltag (nicht nur) von Kindern.
Ums Teilen geht es in „Zwei für dich, einer für mich“. Bär hat im Wald Pilze gesammelt, drei Stück bringt er eben nach Hause. Wiesel bereitet daraus eine Mahlzeit zu.

Drei Stück – wie sollen die nun aufgeteilt werden? Die ersten Argumente der beiden Hauptfiguren sind schon zu Beginn hier genannt worden. Weitere folgen: Bär hat die Schwammerln gefunden, Wiesel sie hingegen gebraten, gewürzt und angerichtet. „Aber nach meinem Rezept!“, so der Bär, der außerdem darauf pocht, den Tisch gedeckt zu haben…
Der Streit schaukelt sich hoch und …
… der Autor und Illustrator gibt, wenngleich er die Geschichte in Wort und Zeichnung weitererzählt, keine wirkliche Lösung vor. Wie bei seinen interaktiven Lesungen kürzlich beim Kinderliteraturfestival im Wiener Odeon (Link zum Bericht darüber weiter unten) überlässt er dir und dir und … und allen, sich eigene Gedanken zu machen; mit anderen darüber zu diskutieren; eigene, vielleicht auch ganz unterschiedliche Auswege zu finden. Denn auch – konstruktiv – Streiten will gelernt werden.


Sind es bei Janosch kleiner Tiger und kleiner Bär, so bevölkert Jörg Mühle, der auch viele Bücher anderer Autor:innen illustriert, einige seiner Bücher, für die er auch die Geschichte erfindet und schreibt, mit großem Bär und kleinem Wiesel sowie oft auch Dachs und Fuchs.
Wie schon bei seinem „Zwei für mich, einer für dich“, drehen sich die Szenen der Doppelseiten um Streits zwischen den Hauptfiguren wie sie im (nicht nur) kindlichen Alltag recht häufig vorkommen.
Geht’s beim zuletzt genannten Bilderbuch ums Teilen, wie und was gerecht ist oder sein könnte, so beim hier vorgestellten darum, wer bestimmen darf. Zu Beginn kommt Wiesel nach Hause, Dachs ist zu Besuch und spielt mit dem Bären, der von Wiesel gerne hätte, dass dieses etwas kocht.

Das tut Wiesel – aber ganz anders, vor Wut. „Der Dachs ist mein Freund! Du darfst nicht einfach mit ihm spielen!“
„Der Dachs gehört dir nicht. Du kannst morgen mit ihm spielen“, kontert Bär.
Sozusagen zwischen den Stühlen hat der Dachs eine zündende, verbindende Idee: Spiel zu dritt.
Und schon hat Wiesel einen Vorschlag: „Vatermutterkind!“ Selbst will es Mutter sein, Dachs kriegt die Vaterrolle und zu Bär gewandt: „Du wärst das Kind… und müsstest jetzt ins Bett!“
So hatte sich Bär das gar nicht vorgestellt. Wie aus dieser Nummer rauskommen? Dem Autor und Illustrator sind ganz schön viele Wendungen eingefallen – aber die seien hier natürlich nicht verraten…
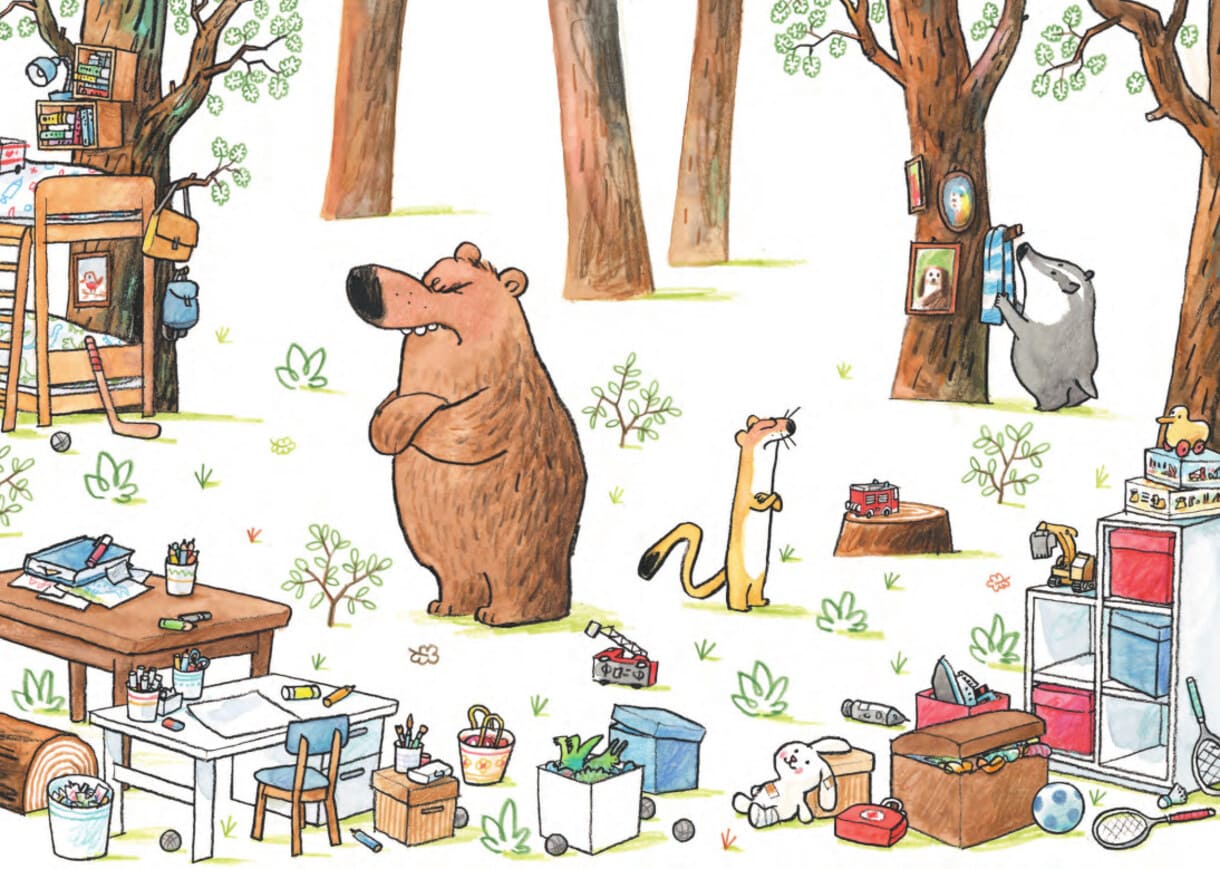
Macht Spaß sie zu sehen und lesen – oder vorgelesen zu bekommen; und vielleicht mit Freund:innen, Eltern, (Elementar-)Pädagog:innen zu diskutieren, möglicherweise auch heftig, wer, wann, worüber bestimmen darf. Da Jörg Mühle scheinbar kleine und doch so große, nicht selten schmerzhafte Konflikte für junge Seelen – in einfachen Worten und szenischen gezeichneten Bildern darstellt, die immer wieder auch mögliche Auswege andeuten, aber nie belehrend und fix was vorgeben, regen sie an, selber zu sinnieren, was würde ich jetzt tun, oder gar, wie könnten wir gemeinsam aus dem Schlamassel raus?
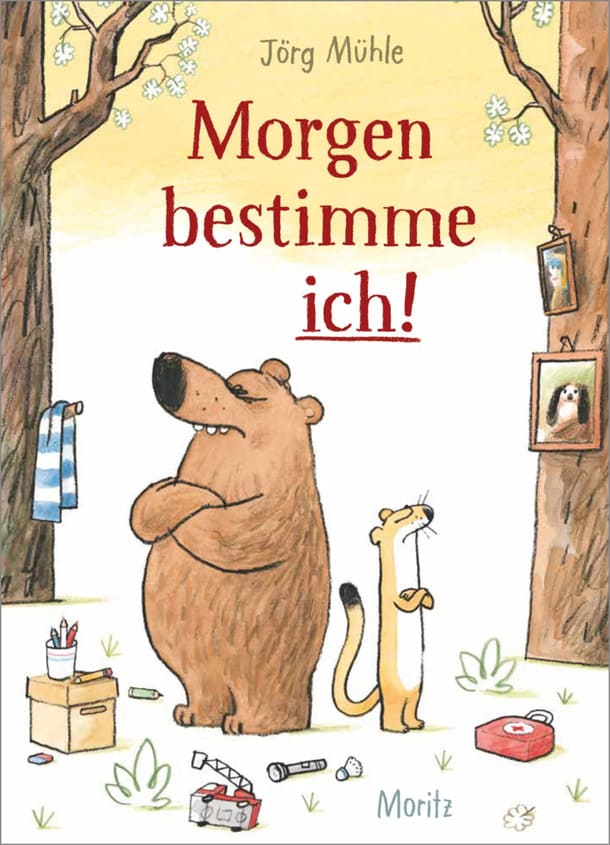

Dieses gedruckte Bilderbuch kann definitiv etwas, das hier höchstens beschrieben, aber nicht einmal mit Bilder-„Kostproben“ zu vermitteln ist. Die Hauptfigur, die sich Autorin Heidi Leenen ausgedacht und beschrieben hat sowie von Alina Spiekermann gezeichnet wurde macht ihrem Namen alle Ehre. „Die kleine Glitzerblume“ glitzert wirklich – und das noch dazu spürbar. Und das nicht nur auf der Titelseite, sondern durchgängig auf (fast) jeder Doppelseite. Jedenfalls auf jenen, auf denen sie auch zu sehen ist. Im Winter unter der Schneedecke natürlich nicht, und auch im Frühling, bevor sie zu blühen beginnt (noch) nicht.

Neben dem Glitzer wollen Geschichte und die Illustrationen noch den Untertitel vermitteln „Gemeinsam sind wir einzigartig!“ Eichhörnchen und Rabe aus dem Nachbarsbaum freunden sich mit Glitzerblume an. Die konnte immerhin ersteres überzeugen, dass sie nicht gepflückt wird, sondern weiterleben kann.
Dass Eichhörnchen dann aber nicht einfach nur Freund der Blume wird, sondern meint, sie beschützen zu müssen und bloß zuhören darf, wenn der kleine Nager und der Rabe mutigen Heldengeschichten erzählen… naja ;(

Aber immerhin sind die Kinder, die rund um die Blume spielen recht vielfältig – eben eine Art Loblied auf Einzigartigkeiten in der Vielfalt.
Zum Drüberstreuen sind die beiden letzten Seiten nach der bunt -und glitzernd – bebilderten Geschichte mit schwarzen Notenlinien und Noten auf weißem Hintergrund versehen: Die Autorin hat ein Lied getextet (Musik: Manfred Schweng) – und per Scan eines abgedruckten QR-Codes kannst du das „Glitzerglück“ auch hören, ein Lied das den glücksbringenden Weg vom Ich zum Wir besingt.

Drachen – sind längst aus dem Eck der bösen Monster befreit. Jahrhundertelang standen sie für Sagen und Geschichten von feuerspeienden, ur-argen Wesen, die a) Prinzessinnen rauben und b) von jungen Rittern besiegt werden mussten. In anderen Kulturen, etwa der chinesischen, gelten Drachen eher als Glückssymbol, stehen für Weisheit und Güte.
Aber auch bei uns quellen seit Jahrzehnten Geschichten aus Büchern, Filmen, Musicals und Theaterstücken, die das eine oder andere Exemplar dieser Fabelwesen ziemlich anders zeichnen – nicht zuletzt der kleine Grisu, der am liebsten Feuerwehrmann werden möchte.

Dass sich machen auf Drachen reimt, schlägt sich auch als Titel einiger Kinderbücher nieder. Ganz druckfrisch ist ein knallbuntes Bilderbuch namens „Drachen machen Sachen“ (Text: Mathias Jeschke, Illustration: Artur Bodenstein). Jede der zwölf Doppelseiten widmen sie einem anders aussehenden, anders handelnden Drachen. Obendrein hat der Autor diesen Wesen jeweils sehr fantasievolle Bezeichnungen bzw. Namen verpasst und dessen Hauptzweck immer in einen kurzen Reim gefasst.
Das beginnt mit „Norburga, ein Nasenherziger Wellenschwanz, vollführt ihren alle verzaubernden Flammentanz.“

Manche Reime grenzen fast an Zungenbrecher, die Namen gehen nicht immer nicht über die Lippen, etwa Woggmonn, Schorrgoppa oder Fommtocka.
Aus der kunterbunten Schar mit oft liebenswerten Vorlieben sticht einzig und allein Torsmolla in einem fast durchgängig düsteren Schwarz-Weiß Bild hervor. Doch seine Aufgabe ist auch eine sehr ernste: „Torsmolla, ein angsteinflößende Schwenkflügler jagt die übelbösen Kinderprügler.“


„Oje“, denkt der gemütlich mit einem Buch, einem Keks und einem Luftballon an einer Schnur auf einer Bank sitzende, aber ein wenig ängstlich in die Welt schauende Bär. Aber „na klar“ sagt er zum Fuchs, der sich zu ihm setzen will.
Als der Wolf kommt und vom Keks des Bären abbeißen will, denkt er „nie im Leben“ – und was er sagt, ist hingegen „gern“.

Ähnlich geht’s die nächsten Doppelseiten weiter. Das von vielen bis allen anderen erwartete erwünschte Verhalten – in dem Fall teilen – macht er, obwohl es gar nicht möchte, sozusagen das „Drama des begabten Kindes“ (Alice Miller, Psychologin und Autorin, 1923 – 2010).
Natürlich belässt es die Autorin und Illustratorin Natalia Shaloshvili (Übersetzung aus dem Englischen: Ebi Naumann) nicht dabei. Irgendwann lernt der unfreiwillig großzügige – wollig-ausgefranst und fast ein wenig unförmig gemalte, ähnlich illustriert sind auch die anderen Tiere – Bär auch seine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und dabei, dass es doch auch ein „nein“ geben kann.

Shaloshvili, auf der ukrainischen Krim aufgewachsen, später im russischen St. Petersburg beheimatet und nun schon länger in London lebend, „wollte schon als Kind Illustratorin werden. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, dass ich davon träumte, Kinderbücher zu illustrieren“, sagte sie in einem englischen Interview mit der Website childrensillustrators. „Ich habe ein Architekturstudium abgeschlossen und kam nach der Geburt meiner Tochter wieder auf die Idee, Kinderbuchillustratorin zu werden. Sie hat mich also wohl inspiriert.“
Lange Zeit habe die studierte Architektin „digital gearbeitet, als ich Zeitschriften illustrierte. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mit traditionellen Medien zu arbeiten, und bin daher immer noch dabei, meinen eigenen Stil zu entwickeln… Ich arbeite gerne mit Acrylfarben, Aquarellstiften und Buntstiften.“


Ein Vogel aus bunten Papieren collagiert immer auf einem braunen Karton führt durch dieses Bilderbuch über Gefühle. Der Bogen spannt sich sozusagen von himmelhoch jauchzend bis tief betrübt: Mutig, niedergeschlagen, neugierig und schüchtern fliegt, flattert oder versteckt sich der Vogel – auf der einen oder anderen Doppelseite begleitet von Artgenossen.
Die jeweiligen Eigenschaftswörter sind noch um dazu passende Sätze ergänzt. Beispielsweise „Wie funktioniert das?“ und „Erzähl mir mehr davon“ bei neugierig / interessiert / wissbegierig. Oder „Entschuldigung, es tut mir leid.“ Und „das ist mir peinlich“ bei beschämt / schuldbewusst / zerknirscht.

Das „bunt“ schlägt sich auch im Titel nieder: „In mir drin ist’s bunt“ – ausgedacht, geschrieben und illustriert von Theresa Bodner, das es schon vor ein paar Jahren gab, ist nun neu erschienen: Erweitert um vier Sprachen: Arabisch, Englisch, Türkisch und Bosnisch / Kroatisch / Serbisch / Montenegrinisch: ‚iinah mulawan fi dakhili / All the colurs inside me / İçimdeki Dünya Rengarenk.
Bei den Adjektiven klappt das Zusammenfassen der vier eng verwandten Sprachen, oft auch als BKS bezeichnet, bei den Sätzen nicht immer, was übrigens gleich für den Buchtitel gilt.
Aber gerade über Gefühle zu reden ist für schon sehr junge Kinder ganz wichtig, da sind die vier zusätzlichen Sprachen neben Deutsch in diesem Bilderbuch ein wunderbares Werkzeug besonders in Kindergärten. Da wäre es vielleicht nur nicht unspannend gewesen die arabische Schrift durch lateinische Lautschrift zu ergänzen – oder auf der Homepage des Verlags bzw. über QR-Codes überhaupt diese Sprachen von Original-Sprachler:innen einsprechen zu lassen und als Audio-Dateien zum Anhören anzubieten


Kleinwunzig – höchstens einen Millimeter -, langsam, aber praktisch unkaputtbar und überall lebensfähig. Ob Salz- oder Süßwasser, Eiseskälte oder große Hitze, tief unter Wasser oder oben auf höchsten Bergen – und sogar im Weltall – das sind die sogenannten Bärtierchen oder auch Wasserbären. Ihre wissenschaftliche Bezeichnung lautet Tardigrada – das sich aus „tardus“ für langsam und „gradus“ für Schritt zusammensetzt. Mit ihren bis zu acht Füßchen bewegen sie sich tapsig wie Bären fort – was ihnen den deutschsprachigen Namen bescherte.
Liebevoll abgekürzt als „Tardi“ bevölkert ein solches Tierchen ein wunderbares, spannendes Bilderbuch – und zehn, nein eigentlich sogar elf YouTube-Videos des „Museums der Zukunft“, des Ars Electronica Centers in Linz. Leider gibt es nur mehr Rest-Exemplare und es wird nicht neu aufgelegt. Auf Moos fühlen sich Bärtierchen ziemlich wohl. Was sie zum Leben brauchen, ist Wasser. Den Winzlingen reicht schon ein Tropfen. Aber sie überleben sogar in Trockenheit. Da stellen sie sich scheintot, nein sie stellen sich nicht, ihre Körper verfallen tatsächlich in einen solchen Zustand. Doch schon ein Wassertropfen und sie erleben sozusagen eine Wiederauferstehung.

Viel Wissenswertes – neben Bärtierchen auch über Zellen, Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Weltraum-Satelliten und einen kleinen Fadenwurm namens C. Elegans findest du auf elf der zwölf Doppelseiten des Bilderbuchs auf einem seitlichen Streifen. Gut zwei Drittel der Doppelseite füllen lustige Computer-Zeichnungen (Nini Spagl) und eine durchgängige Geschichte über die Hauptfigur, ein Tardi aus dem AEC (Idee und Geschichte: Ulrike Mair; Konzept und Umsetzung: Katharina Hof).
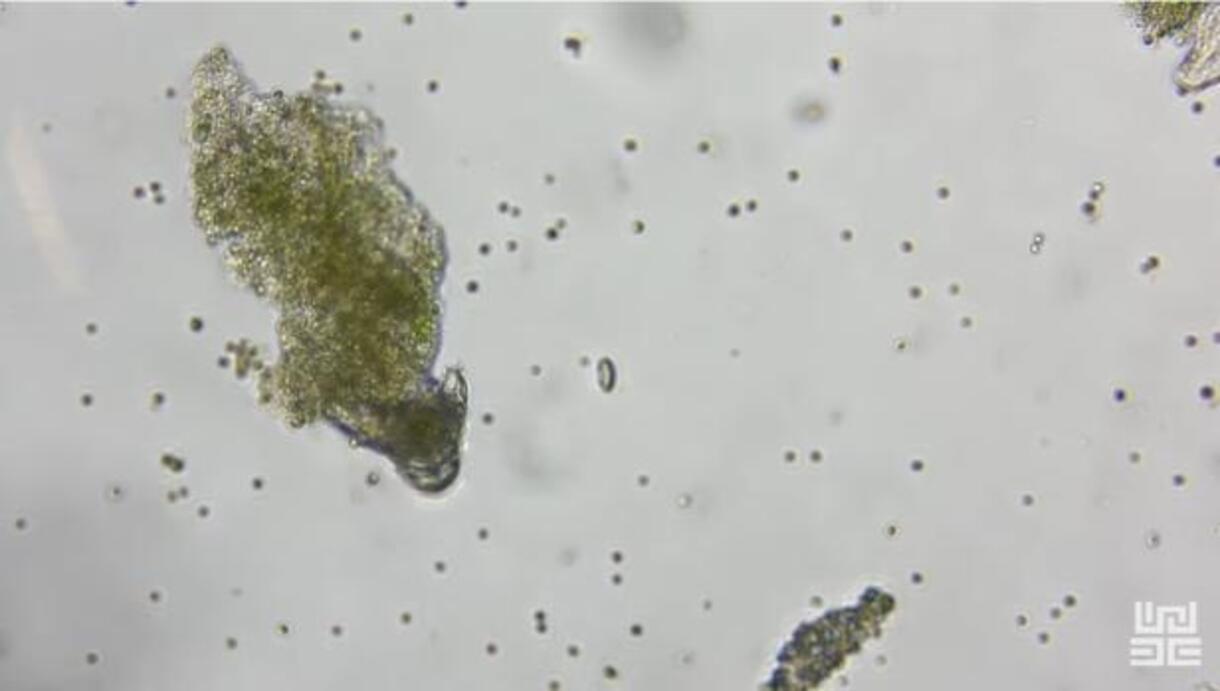
Heuer jährt sich übrigens jener Tag, an dem angeblich zum Ersten Mal ein Mensch die Bärtierchen entdeckt hat, zum 253. Mal. Laut Wikipedia gilt Johann August Ephraim Goeze als Entdecker der Tardigrada – seine erste Beobachtung, über die er berichtet fand am 10. Dezember 1772 statt.
Natürlich nur ein solches, sondern mehrere leben tatsächlich im Museum. Und dort kannst du es unter Mikroskop auch analog und real live anschauen. Bis dahin – oder wenn du einfach nicht nach Linz kommst – kannst du dich ins Buch vertiefen – oder dir die Doppelseite für Doppelseite – aufgeteilt auf zehn Videos vorlesen lassen – und mehr.

Jedes der meist rund ¼-stündigen Videos, das im AEC gedreht wurde, widmet sich einer Doppelseite und liefert dazu aber viele weitere Infos in Film-Form. Unter anderem zeigen und erklären die Videos, was die Menschheit vom Bärtierchen lernen kann und will – etwa wie es möglich ist, in so unterschiedlichen Bedingungen zu leben und vieles mehr.
Erstveröffentlicht im Kinder-KURIER
(dort funktionieren aber die Links zu den Buchseiten und den Videos nicht mehr)

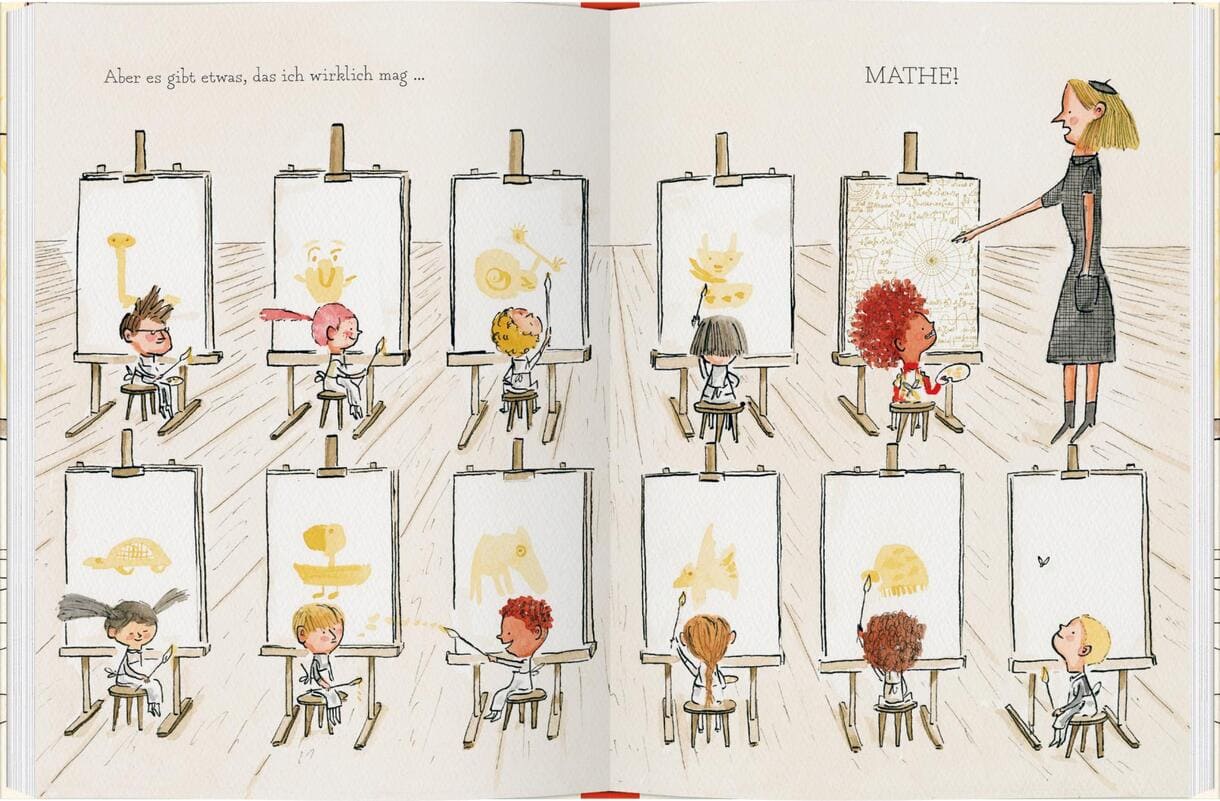
Der Vater malt am liebsten, die Mutter widmet sich der Erforschung von Kleintieren wie Insekten, der Bruder liebt Musik und bläst auf einer riesigen Tuba, doch was will sie, seine Schwester? Alles mögliche probiert sie aus – vom Tennis über Trompete bis Karate, kochen und tanzen…
Nun gut, in Wahrheit verrät schon der Buchtitel, worauf die junge Hauptfigur steht: „Ich mag Mathe“ – in Wort (auf Englisch) und Bild (Wasserfarben und Tinte) vom in Italien lebenden Spanier Miguel Tanco (Übersetzung aus dem Englischen: Margot Wilhelmi) zeigt zunächst den längeren Weg, bis die namenlose Heldin draufkommt, dass ihre Leidenschaft Zahlen und vor allem geometrische Formen sind.
Da staunt etwa die Lehrerin nicht schlecht – und nicht besonders angetan-, dass das Mädchen Formeln, Kurven und Diagramm auf das Blatt auf der Staffelei zeichnet, während ihre Mitschüler:innen alles mögliche andere malen.
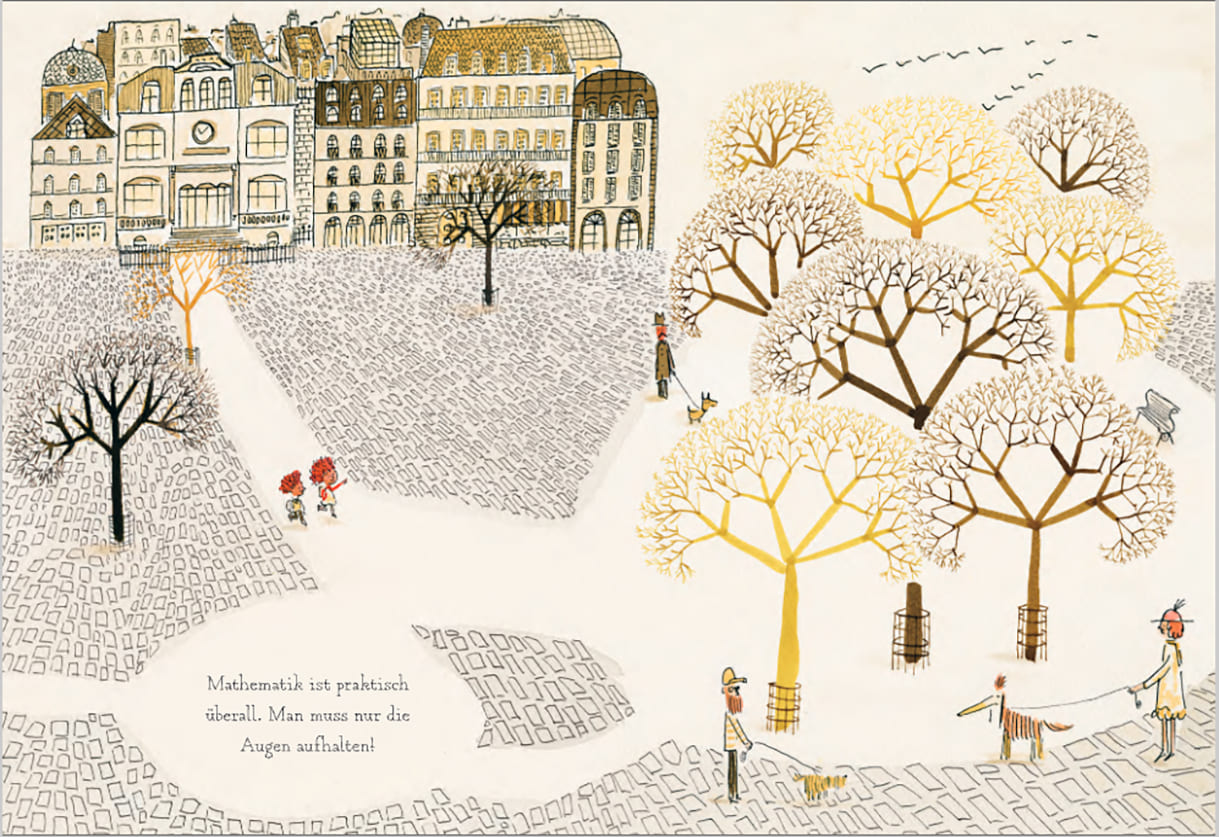
Auf den folgenden Doppelseiten gelingt es dem Autor und Illustrator den Satz „Mathematik ist praktisch überall. Man muss nur die Augen aufhalten!“ wunderbar in ein Bild umzusetzen, das dies sogar bis in die Äste von Bäumen oder Klettergeräte auf dem Spielplatz sowie beim Steine-in-den-See-werfen beweist. Oder wie hilfreich die Kenntnis dieser Wissenschaft sein kann, wenn es darum geht, Essen gerecht auf die vier Familienmitglieder aufzuteilen. Und dennoch wird letztlich in diesem Bilderbuch nicht alles durch die Mathe-Brille betrachtet, sondern der Blick erweitert.
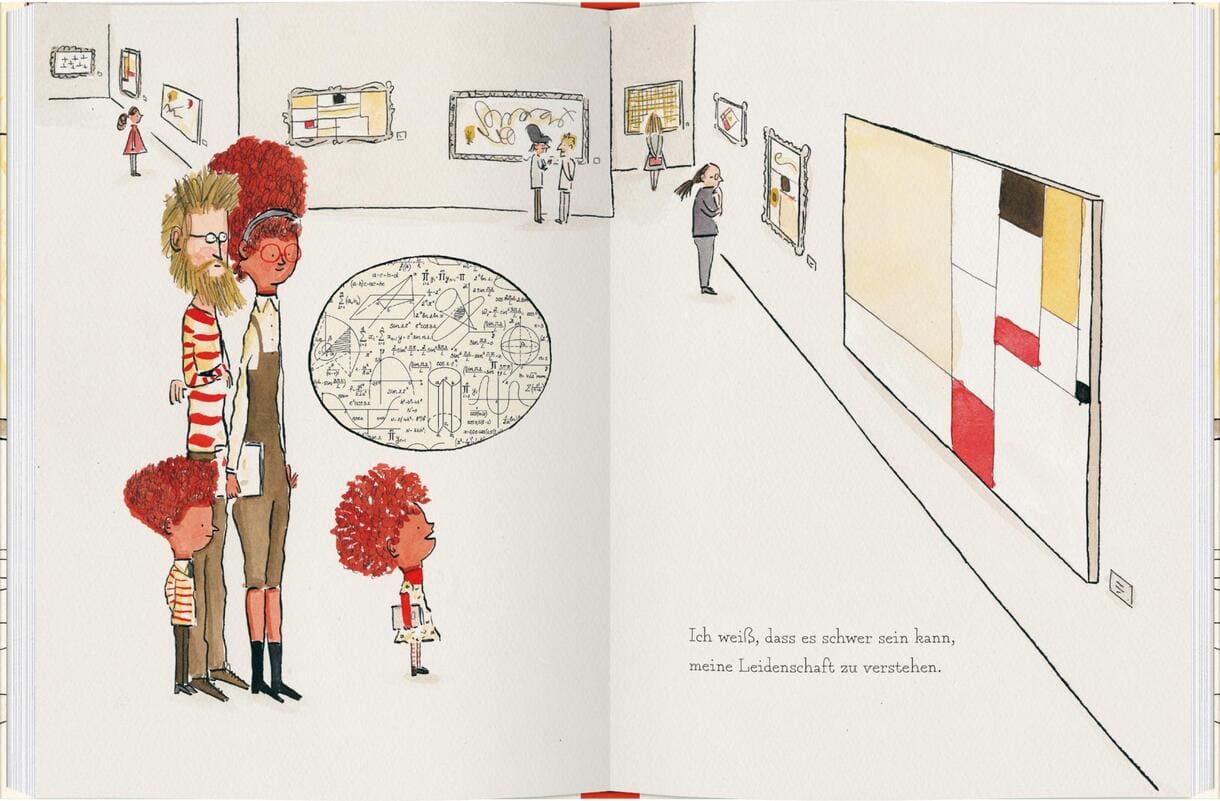
Nach der Bilderbuchgeschichte gibt es am Ende einen Anhang unter dem Titel „mein Matheheft“ mit anschaulichen Beispielen und Erklärungen aller möglichen geometrischen Formen. Ein wunderbares Buch, um diese Wissenschaft, die in Schulen oft noch immer als Angstfach gilt, charmant und interessant darzustellen.
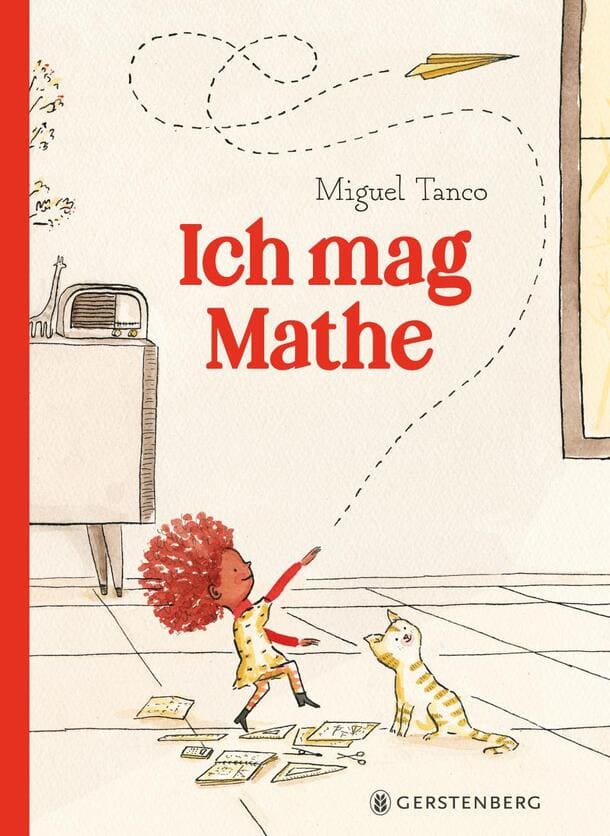
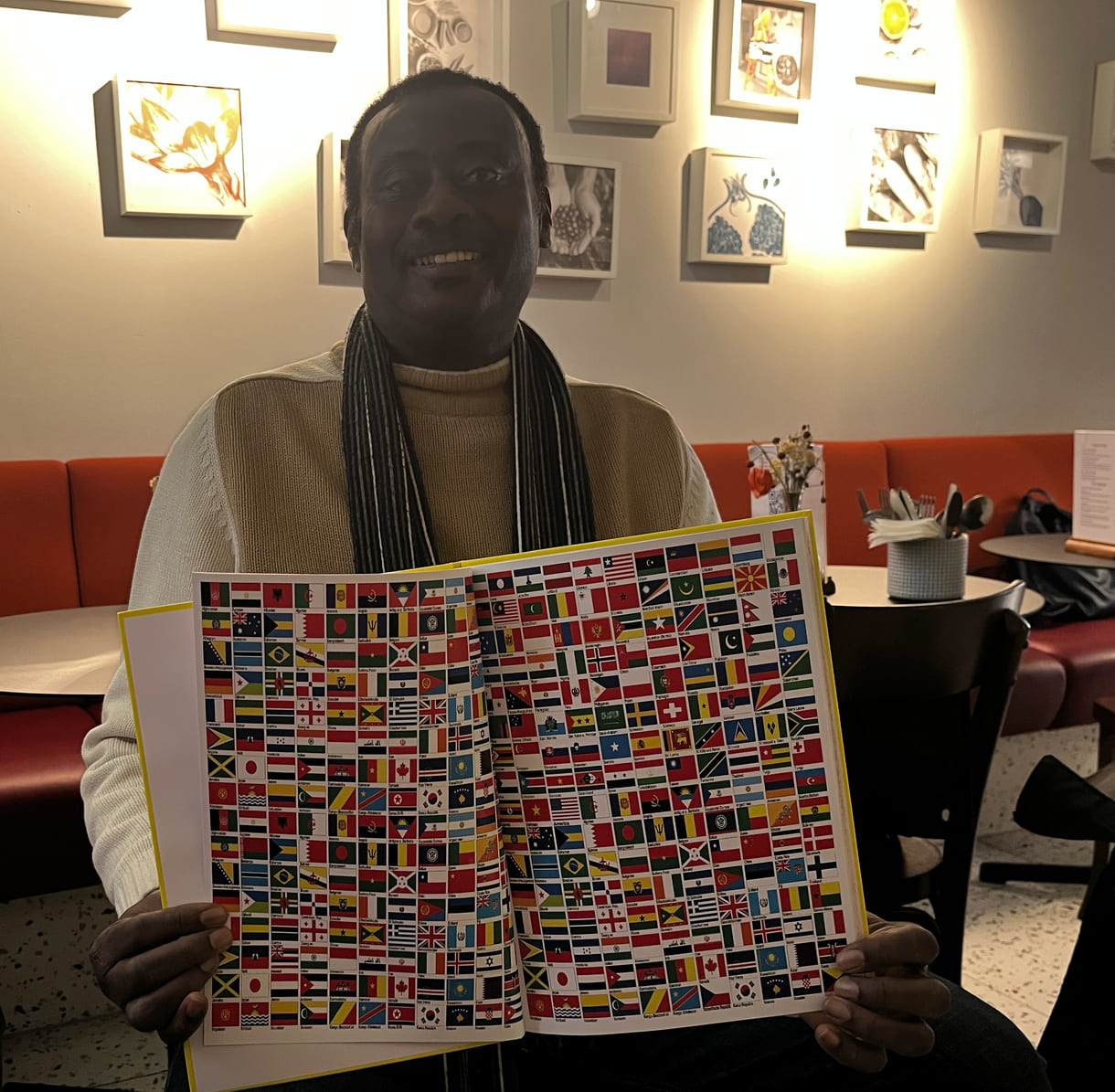
KiJuKU: Du hast gesagt, die Idee zu diesem Buch hattest du in der Schweiz, wie und warum?
Patrick Addai: Ich war auf Lesereise unter anderem in einer Schulklasse in Luzern. Ein Kind hat mich gefragt, woher ich ursprünglich komme. Nachdem ich Ghana genannt hatte, habe ich begonnen, die Kinder zu fragen, wo ihre eigenen Wurzeln liegen. Und da haben sie genannt: Peru, Mexiko, Japan, Eritrea, das letzte Kind in der Reihe sagte: Meier aus der Schweiz. Das hat mir so gefallen – verschiedene Nationen, verschiedene bunte Farben der Fahnen …
KiJuKU: Und wie kam es zum Buchtitel Komödien-Schildkröte?
Patrick Addai: Diese Schildkröte sendet die ganze Botschaft des Buches, nicht ich.
KiJuKU: Sie schlüpft sozusagen in diese Rolle wie ein Schauspieler, eine Schauspielerin? Weshalb gerade eine Schildkröte?
Patrick Addai: Ja, dieses Tier hat eine gewisse Langsamkeit und Sicherheit, so kann sie diese Botschaft besser in die Welt hinaustragen.

KiJuKU: Das ist jetzt ein neues Tier in deinem Buch-Universum, du hattest ja schon viele von Adler über Huhn, Hase und Esel bis Ungeheuer?
Patrick Addai: Die Panzer dieser Schildkröten repräsentieren alle Nationalitäten. Das und die verschiedenen Sprachen am Anfang sind eben, was das Buch sagen will: Egal woher und mit welcher Sprache, die Schildkröten – und auch wir Menschen – sind alle gleich und sollen lieber miteinander feiern als sich zu bekriegen.
KiJuKU: Und weil nicht für alle Flaggen in den großen Bildern Platz ist dann die Ausmalbilder?
Patrick Addai: In sehr vielen Schulklassen gibt es ja Kinder aus vielen verschiedenen Ländern, und wenn eines dabei ist, dessen Fahne nicht von einer großen Schildkröte getragen wird, kann es dann ergänzen und den anderen Kindern davon erzählen.
KiJuKU: One People – Different Colours – dieser Spruch in mehreren Sprachen am Beginn des Buches vereutlicht die Botschaft noch einmal.
Patrick Addai: Und er ist ein Song des südafrikanischen Reggae-Sängers Lucky Philip Dube (1964 – 2007). Sein erstes Album ist damals noch unter dem Apartheid-Regime (eine Minderheit von Weißen herrschten, die große Mehrheit der Schwarzen hatte praktisch keine Rechte) verboten worden. Später bekam er zwei Platin-Schallplatten, ein Album wurde zum meistverkauften der 80er und 90er Jahre. 2007 wurde er in Johannesburg vor den Augen seiner Kinder erschossen. Ihm widme ich das Buch – mit diesem Spruch aus einem seiner bekannten Nummern. Bei Afrikatagen in Wien vor vielen Jahren hab ich seine Tochter Nkulee, die auch Reggae-Sängerin ist, kennengelernt und ihr versprochen, eines Tages werde ich ein Buch ihrem Vater widmen.
kinderbuchautor-als-schul-hebamme-in-ghana <- damals noch im Kinder-KURIER
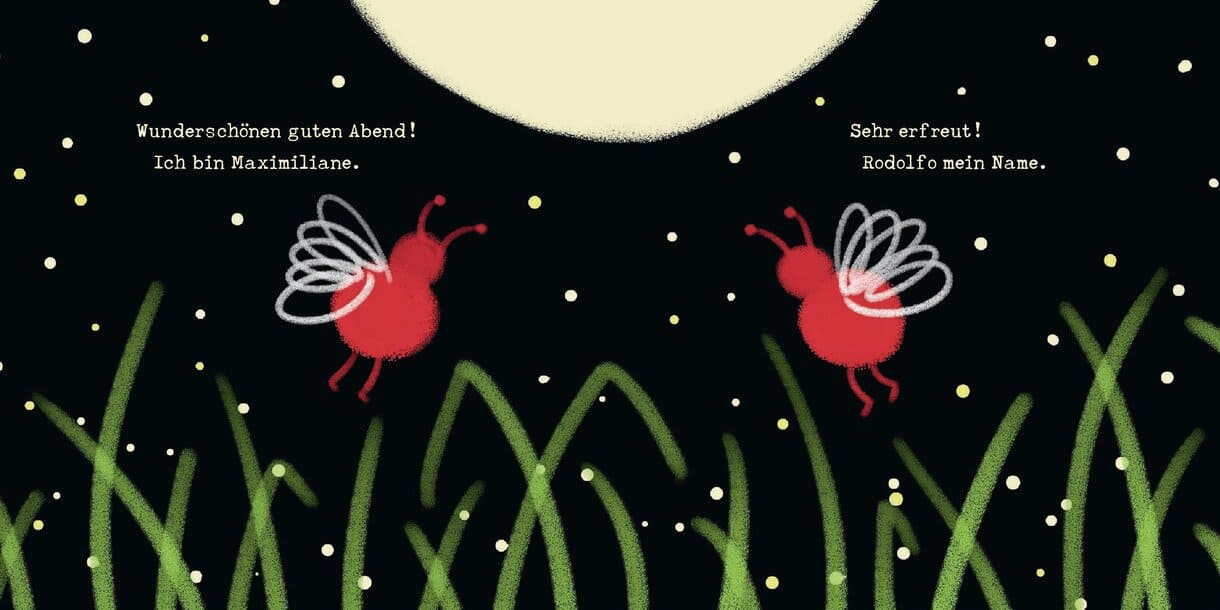
So viel dunkle Nacht – und dich wird sie vielfach erhellt – von vielen kleinen gelb leuchtenden Punkten. Sind das alles Sterne? Oder gibt’s da auch solche wie mich, scheint sich ein besonderes Glühwürmchen zu fragen. Maximiliane ist ein rot leuchtendes ihrer Art.
Und siehe da – da gibt’s noch ein zweites solches. Als Rodolfo stellt er sich ihr vor.
Von nun an – ab der sechsten Doppelseite (von insgesamt 13) – fliegen sie gemeinsam durch die Nacht der Bilder aus Collagen als wären sie aus Wollfäden und ausgeschnittenen Bildern zusammengepuzzelt.
Als Vorlese- und dabei unbedingt Mitschau-Buch eignet sich „Zwei rote Glühwürmchen“ gut als Gute-Nacht-Einschlaf-Hilfe.
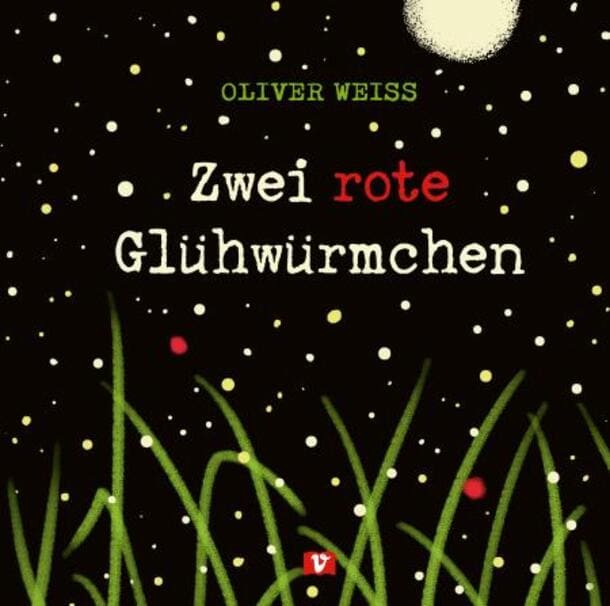
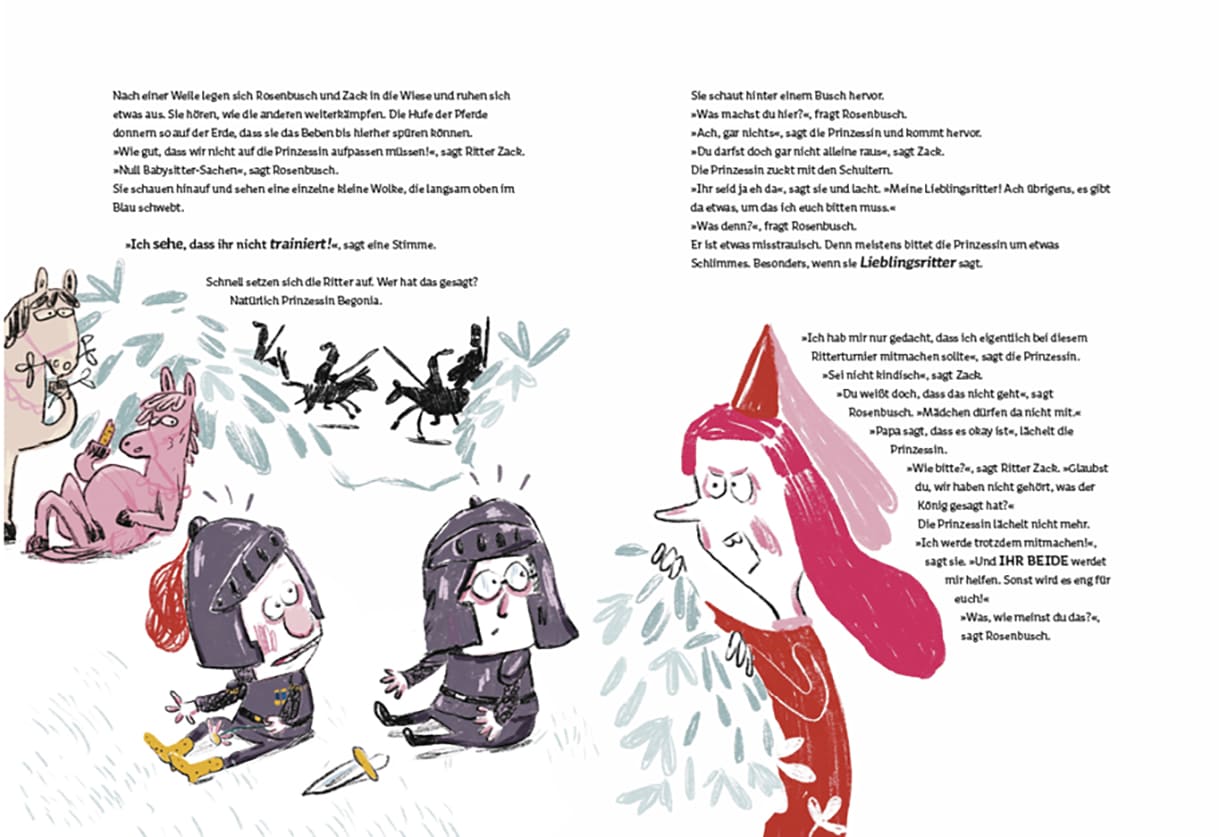
„Das ist nichts für Mädchen, Begonia“, meinte der König und Vater des Mädchens den Wunsch der Tochter vom Tisch seines Büros mit Aussicht auf Land und Stadt des Reiches zu wischen.
„Zeig mir, wo das steht!“ konterte die Prinzessin.
Das würde zwar nirgends schriftlich festgehalten, aber „es war immer schon so.“

Da hatte der Herrscher die Rechnung ohne seine Tochter gemacht. Mit einem „du bist so wahnsinnig altmodisch!“ rauschte sie ab, schlug die Tür zu und …
… natürlich wird sie am Ende dieses Bilderbuchs „Die Ritter holen Gold“ ihren Kopf durchgesetzt, und damit den Buchtitel ein wenig Lügen gestraft haben. Das kannst du wohl annehmen – ohne Details zu verraten.
Davor aber hat sich Bjørn F. Rørvik (Übersetzung aus dem Norwegischen: Barbara Giller) noch die Begegnung Begonias mit ihren Lieblingsrittern Rosenbusch und Zack einfallen lassen. Die bittet sie um Trainingseinheiten in den Bewerben eines Turniers auf der Klampenburg. Mit einer List will sie – zunächst – unerkannt teilnehmen, denn mutig ist sie sowieso.
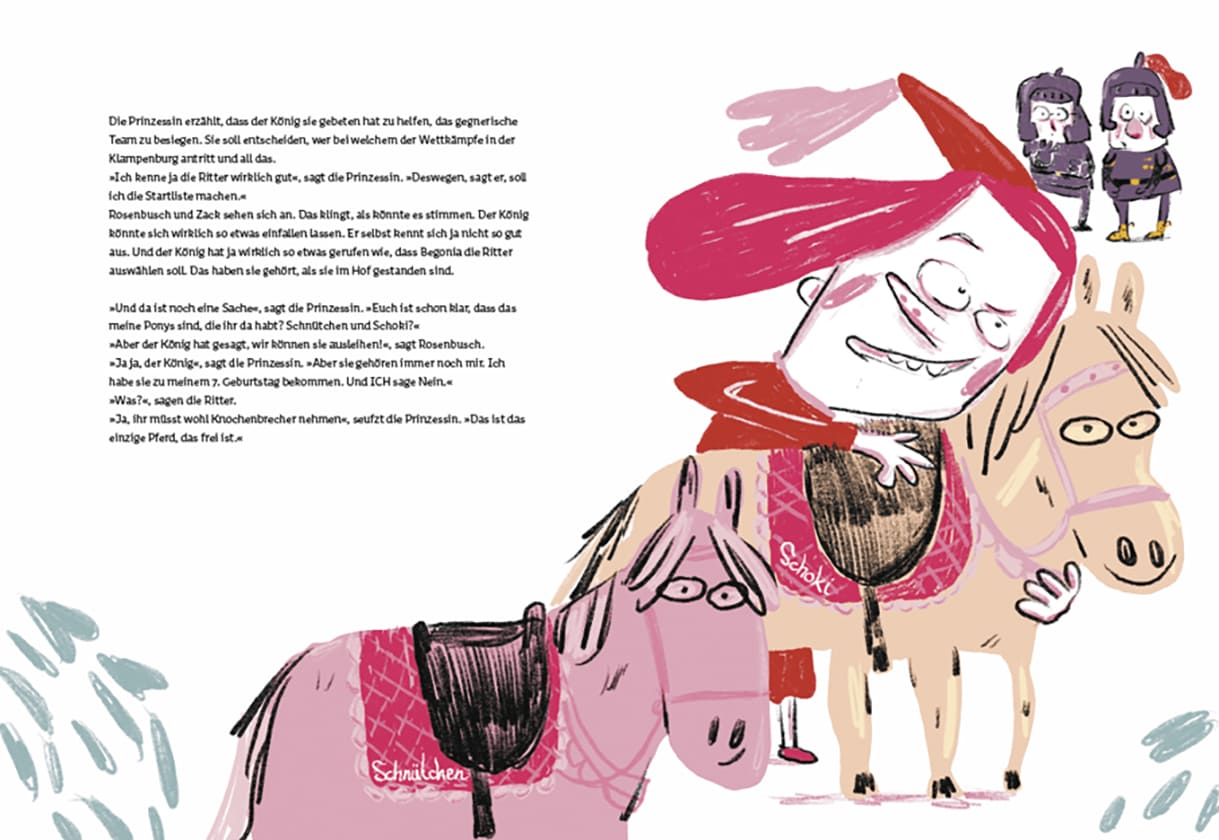
In buntem comic-artigem Stil zeichnete Camilla Kuhn Ritter, die Prinzessin, ihren Vater und verschiedene Burgen und Wettkämpfe – klassisch ritterliche und einen Extrabewerb, der hier nicht gespoilert wird.
Als Begonia nach ihrer überaus erfolgreicher Teilnahme den Helm lüftet und der Herzog der Klampenburg protestiert, greift Vater und König zu sehr ähnlichen Worten wie sie ihm seine Tochter zu Beginn an den Kopf geworfen hatte 😉

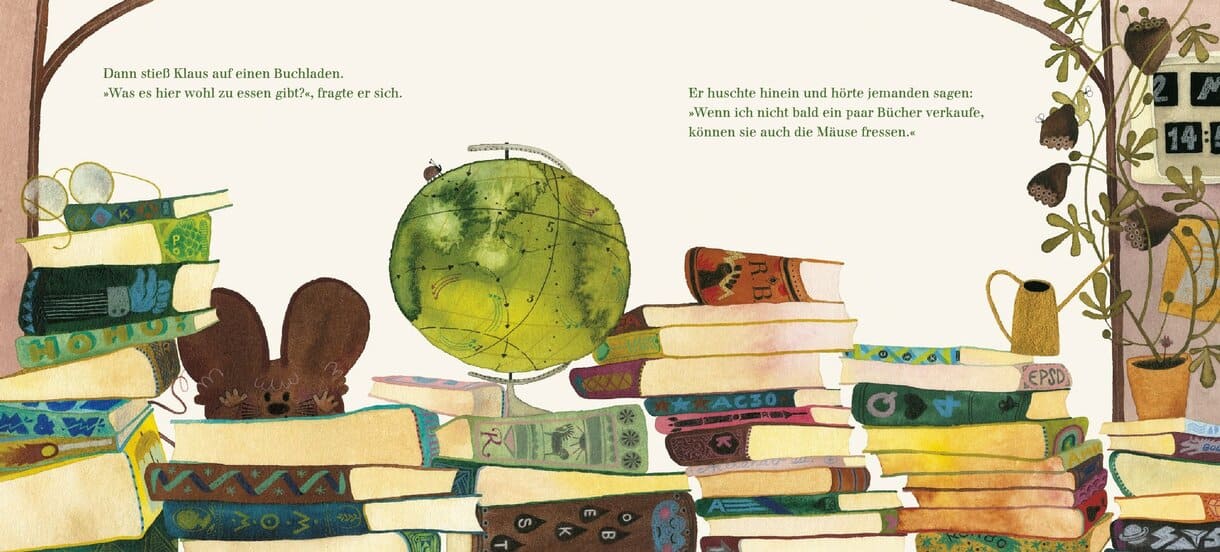
„Als Nächstes probierte er ein paar dicke Bücher mit sehr vielen Wörtern. Diese schmeckten nach Abenteuern, Piratenschiffen und verborgenen Schätzen. Sie waren vorzüglich! Zum ersten Mal in seinem Leben war er richtig satt und schlief glücklich ein.“
So geht es der klitzekleinen Maus mit riesigen Ohren und noch größerem Hunger auf der sechsten Doppelseite des Bilderbuchs „Klaus, die Büchermaus“. Davor hatte Maus Klaus alles Mögliche in sich hineingestopft: Käse, Brot, Obst, Fisch…
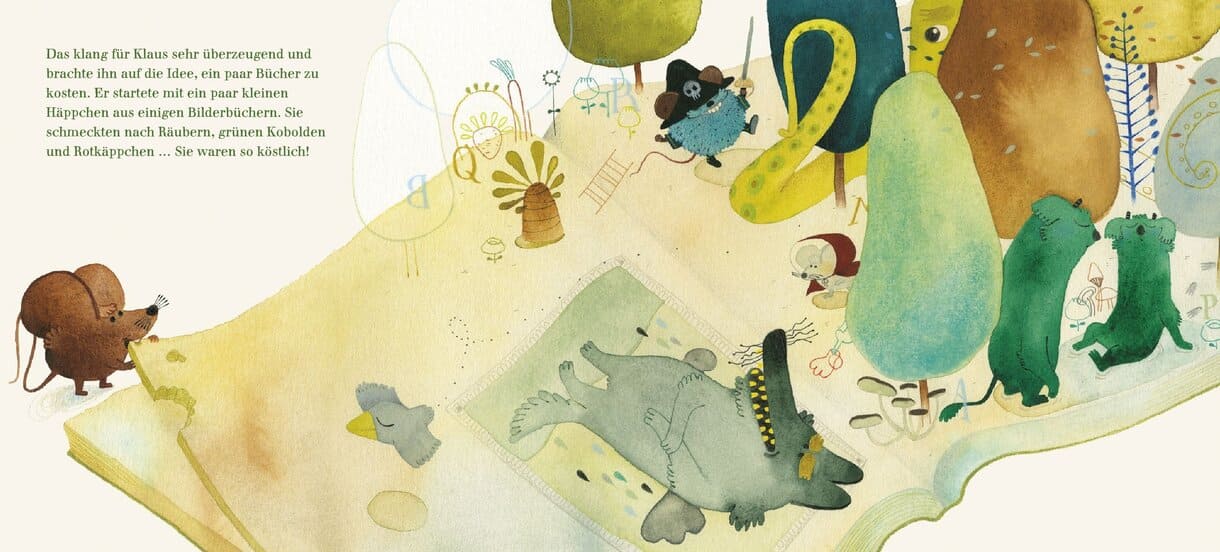
In einer Buchhandlung hörte er einen Menschen sagen: „Wenn ich nicht bald ein paar Bücher verkaufe, können sie auch die Mäuse fressen.“ Und so versuchte sich die kleine Maus am Verzehr von bedrucktem Papier – erst mit vielen Bildern, dann mit mehr Wörtern. Klaus wurde wie das Zitat im ersten Absatz zeigt, satt – in Bauch und Kopf.
Doch meinte die Buchhändlerin schließlich, sie könnte auch vorlesen, die Maus müsste die Werke nicht „verschlingen“. Besonders gefiel Klaus die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln. Davon ließ sich die Maus inspirieren und … – nein, Ende vom Spoilern 😉
Verraten sei natürlich schon, wer dieses Buch geschrieben hat: Im spanischen Original: José Carlos Andrés. Es wurde nicht eins zu eins übersetzt, sondern auf Deutsch nacherzählt – von Simone Klement und Christine Laudahn. Die fantasievollen, bunten gezeichneten Bilder stammen von Katharina Sieg. Und das Buch setzt sozusagen (fast) allen Büchern ein „Denkmal“.
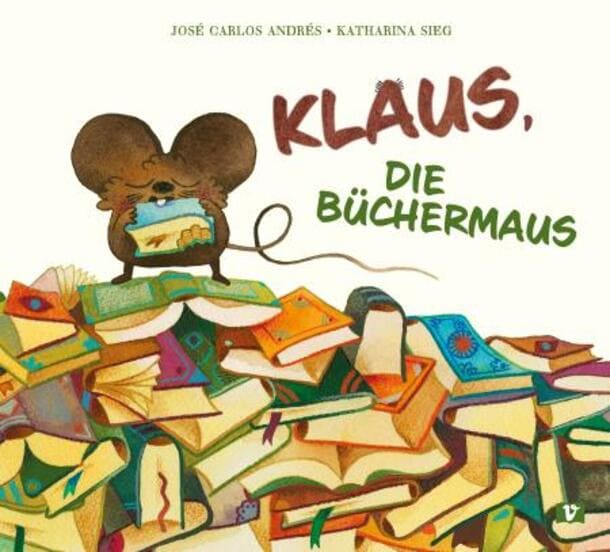
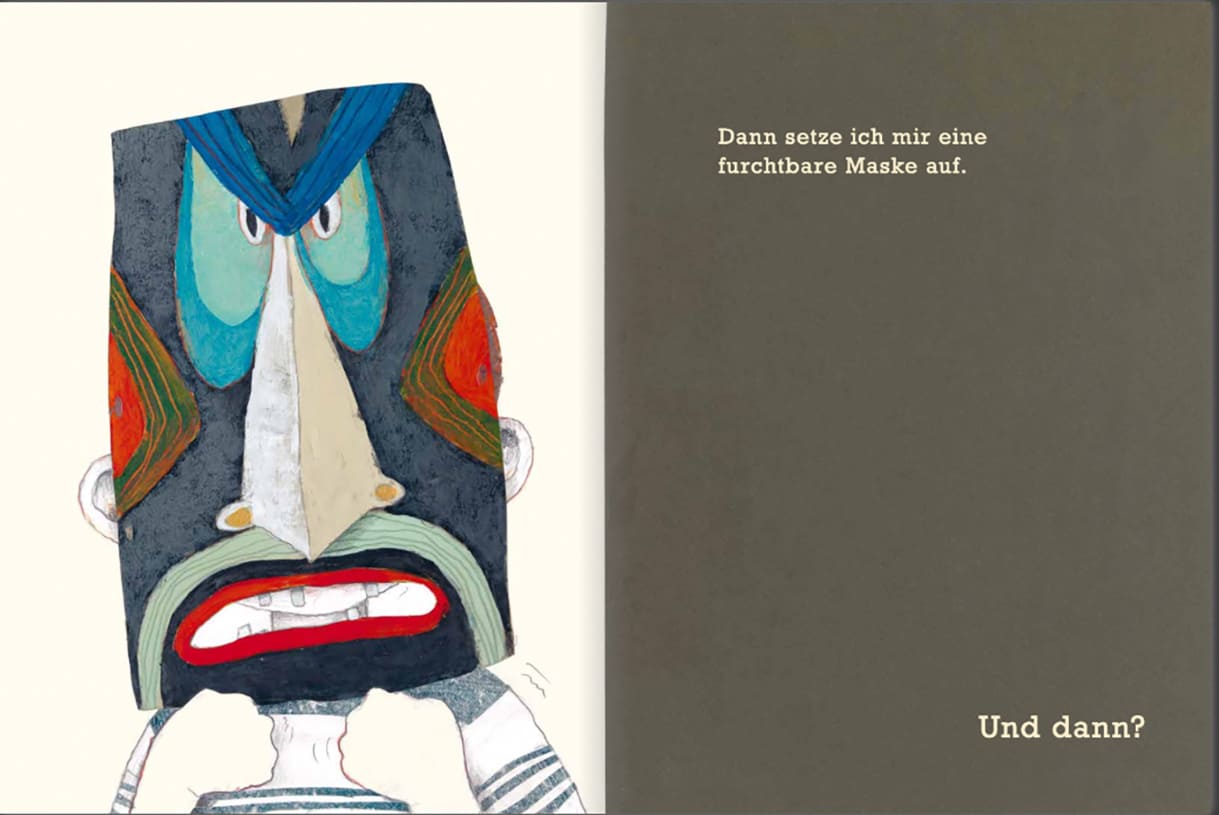
„Und dann?“ – so losgelöst könnten die beiden Wörter für vielfältige Fragen stehen. Bei diesem Bilderbuch ist es ganz wichtig, dass du dir die Vorsatzseite anschaust. In vielen Büchern ist sie oft „nur“ ein buntes Vorspiel. Hier aber erklärt sie – wortlos – den Ausgangspunkt für die folgende Geschichte.
Zwei Kinder sitzen irgendwo an einem Ufer und halten ihre Angeln ins Wasser. Während das Kind mit zwei blonden Zöpfen und einem roten Kleid alles Mögliche rausfischt auch wenn es sich dabei nur um altes Zeugs handelt, geht das Kind mit dünkleren Haaren, gestreiftem T-Shirt und kurzer Hose leer aus.

Wütend verlässt er diese Vorsatzseite, um nun einen viele Doppelseiten langen Solo-Auftritt zu haben. In seinem Ärger, den Illustratorin Helga Bansch gleich auf der ersten Doppelseite so ins Gesicht des Kindes zeichnet, dass du vielleicht sogar Angst kriegen könntest. Jedenfalls aber kannst du dessen Wut fast spüren.
Autor Heinz Janisch hat sich erdenklich vieles einfallen lassen, was dieses eher als Bub gelesene Kind in seinem Zorn alles anstellen könnte. Kürzeste Sätze reichen. Was auch immer er aufführt, es geht darum, allen anderen Angst einzujagen: Furchtbare Maske, brüllen und vieles mehr.
Am Ende sind alle davongelaufen. „Und dann?“
Nun, vielleicht doch nicht alle, aber verraten sei das Ende hier sicher nicht.

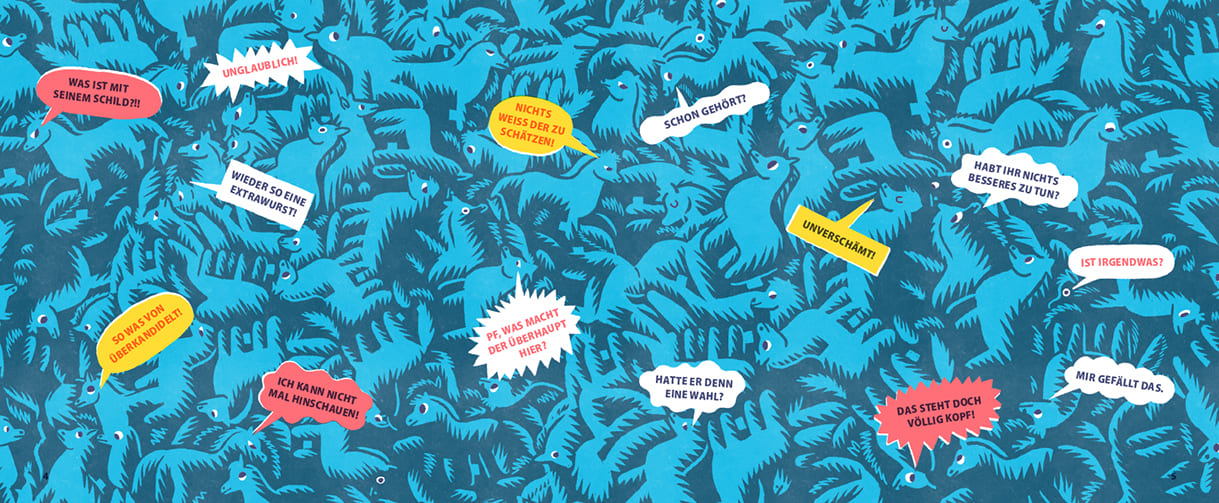
Fast unzählbare blaue Kuschel-Ponys versammelt die Illustratorin Daniela Olejníková auf der ersten Doppelseite des Bilderbuchs „Der allergrößte Wunsch“. Dazwischen platzierte sie etliche Sprechblasen. Offenbar gibt’s Streitereien unter de Ponys. Etliche regen sich darüber auf, dass eines von ihnen offenbar meint, etwas Besseres zu sein.
Dieses hat – im Gegensatz zu allen anderen – das Zettelchen mit der (Nicht-)Waschanleitung auf dem Rücken. Und es ist von der Autorin Ester Stará (Übersetzung aus dem Tschechischen: Mirko Kraetsch) dazu auserkoren, Kapitel für Kapitel durch die Geschichte zu führen.

In der Fabrik im chinesischen Dorf Nahui (Provinz Guizhou) spricht die Näherin mit der Hauptfigur des Buches, meint, ihre Schwester Li würde sich über dieses freuen… aber nix da. Nach erledigtem Tagwerk wird’s finster und das Pony landet – wieder mit vielen anderen eng aneinander gequetscht in einer großen Kiste, die hin und herschwankt. Du siehst auf der entsprechenden Doppelseite, warum das so ist: Container-Schiff.
Irgendwann landet das blaue Kuscheltier in einem Spielzeuggeschäft, wird gekauft – von einem Mädchen, aber nicht für sich, sondern als Geschenk für einen Freund zu dessen neuntem Geburtstag. Doch der beachtet es nicht, es landet im Mist – und wird natürlich gerettet…
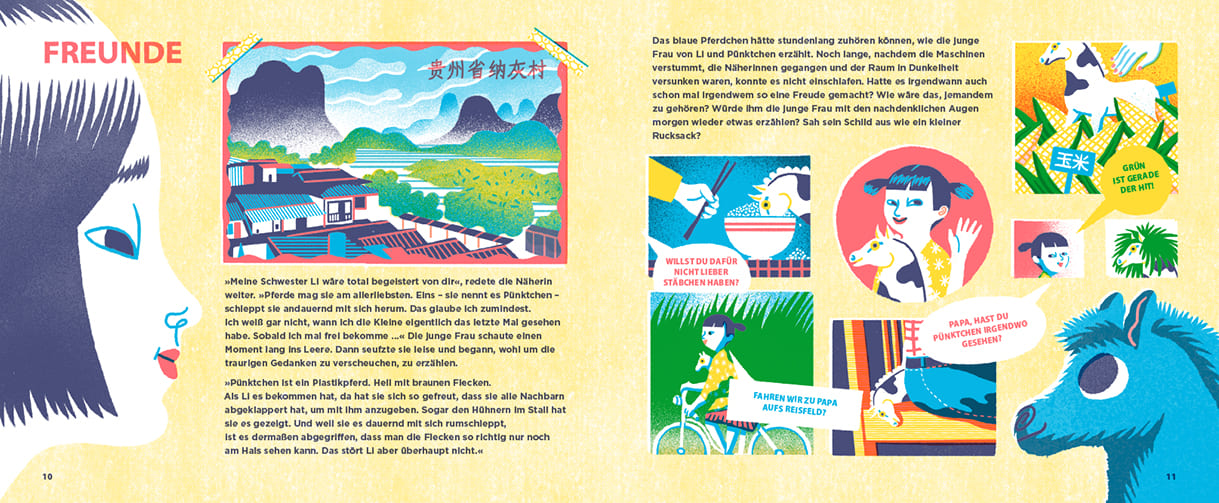
Klar, ein Happy End muss her. Wie es zu diesem kommt, bleibt der Lektüre dieses Bilderbuchs überlassen, das mit der Geschichte des Ponys – ähnlich wie der Teddybär Mat in „Mat und die Welt“ (Link zu der Besprechung dieses Buches weiter unten) – auch die weite Reise des Spielzeugs und die Wanderung eines solchen von einem Kind, das es gar nicht beachtet zu einem anderen erzählt.

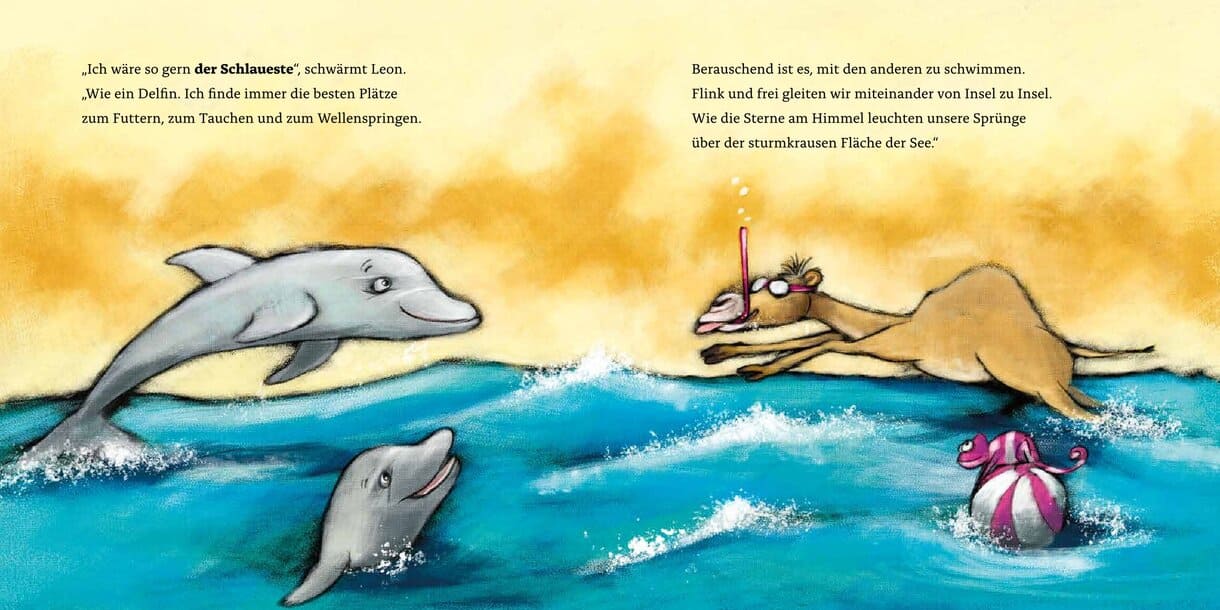
Kamel Leon trifft seinen „allerbesten Freund“, das Chamäleon Felix. Und schaut traurig drein – gleich auf der ersten Doppelseite. Neugierig und aufmerksam mustert Felix seinen großen Freund.
Dieser vertraut dem kleinen Farbenwechsler sein größtes Geheimnis, das gleichzeitig die tiefste Sorge ist, an: „Ich wäre so gerne auch mal in irgendetwas der Beste!“ (Hervorhebung im Buch). Und dann fantasiert Leon los, er wäre gern so wild und mutig wie ein Löwe, so schlau wie ein Delfin, groß und stark wie ein Elefant und noch vieles mehr.
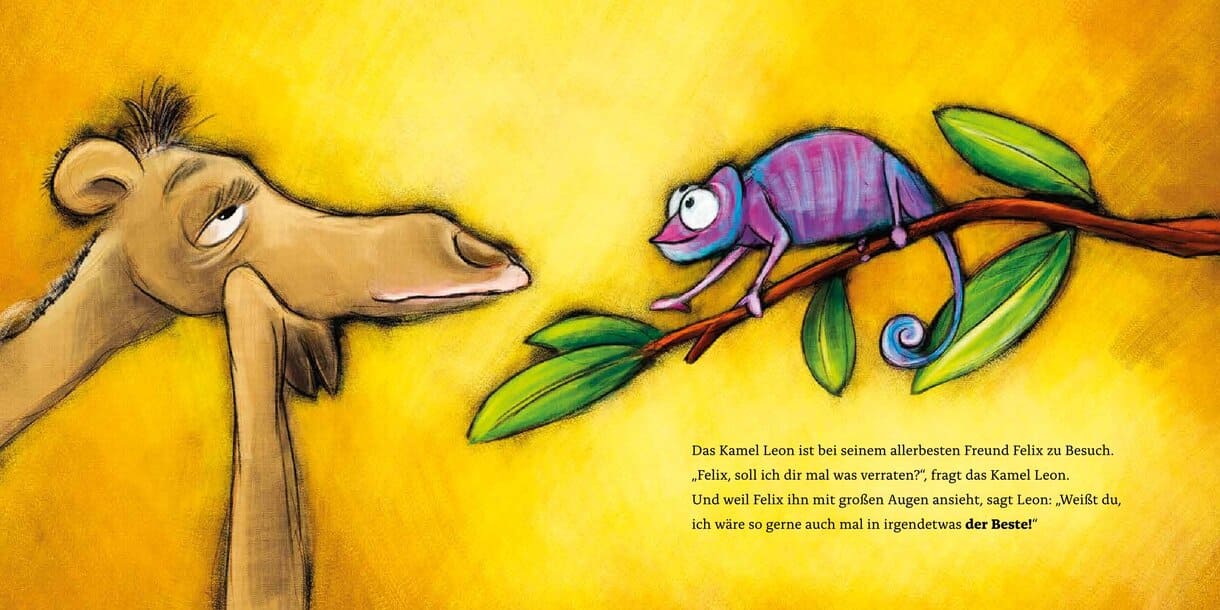
Während er so drauflos träumt, wer anderer oder anders zu sein, achtet er fast gar nicht auf seinen Freund und lässt Felix auch nicht zu Wort kommen.
Bis er seinen Freund fast nicht entdeckt. Da meint Leon, ein so guter Verstecker wie ein Chamäleon wäre er vielleicht auch ganz gern.
Und eeeendlich kommt auch dieser Freund zu Wort. Neben der Weisheit, dass es praktisch immer wen gibt, der in irgendwas viel besser, schneller, größer und so weiter ist. Und dennoch hat er ein Mut machendes Schlusswort für Leon, worin der jedenfalls der beste ist. Aber das sei hier nicht verraten.
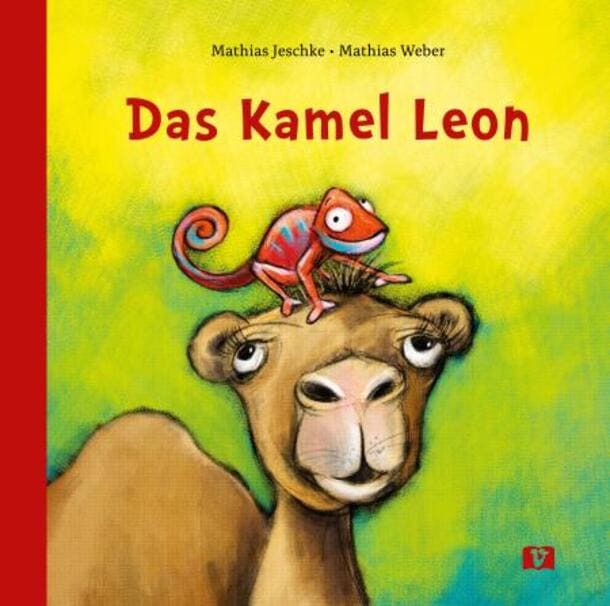
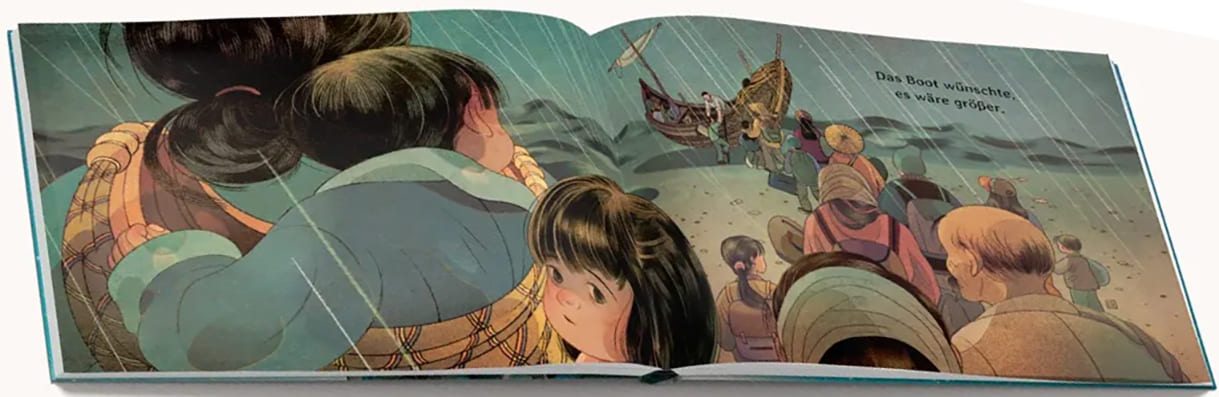
Ein mehr als voll besetztes Boot schaukelt auf Wellen. Sehr viele Menschen, dicht an-, fast schon aufeinander, sind auf der Titelseite des Buches „Wünsche“ zu sehen – gezeichnet von Victo Ngai.
Und dann lässt die Autorin Mượn Thị Văn in gut zwei Drittel der Doppelseiten nicht Menschen, sondern zunächst die Nacht, dann die Tasche, das Licht, den Traum, den Pfad, das Meer, die Sonne … mit deren Wünschen zu Wort kommen. Die Tasche beispielsweise wäre gern tiefer, der Traum länger…
Angsterfüllte Augen malte Victo Ngai den Kindern in ihre Gesichter. Sie müssen ihre Heimat, ihr vertrautes Umfeld verlassen. Und so erzählen die Wünsche der zuvor aufgezählten und weiterer Objekte die Sorgen, Nöte, Ängste der Menschen sozusagen auf Umwegen. „Das Boot wünschte, es wäre größer.“
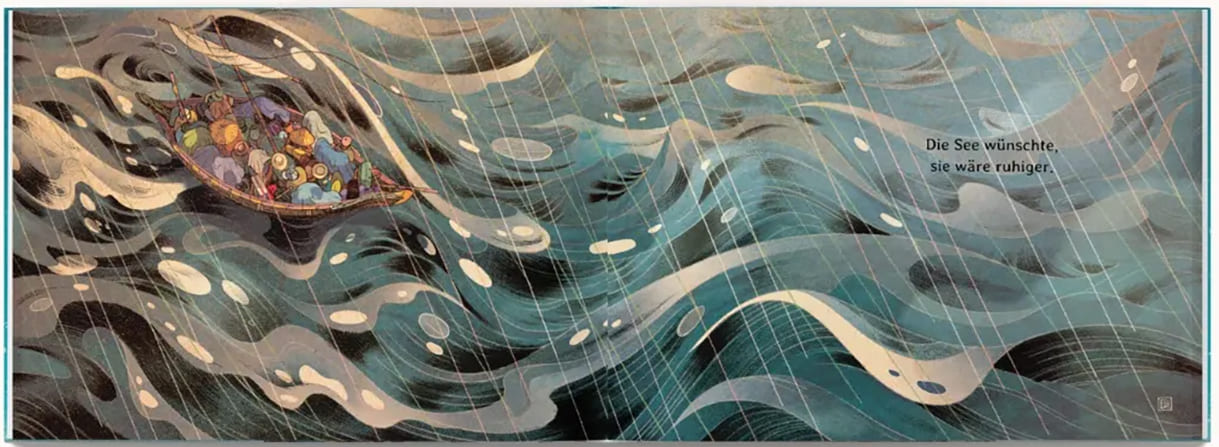
Erst sehr spät in der durch ganz wenige Sätze (in der deutschsprachigen Version sind es 76; Übersetzung aus dem englischen Original: Petra Steuber), die so viel aussagen und doch auch großen Freiraum fürs Spinnen eigener Gedanken dazu lassen, kommt eines der Kinder direkt zu Wort: „Und ich wünschte… ich müsste mir nichts wünschen…“
Obwohl die Autorin auf ihre eigene Fluchterfahrung aus dem damaligen Südvietnam zurückgreift, legt sie die Geschichte in „Wünsche“ doch so universell an. Und die Illustratorin schafft Stimmungsbilder, in denen viele zu entdecken, aber vor allem noch mehr in den Gesichtsausdrücken der Abgebildeten sowie in ihrer Körperhaltung abzu„lesen“ ist.

„Wünsche“ ist übrigens ein Preisträger der Kritikerjury in den Kategorien Bilderbuch beim deutschen Jugendliteraturpreis und wurde obendrein von der Jugendjury ausgezeichnet. In der Begründung zum erstgenannten Preis heißt es unter anderem: „Was die 16 Doppelseiten des Bilderbuchs über die Erlebnisse eines Kindes erzählen, das mit seiner Mutter und zwei jüngeren Geschwistern sein Zuhause verlassen muss, bekommt eine raum- und zeitübergreifende universelle Dimension, die für Erwachsene und Kinder gleichermaßen berührend ist… Victo Ngai hat die hohe poetische Verdichtung der prägnanten Sätze in farbstarken Bildern eindrücklich verstärkt.“
Auf der letzten Doppelseite des Buches legen Autorin sowie Illustratorin ihre Gedanken zum Buch und dessen Hintergründe dar. Und Mượn Thị Văn schreibt unter anderem: „Und dann frage ich mich: Wie lange und wie oft müssen solche Geschichten noch erzählt werden?“ Ihre kongeniale Partnerin, die Illustratorin schildert ihre Eindrücke des Textes u.a. so: „Die Erzählung durch leblose Gegenstände hat mich besonders berührt. Die Passivität verdeutlicht die wenigen Möglichkeiten, die der Einzelne in Zeiten großer Veränderungen und Unruhen noch hat.“
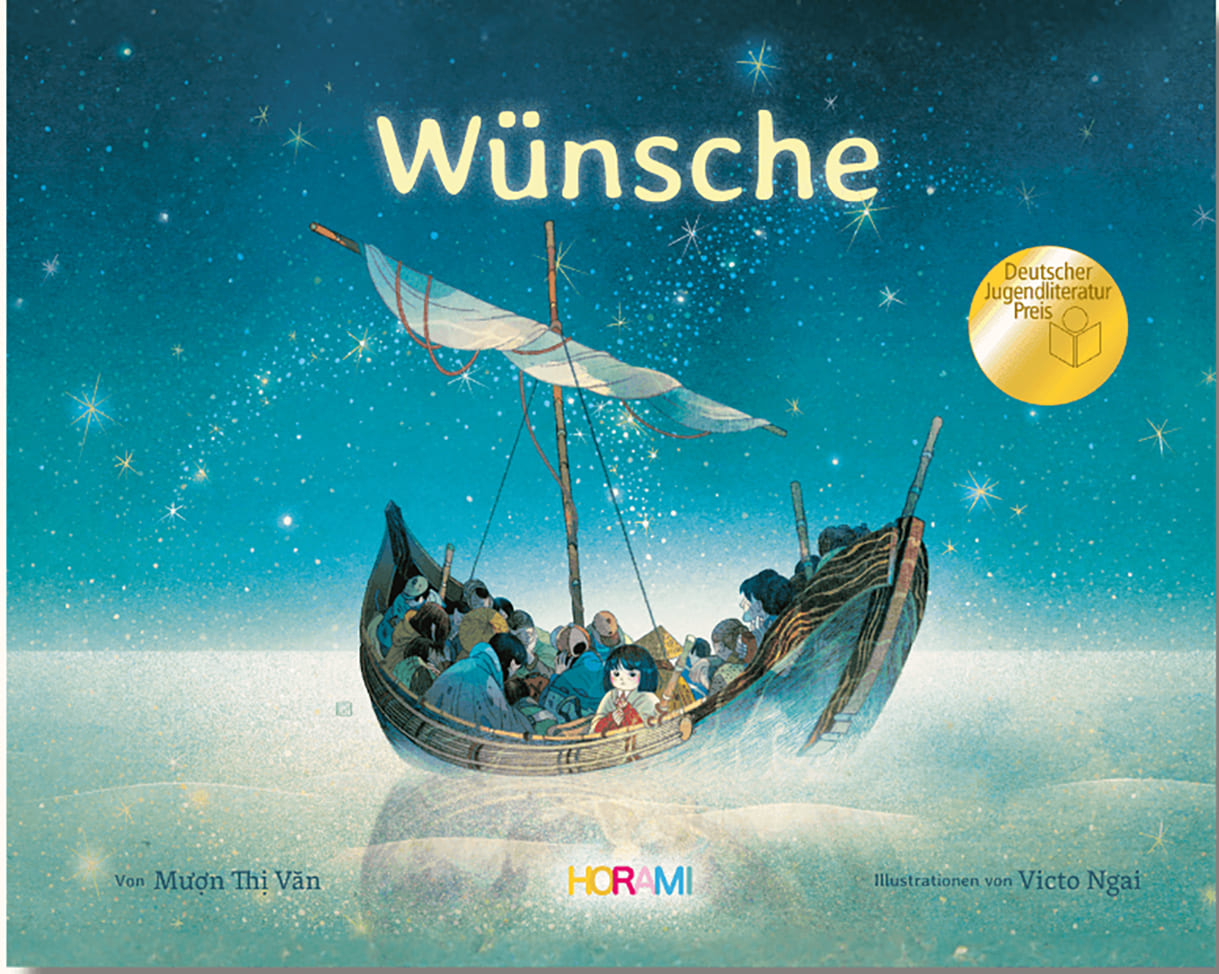
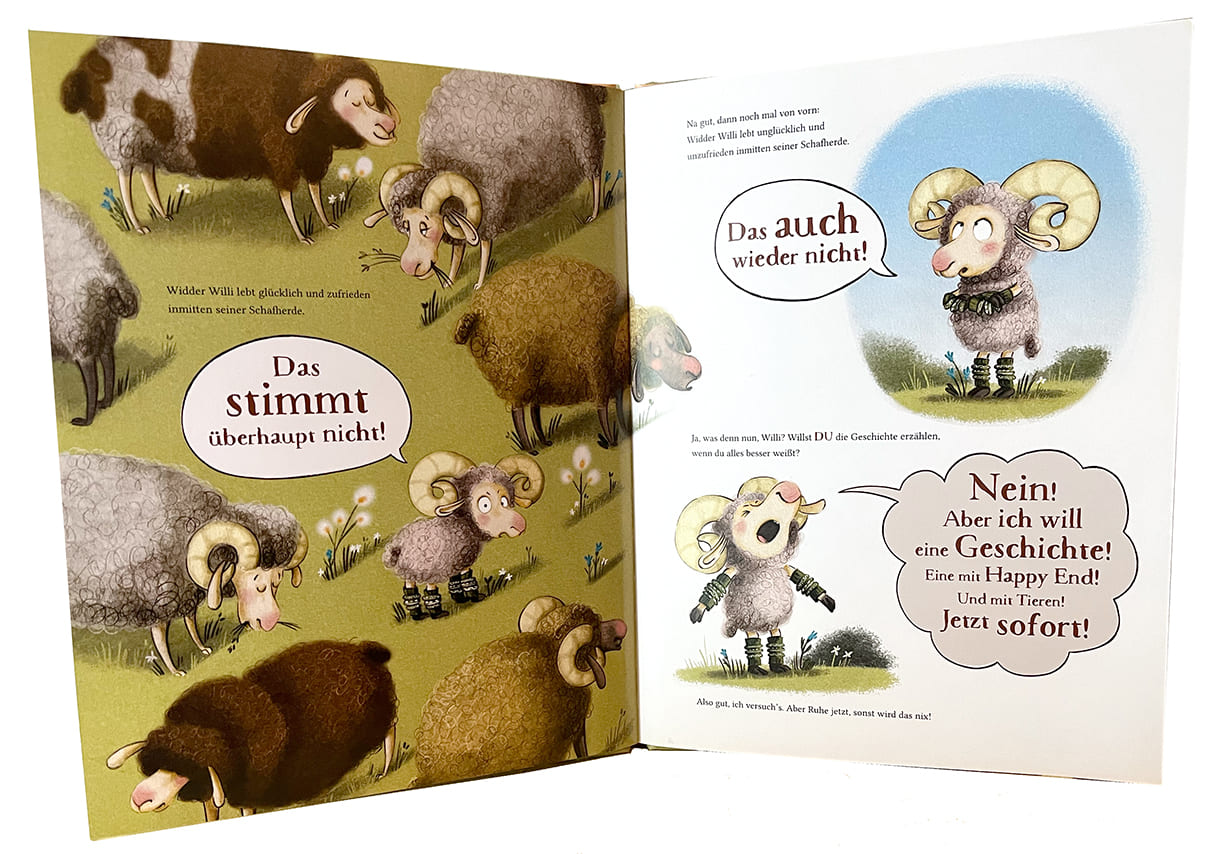
Schon der Titel – samt dem Namen für die tierische Hauptfigur ist Programm. „Widder Willi will aber!“ Romy Pohl hat sozusagen versucht, eine Art Erziehungsratgeber mit so manch eigenen familiären Erfahrungen in eine „fabel“hafte Bilderbuchgeschichte im Tierreich zu verpacken.
Gleich auf der ersten Doppelseite lässt sie die Hauptfigur, eben den Widder Willi, ihr selbst, der Autorin, widersprechen. Erster Satz: „Widder Willi lebt glücklich und zufrieden inmitten seiner Schafherde.“
Eine riesige ins Auge stechende Sprechblase unter diesem Satz, in der steht: „Das stimmt überhaupt nicht!“
„Na gut, dann noch mal von vorne: Widder Willi lebt unglücklich und unzufrieden inmitten seiner Schafherde“, probiert’s die Autorin neu. Und schon wiederholt sie das Spiel neue große Sprechblase: „Das auch wieder nicht!“…
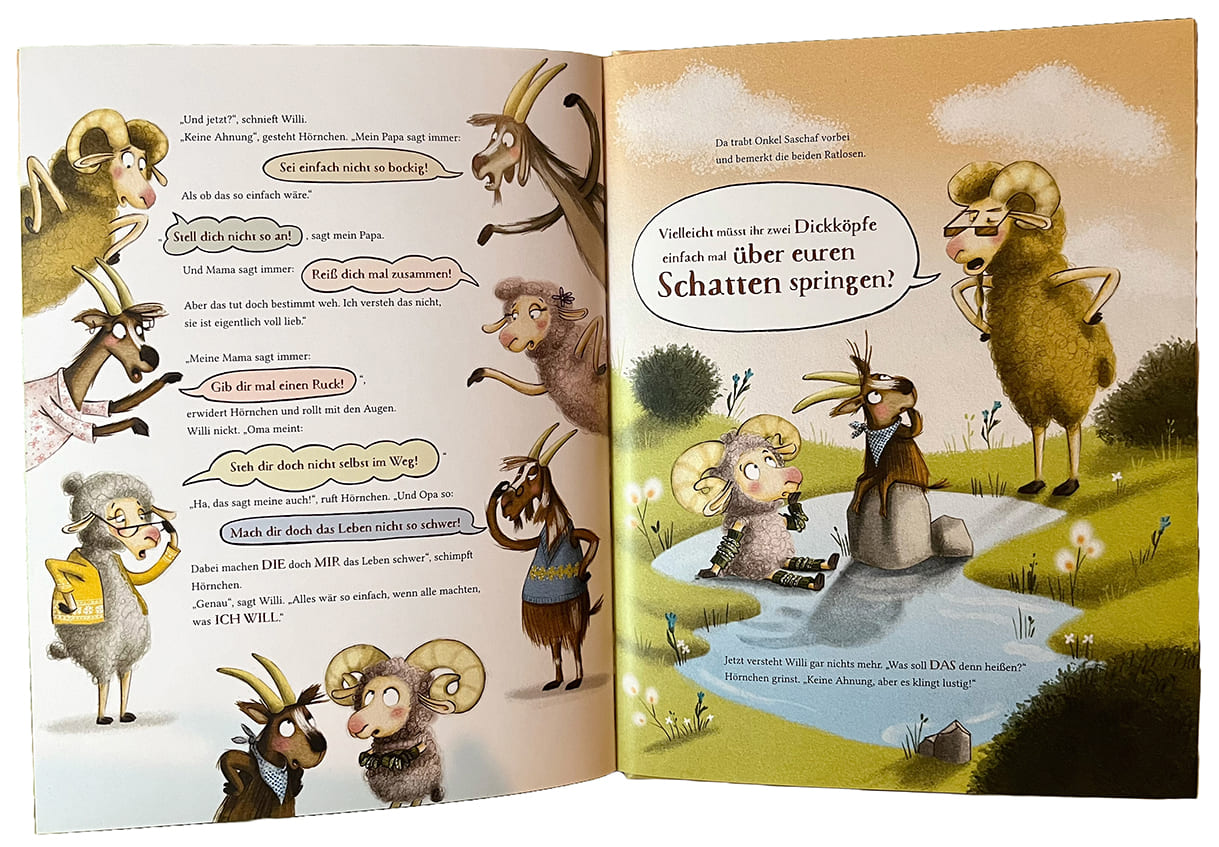
Auf den folgenden Doppelseiten lässt die Autorin ihren jungen Schafbock zwar nicht ihr selbst widersprechen, aber eine – wie es im Wienerischen heißen würde – „Zwiderwurzn“ ist Willi in dieser Phase allemal. Nix passt dem jungen Widder, dessen Hörner gerade einen kleinen Wachstumsschub samt dazugehörigem Schmerz durchmachen. Nervt alle anderen, aber immer wieder auch sich selbst.
Da trifft Willi eines Tages auf einen Steinbock, seines Zeichens auch ganz schön „bockig“, also ähnlich drauf wie Willi, sozusagen ein „Kein-Bock“. Anders gesagt: zwei Dickköpfe bevölkern nun die folgenden Seiten des Bilderbuchs – illustriert von Marta Balmaseda. Die beiden sollten einfach über ihre Schatten springen, rät ihnen Willis Onkel Saschaf.
Und siehe da, als sie zwar nicht über den jeweils eigenen springen können, kommen sie auf die Idee über den Schatten des jeweils anderen zu hüpfen. Und finden Spaß an dem Spiel… „Das macht voll Bock, jubelt Hörnchen.“
Was zwar im Moment den beiden Freude bereitet, den anderen Ruhe verschafft, aber … so einfach ist’s am Ende dann doch auch wieder nicht 😉
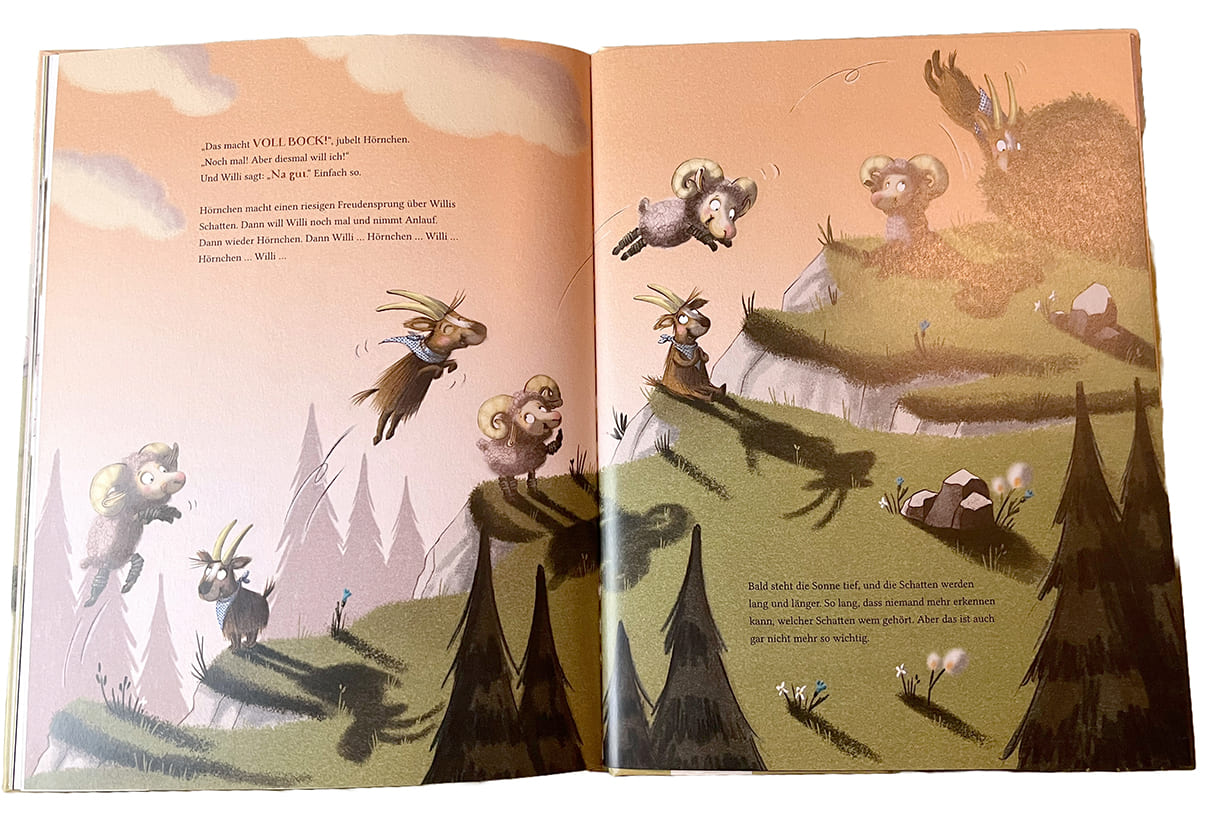
„Ich will aaaaberrrr!“ Nicht nur Möchtegern-Präsidenten führen sich so auf. Praktisch jedes Kind hat die sogenannte Trotzphase. Da helfen meist keine Argumente. Es kann noch so kalt draußen sein, das junge Wesen will in leichter Sommerkleidung ins Freie. Kann auch umgekehrt sein. Oder ganz was anderes. Viele nennen das Trotzphase in sehr jungen Jahren – ungefähr zwei bis vier – und ein zweites Mal ein paar Jahre später Pubertät.
Aber stimmt das auch, das mit der Torztphase?
Der bekannte dänische Familientherapeut und Verfasser etlicher pädagogischer Ratgeber-Bücher Jesper Juul (1948 – 2019) hat in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ vor rund zwölf Jahren gesagt: „Kinder haben kein Trotzalter. Es ist eine natürliche Entwicklung, dass sich das zwei- bis dreijährige Kind aus der kompletten Abhängigkeit von den Eltern zu einem teilweise unabhängigen Individuum entwickelt. Diese Entwicklung wiederholt sich in der Pubertät. Wenn die Eltern versuchen, diese Entwicklung des Kindes zu verhindern, zu beeinträchtigen oder darüber zu bestimmen, dann wird das Kind trotzen. In diesem Alter brauchen Kinder Eltern, die sie wertschätzen und anleiten. Je mehr die Eltern versuchen, einzugreifen und Grenzen zu setzen, desto mehr Machtkämpfe wird es geben.“
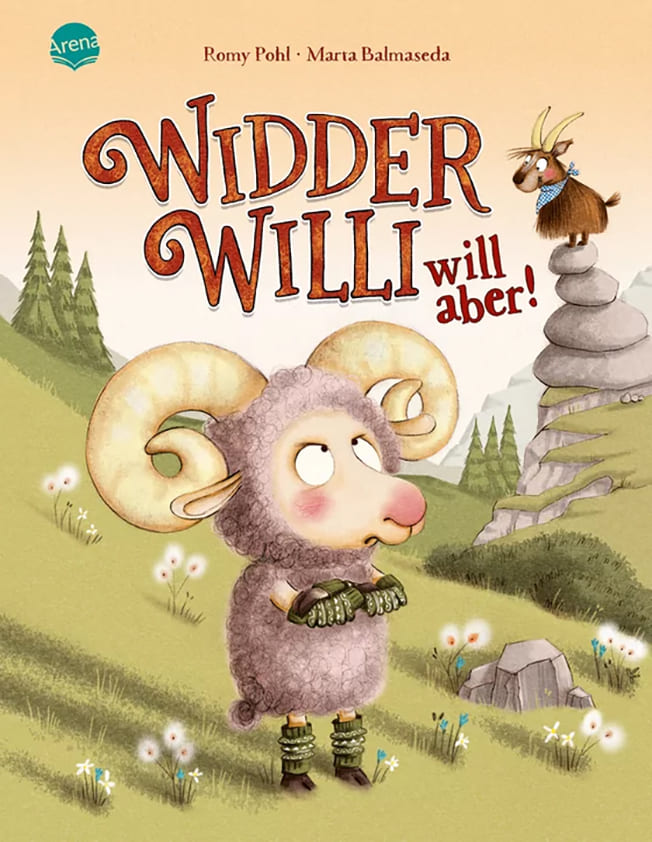
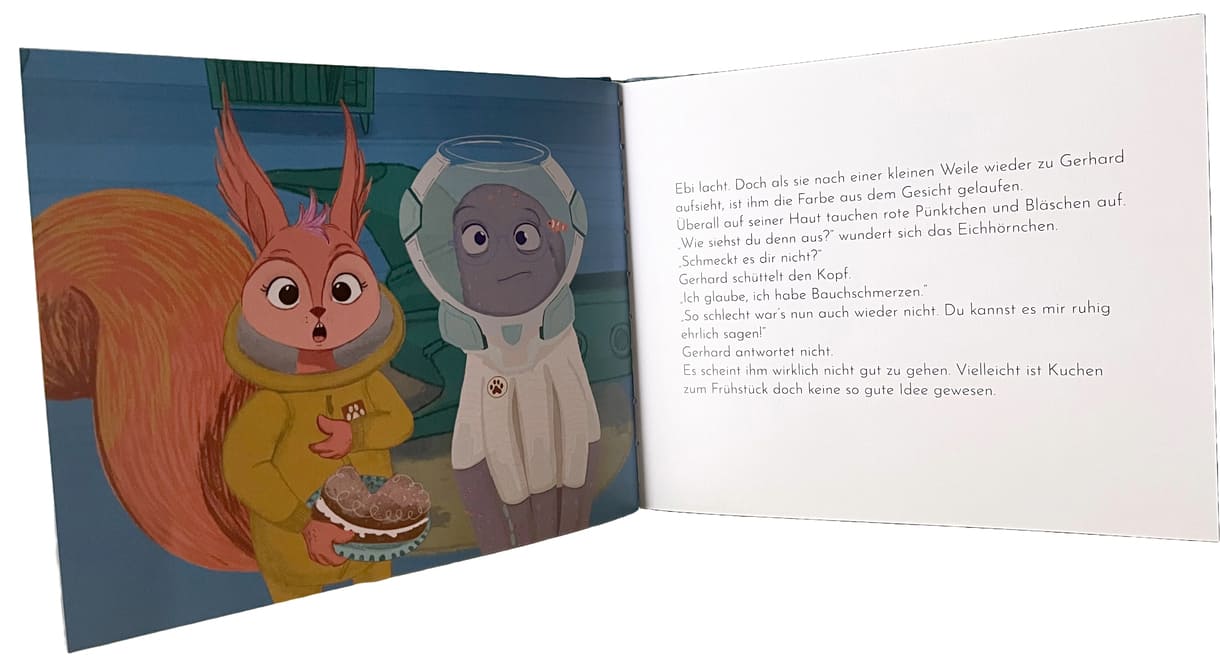
Der Oktopus im Raumschiff, der immerhin im Trockenen leben kann – nur sein Kopf ist einer Art Goldfischglas – kriegt auf einmal viele rote Punkte und Bläschen im Gesichte und auf seinen Tentakeln. Und Bauchweh obendrein. Du als (Vor-)Leserin oder -Leser weißt natürlich schon, was es geschlagen hat. Immerhin steht im – kostenlosen – Bilderbuch „Von Sternen und Erdnüssen“ mit Untertitel „Ein Oktopus in Gefahr!“ schon auf der ersten Innenseite unter Titel und Untertitel: „Ein Kinderbuch zum Thema Nahrungsmittelallergien“.
Und bevor bei Oktopus Gerhard diese Flecken und Schmerzen aufgetaucht sind, hat er vom Kuchen, den Eichhörnchen-Astronautin Ebi gebacken hat, gegessen.

So leicht und schnell geht’s natürlich nicht. Eine Geschichte braucht einen Spannungslosen. Obendrein werden auch im wirklichen Leben Allergien nicht immer schnell erkannt. Also führt Ebi und Gerhard der Weg zunächst in die Kantine, wo „lange Schlange“ sehr wortwörtlich wird 😉
Schildkröte Traude probiert’s mit Kräutertee. Hilft hier nicht. Beim Käpt‘n des Raumschiffs gibt’s noch weniger Abhilfe.
Erst nach der ohnehin geplanten Landung auf Raumstation Guglhupf hat Gerhard die Chance, eine Ärztin zu Rate zu ziehen. Doktorin Hase (in der Onlineversion Frau Doktor) – assistiert von Krankenpflegerin Bärwin – erkennt nach Frage, wann die Pustel aufgetreten sind und welche Zutaten Ebi für den Kuchen verwendet hat: Ach, Erdnuss-Allergie…
Akut-Medikament und gleich noch Testung, auch was Gerhard vielleicht noch allergisch sein könnte, runden die Behandlung ab.
Neben der Story gibt es an manchen Stellen extra hervorgehobene Erklär-Stellen über Symptome einer Allergie, wie es dazu kommt, was zu tun ist…
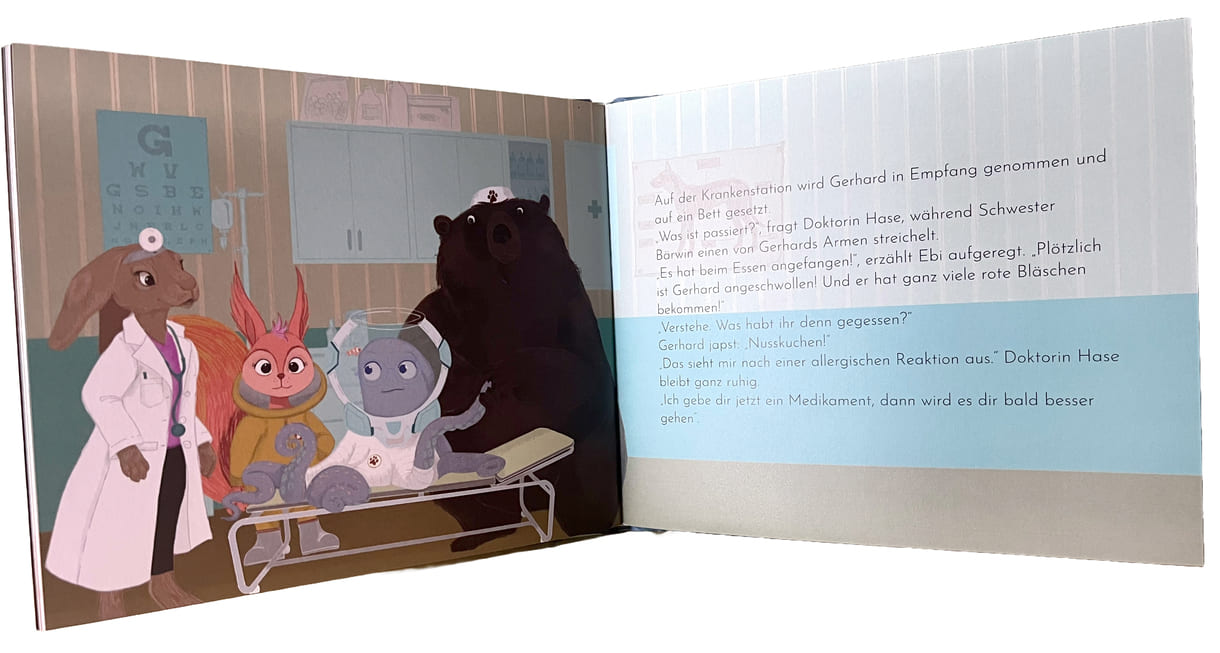
Dieses informative, leicht lesbare und natürlich praktisch brauchbare Bilderbuch ist im Rahmen eines Projekts zur Wissenschaftskommunikation an der Fachhochschule Campus Wien entstanden. Wissenschafter:innen haben sich auch von Kindern einer Wiener Volksschule bei Gestaltung und Layout des Buches Anregungen geholt.
Am Ende findest du einen zwei-seitigen Quiz, der abfragt, was du dir aus dem Buch gemerkt hast.

Durch finanzielle Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung kann es kostenlos zur Verfügung gestellt werden – wie? Siehe Info-Box.
Und aus dem Buch wurde auch eine Website. Online kannst du dir die Geschichte auf der Website auch vorlesen lassen. Die angekündigte Interaktivität beschränkt sich auf sehr wenige kleine Elemente – beim Leuchtring dreht sich etwa der Kommando-Sessel um einen Halbkreis, bei einer Glühbirne gehen Info-Felder auf.
„Die Zellen in Lottas Körper verwandeln sich in Soldaten, wenn sie Gluten sehen. Sie versuchen es zu bekämpfen. Davon bekommt Lotta Bauchweh.“
Abigail Rayner hat sich das Bilderbuch „Lotta und die Krümel“ ausgedacht, in eine einfache Geschichte verpackt, geschrieben. Immerhin weiß das Mädchen, dass sie Zöliakie hat – was vier von fünf Betroffenen nicht wissen. Deswegen kann Lotta darauf aufpassen und andere bitten, nicht mit bloßen Händen oder Besteck auf dem schon Krümel mit Gluten sind, Nahrungsmittel anzufassen. Aber sie fühlt sich von vielem, unter anderen Geburtstagspartys ausgeschlossen.“ – Zur ausführlicheren Besprechung des in diesem Absatz genannten Buches auf KiJuKU.at geht es in einem Link am Ende dieses Beitrages.

Beim 36. Internationalen Kinderfilmfestival lief im Kurzfilmprogramm „Boris‘ Bäckerei (La Boulangerie de Boris“, eine Drei-Länder-Koproduktion Kroatien, Frankreich, Schweiz. Ausgerechnet ein Bächer hat eine Mehl-Allergie. Würden Taucherbrille und Schnorchel da bei der Arbeit helfen? Oder Job wechseln? Die Hauptfigur namens Boris holt sich Rat und Hilfe in der Backstube.
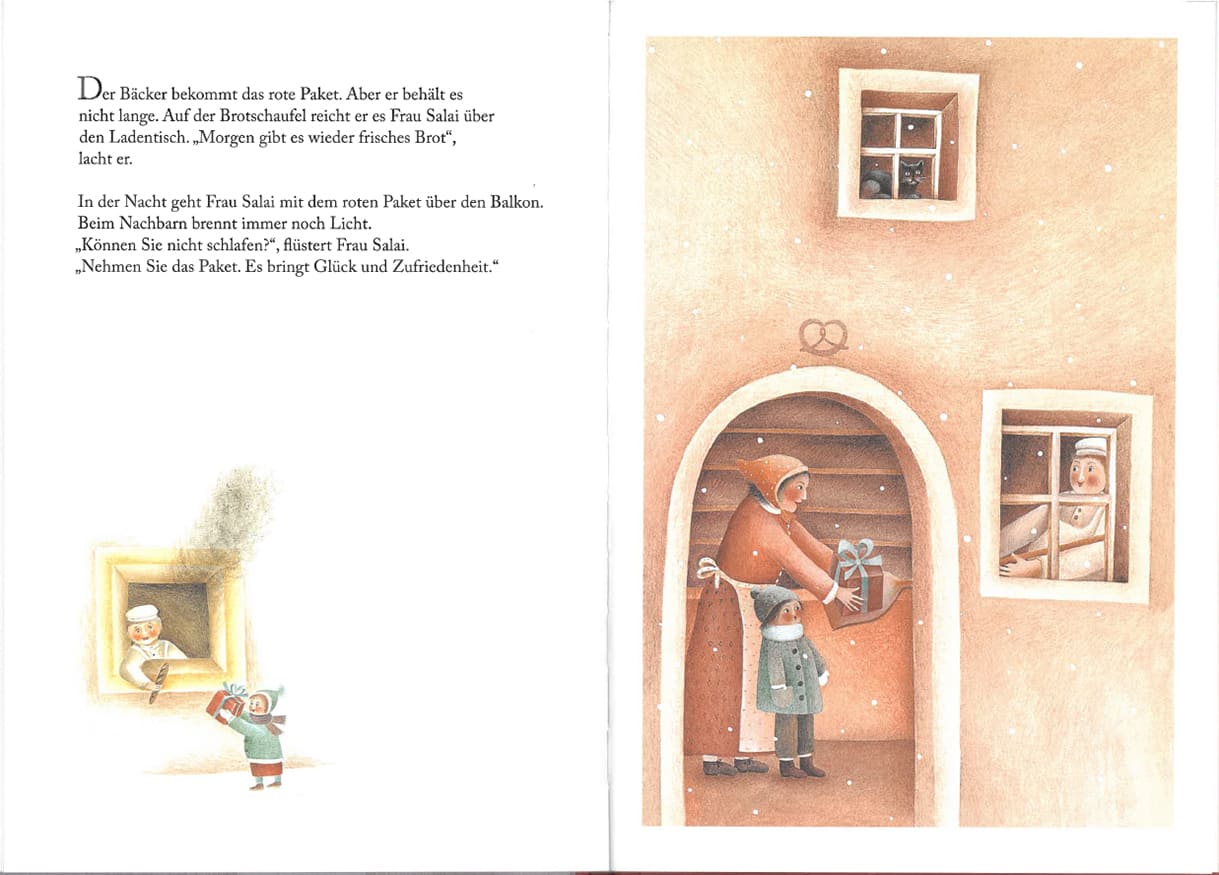
Weihnachten ist ein ziemlich passender Zeitpunkt für dieses Buch mit „Zusatznutzen“. In dem fein gemalten und leinen-gebundenen Bilderbuch „Das rote Paket“ – die Schrift auf dem Einband kann sogar ertastet werden – geht es ums Schenken.
Und weil Mitte November (2024) das Linzer Theater des Kindes aus diesem Buch von Linda Wolfsgruber und Gino Alberti (beide Text und Illustration) ein Theaterstück für sehr junges Publikum (ab 3 Jahren – Details siehe Infobox) macht, bringt Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die Besprechung dieses Buches – mit Änderungen am Schluss – aus dem Vorläufer dieser Seite, dem Online-Kinder-KURIER.
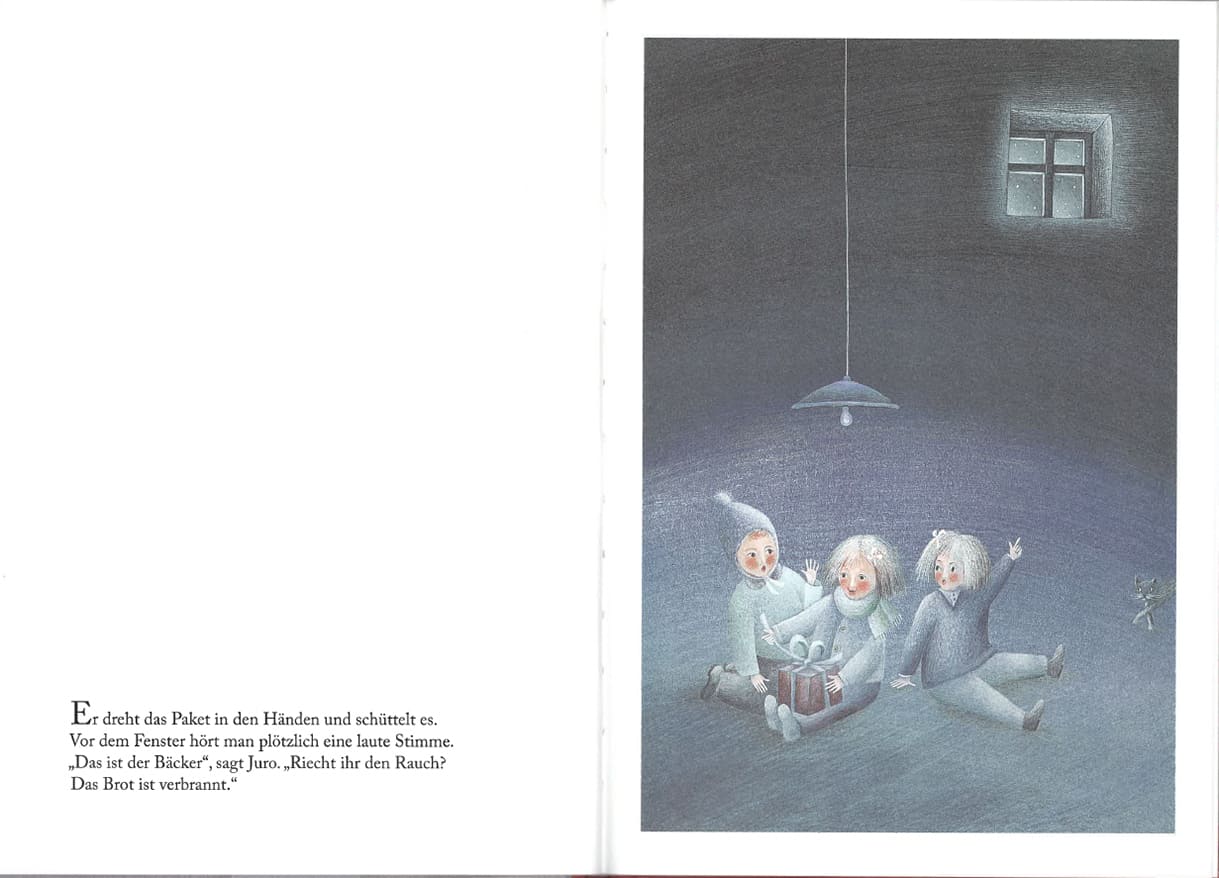
Anna ist bei ihrer Oma im Dorf zu Besuch, stapft durch den Schnee und begegnet zunächst nur hektischen Menschen. Da hat die Großmutter eine Idee – ein Packerl. „Das rote Paket ist ein Geheimnis… Aber machen Sie es nicht auf“, sagt sie dem ersten, den sie gemeinsam mit ihrer Enkelin trifft, „sonst geht verloren, was drinnen ist“. Und auf die Frage des Försters – er war der erste, der es überreicht bekam, antwortet die Oma: „Glück und Zufriedenheit“.
Die Augen des Mannes strahlen, Anna schlägt daher vor, gleich vieler solcher Packerln zu verschenken. Doch die Großmutter meint „nur“: „eines ist genug“.
Und in der Tat, angesteckt vom wertvollen, nicht in Geld zu bezahlendem Inhalt, schenkt der Förster das geheimnisvolle rote Paket weiter und der wieder weiter…und am Ende – das sei jetzt nicht verraten, auch wenn du’s dir vielleicht schon denken kannst.
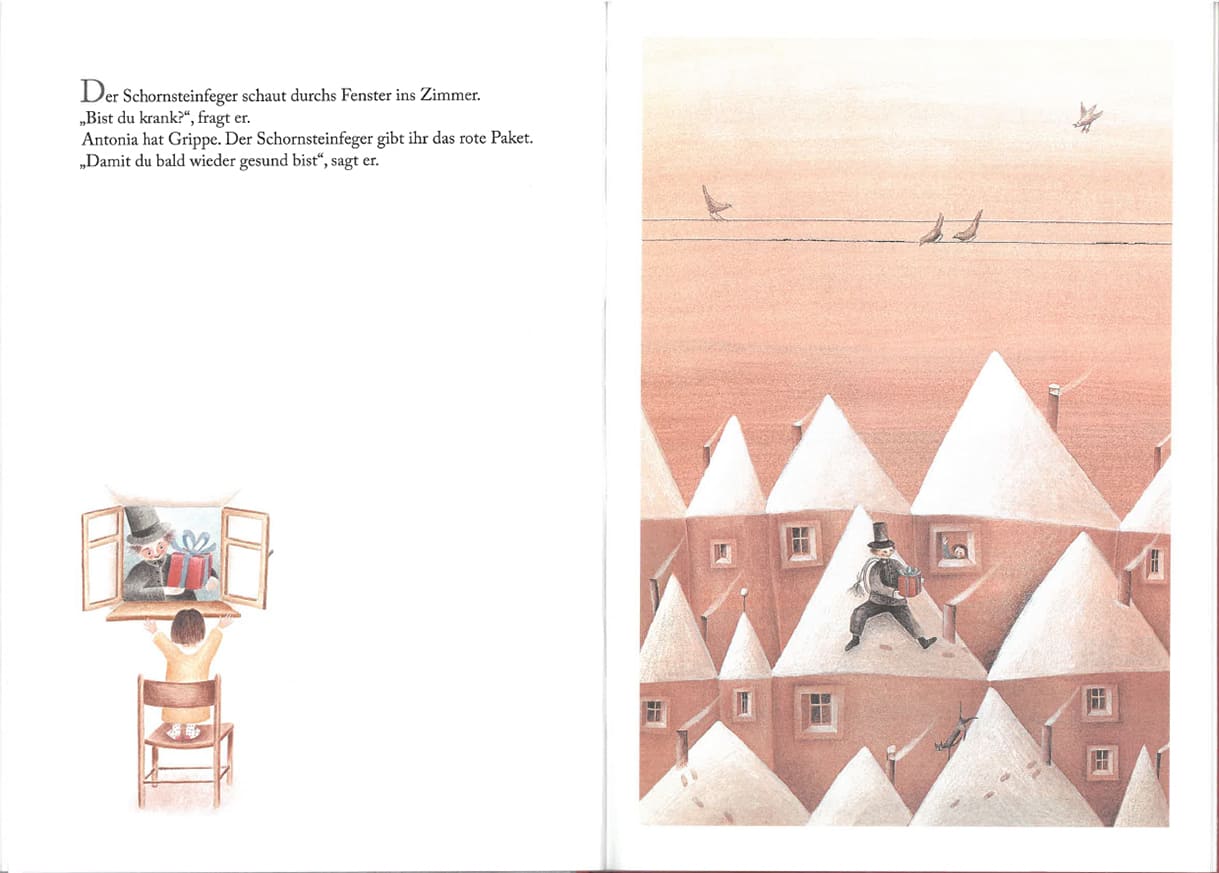
Das Buch hat auf der letzten Doppelseite einen Bastelbogen für einen roten Papier-Würfel samt aufgemalten dunklem Band mit Schleife. Damit kannst du dir ein eigenes geheimnisvolles Packerl basteln. Es sieht ziemlich ähnlich aus wie in der Geschichte, die Linda Wolfsgruber und Gino Alberti gemeinsam geschrieben und gezeichnet haben. Und ob du selber darin kleine Dinge aufbewahren möchtest, oder etwas reingibst und es weitergibst oder wie in dieser Erzählung mit scheinbar Nichts und dennoch so Großem wie Glück und Zufriedenheit verschenkst, bleibt dir überlassen. Im letztgenannten Fall braucht’s natürlich als „Gebrauchsanleitung“ einen ähnlichen Satz wie im Buch, der darauf hinweist, es ja nicht zu öffnen, sondern möglichst auch weiterzureichen, damit sich der entsprechende „Zauber“ entfalten kann…
Viele Buchbesprechungen in einem Sammel-Artikel, darunter auch dieses <- noch im Kinder-KURIER
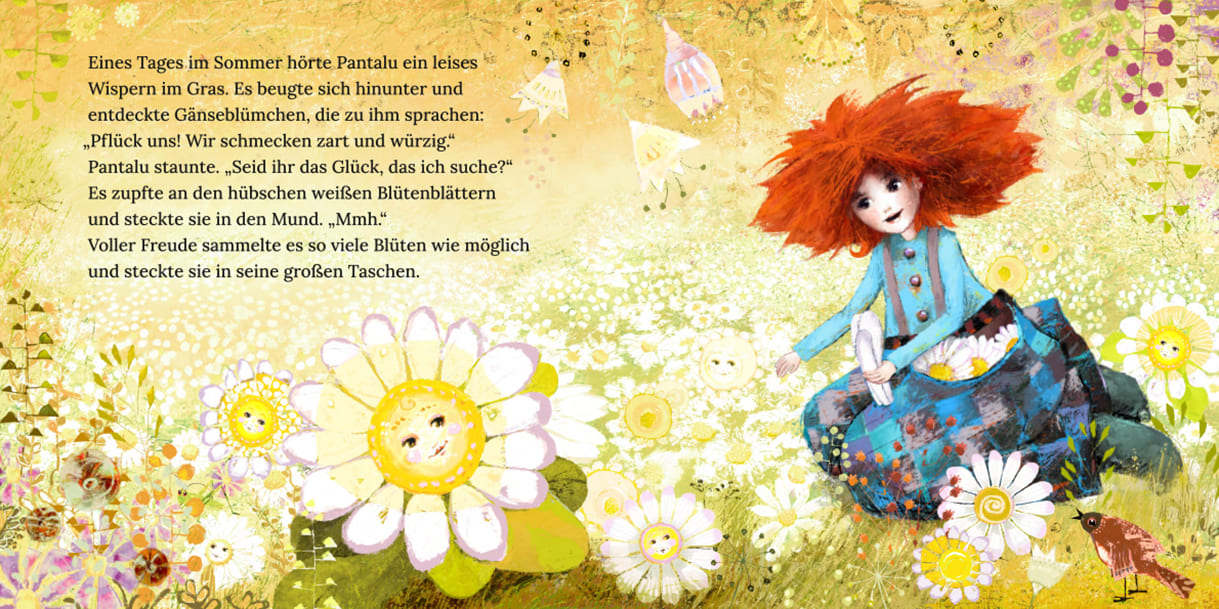
Breite, wild abstehende dunkelrote Haare, große karierte Hose. Auch ohne rote Nase erinnert so eine Figur an Clown. Sein Name Pantalu klingt – vielleicht nicht zufällig – nach Pantalone, einer Figur aus der italienischen komödiantischen Theatergattung Commedia dell’arte (abgeleitet vom Wort für Hose – pantaloni).
Dieses Bilderbuch hat sich die Illustratorin Uta Polster – und nicht wie ursprünglich hier gestanden ist, die Autorin Julia Dorothea Gaidt – ausgedacht. Pantalu wird auf eine fast fünf Dutzend Seiten lange Reise geschickt, das Glück zu suchen.
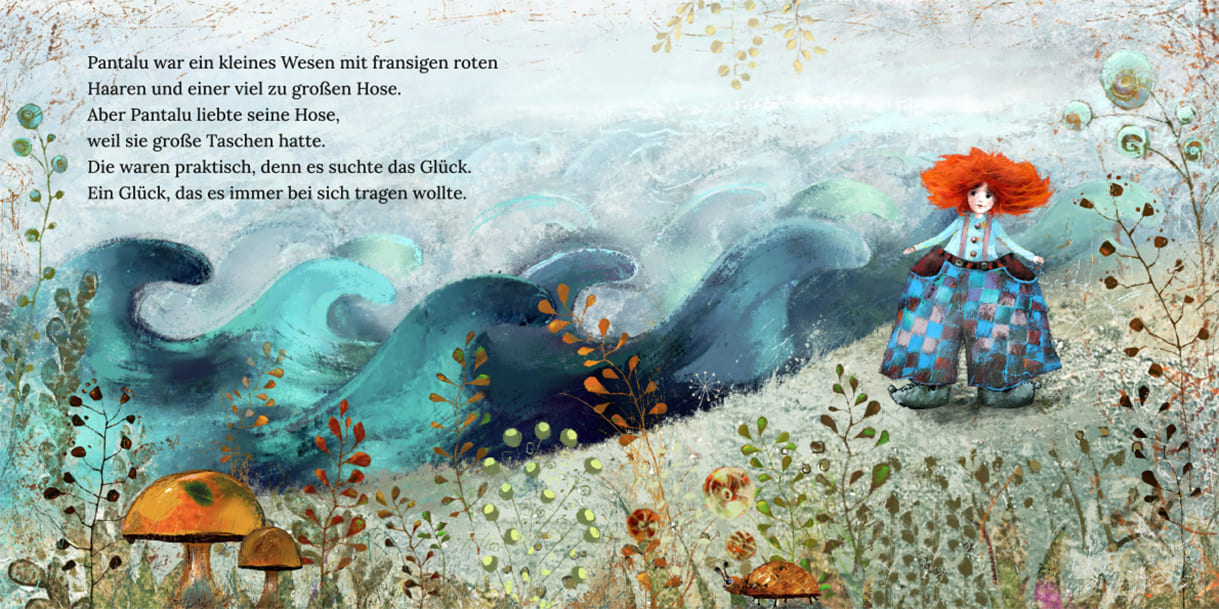
Die erste Station seiner Suche bringt ihn auf eine Blumenwiese, wo ihm Gänseblümchen zuflüstern „Pflück uns!“ Das lässt sich Pantalu – offenbar ein Kind, da die Autorin aus Pronomen immer es verwendet – nicht zwei Mal sagen. Gepflückt in einen der großen Hosensäcke gestopft. Und, was wohl (fast) jedes Kind weiß, nach ein paar Stunden schauen die Blütenblätter eher verwelkt aus.
Dass sich Seifenblasen – auf einer der folgenden Doppelseiten – so gar nicht einfangen lassen… eh kloar. Und so geht es Station für Station ähnlich erst freudig und dann sehr enttäuscht weiter.

Aber, natürlich bleibt es nicht dabei, und Panatalu findet wohl anderes, das glücklich macht. Was das ist und wie es dazu kommt und dass Glück auch zu jenen Dingen gehört, die durchaus mehr werden (können), wenn sie geteilt werden… – nein das Glück, das du vielleicht empfindest, wenn du die überraschende Wendung liest und siehst, soll hier nicht zerstört werden 😉
PS: Wie – nun, einen halben Tag nach der Erstveröffentlichung dieser Buchbesprechung – schon oben erwähnt geht die Geschichte auf die Illustratorin zurück. Die ursprüngliche Vermutung, dass sie von der Autorin stammt, war eben nur eine solche. Nach der Veröffentlichung meldete sich die Illustratorin und schrieb, dass eben sie Pantalu erfunden hat. „Sie ist entstanden für ein Buch, das noch nicht veröffentlicht und noch in Arbeit ist. Dieses Buch hat die Autorin Julia Dorothea Gaidt zu der Story mit dem Glück veranlasst und mir zukommen lassen. Daraus habe ich dann das Buch Pantalu sucht das Glück entwickelt, gezeichnet und den Satz für die Druckerei gemacht.“


Vor einem stilisierten Baum und zwei vieleckigen Kisten mit je einem kleinen Loch treffen die beiden aufeinander: Tiger und Löwe. Bevor sie ins Spiel der Bilderbuch-Geschichte „Wenn sich zwei streiten“ eintauchen, lockern die beiden Schauspielerinnen ihr (junges) Publikum mit ein paar kleinen Schmähs auf. In gespielter Konkurrenz wollen sie die Zuschauer:innen begrüßen – „lauter nette Menschen“ – „kannst du doch gar nicht wissen, du kennst sie ja gar nicht“…
Um Konkurrenzkampf dreht sich die Story, die auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Britta Sabbag (Text) und Igor Lange (Illustration) aufbaut. Tiger und Löwe meinen, jeweils der Stärkste, Größte und so weiter im Tierreich zu sein. Und das müsse nun sozusagen ausgefochten werden, um klarzustellen, wer es tatsächlich ist.

Das Theater des Kindes in Linz hat auf der Basis des Buches eine Bühnenversion erarbeitet. Regisseur Harald Bodingbauer hat eine Stückfassung getextet, die sich sehr nahe am Original bewegt. Das teils tänzerische (Choreografie: Jasmin Shahali) Spiel der beiden Akteurinnen bringt aber noch eine zusätzliche Ebene ins Geschehen. Immer wieder brechen sie die Bewerbe um die Vormachtstellung mit mindestens einem Schuss (Selbst-)Ironie. Die beginnt schon damit, dass beide zunächst ihre Schwänze (Kostüme: Elke Gattinger) gar nicht am Popo haben, sondern erst aus den Kisten holen müssen und dann zunächst sogar vertauschen.
Ob Stärke, Sprungkraft, Balancierkunst – mal legt Lena Matthews-Noske als Tiger vor und Katharina Schraml als Löwe muss und wird ausgleichen, dann wieder muss Tiger versuchen, die gleiche Leistung zu erbringen wie Löwe. Übrigens ist es für Schraml nicht ihr erster Löwe, einen solchen spielte sie auch schon in „Konferenz der Tiere – ihre helle gelockte Haarpracht prädestiniert sie schon rein optisch dafür.

Bei der Premiere Freitagvormittag (18. Oktober 2024) begannen die meisten Kinder sich wie bei einem sportlichen Wettkampf auf eine Seite zu schlagen und eine der beiden Raubkatzen anzufeuern – welche, das sei hier nicht verraten, um nicht eventuell einen Nachahmungseffekt für spätere Vorstellungen auszulösen. Aber trotz dessen beklatschten (fast) alle stets die jeweilige Akteurin, wenn sie ihre Herausforderung bewältigte.
Je länger das Kräfte- und Stärkemessen dauert, umso öfter kommt es – natürlich nicht zufällig – vor, dass Tiger und Löwe (mitunter scheinbar unfreiwillig) einander helfen. Und natürlich kommen sie auf kein wirkliches Ergebnis: Immer gleich stark, schnell, geschickt… Aber statt eines Unentschiedens kommt’s zu einer riesigen kleinen Überraschung. Nein, gespoilert wird hier wie auch schon bei der Buchbesprechung (Link unten) nicht; lass dich überraschen 😉

Eines sei aber schon verraten: Die mit wenigen Mitteln auskommende und doch so weite Welten eröffnende Bühne wurde von Franz Flieger Stögner erdacht und gebaut. Er sorgte dieses Mal aber auch gleich noch für die Musik. Seine Überlegung dazu zitiert das Programmheft des Theaters des Kindes so: „Mein erster Gedanke war, Löwe und Tiger mit heißen afrikanischen und indischen Rhythmen zu manifestieren. Aber auch ruhigere Töne aus den beiden Kulturkreisen werden ihren Platz finden. Ich finde es sehr interessant, Kindern diese ethnographischen Musikstile näher zu bringen und ihren musikalischen Horizont abseits des Mainstreams zu erweitern.“ Über die Musik hinaus schuf er allerdings noch eine Geräuschkulisse, die Dschungel, Wind aber auch die Wettkampf-Atmosphäre akustisch erahnen lässt. Für die passenden Lichtstimmungen sorgt Natascha Woldrich.
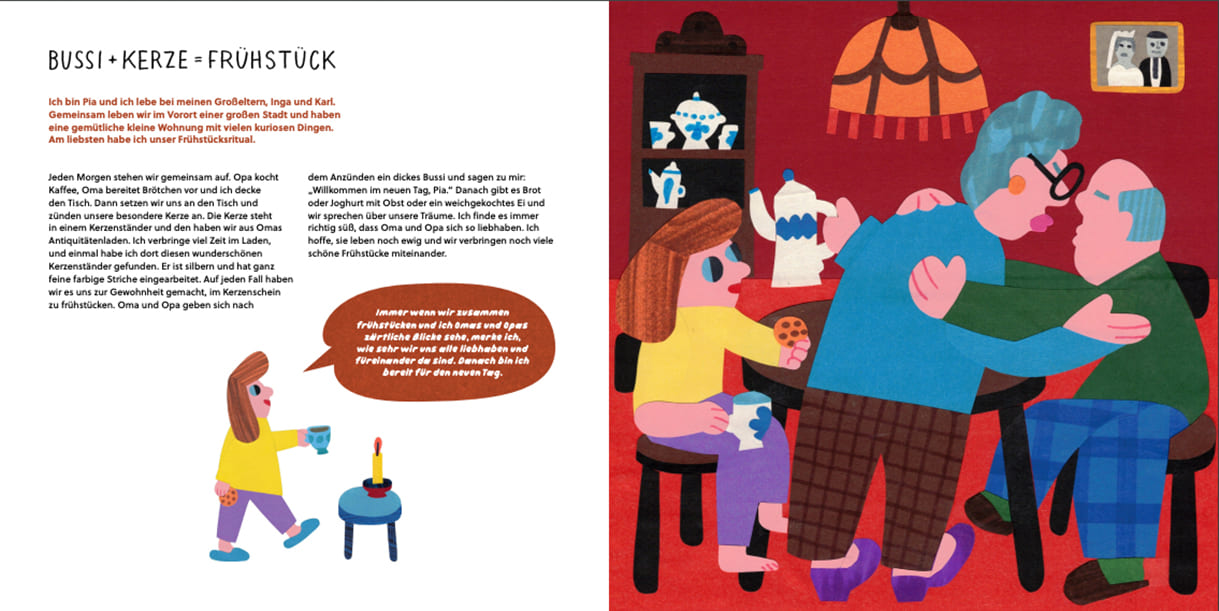
(Bilder-)Bücher über Feste auch aus verschiedensten Kulturen – von Weihnachten bis Geburtstag, Chanukka (Judentum) bis Bayram (Islam) – gibt es mittlerweile eine ganze Reihe. Das mit bunten Collagen der preisgekrönten Illustratorin Yulia Drobova bebilderte Buch „immer wenn wir…“ versammelt aber ganz besondere Feste und Feierlichkeiten in Familien. Solche, die sich die Protagonist:innen des Buches sozusagen selber ausgedacht haben.

Jeweils ein Kind stellt sich und die jeweilige Familie kurz vor, um dann das jeweilige Fest zu schildern. In einer der letzten Geschichten des 40-seitigen Buches – jeweils eine Doppelseite ist einem der Feste gewidmet – schildert Joana (9), dass ein Teil ihrer großen Familie weit weg in einem anderen Land wohnt „und wir können uns nicht so oft sehen, wie ich das gerne hätte“. Und so dachten sich Joana, ihre Schwester Julia, Mama Malwina und Papa Pavel sowie Tante Niki, die gemeinsam in der Stadt wohnen das gemeinsame Essen mit Cousinen und Cousins via Laptops aus: „Seitdem haben wir uns angewöhnt, jeden Donnerstagabend per Videokonferenz mit unseren Verwandten zu essen. Es ist zwar nicht so toll, wie wenn wir uns wirklich sehen, aber trotzdem können wir einander Neuigkeiten erzählen…“
Gut, dass offenbar alle in einer ähnlichen Zeitzone leben, sonst wär’s vielleicht doch ein wenig schwierig;)
Apropos weltweit: Rahmin lebt mit seiner Schwester Ada, dem jüngeren Bruder Omar und den Eltern Nael und Mira in einem Haus am Land. „Unsere gemeinsame Lieblingsroutine: unsere monatliche Weltreise!“
Die findet nicht echt, sondern im Wohnzimmer statt. Eines der Kinder darf jeweils mit verbundenen Augen auf dem in Drehung versetzten Globus mit dem Finger auf ein Land zeigen. Dann beginnen alle möglichst viel über dieses Land zu recherchieren – nicht zuletzt, was dort vorwiegend gegessen wird – und das wird dann zum Abendessen gekocht oder zubereitet.

Die achtjährige Clara, die mit Mama Lotte und deren neuem Freund Holger sowie dessen Tochter Frida zusammen wohnt feiert mit diesen und ihrem Papa Karlo den Jahreswechsel besonders. Während des Jahres sammelt jede und jeder auf kleine Zettel aufgeschriebene Glücksmoment in einem eigenen Glas. Zu Silvester kommen sie alle zusammen und jede und jeder zieht einen Zettel nach dem anderen, um die Glücksmomente in Erinnerung zu rufen und mit den anderen zu teilen.

Kleine alltägliche Überraschungen unter der Türmatte oder in der Jausenbox, gemeinsames Einsetzen von Pflanzen oder Putzen der Wohnung sind andere Rituale, die die jeweiligen Familien gemeinsam begehen. Und diese Familien sind ganz unterschiedlich: Mal mehr oder weniger Geschwister, mal Mutter und Vater, dann wieder Alleinerzieher:in oder bei Großeltern lebend bzw. zwei Müttern, Patchwork mit Bonus-Papa und Bonus-Geschwistern… Und ebenso divers sind die beteiligten Personen gezeichnet, ausgeschnitten und collagiert – verschiedene Hautfarben gehören ganz selbstverständlich ebenso dazu wie ein Kind im Rollstuhl.
Vielleicht erfindets du – allein oder mit deiner Familie – ja auch ein eigenes Fest, Ritual oder eine ausgefallene gemeinsame Aktivität…


Natürlich verrät schon das Titelbild und der Untertitel des Bilderbuchs „Patti packts an“ mehr oder minder ein Happy End: Das Mädchen lächelt beim Klettern auf der Stange und in der sternförmigen Sprechblase steht „Ich schaff das!“
Und dennoch ist es für Patti alles andere als easy. Herzhaft schreit und tobt sie auf der ersten Seite der Geschichte von Edith Schachinger (Text) und Dani Remen (Bilder): „Warum geht das nicht?“
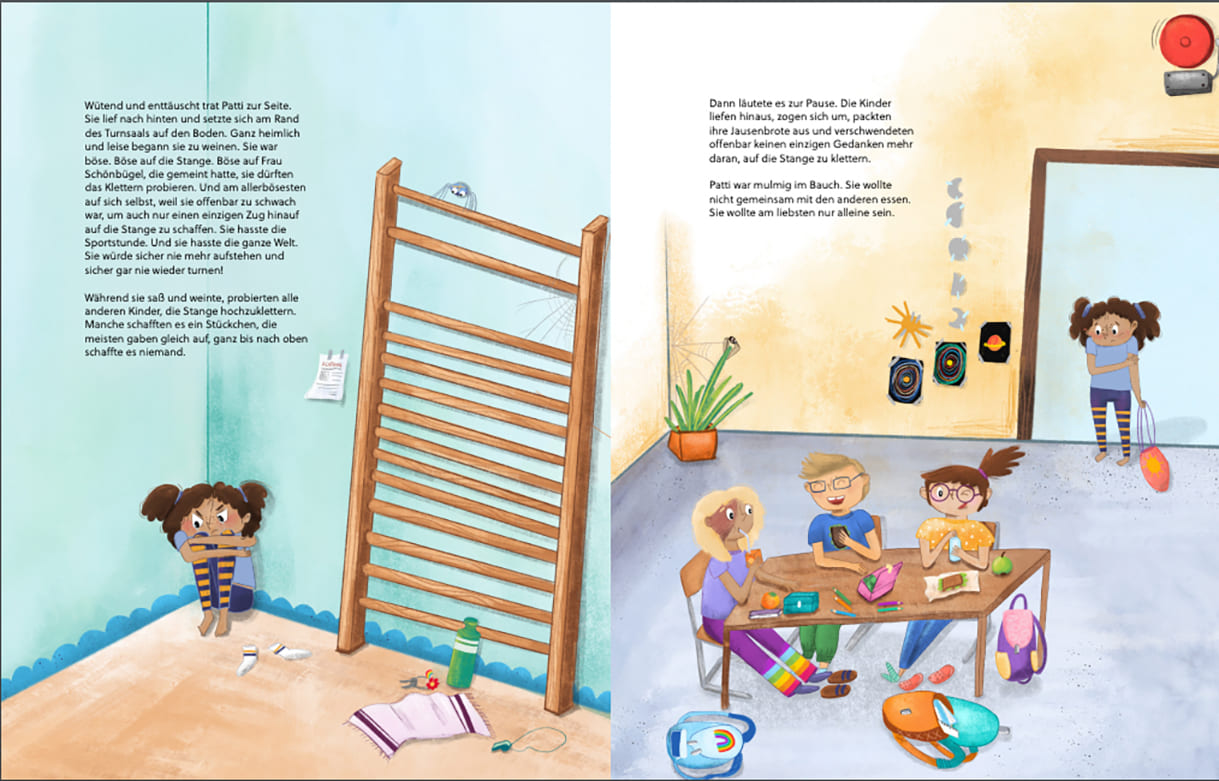
Natürlich schafft sie zu Beginn das ganz und gar nicht, auf die Stange im Turnsaal raufzuklettern. Was wäre das denn auch für eine Geschichte, wenn das Ende gleich am Anfang stünde – was sollte sich denn dann zwei Dutzend Seiten lang tun?
Und so lassen die beiden in ihrem Buch die Hauptfigur zunächst scheitern, wütend, zornig und ungeduldig sein.
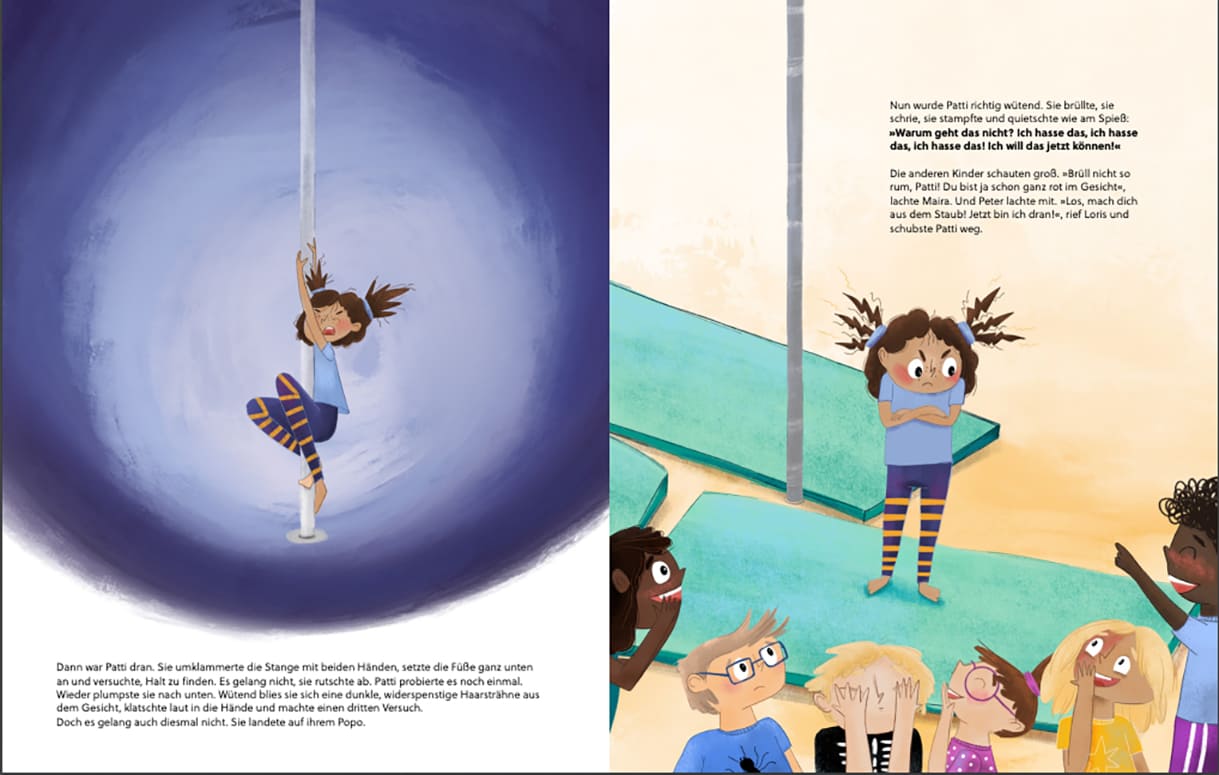
Doch, um etwas letztlich doch zu schaffen, braucht es mitunter auch Helfer:innen. In diesem Fall haben sich Autorin und Illustratorin eine Lehrerin einfallen lassen, die Patti Mut macht, nicht aufzugeben. Anhand des Beispiels eines Super-Kletterers, der auch zunächst ganz schwach war, bringt die Pädagogin ein mögliches Vorbild ins Spiel und …
Wie und wodurch Pattis Geschichte weitergeht und wie diese, letztlich doch ein wenig überraschend, endet, sodass sie in deinem Kopf dennoch weitergeht, sei nicht verraten.
Warum im Titel ein Apostroph fehlt – eigentlich müsste es ja „packt’s“ heißen – bleibt allerdings ein Rätsel.
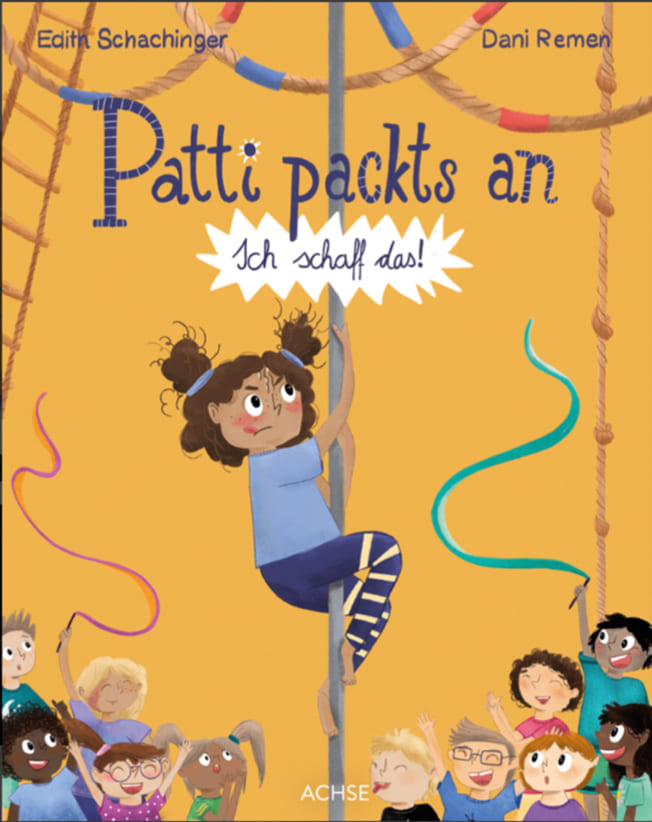
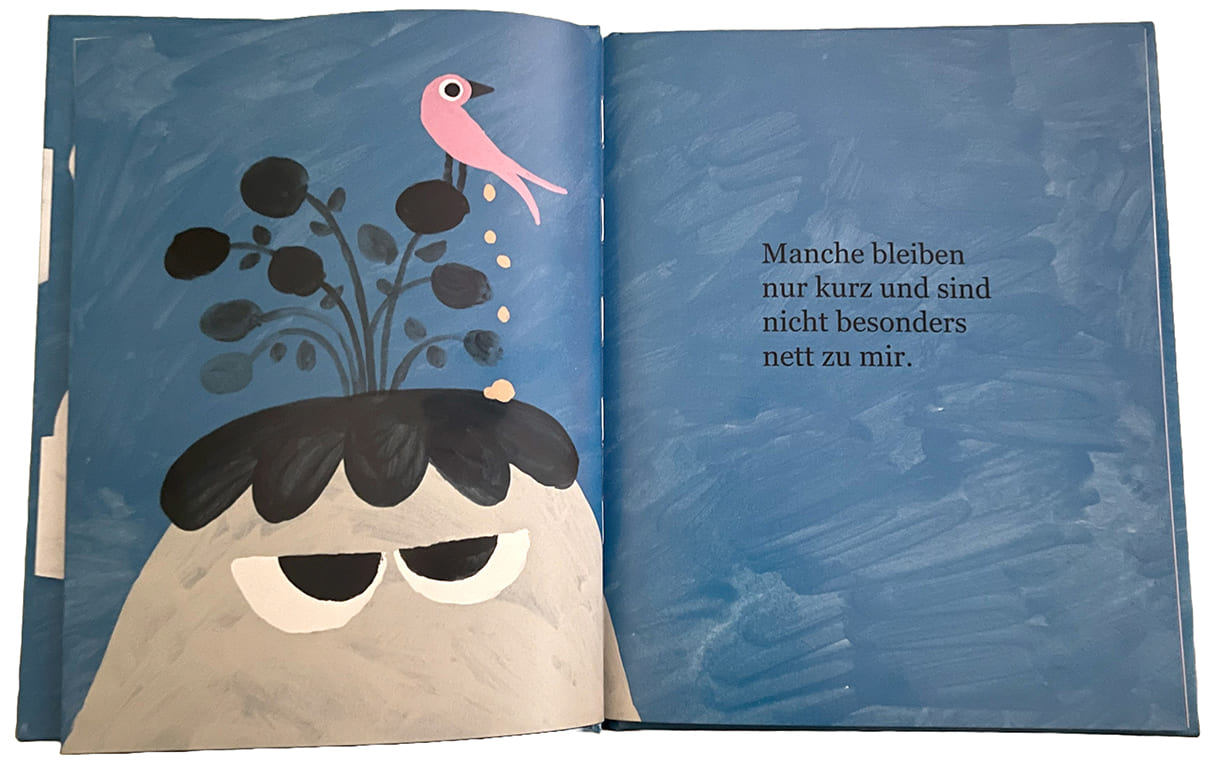
Taucht da ein graugesichtiger Mensch mit großen Augen und ein paar Blumen auf dem Kopf aus dem Wasser auf?
Nein, es handelt sich um eine Mini-Insel – mit Augen. Sie erzählt von ihrer Einsamkeit, manchen Besucher:innen, die mitunter nicht nur nett sind – so kackt ein Vogel auf einem der ersten Bilder der Doppelseiten.
Doch eines Tages lässt Autor und Illustrator Bruno Nunes Coelho einen bärtigen Mann mit kleinem Segelboot landen und für längere Zeit bleiben. Doch dann, … – aber…“
So schnell sich die ganze Geschichte erzählen würde, so soll doch den Leserinnen und Leser – und jenen, die vielleicht „nur“ die Bilder ausführlich betrachten – noch die Überraschung bleiben für dieses Bilderbuch mit der außergewöhnlichen Erzählerin – so wie das Buch heißt: Die Insel.
Neben dem was du siehst und liest – oder dir vorlesen lässt – kannst du deinen Gedanken und Fantasien zu Einsamkeit bzw. Freundschaft sehr gut nachhängen.
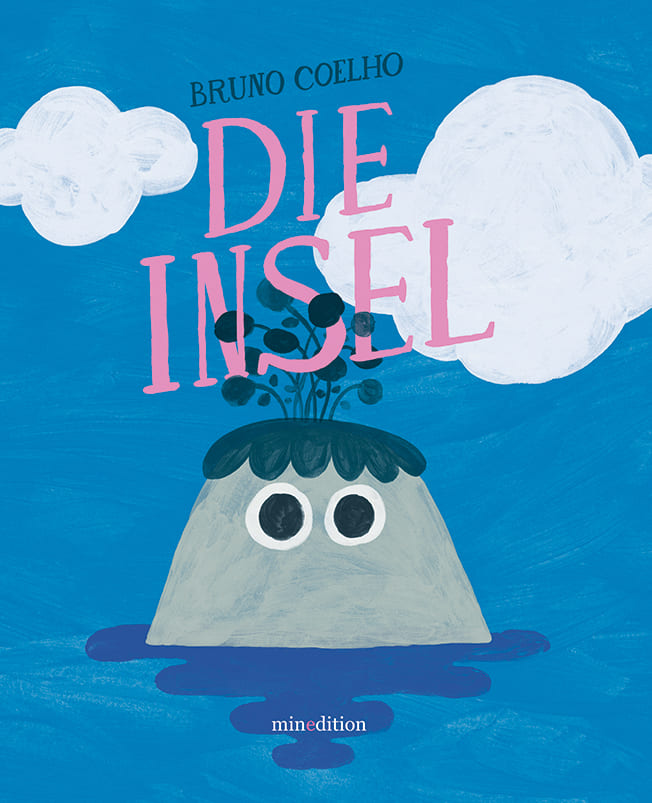
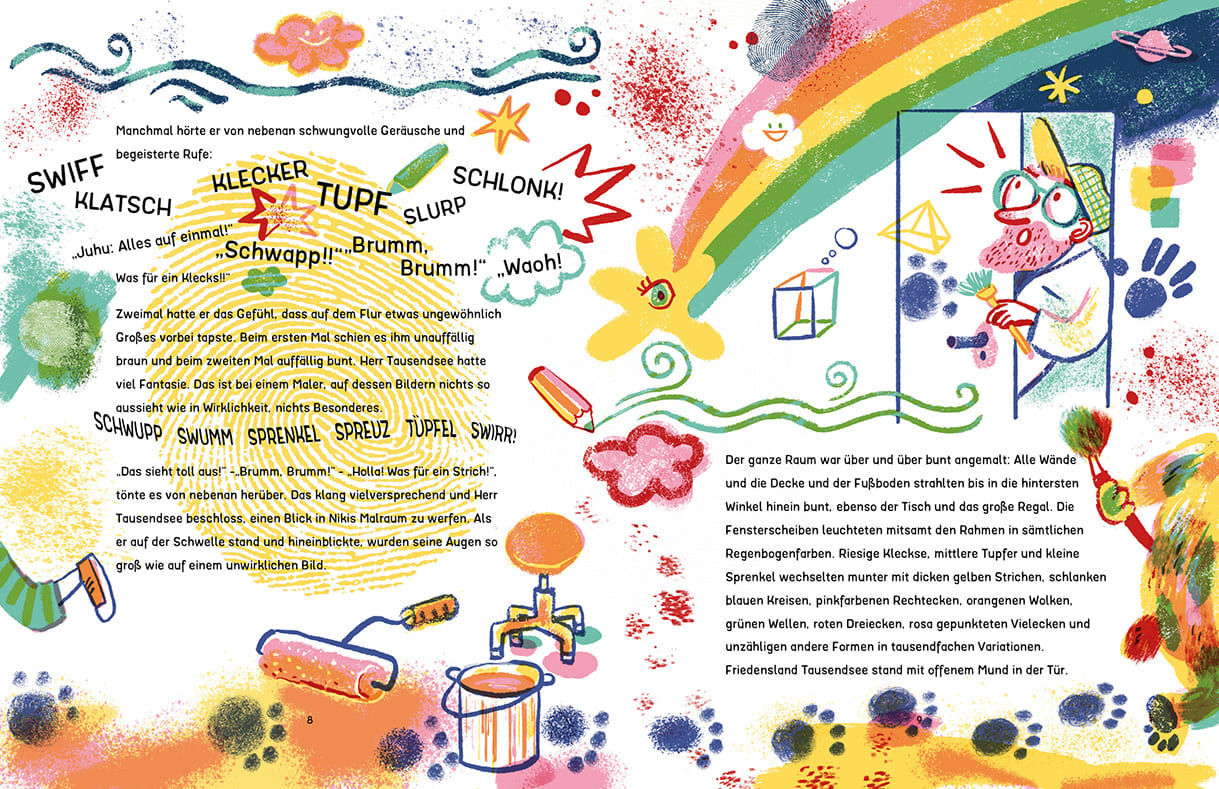
Kunterbuntes Chaos – sowohl von den Bildern her als auch in der höchst fantasievollen Geschichte – dies bietet das Bilderbuch „Na so was, wer war das?“.
Hauptfigur ist das Mädchen Niki das urgerne malte. Und eines Tages darf sie sich wie wild austoben in einem Kunsthaus namens „Kunterbunt“. „Lasst die Farben raus!“ stand auf dem Schild. Damit beginnt die Erzählung von Martin Klein, dem Autor dieses Buches. Wie wild beginnt sie tatsächlich zu zeichnen und malen – und sich Geschichten auszudenken.
Und ab der zweiten Doppelseite tauchst du – nun sogar ohne sie – in die abenteuerlichsten Geschichten ein. Von umgestoßenen Farbtöpfen und dem größten, aber doch recht charmant wirkenden Chaos ist die Schreibe. Da taucht ein Bär auf, ein paar Seiten weiter sind es Außerirdische. Immer passiert etwas – und die Frage aus dem Titel „wer war das?“ wird recht ungewöhnlich beantwortet. Eine Ausrede fantasievoller als die andere – oder waren’s etwa wirklich in einem Fall Wichtelmännchen?
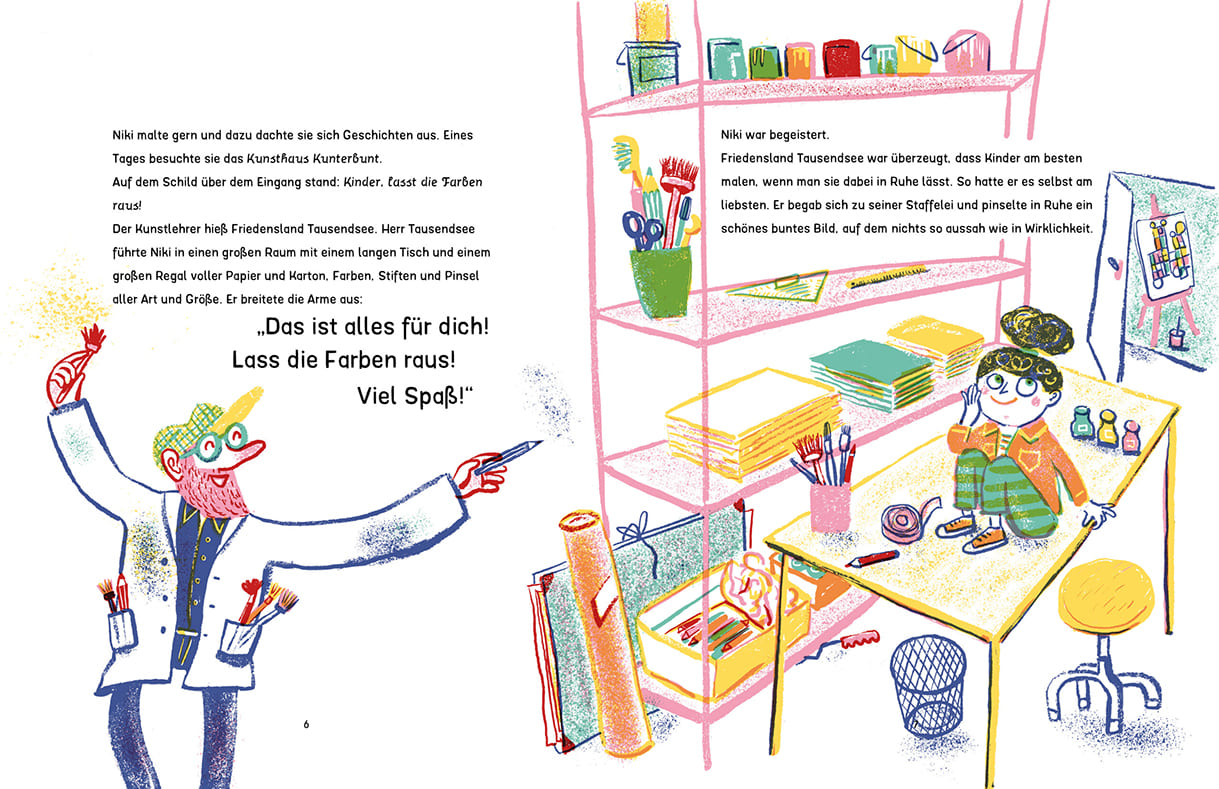
Eins gibt das andere – und du liest nicht nur den Fortgang der Geschichte sondern viele lautmalerische Begriffe wie du sie vielleicht aus Comics kennst wie „zong“, „bamm“, „plong“ und viele mehr. Und diese Buchstabenfolgen hat Sabine Kranz, die Illustratorin, genauso bunt und kreativ gemalt wie all die abenteuerlich-chaotischen Szenen.
Der Autor liebt offenbar auch Anspielungen auf – eher deinen Eltern und Großeltern bekannte Persönlichkeiten bzw. Figuren aus Filmen. So heißt der Lehrer im Kunsthaus Friedenstag Tausendsee womit er wohl den Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) meint. Und in der Klasse, in der das Chaos ausbricht, nachdem Außerirdische mit ihrem Raumschiff gelandet sind, wimmelt’s nur so von Star-Wars-Namensspielen – Darts Vetter, Obi Vollknobi, Siezwoerzwo… Da drehen sich übrigens die Antworten auf die Frage der Lehrerin, wer für das Durcheinander verantwortlich ist, um. Da beschuldigt keine und keiner wen anderen, sondern jede und jeder will die Schuld auf sich nehmen 😉
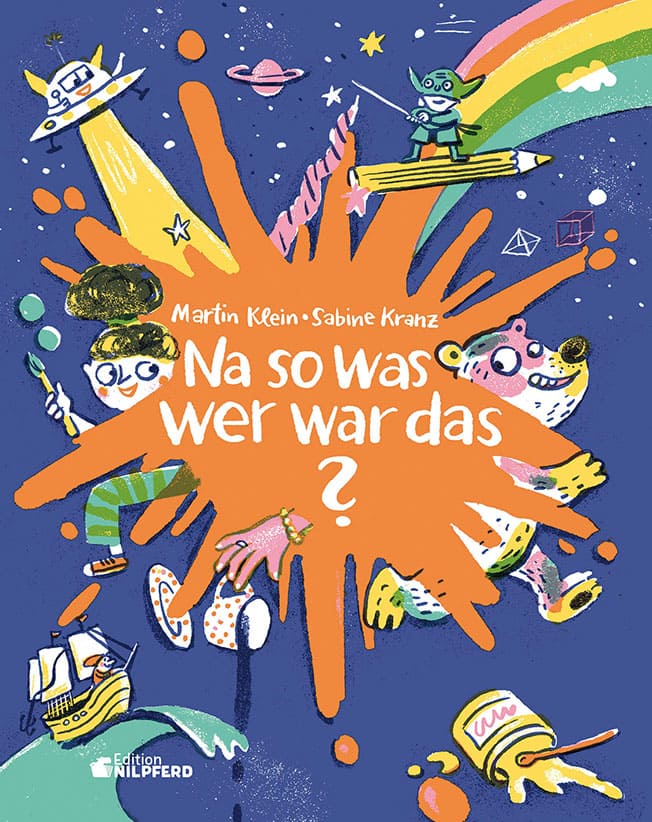

Die meisten der gemalten Bilder wirken eher verschwommen. Sind die Erinnerungen verblasst? Sollen/ wollen sie nie zu nahe kommen? Eher düster gehalten sind die Doppelseiten der großformatigen Köpfe von Mutter und Kind – eher nah, fast aneinander gekuschelt – und doch irgendwie von den Blicken her (weit) entfernt.
Bunter – und doch auch verschwommen – jeweils mehrere kleinere Bilder mit Wiesen-Picknick oder ersten Radfahr-Erlebnissen. Da war noch Papa mit im Spiel. Dann die Abfahrt – unausgesprochen – ohne Vater. Weite Reise, Ankunft in einer neuen Unterkunft.
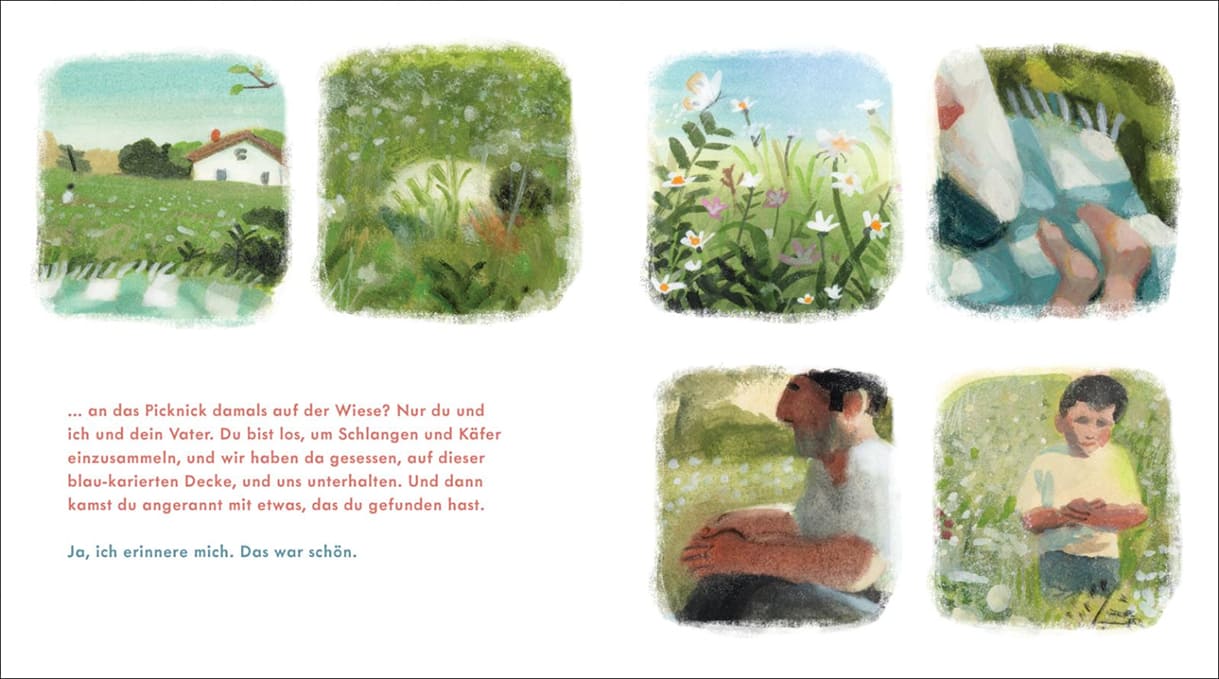
Zwischen den Zeilen, da und dort angedeutet, sowie in den Bildern schwingt viel an Gefühlen mit, die nicht einfache Zeiten zuvor andeuten. „Erinnerst du dich?“ – geschrieben und gezeichnet von Sydney Smith (Übersetzung aus dem Englischen: Bernadette Ott) lässt viele Spielraum für Interpretationen, Anlass für Gespräche über Gefühle – vom Weggehen und Ankommen sowie Neu-Anfängen ohne Altes wegzuwischen oder zu vergessen. Und mit einem – sorry fürs Spoilern – doch eher hellen letzten Bild, das Zuversicht und Geborgenheit vermittelt.
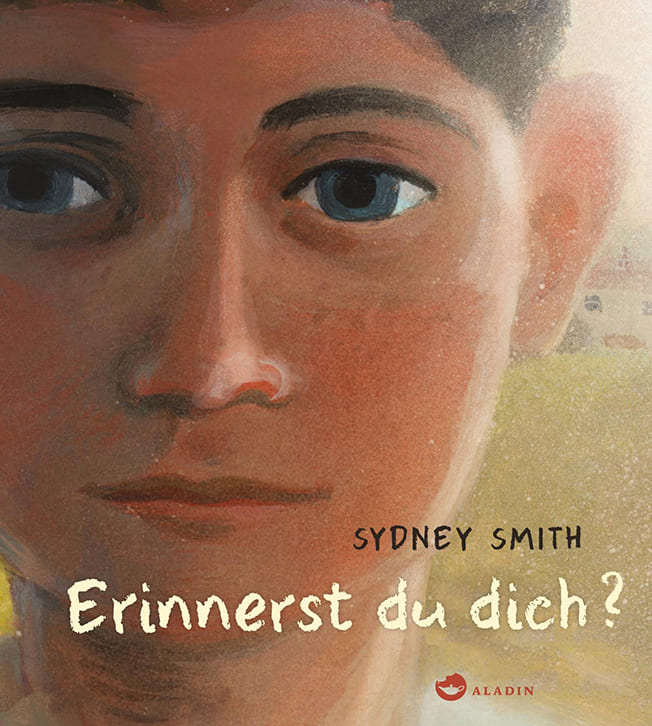
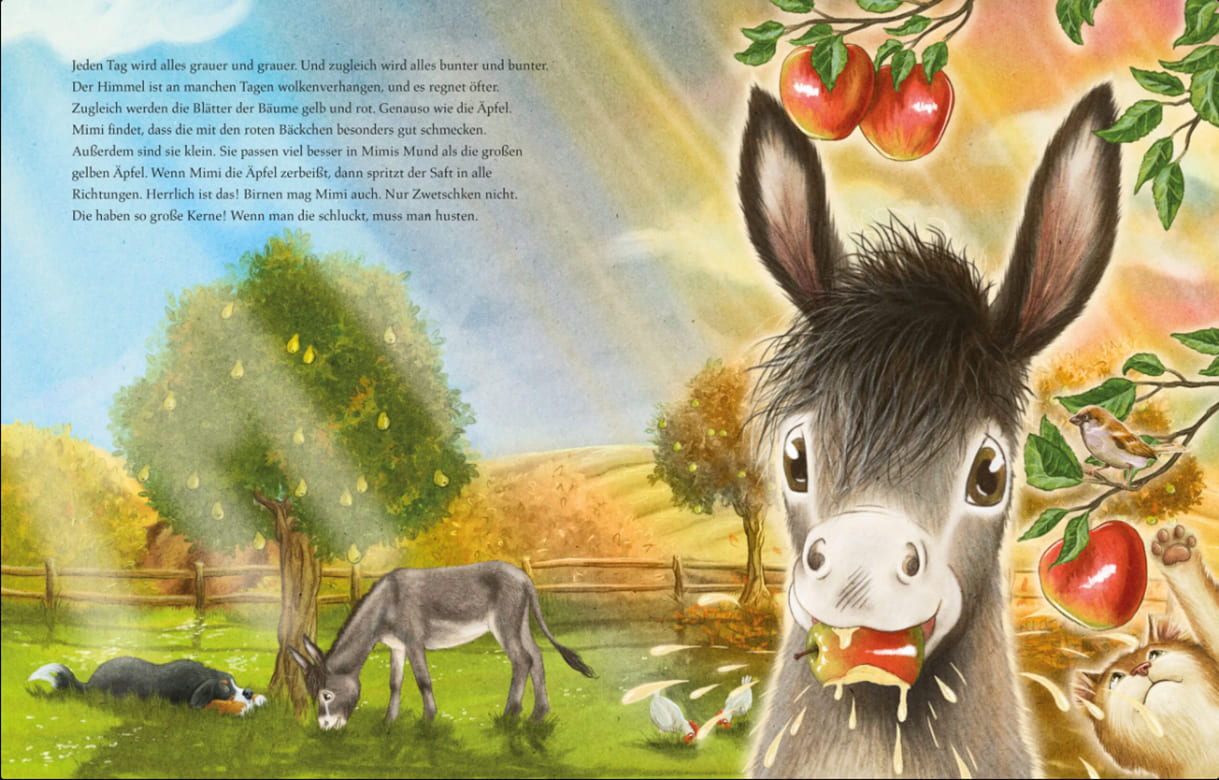
Mimi – so heißt die junge Eselin, von Familie Schneckberger (Oma Gundi, Opa Ludwig, Eltern sowie die Kinder Lilly und Flo) „Eselprinzessin“ tituliert. Sie alle wohnen auf einem Bauernhof. Und zur Familie gehören noch Hund Stupsi, Katze Struppi sowie einige namenlose Kühe, Hühner und Kaninchen; ach ja und Mimis Mutter – auch sie ohne Namen.
Mit dieser menschlichen und tierischen Schar erlebst du in diesem Bilderbuch den Übergang vom Sommer zum Herbst.
„Jeden Tag wird alles grauer und grauer. Und zugleich wird alles bunter und bunter.“ Letzteres gilt für die Blätter der Laubbäume und so manche Obstsorten, die Lilly und Flo von den entsprechenden Bäumen pflücken – nicht zuletzt für ein demnächst anstehenden Hoffest.
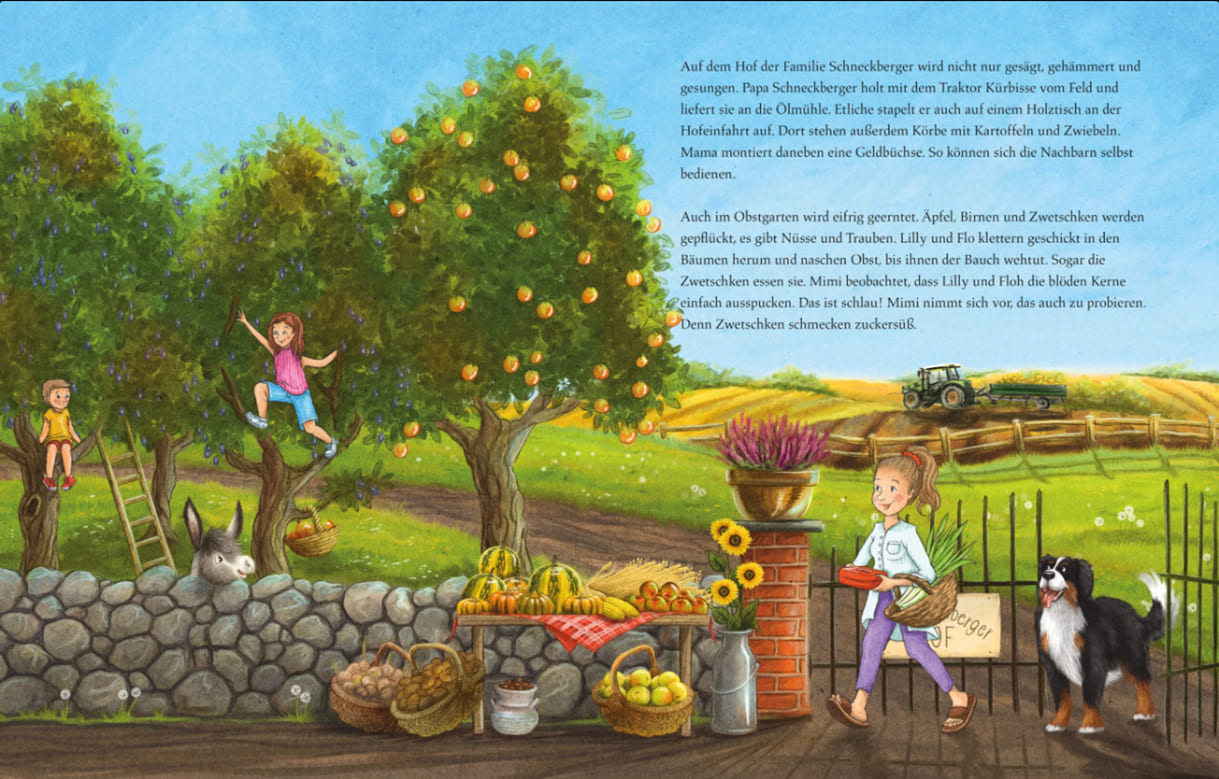
Begleitet von fotorealistischen Zeichnungen kannst du fast reichen, wie es in der Küche duftet, wenn aus so manchen Kilos Äpfel, Birnen… Marmelade eingekocht wird.
Wie und warum Mimi schließlich beim Fest aufgebrezelt zur „Prinzessin“ wird – schildern Autorin Lilo Neumayer und Illustratorin Julia Gerigk in dem Buch, in dem sie so „nebenbei“ die demnächst ins Land ziehende Jahreszeit beschreiben. (Das Duo hat Mimi – und ihre „Familie“ auch schon Frühling, Nacht und Advent erleben lassen.)
Warum allerdings zwar das Eselkind, Hund, Katze, Kinder und Großeltern Vornamen haben, die Eltern aber nur Papa und Mama „heißen“? Wirkt ein bisschen seltsam.
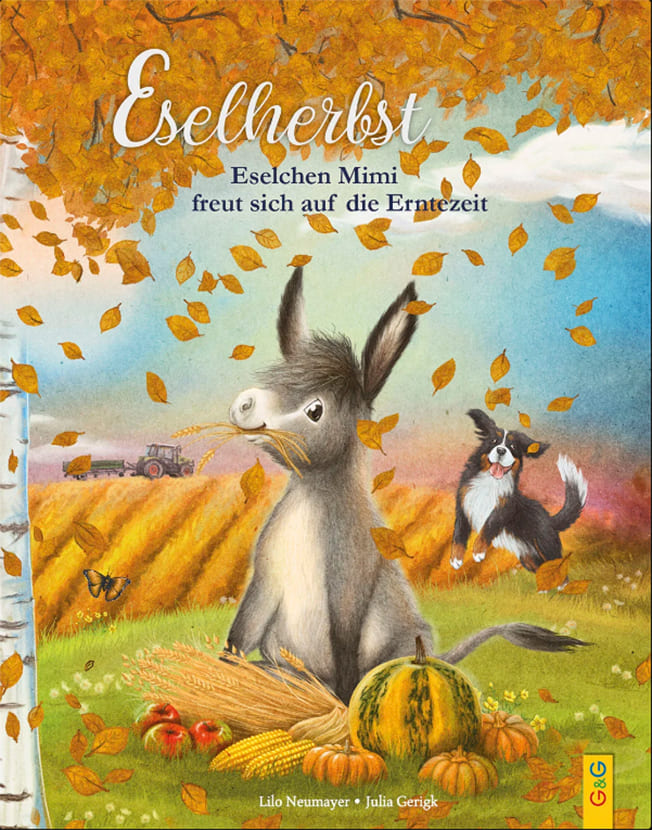
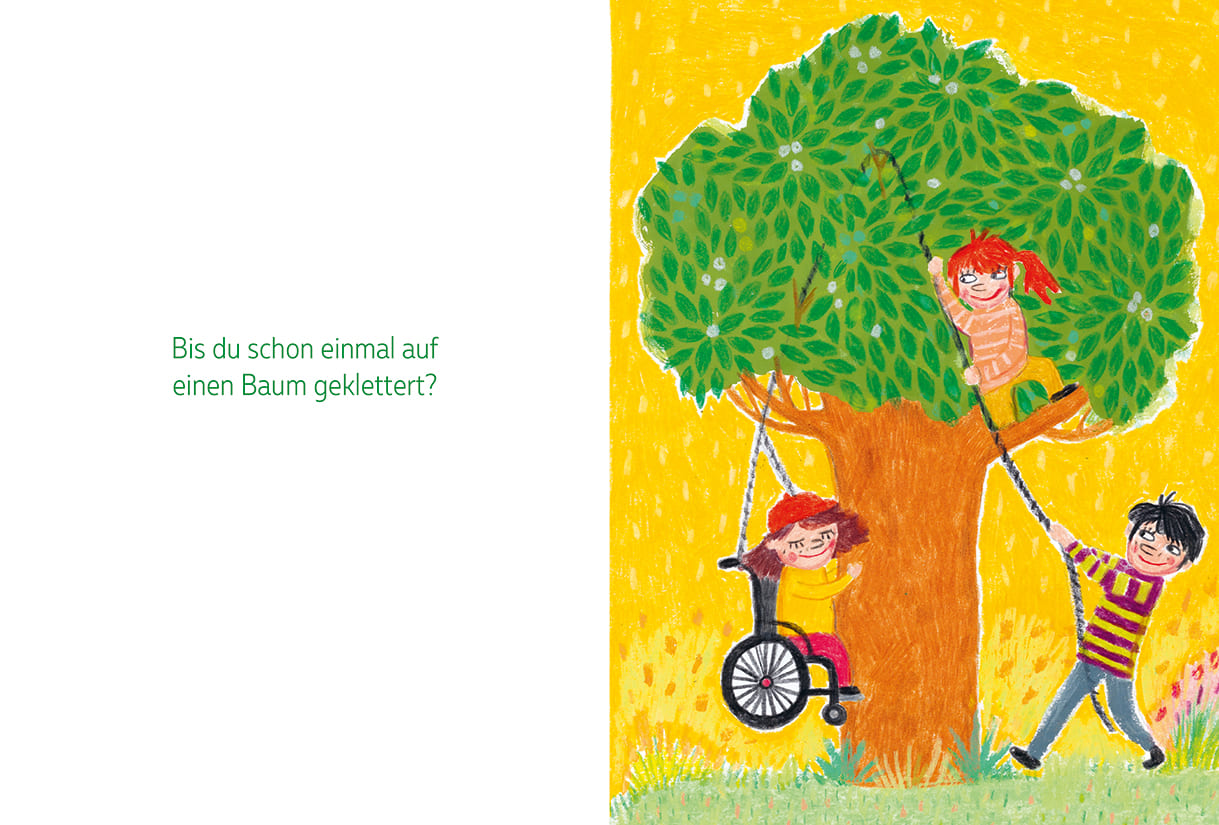
Fragen stellen – und sogar nie aufhören, solche zu stellen – ebenso wie Antworten darauf zu suchen – das müssen Kinder versprechen bzw. geloben, wen sie am Ende der Wiener Kinderuni in den Ferien bei der Sponsion (Gelöbnis). Tun sie das – und da reißen alle ihre Arme hoch, wenn die (Vize-)Rektor:innen in ihren ehrwürdigen schwarzen Talaren diese Frage stellen -, dann werden sie mit den Titeln Magistra bzw. Magister universitatis iuvenum (der Kinderuni) belohnt.
Fragen stellen – das ist der Autorin und Illustratorin Leonora Leitl (oft macht sie beides) offenbar auch sehr wichtig. Schon vor vier Jahren im Buch „Einmal wirst du…“ arbeitete sie vor allem mit Fragen. Nun ist ein neues Buch von ihr erschienen, das trägt das Anliegen sogar schon im Titel: „Gute Frage, sagt die Buchstabensuppe“.
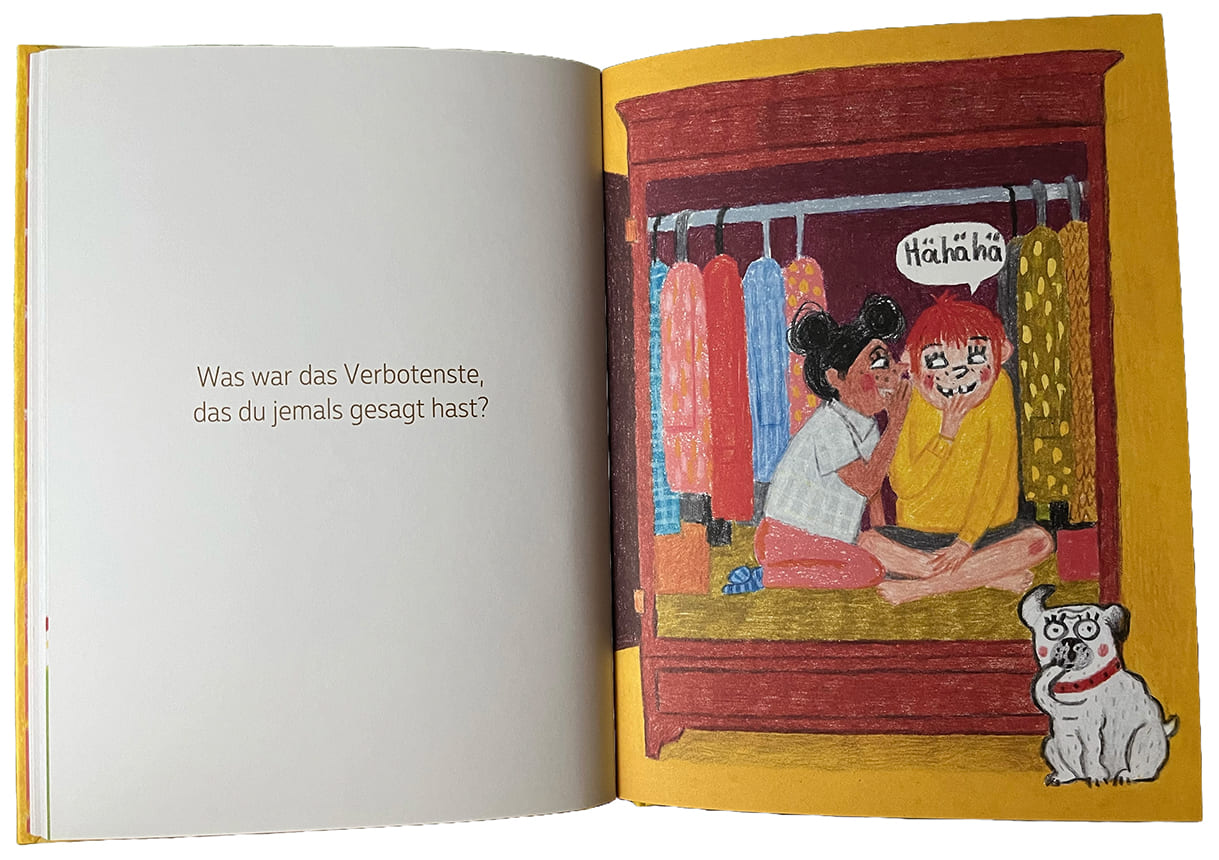
Natürlich darf dann sogar bald nach dem Anfang so ein Bild nicht fehlen. Und so formt die Künstlerin in der orangefarbenen Suppe (vielleicht Kürbiscreme?) die Buchstaben zu der Frage: „Was ist dein größtes Geheimnis?“
Jede der Doppelseiten ist einer Frage gewidmet – ohne selber Antworten zu geben. Du als Leserin oder Leser bist gefragt, den Ball dieses Spiels aufzunehmen und darüber nachzudenken, weiter zu spintisieren und fantasieren, was (d)eine mögliche Antwort sein könnte. Neben der jeweiligen Frage findet sich immer ein gezeichnetes Bild. Führt es dich zu einer möglichen Antwort von Leonora Leitl? Oder will sie dich auf einen möglichen Antwortweg führen? Oder? Schon wieder eine Frage 😉
Spannend sind die Fragen allemal – und meist gar nicht leicht zu beantworten. Da kannst du ganz schön ins Grübeln und Philosophieren kommen.
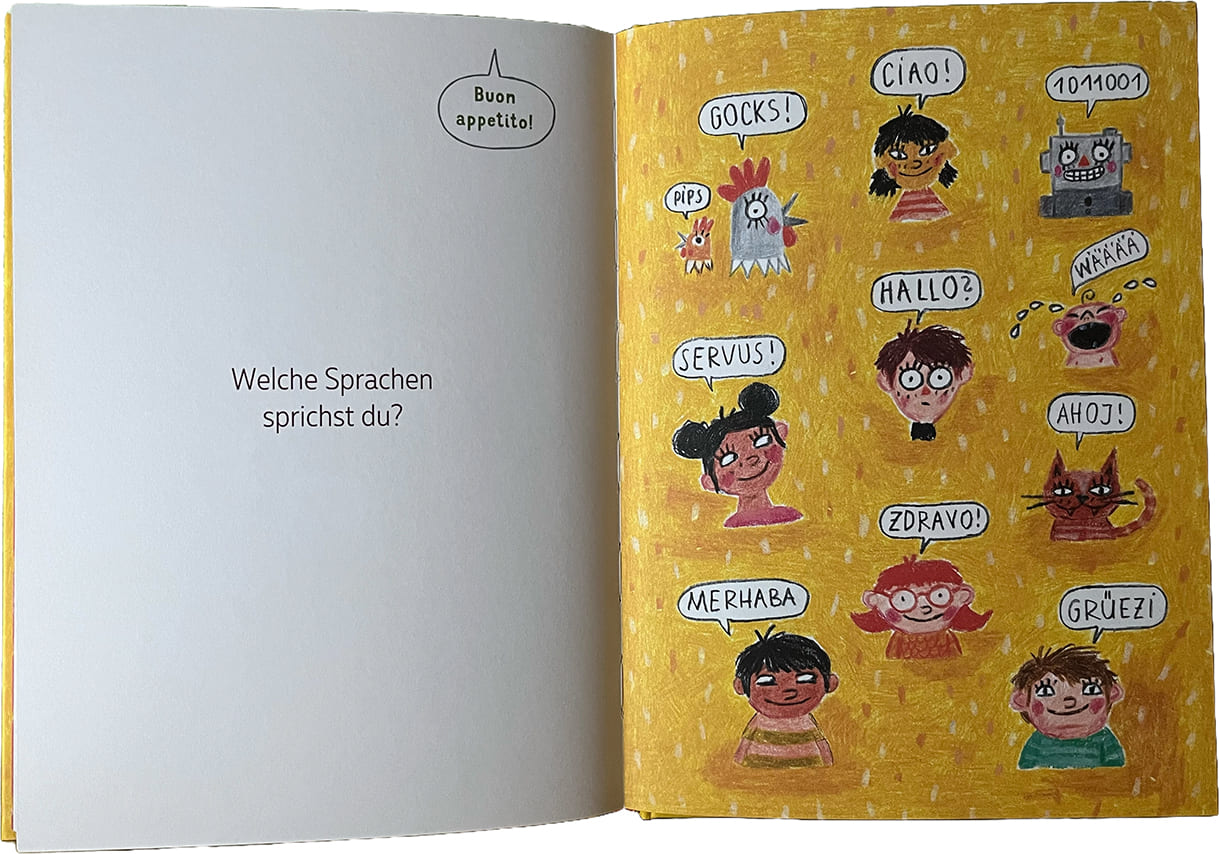
Bald nach Beginn schon stellt das Buch etwa die Frage: „Warum werden manche Menschen Freunde?“ – illustriert mit zwei offenkundig sehr befreundeten Kindern. Um gleich auf der folgenden Doppelseite zu fragen: „Und andere nicht?“
Eine spätere Doppelseite hält schon einige Antworten bereit. „Welche Sprachen sprichst du?“ ist bebildert mit Menschen-, Tier-, und einem Robotergesicht und in Sprechblasen Begrüßungs-Wörtern. Aber du hast ja vielleicht noch die eine oder andere Sprache mehr als sie auf diesem Bild zu finden ist…
Besprechung eines früheren Leitl-Fragebuchs <- damals noch im Kinder-KURIER
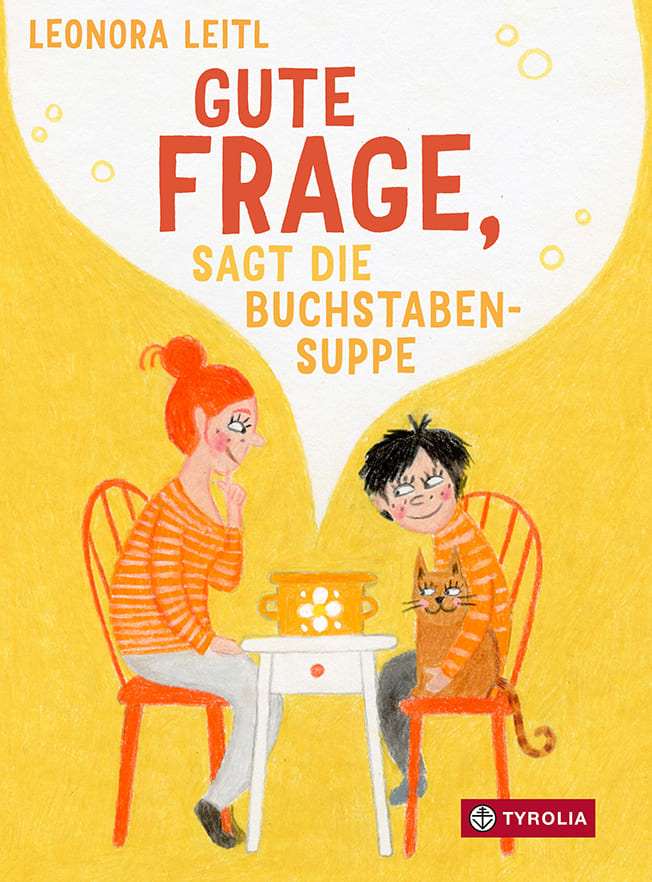
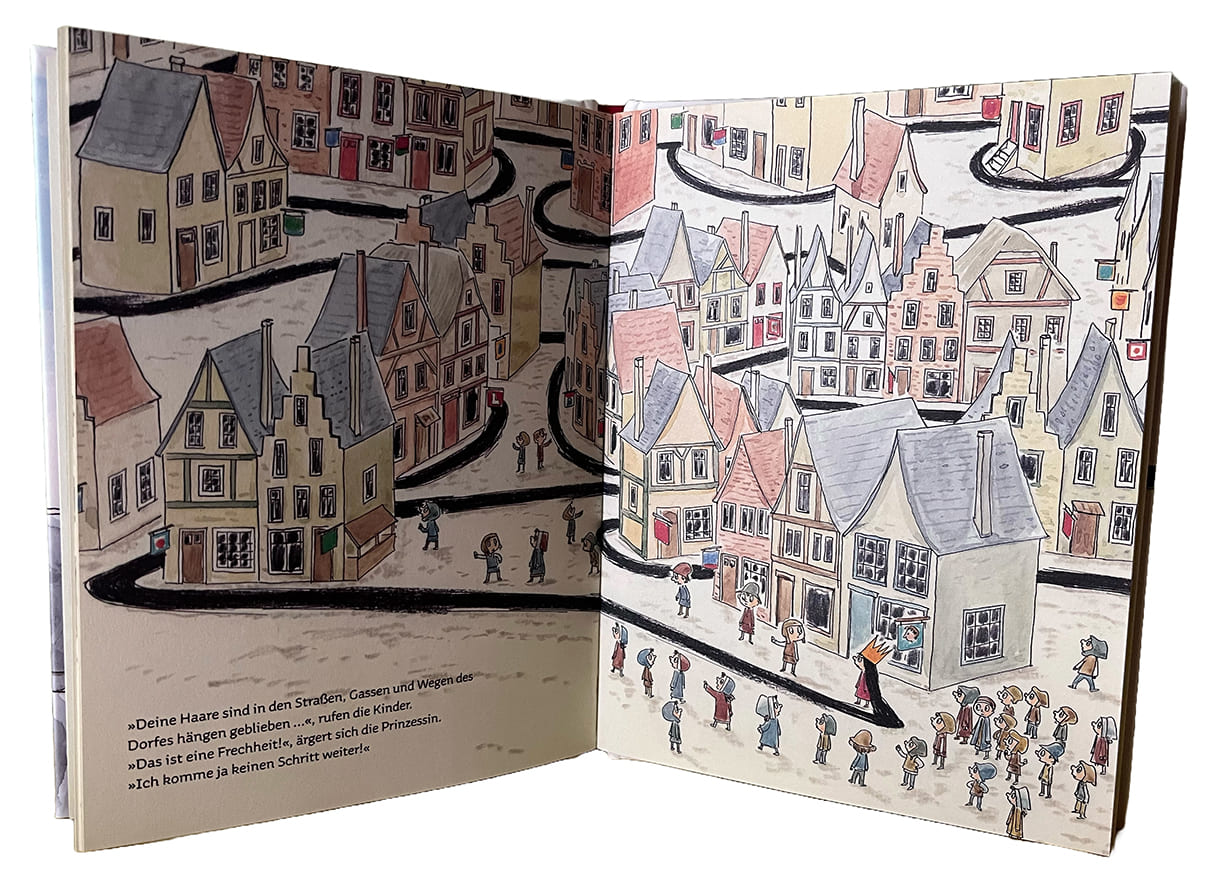
Hoch auf dem Berg und noch dazu ganz oben im Turm erwacht Prinzessin Bertie. Ihr Wunsch – wie schon der Titel des Bilderbuchs – neu in kleinerem, handlicherem Format aufgelegt – ankündigt: „Ich will ein Schokocroissant. Sofort!“
Und so macht sie sich auf ins nahegelegene Dorf. Ur-laaaaaaaange Haare hat sie, die schlängeln sich die Treppen des Turms entlang, den ganzen Weg und zwischen den Häusern. Und dann noch das: Im ersten Geschäft gibt’s nur Hüte, im zweiten Schwerter, es folgen Schuhe, Gläser und so manches, aber nirgends ein Croissant.
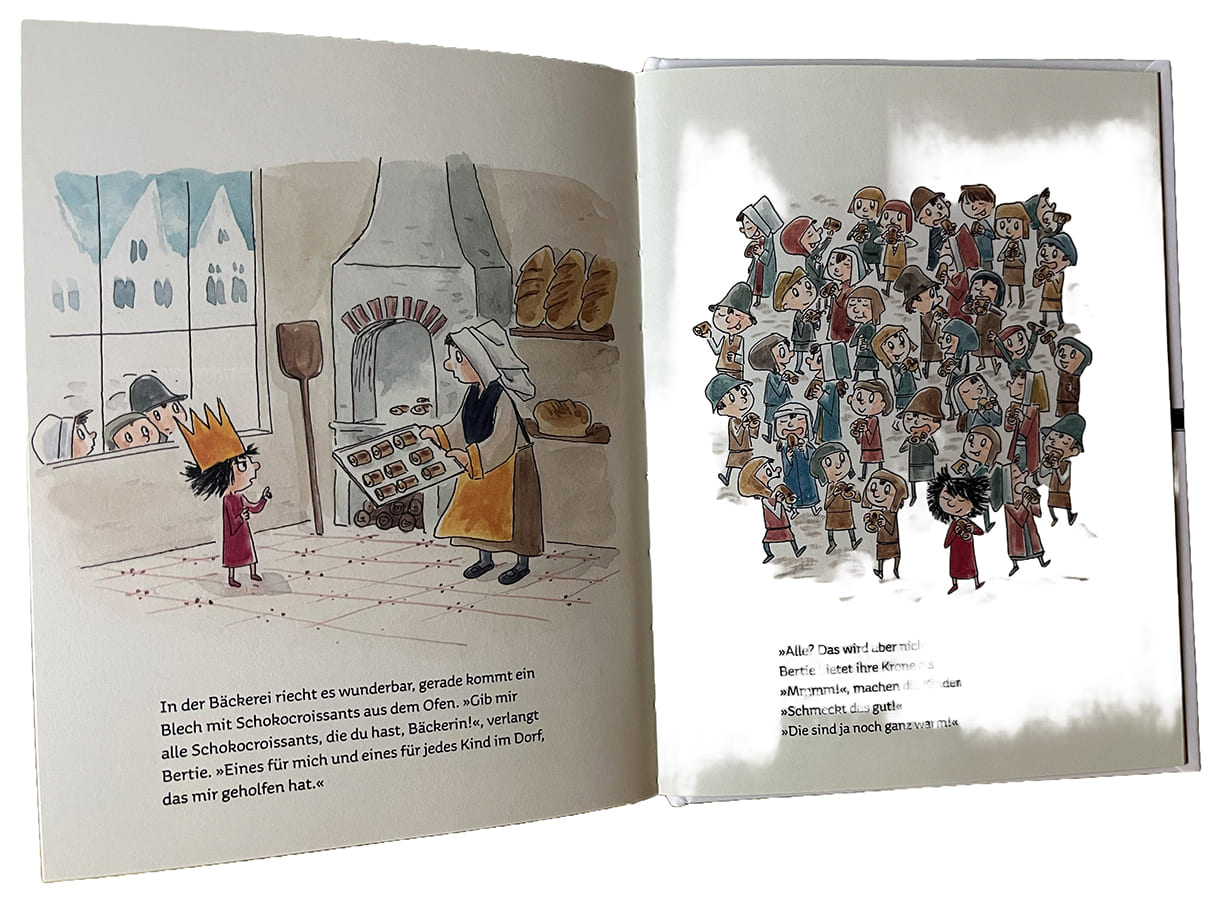
Klar, was wäre ein Buch, in dem nicht irgendwann der Titel doch Wirklichkeit würde. Hier helfen Kinder auf die sie trifft, die weisen ihr den Weg zur Bäckerei. Aber in der Zwischenzeit bleiben ihre Haare an Häusern hängen. Also weg damit. Und dann – Schokocroissants für alle Kinder.
So nebenbei taucht noch ein reitender Prinz auf, der nach dem Weg zum Turm und der Prinzessin fragt, denn – so behauptet er -, die würde auf ihn warten. Die steht vor ihm und hat alles andere als auf ihn oder seinesgleichen gewartet. Sie ist ja nicht Rapunzel, die statt an ihren eigenen langen Haaren den Turm runter zu klettern, darauf wartet, einen schweren Mann in Rüstung an diesen Haaren hinaufzuziehen, um sich „befreien“ zu lassen 😉
Und so hat Jean-Luc Englebert (Übersetzung Alexander Potyka) mit Bertie ein selbstbewusstes Mädchen geschaffen, das noch dazu – entgegen dem Titel – nicht bedient werden will, sondern sich selbst zu helfen weiß. Und obendrein gern teilt.

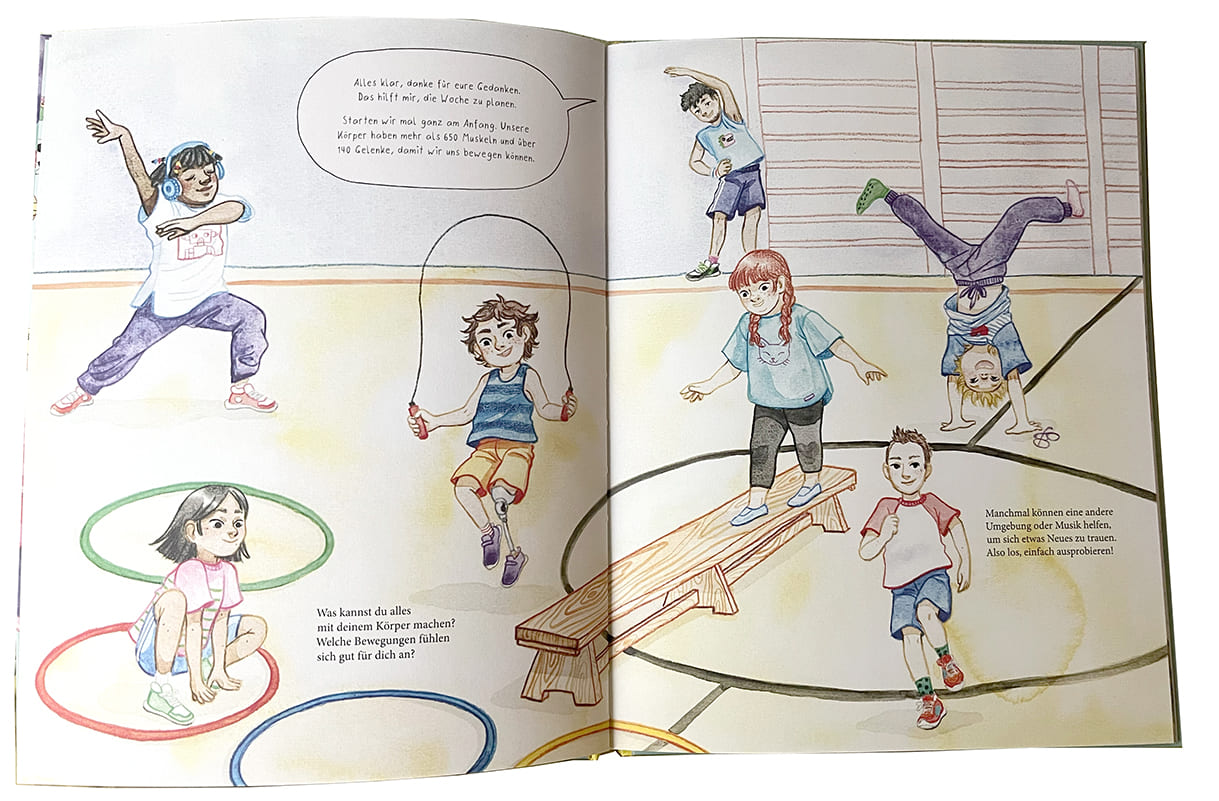
In Paris startet eben sozusagen die zweite Hälfte der Olympischen Sommerspielen, die Paralympics, bei denen Sportler:innen mit unterschiedlichsten Behinderungen körperliche Höchstleistungen vollbringen.
Vielleicht wird es ja eines Jahres einmal Spiele geben, bei denen – wie kürzlich bei den 3×3-Basketball-Europameisterschaften in Wien – alle Sportler:innen, egal ob ohne oder mit Behinderungen, gleichzeitig ihre Leistungen zeigen dürfen.
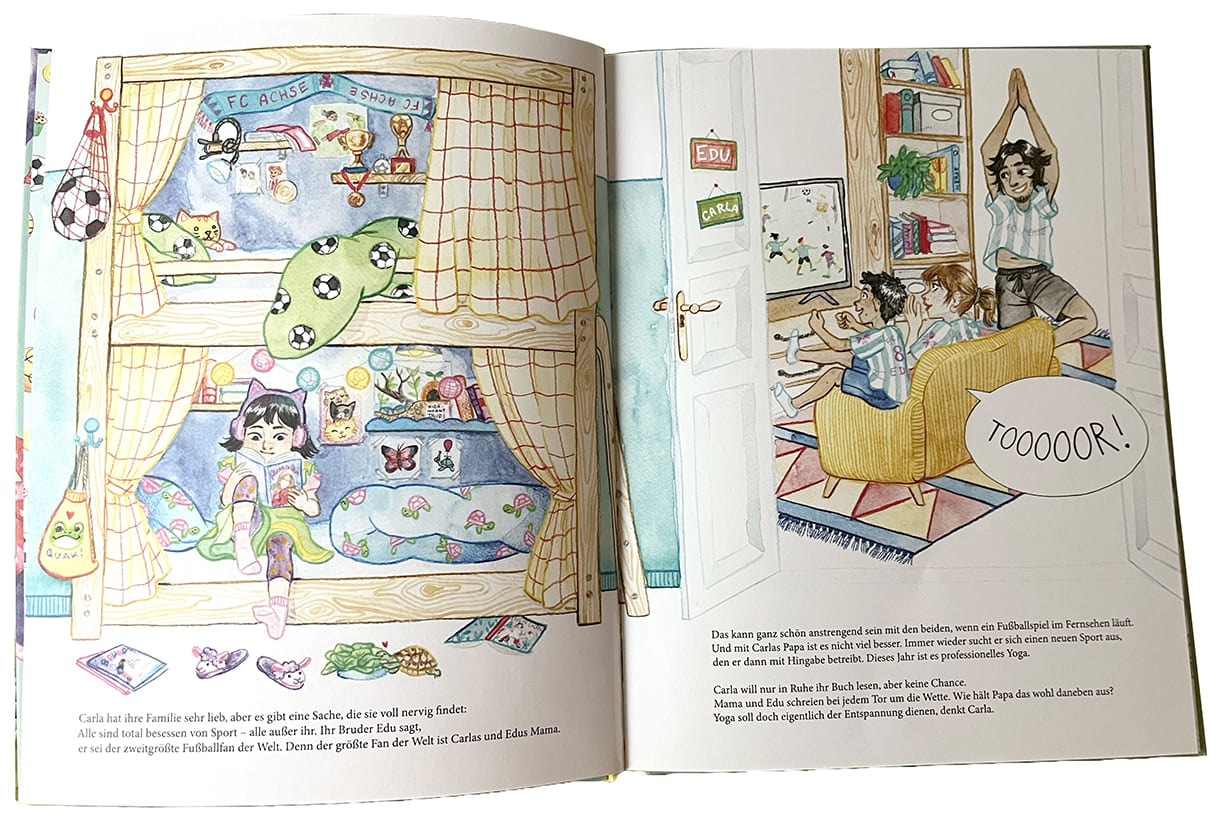
Auch wenn sich wohl jedes Kind liebend gern bewegt und der Zwang zum Stillsitzen – noch dazu stundenlang – eher eine Qual ist, mögen dennoch nicht alle Sport betreiben. Vor allem das „schneller, höher, weiter, besser“ ist nicht unbedingt jederkinds Sache. Carla zum Beispiel kann weder dem aktiven noch dem passiven Sport (im TV zuschauen, wie andere Fußball spielen) etwas abgewinnen, das Bruder, Mutter und Vater beides gerne machen.
Natürlich verändert sich das in diesem Bilderbuch, heißt es doch „alle machen Sport“ 😉 Und so findet auch Carla Gefallen daran – als Cem in die Schule kommt und alle Kinder zunächst einmal fragt, wie und was sie gern an körperlicher Bewegung machen möchten und das zum Teil sogar mit Musik. Und ohne wen auszulachen, wenn die eine oder andere etwas nicht so toll schafft wie andere. Im Vordergrund steht von nun an: Spaß!
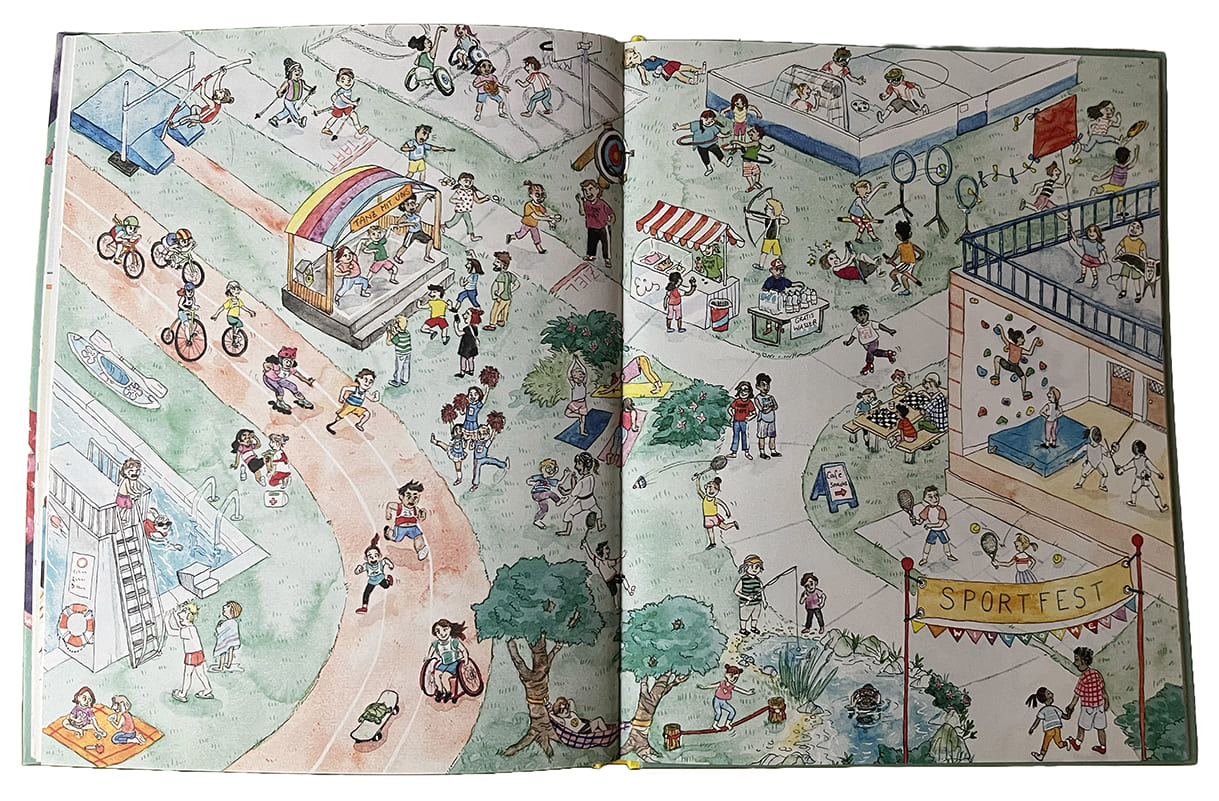
Nebenbei präsentieren Liese Macher und Vale Weber mit Zeichnungen von Anna Horak auch bekannte und weniger bekannte Sportler:innen von Paralympics bzw. queere Fußballer:innen, für die das Outing noch immer – insbesondere bei den Männern – nicht so ganz leicht ist. Und klar, finden sich auch sportliche Kinder im Rollstuhl oder mit einer Beinprothese in den Bildern.
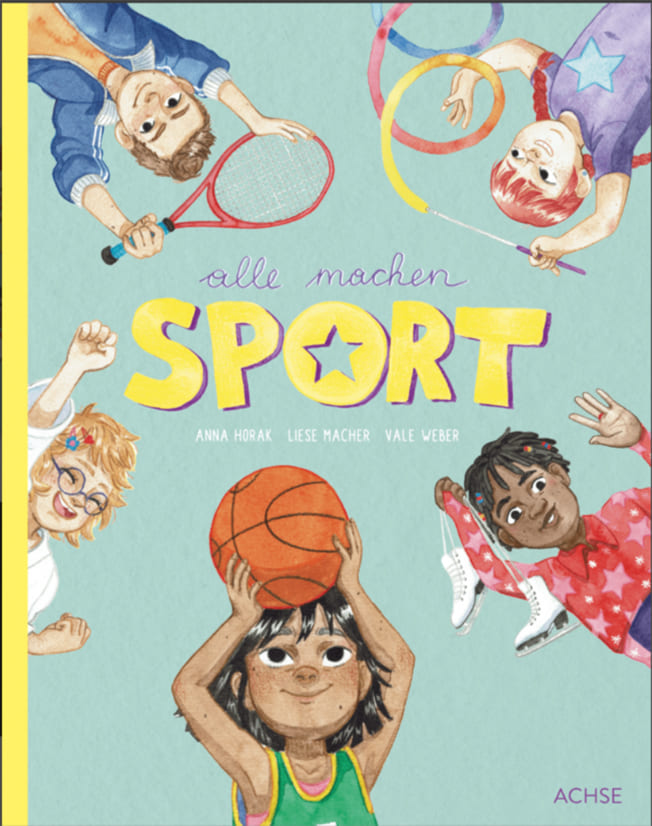
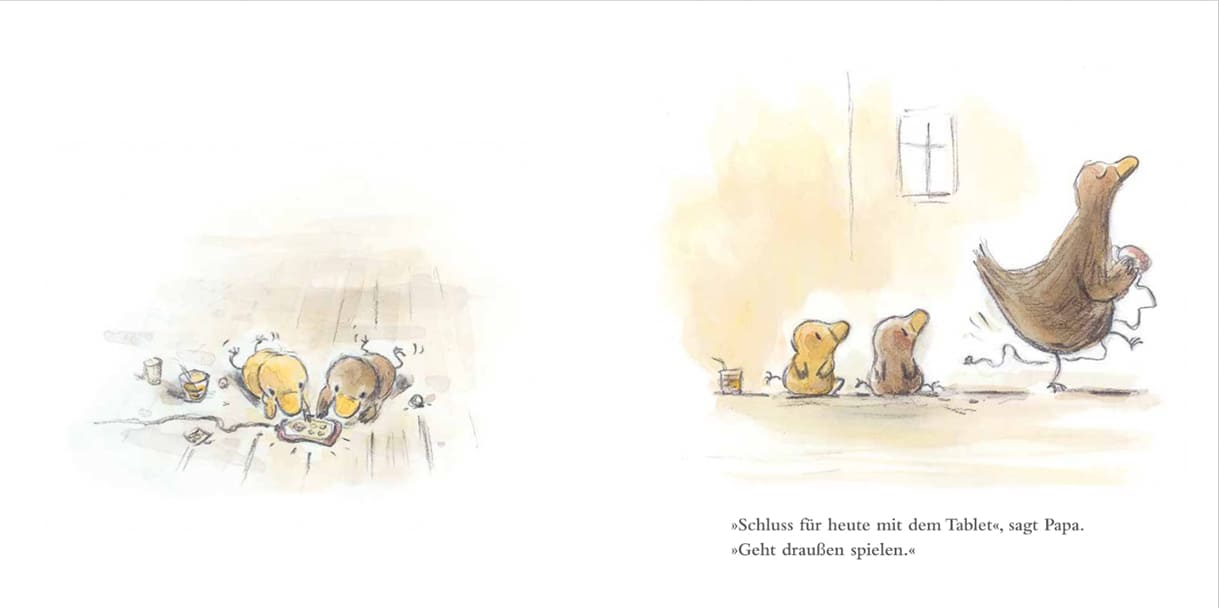
Diese Bilderbuch trägt den vielleicht ungewöhnlichsten Titel: „Pfff…“ Dieser Laut – oft verbunden mit der Luft, die aus einem Ballon entweicht – ist sogar so international, dass ihn Tobias Scheffel nicht aus dem Französischen übersetzen musst 😉
Die Belgierin Claude K. Dubois, die schon mehr als vier Dutzend Bilderbücher geschrieben UND gezeichnet – oder umgekehrt(?!) – hat, lässt hier zwei Vogelkindern ziemlich fad werden, nachdem ihnen der Vater ihr Tablet weggenommen hat. „Geht draußen spielen“, schlägt er ihnen stattdessen vor.
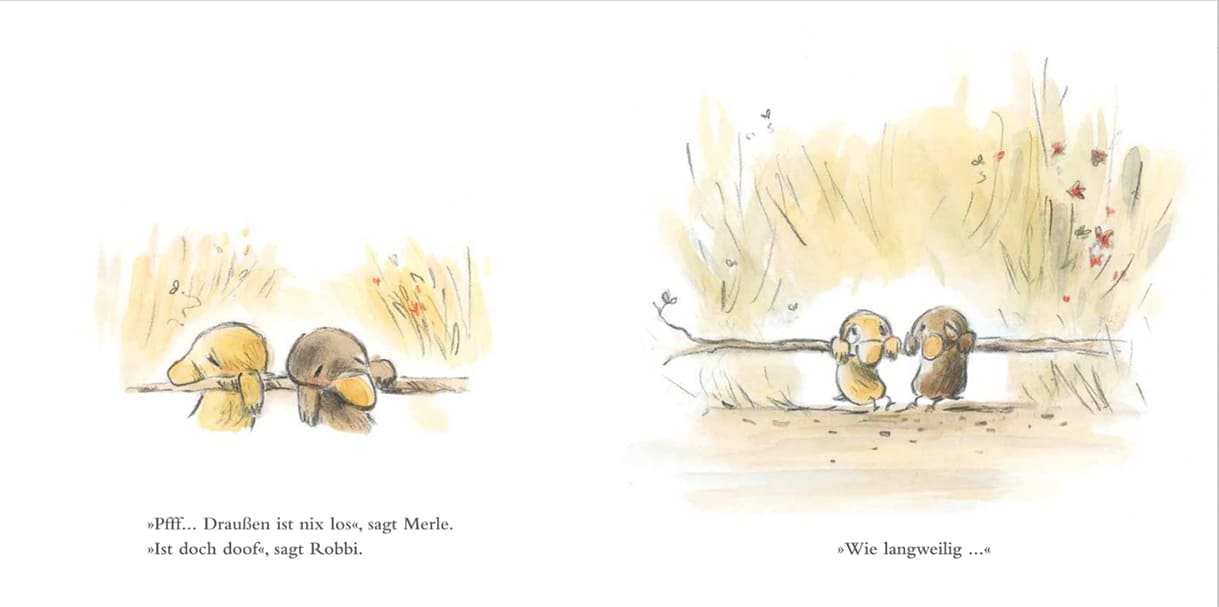
… finden Merle und Robbi das. Wurscht was Papa anbietet – nix taugt den beiden Vögelchen. Schlapp und fadisiert hängen oder liegen sie herum. Die Künstlerin zeichnet das so, dass es trotz der schönen Bilder nachvollziehbar wirkt. Fast scheint’s als würden die beiden die Bilderbuch-Betrachter:innen anstecken und zum Gähnen verleiten. Da könnte der Titel-Laut schon auskommen, aber…
Natürlich kann’s so nicht bleiben, irgendwas muss die beiden gefiederten Kinder doch zu Aktivitäten verleiten – aber das sei hier sicher nicht verraten; nur so viel: Es hat mit dem verschriftlichten Geräusch im Buchtitel zu tun.
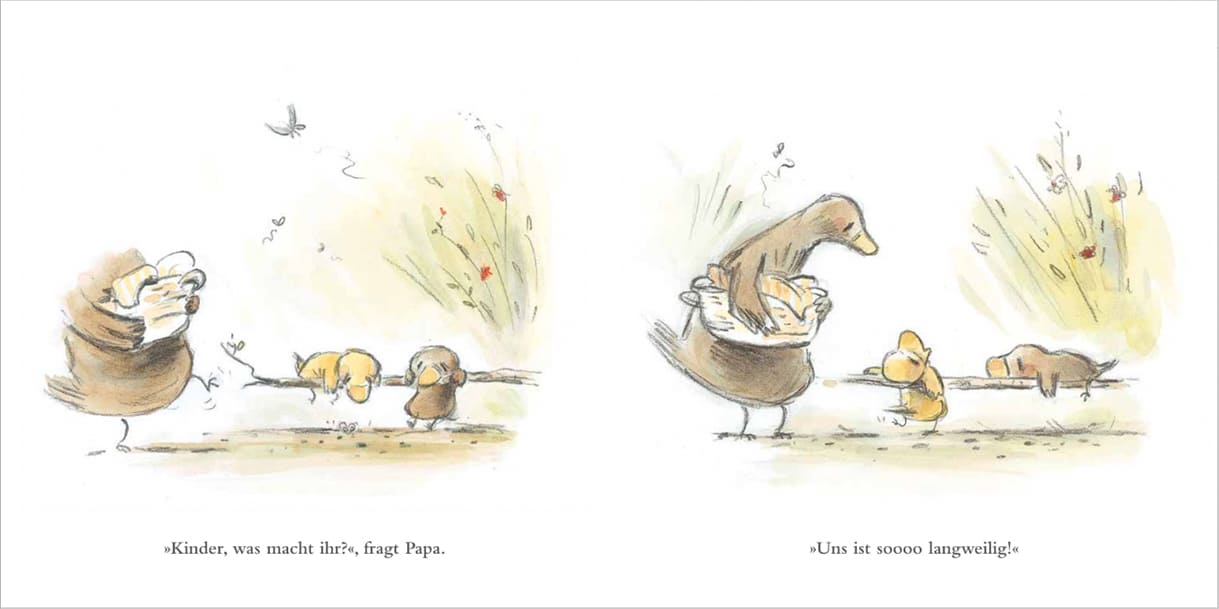
Apropos Langeweile: Jahr für Jahr redet eine oder einer der ehrwürdigen (Vize-)Rektor:innen einer der Wiener Universitäten bei der Sponsion der Kinderuni den (Groß-)Eltern ins Gewissen: Sie mögen ihren (Enkel-)Kindern in den folgenden Ferienwochen doch auch Freiraum für „ins Blaue schauen“, vermeintliches Nichts-Tun und das lassen, was andere als Langeweile bezeichnen. Auch Wissenschafter:innen und Forscher:innen würden solche Phasen brauchen, in der sie dann vielleicht den einen oder anderen Geistesblitz haben, wenn sie eben nicht im Hamsterrad der alltäglichen Arbeit gar nicht Raum und Zeit dafür hätten…
PS: Dieses Bilderbuch – sowie der dänische Familientherapeut Jesper Juul mit seinem Ansatz „gleichwürdige Erziehung“ haben vier Künstlerinnen zum Bühnenprogramm „Ein ? für die Langeweile“ inspiriert, das sie beim diesjährigen Kultursommer Wien zwei Mal zeigen – Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wird es sich ansehen und darüber berichten.
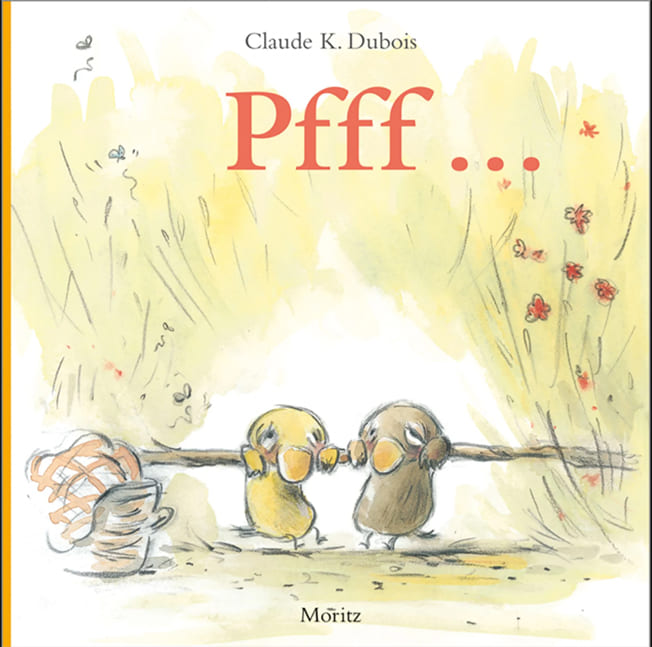
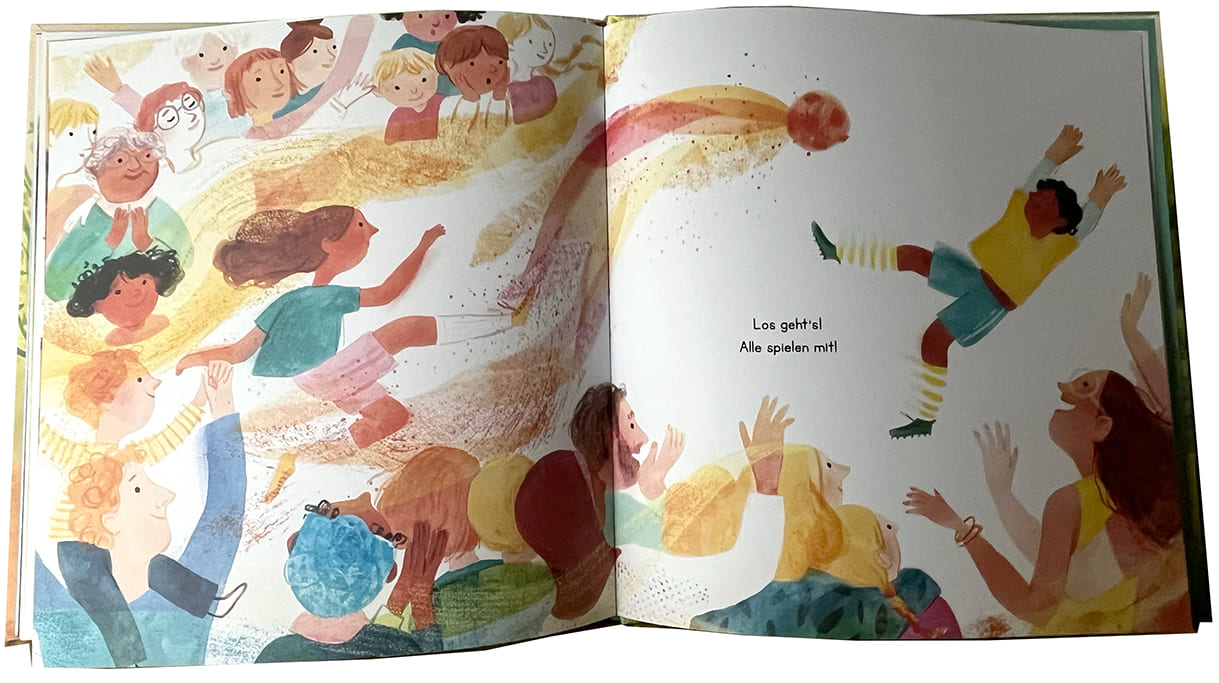
Sowohl die Europa-, als auch die Amerika- (ganzer Kontinent!) Meisterschaften im Fußball der Männer sind beide Mitte Juli zu Ende gegangen. Die Qualifikation für die EM bei den Frauen (2025 in der Schweiz) ist im Gange, Österreich, das schon einmal in einem Halb- und ein weiteres Mal im Viertelfinale spielte, muss ins Play-Off gegen Slowenien im Herbst. Die Olympischen Fußballturniere in Paris starten am 24. und 25. Juli 2024.
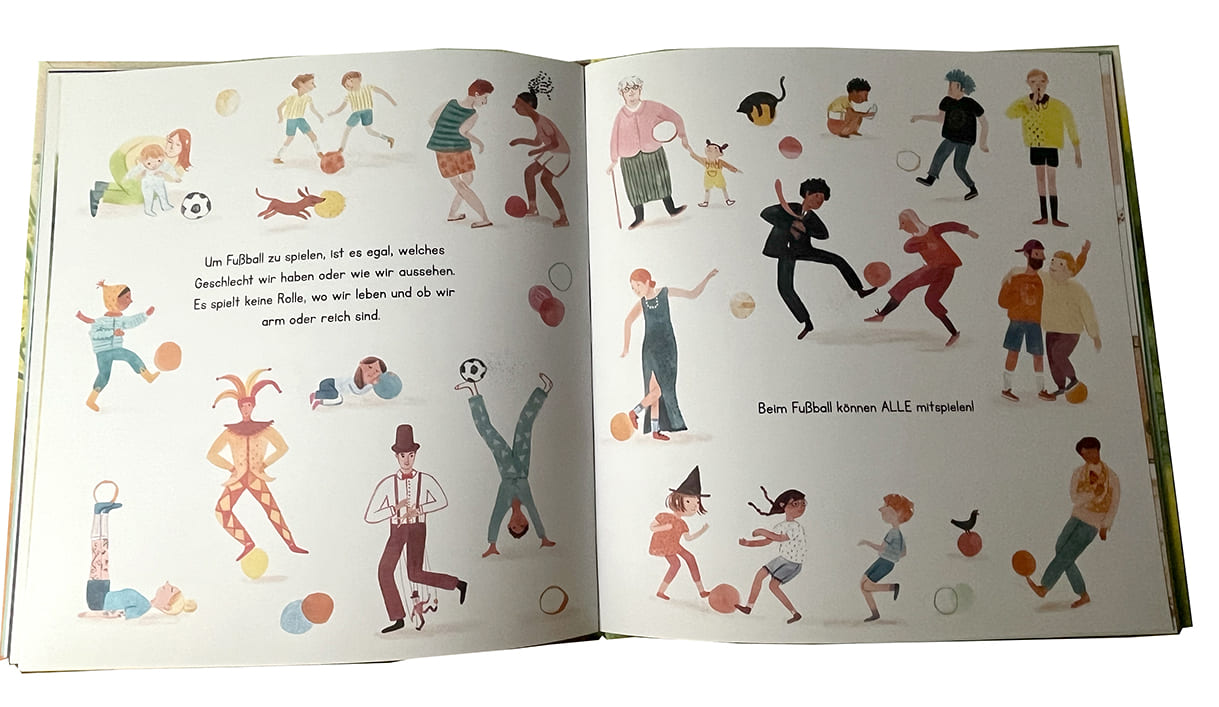
Abseits der großen Turniere spielen weltweit – nach Angaben des Weltverbandes Fifa – mehr als 265 Millionen Menschen Fußball, rund 15 Prozent davon in Vereinen (38 Millionen Menschen). Darüber hinaus spielen ja fast überall Kinder schon von klein auf gern mit einem Ball, auch wenn der vielleicht nur aus zusammengebundenen alten Stofffetzen besteht und auch ohne Schuhe gekickt werden muss.
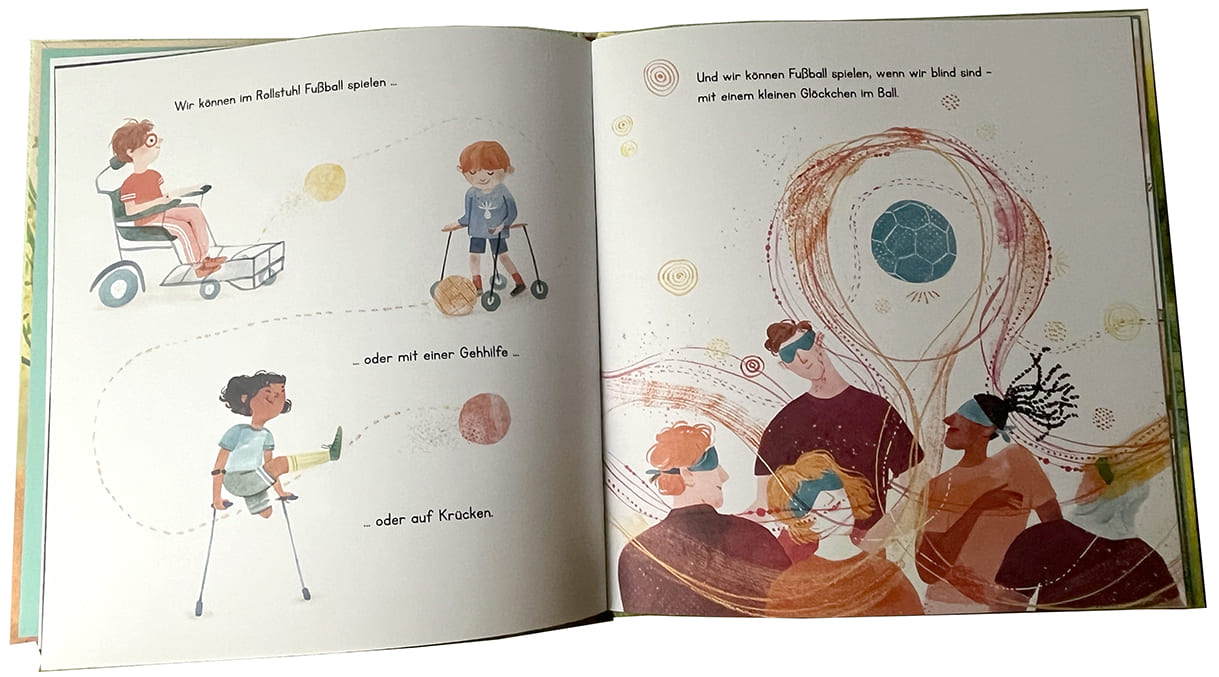
Genau dieser Faszination für dieses wahrscheinlich am weitesten verbreitete Team-Spiels widmet sich das Bilderbuch „Fußball – Alle spielen mit“ von Ben Lerwill (Übersetzung aus dem Englischen: Jens Dreisbach) und Marina Ruiz. Ihre Zeichnungen zeigen deutlich die Botschaft: Alle heißt auch wirklich alle – nicht nur in Sachen Hautfarben oder Geschlecht, sondern auch ob mit Krücken, im Rollstuhl und sogar blind (mit Glöckchen im Ball).
Zweite Botschaft des Bilderbuchs: Es geht um den Spaß beim Spiel und das Zusammenspiel – oder sollte vielmehr darum gehen.
Dass Fußball sogar in schwierigsten Situationen verbinden kann, zeigt das Buch unter anderem mit dem historischen Beispiel, dass während des Weihnachtsfriedens 1914 im 1. Weltkrieg Soldaten der feindlichen Armeen von Briten und Deutschen ein Match austrugen.
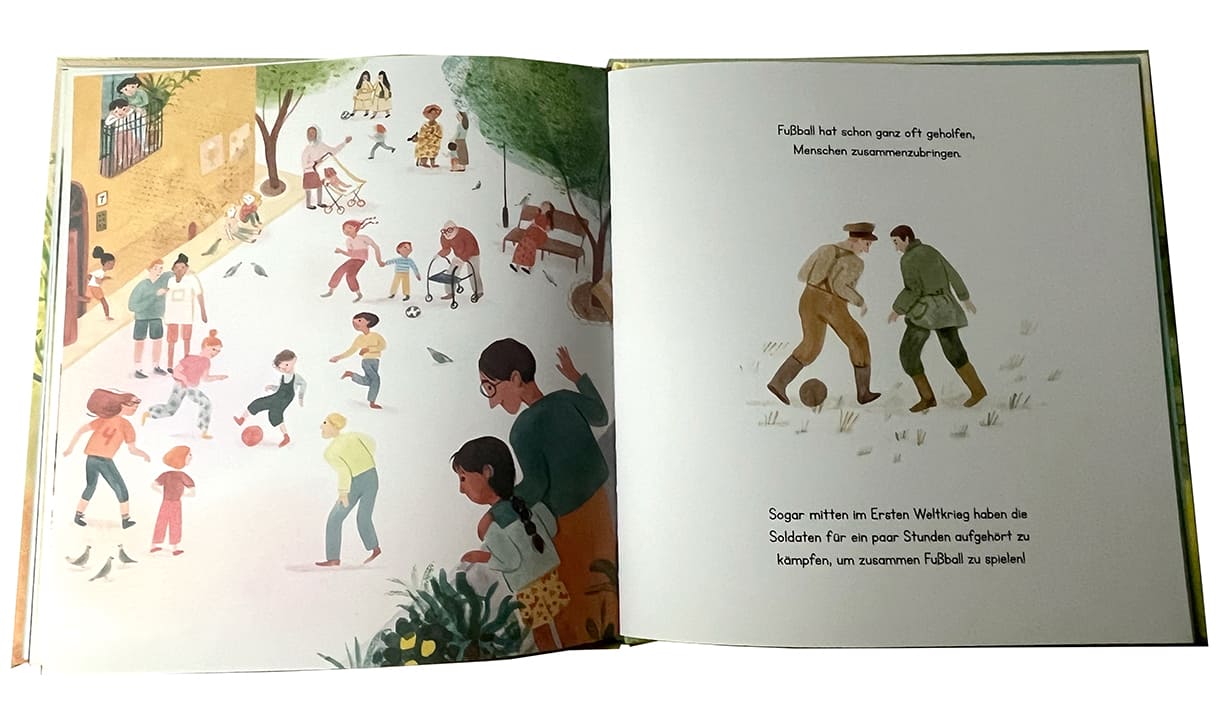
Allerdings wirkt dieses Verbindende ebenso wie die These, dass es nicht ums Gewinnen oder Verlieren geht doch ein wenig krampfhaft, wird doch Gegenteiliges ausgespart. Abgesehen vom sehr wohl sehr oft wettbewerbsmäßigen Gesichtspunkt oder der Geschäftemacherei gibt es zum friedlichen Fußballspiel der Soldaten, die anderntags wieder aufeinander schossen und das nicht mit dem Ball, ein Gegenbeispiel: Im Juli 1969 kam es nach gewaltsamen Ausschreitungen mit Todesfolgen beim Qualifikationsspiel zwischen Honduras und El Salvador für die Männer-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko sogar zu einem mehrtägigen Krieg (14. bis 18. Juli 1969).
Auf einer Doppelseite wird auch dargestellt, dass es Ballspiele schon im alten Ägypten, China, im antiken Griechenland und Rom gegeben hat. Hinweise auf Mittel- und Südamerika hätten vielleicht doch noch Platz gehabt.
Noch eine kleine Anmerkung: Während durchgängig auf Diversität und Inklusion Wert gelegt wird, heißt es immer nur „Fußball-Mannschaft“, hätte sich doch das Wort Team statt MANNschaft gut gemacht 😉
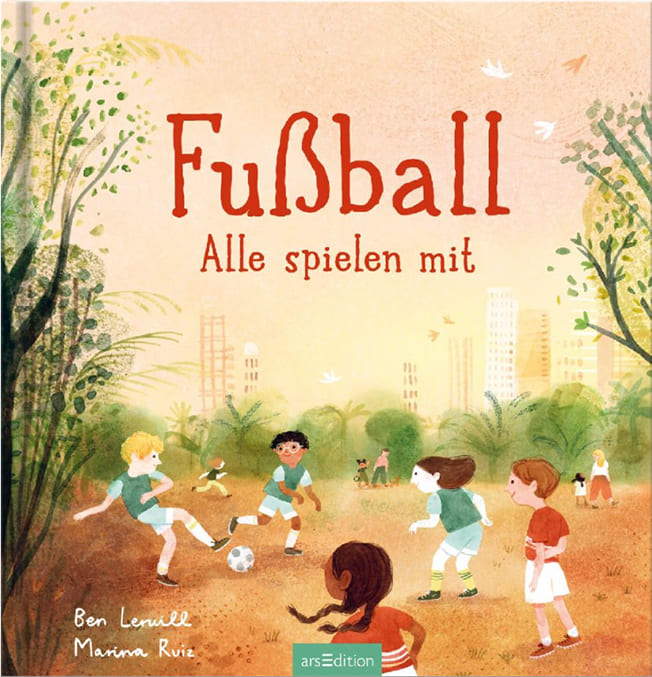
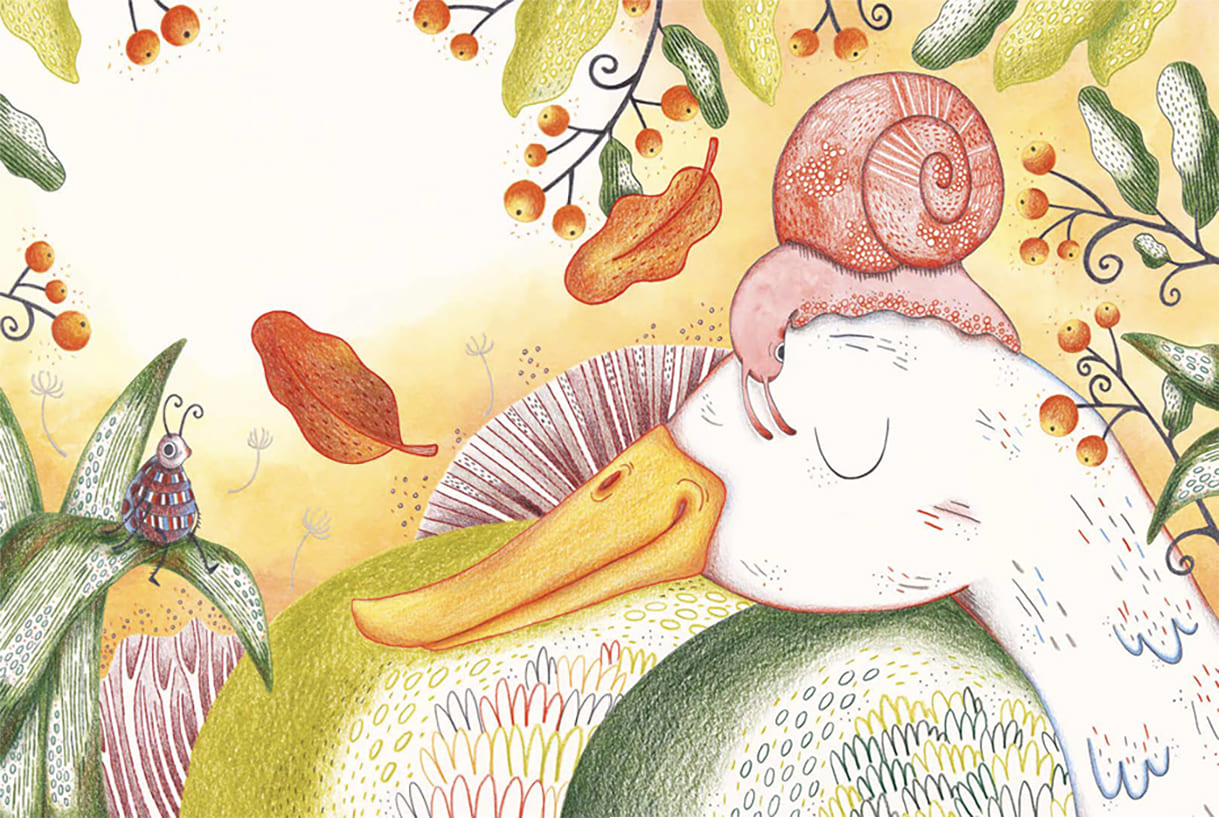
Fast als wäre sie ihr am Kopf angewachsen „wandert“ die Schnecke auf den ersten Seiten durch das Bilderbuch „Da war ich noch nie!“ Und damit legt auch schon der Titel nahe, dass es nicht so bleiben wird. Die (fast) flugunfähige Lauf-Ente kann sich nicht in die Lüfte erheben. Vor allem wenn im Herbst die Zugvögel in den Süden fliegen packt die Schnecke auf Entes Kopf die Sehnsucht…
Würde aber auch schon eine flugfähige Gans reichen oder vielleicht sogar nur ein Pferd – bessere Aussicht, weiter kommen – wohin wo sie noch nie war!
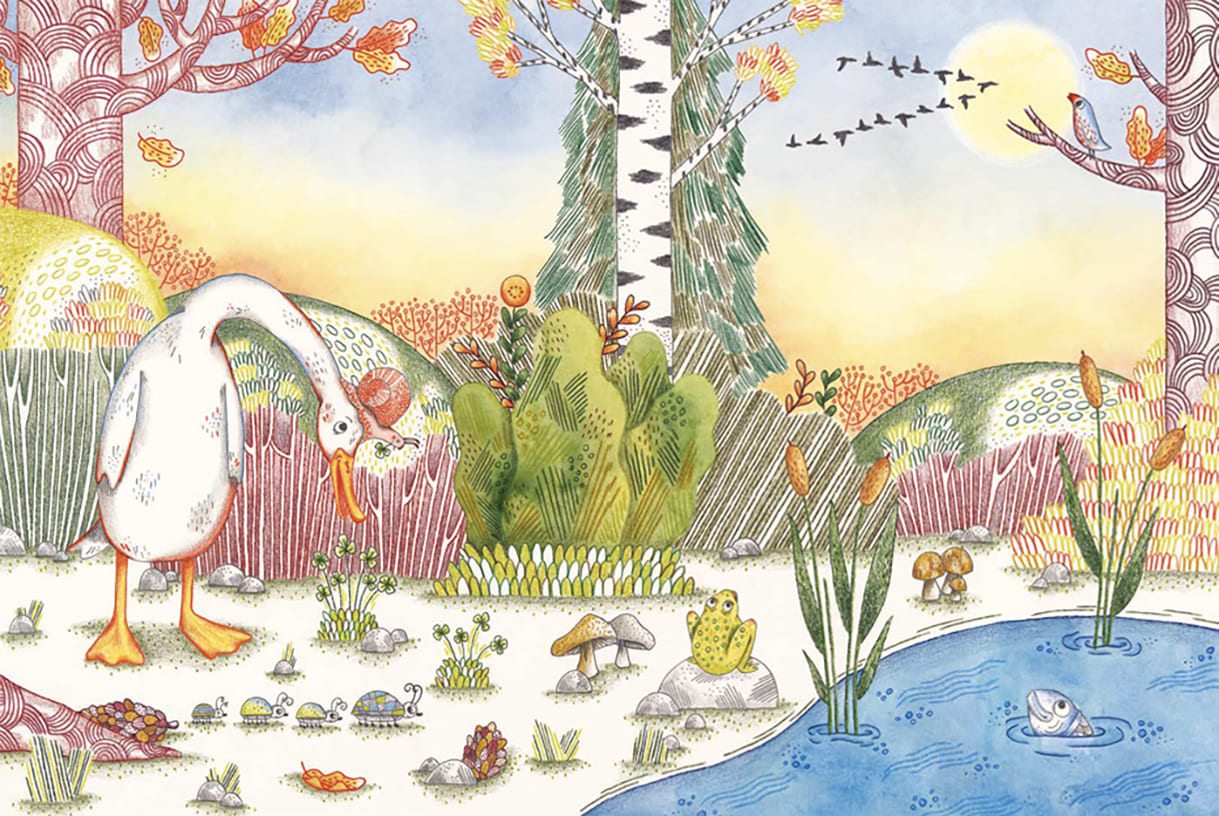
Irgendwann kriecht die Schnecke – immer natürlich samt ihrem Haus – sanft und fast unbemerkt von der Ente über die Wiese auf einen Baum und dort hinauf. Wowh! Diese Aussicht. „Das muss ich Ente zeigen“, lässt Autor Daniel Fehr die Schnecke denken, denn „ihr würde das auch gefallen!“
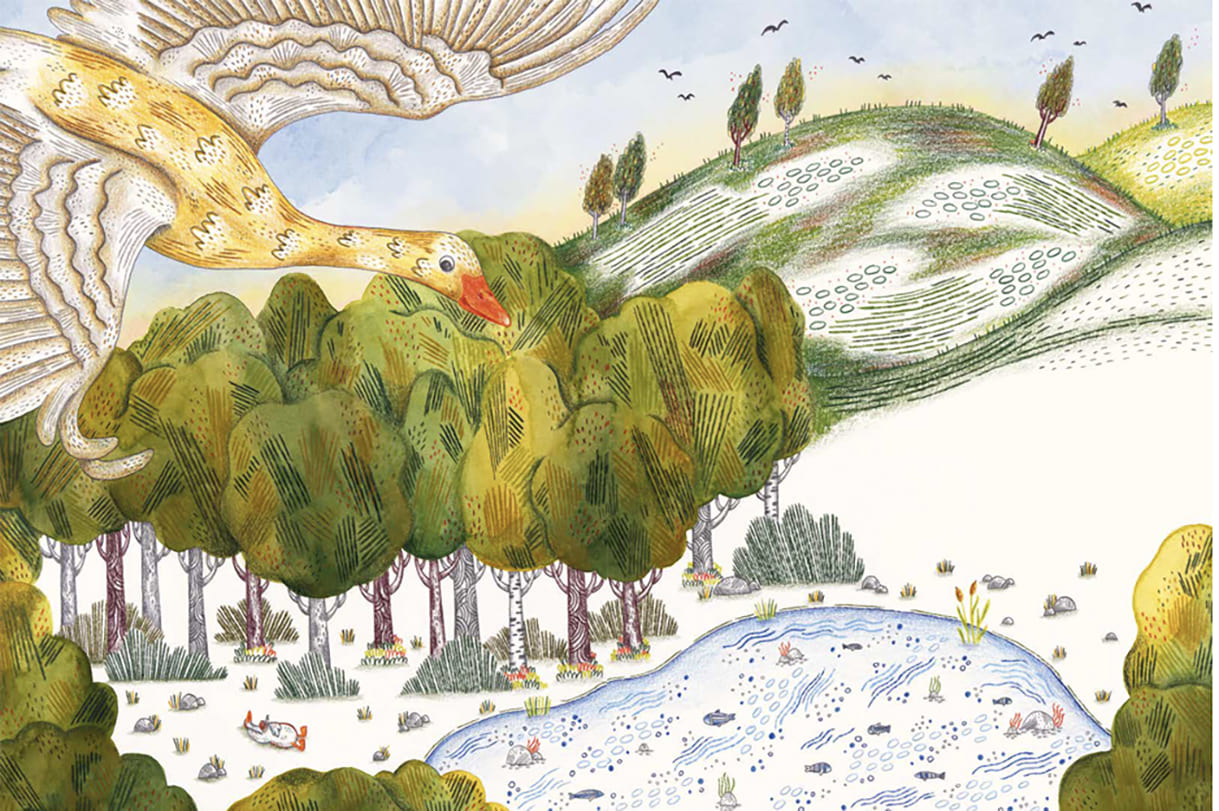
Und so kriecht Schnecke den ganzen Weg zurück. Dass dies natürlich bei ihrem Tempo dauauauauert macht Illustratorin Raffaela Schöbitz mit einer Zwischen-Doppelseite in Blautönen für die nächtliche Wanderung unaufdringlich sichtbar…
Aber Ente hat noch ein weiteres Ziel im Auge – eines wo beide noch nie waren 😉
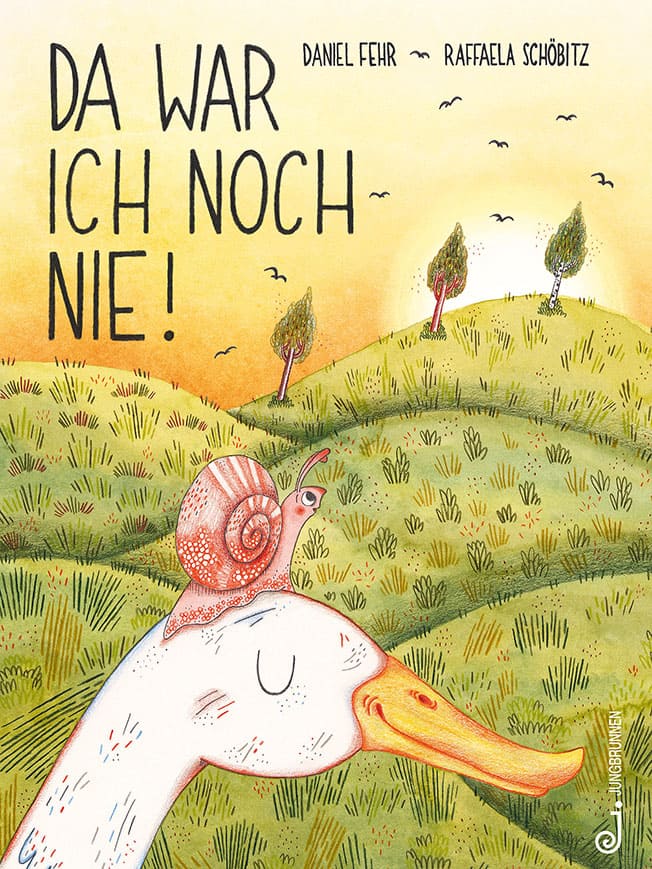
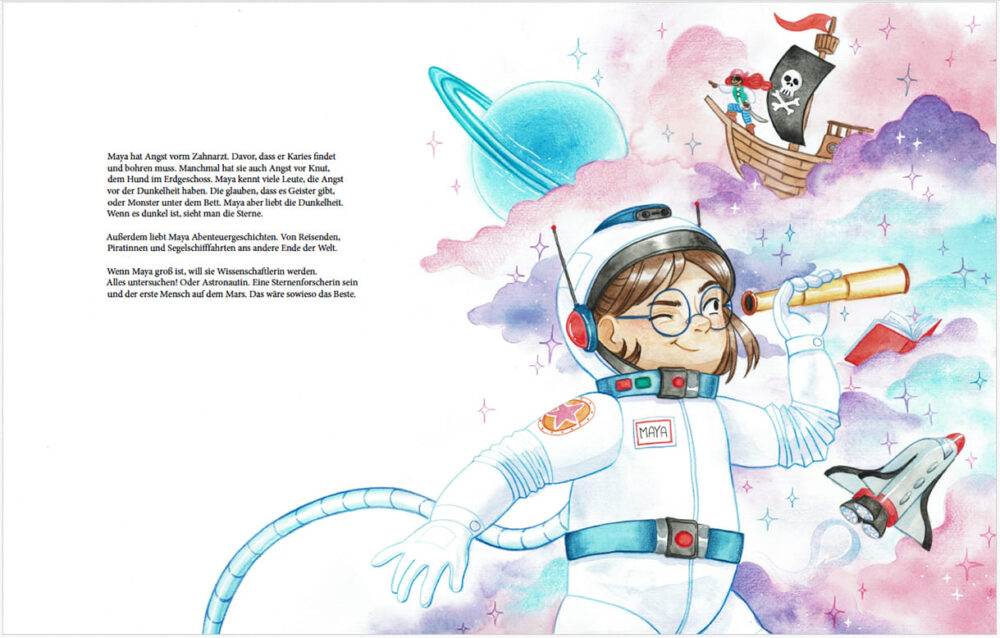
Adjustiert wie eine Raumfahrerin, nur das Visier des Helms geöffnet und ein Fernrohr ans Auge gehalten – so steht Titelheldin Maya im Bilderbuch von „Helle Sterne, dunkle Nacht“ auf der ersten Doppelseite im Zentrum des Geschehens. Während unter ihrem Arm eine Rakete vorbeihuscht, schaukelt oben auf den Wolken ein Pirat:innen-Schiff.
Für Maya hat sich die Autorin Lisa-Viktoria Niederberger zwar alle möglichen Ängste ausgedacht, aber eine sicher nicht: die vor dunkler Nacht. Nein, das Mädchen liebt das Dunkel, denn da kann sie gut Sterne beobachten – das will sie auch zu ihrem späteren Job machen. Sternforscherin, oder Astronautin und der erste Mensch auf dem Mars – das wäre ihr Traum.
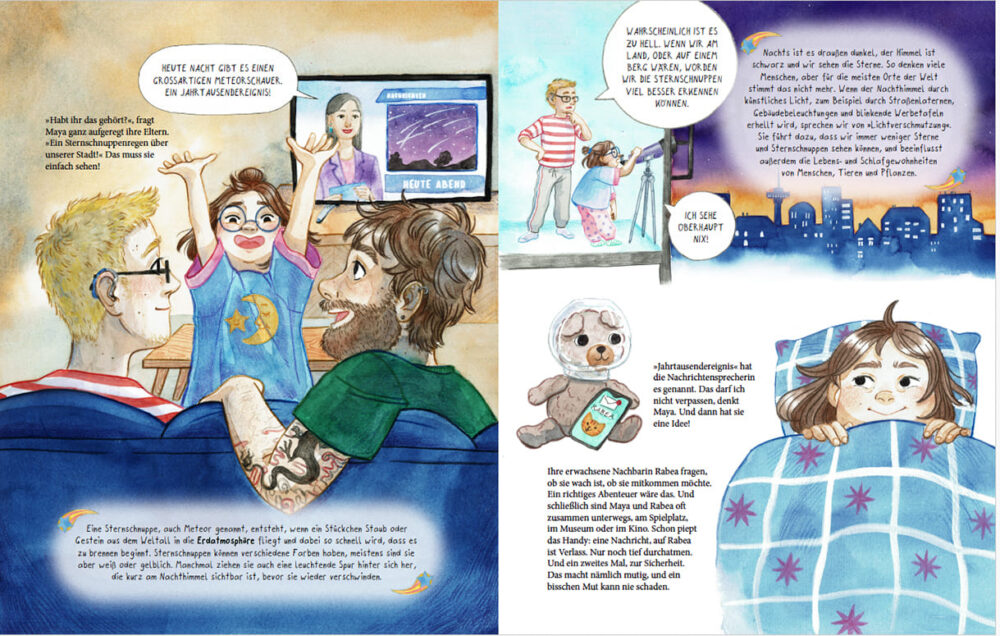
Aber erst einmal geht’s ums Beobachten von Sternen. Und da rückt die Autorin ein Problem ins Zentrum des Geschehens: Die „Lichtverschmutzung“. Zu viele künstliche Lichter erschweren das Sternderlschauen. Deswegen wandert Maya mit ihrer Nachbarin Rabea, einer Ärztin, eines Nachts an den Rand der Stadt, wo weniger beleuchtet wird. Dort können sie viel mehr Sterne beobachten.
Die „Lichtverschmutzung“ ist aber nur so nebenbei ein Hindernis für Mayas Hobby, viel mehr stört sie den Lebensbereich so mancher Tiere – ob das nun Fledermäuse oder Nachtfalter sind. Das bettet die Autorin in die Geschichte ein – und wo nötig, schiebt sie eigens gekennzeichnete Erklär-Texte ein. Unter anderem erfährst du, dass Sternschnuppen nichts anderes sind, als Stein- und Staubteilchen, die mit so großer Geschwindigkeit auf die Erde zurasen, dass sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre zu glühen beginnen.
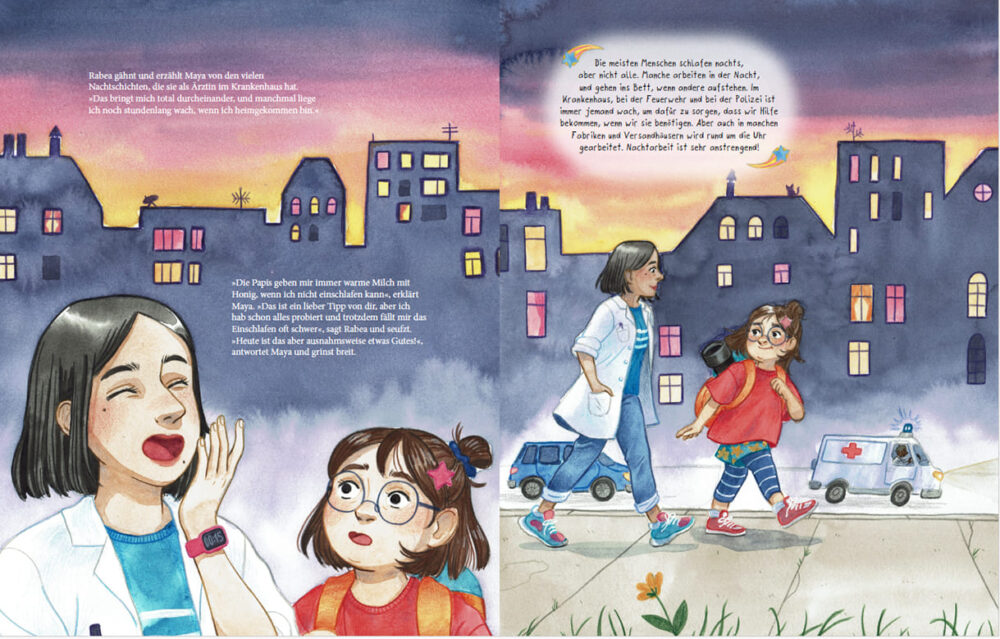
Den schon genannten Fledermäusen und ihrer Orientierung über den von Hindernissen zurückgeworfenen Schall, sozusagen das Echo, widmet sie gar eine Doppelseite. Letzteren, aber auch allen anderen Wesen – ob einem alten Baum oder Nachtfaltern zaubert Illustratorin Anna Horak Lächeln oder andere Gefühlsausdrücke in die Gesichter.
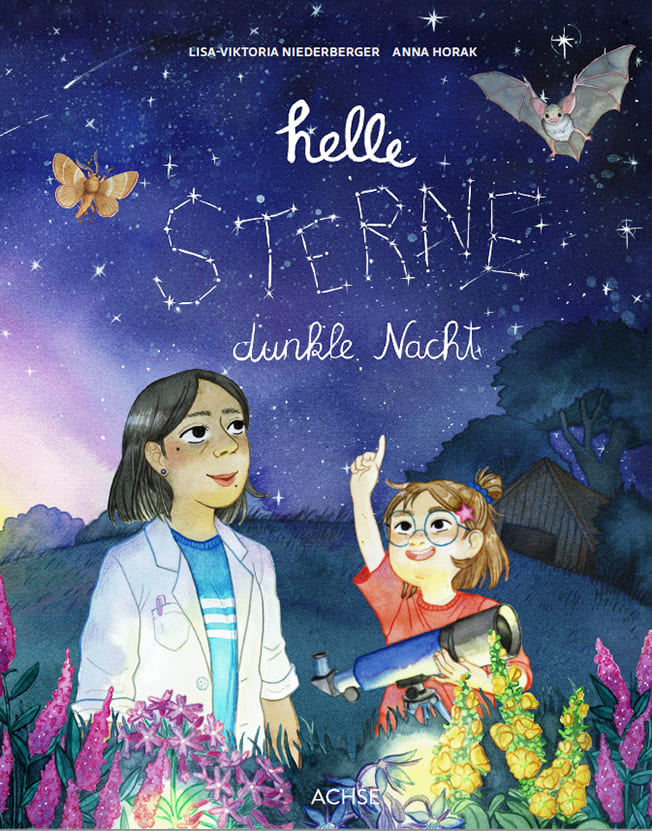
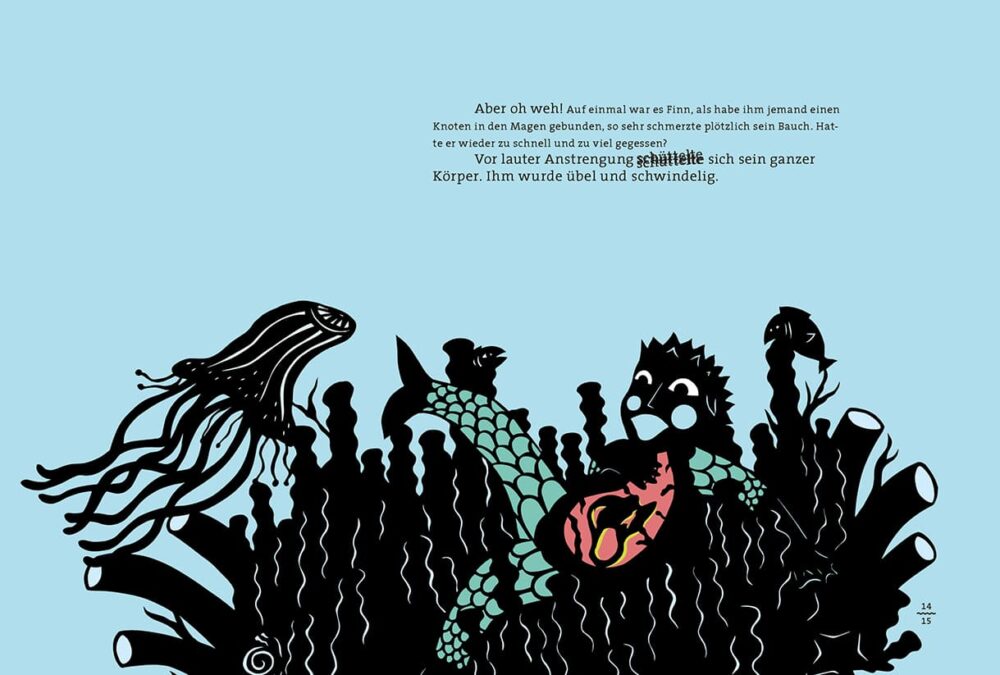
Finn hat zwei Beine und unten dran Flossen, dort wo Menschen Füße haben. Deswegen wollen manche Unterwasser-Kinder nicht mit ihm spielen, andere würden wollen, aber Eltern verbieten es ihnen. Denn Zweibeiner sind gefährlich, böse und mit denen sicher nicht…
Dieser Finn ist das Kind der ganz besonders mutigen Meerjungfrau Ora und einem Menschen-Mann. Diesen hatte Ora einst gerettet. Und das, obwohl Regel Nummer 2 das Verbot ist, sich Zweibeinern zu nähern.
Dieser Finn Flosse ist die Hauptfigur des Bilderbuchs von Eva Plaputta, das schon vor ein paar Jahren erschienen ist. Nun aber wird unter dem selben Titel „Finn Flosse räumt das Meer auf“ im Wiener Figurentheater Lilarum ein Stück gespielt, das auf dem Buch aufbaut – Stückbesprechung am Ende dieses Beitrages verlinkt.
Eines Tages wird Finn beim Verspeisen seiner geliebten Schlammgurken – denn Fische und andere Meerestiere isst er nicht, wer mag schon Freund:innen verschlingen – ziemlich schlecht. Was er da noch nicht weiß: Er hat offenbar auch Plastikzeugs mitverschluckt. Die Qualle holt das mit einem ihrer Fangarme aus seinem Magen heraus. Und bald checkt Finn, so manche Fische leiden auch an Bauchweh, ein Hering ist in einem Netz gefangen und überall kugelt (Plastik-)Müll herum. Die Zweibeiner sind daran schuld.
Finn versammelt – tatkräftig und lautstark unterstützt von Wal Theo – möglichst viele Meeresbwohner:innen um sich. Sie knüpfen ein Riesennetz aus Algen, sammeln den Mist ein und verfrachten ihn an einen der Strände der Menschen.
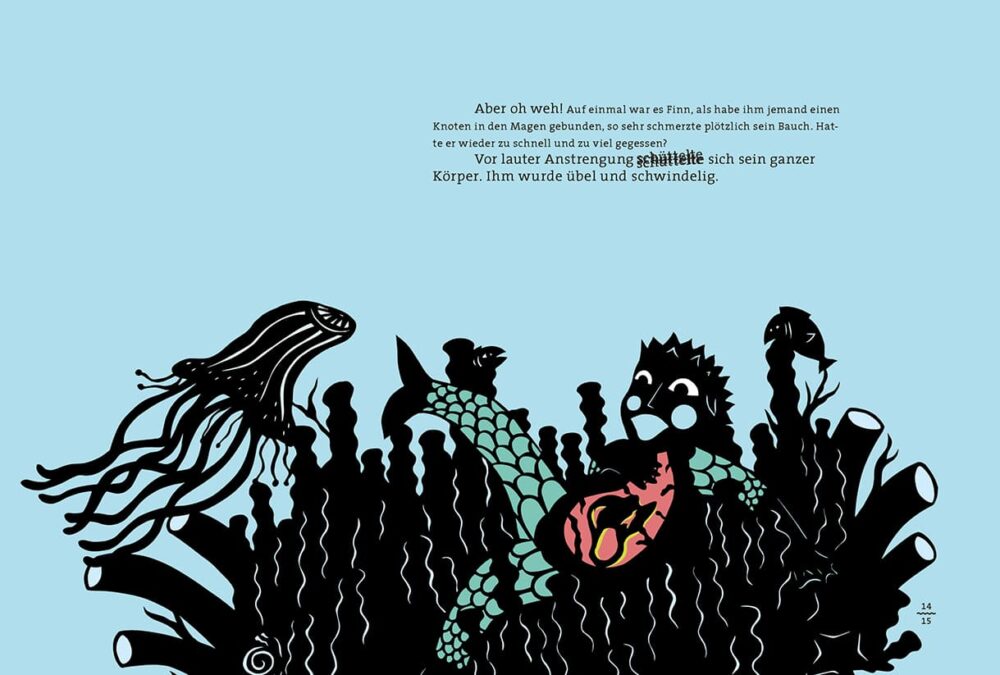
Plaputta hat sich aber nicht nur die Geschichte ausgedacht und geschrieben, sie hat aus schwarzem Papier alle Fische, den Wal, Krebse, Schildkröte, Netze, Korallen auch den Müll, ja sogar Blubberblasen ausgeschnitten. Gerade bei kleinwunzigen Details muss das unheimlich genaue und viel Arbeit gewesen sein.
Diese Scherenschnitte wurden dann vor unterschiedlich gefärbten Hintergründen platziert – Buchgestaltung Claudia Eder – und ergeben so teils magische Unterwasserwelten. Die Gestalterin dieses wunderbaren Bilderbuchs, das Studierende der Wiener Uni für Angewandte Kunst so fasziniert hat, dass sie daraus – mit dem Lilarum – ein Figurentheaterstück machen wollten, hat obendrein auf vielen der Seiten teilweise mit Schriften gespielt. So ist das Wort „riesengroß“ eben viel breiter als der Text davor und danach und so hoch wie gut vier bis fünf Zeilen. Wenn irgendwo „bunt“ steht, hat jeder Buchstabe eine andere Farbe. Der Strudel aus Plastikmüll, den Finn den anderen zeigen will, endet in einem spiralförmig geschriebenem Satz – um nur ein paar Beispiele der verspielten Schriften zu nennen.
Wenn alle gemeinsam den (Plastik-)Müll den Menschen zurückbringen, dürfen sie sogar Regel Nummer 1 brechen, das Verbot an die Meeresoberfläche zu schwimmen. Was für Wale ja offensichtlich auch schon vorher so gewesen sein muss.
Ja, und nun dürfen auch alle Meereskinder mit Finn spielen, ist er doch zum heldenhaften Retter – und Titelhelden des Bilderbuchs – geworden.
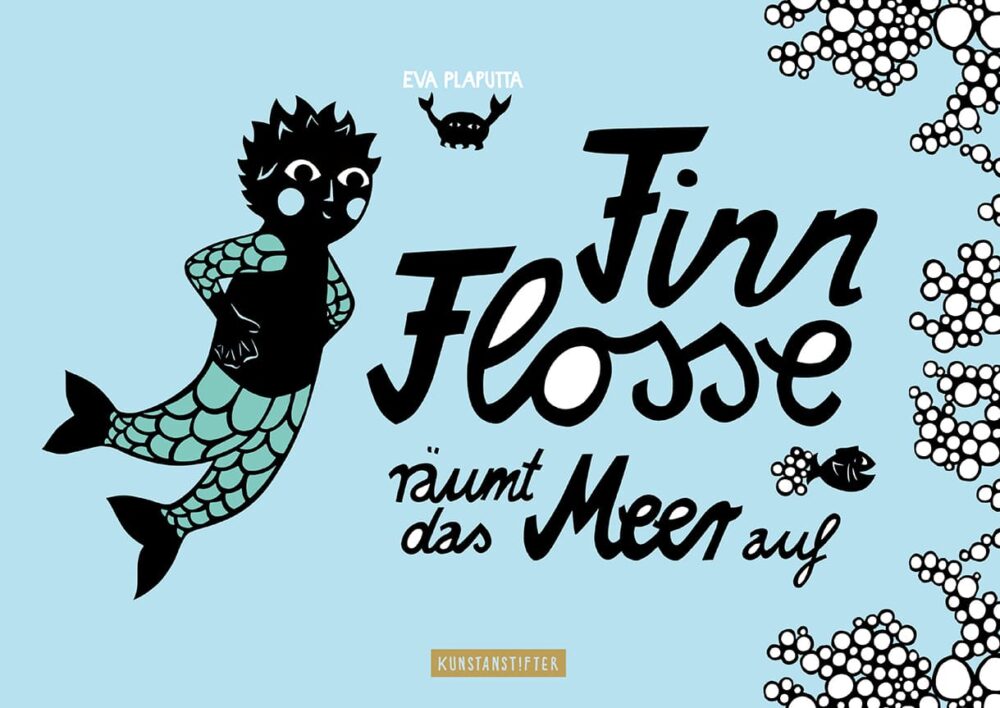

Wasser schillert zu Beginn spiegelnd im Bühnenhintergrund. Die Projektion lässt zugleich Bilder von Öl auf Wasser im Kopf entstehen. Dieser Visual-Effekt ist vielleicht nicht zufällig. Dreht sich doch das aktuelle Stück im Figurentheater Lilarum (Wien) – in Zusammenarbeit mit Studierenden der Uni für Angewandte Kunst – um Verschmutzung der Meere sowie den Kampf dagegen. „Finn Flosse räumt das Meer auf“ baut auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Eva Plaputta auf – Buchbesprechung unten am Ende des Beitrages verlinkt.
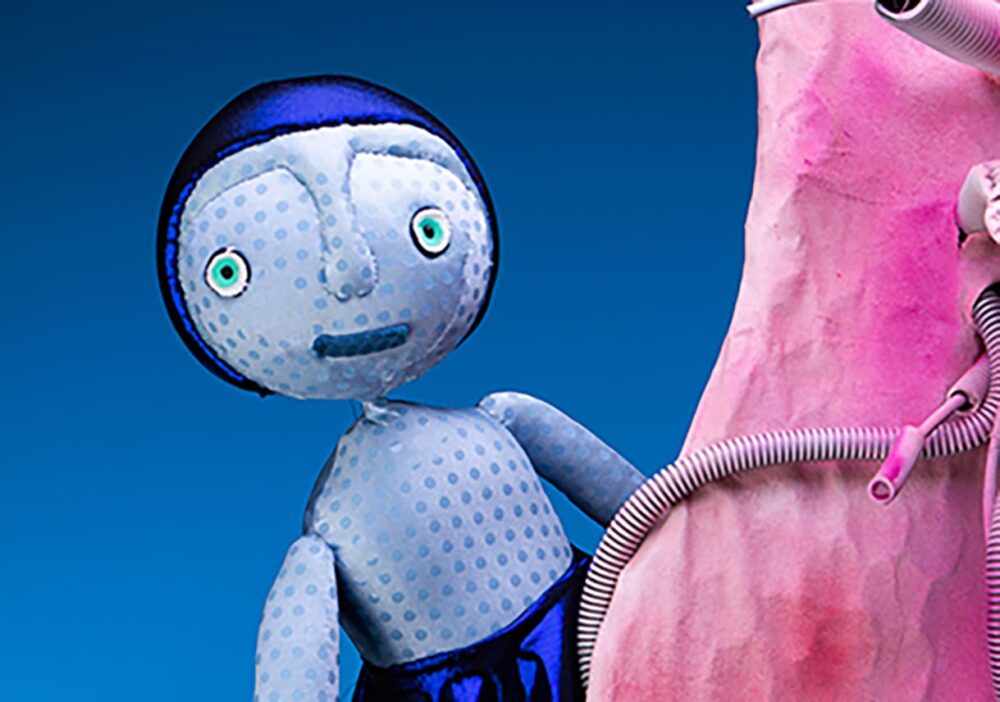
Zunächst kürzest die Story: Finn Flosse ist das Kind der tollkühnen Meerjungfrau Ora und eines Menschen, den sie gerettet hatte. Er, also Finn, der anstatt zwei Beinen zwei Flossen hat, kommt drauf, weshalb ihm beim Verzehr von Schlammgurken schlecht geworden ist und auch viele Fische Bauchweh haben. Es ist das Plastik, das sie mit der Nahrung verschlucken. Das Meer ist ziemlich voll von Abfällen der Zweibeiner. Sie knüpfen ein dichtes Netz aus Algen und bringen den Mist zurück an den Strand der Menschen.
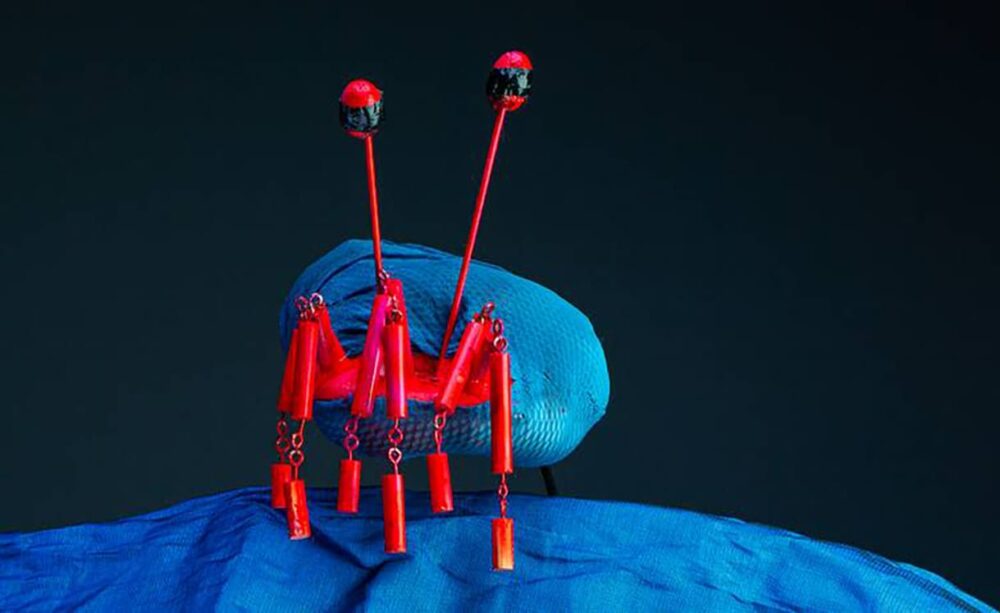
Nun schwebt also dieser Finn zwischen Korallen und Felsen in der Unterwasserwelt, lässt sich beispielsweise auf einer überdimensionalen Seegurke nieder, um die über ihm schwebenden Schlammgurken fast wie märchenhafte gebratene Tauben in den Mund fliegen. Darunter eben offenbar auch ein Stück Plastik. Von diesem befreit ihn eine zauberhafte Qualle mit einer Art knappen, comic-haften Kunstsprache.
Fantasievoll Finns Traum-Szene in der sich von einem großen Plastik-Monster verschluckt sieht. Vorne liegt die Figur am Bühnenrand, im Hintergrund schwebt sie durch den Schlund des Monsters – als Schattenbild, drum herum animierte Mikroplastikteile.

Monströs, aber von seinem Blick her schon freundschaftlich lugt der Kopf von Wal Theo, dem größten Helfer Finns, vom Bühnenrand ins Gesehehen. Witziger Effekt, wenn der Wal zu schwimmen beginnt, bewegen sich Scheibenwischer über seine Augen – was allerdings wiederum an einen Autobus erinnert.
Wenn Finn mit dem Wal durchs Meer schwimmt und sich weiter nach hinten in der Bühne begibt, sind beide kleiner, der Wal ganz sichtbar. Weshalb er dann allerdings eher wie ein zusammengekauerter wuchtiger Mensch aussieht – mit angewinkelten Beinen anstelle der Schwanzflosse? Aber das ist auch schon der einzige Kritikpunkt.

Dem Stück gelingt es neben der Erzählung der Geschichte vor allem immer wieder magische Bilder über die Figuren im Zusammenspiel mit Animationen und vor allem den Lichtstimmungen zu erzeugen, die zu Ausrufen des Staunens bei den vielen Kindern im Saal führen. Glich nach der kurzen Umbaupause – hinter geschlossenem Vorhang – wird’s in der dunklen Tiefsee bei den Anglerfischen sogar ein wenig gruselig.
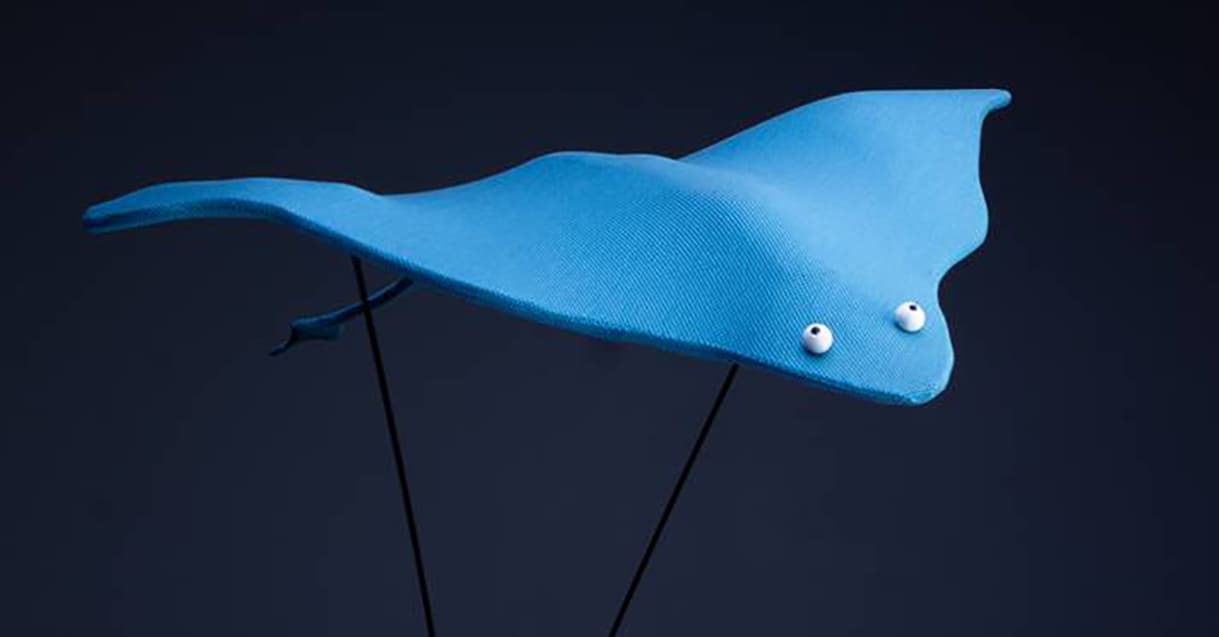
Studierende der Uni für Angewandte Kunst wollten aus diesem Bilderbuch ein Figurentheaterstück – mit Videoanimationen – machen und haben dies gemeinsam mit dem Lilarum entwickelt. Von den Profis lernten sie das Handwerkszeug und manche der Figuren wurden aus Zeitmangel des Uni-Projekts dann doch von den Theaterleuten produziert.

Das Figurentheater Lilarum ist übrigens Teil eines EU geförderten Erasmus-Projekts mit Künstler:innen und Universitäten mehrerer europäischer Länder: „IPMAU (Interdisciplinary Puppetry Modules for Art Univiersities) mit Interplay Hungary /Hungarian University of Fine Arts Budapest, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Kroatien) sowie der Akademie der bildenden Künste Wien.
In der ersten Projektphase entstehen drei Lehrveranstaltungen für Studierende aus bildnerischen und angewandten Richtungen – geleitet von Uni-Lehrenden und Figurentheaterschaffenden. Die dabei entstehenden Lehrveranstaltungen können von Kunstuniversitäten weltweit in bestehende Lehrpläne eingebaut werden.
Die Projektinhalte werden ebenso wie die beteiligten Studierenden und ihre Arbeiten in öffentlichen, internationalen Präsentationen sowie medial präsentiert. Eine Tagung in Wien, in der die Ergebnisse und Zukunftsperspektiven von IPMAU präsentiert werden, bildet den Abschluss – geplant im ersten Quartal 2026.
Seit 2019 lädt das Wiener Figurentheater Lilarum immer wieder Gruppen aus mittel- und osteuropäischen Ländern (CEE Central and East-Europe) zu Gastspielen in der jeweiligen dominierenden Landessprache ein. In erster Linie spricht dieses Kindertheater in Wien-Landstraße (3. Bezirk) damit zwei- bzw. mehrsprachigen Familien mit Herkünften oder Verwandten in diesen Ländern an. Die Kinder können so auch – sonst eher selten – Theater in ihrer jeweiligen Erst- oder Familiensprache erleben.
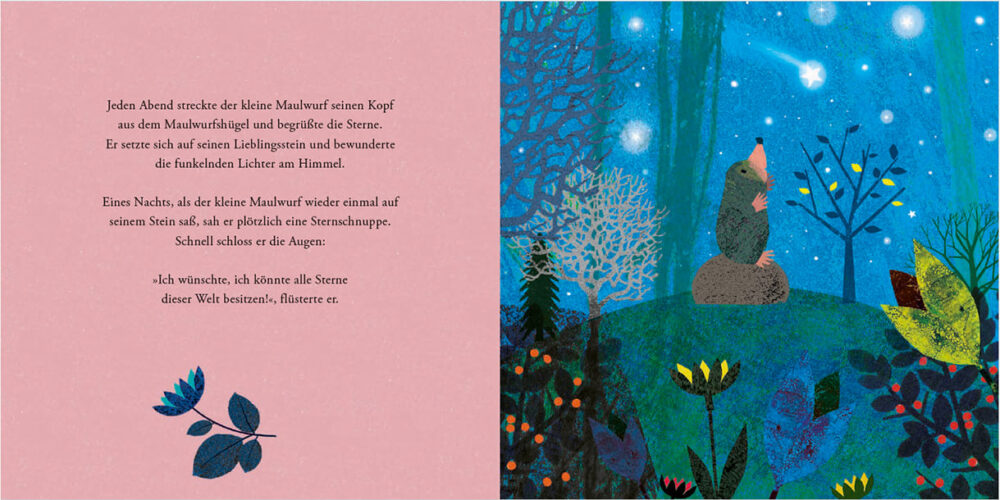
Ach wie fasziniert ist der Maulwurf als er nächtens in seinem Bau nach oben krabbelt, aus seinem Hügel lugt und trotz seiner Sehschwäche den wundervollen Sternenhimmel wahrnimmt. Wie wahrscheinlich fast alle (auch oder nur?) Menschen. Seinen größter Wunsch als er eine Sternschnuppe sieht – …
… ja den verrät die Autorin und Illustratorin Britta Teckentrup (Übersetzung aus dem englischen Original: Verlag ars edition). Und obwohl verratene Sternschnuppenwünsche ja dann angeblich nicht in Erfüllung gehen, …
Doch manches Mal werden erfüllte Wünsche zum Verhängnis. Zumindest in parabelhaften Geschichten über unermessliche Wünsche! So auch hier in diesem Bilderbuch – das ab Anfang April (ab 5.) übrigens im Linzer „Theater des Kindes“ als Stück zu erleben ist – Stückbesprechung folgt.
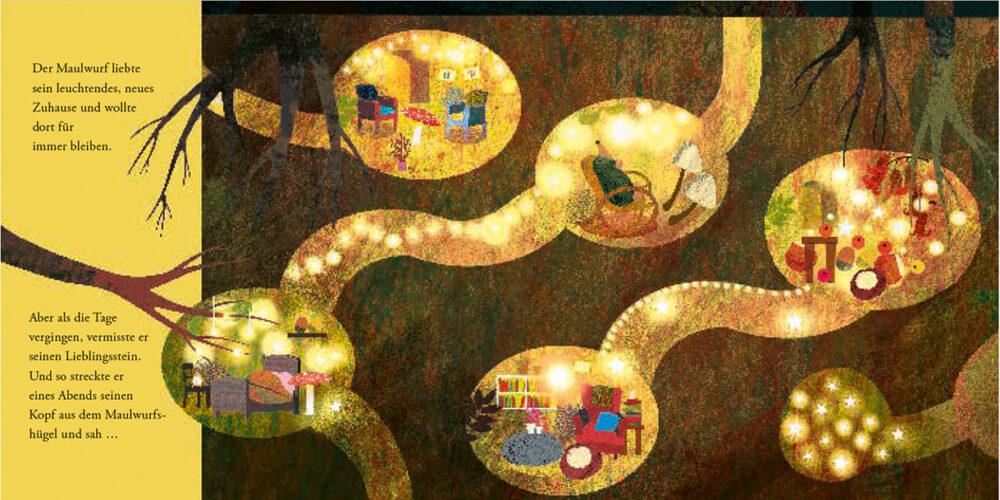
Also, der Maulwurf will alle Sterne besitzen, in der folgenden Nacht sieht er lauter Leitern zum Himmel, klettert rauf und fängt sie alle ein, verfrachtet sie in seinen Bau, der goldglänzend erstrahlt.
Dafür ist eines Nachts, als er wieder seinen Kopf aus dem Hügel streckt – alles grau in grau – auf dieser Doppelseite fast nichts zu sehen, nur ganz zarte schemenhafte Schatten dessen, was einst da als Wald und Wiesen stand. Alle Tiere verzweifelt, weil sie keine Orientierung mehr in der Finsternis hatten…

Natürlich hat auch dieses, wie die allerallerallermeisten Kinderbücher ein Happy End und der Maulwurf erkennt den Fehler seiner Besitzgier…
Etwas das viele Menschen offenbar nicht schaffen. Und trotz der lehrhaften Absicht der Autorin und Illustratorin ist es auch ein wunderbares Bilderbuch mit Zeichnungen in einer Art naivem Stil.
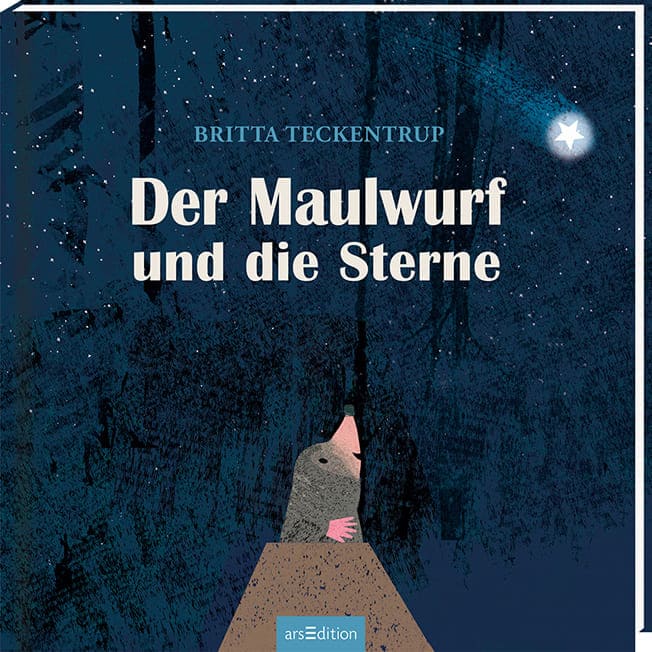

Sieben – Zwerge, Berge, Geißlein… Tage – also eine Woche. Und was für eine. Die am Beginn der Schöpfung, also eigentlich der von Menschen ausgedachten Geschichte – nach der christlichen Religion; die diese wiederum aus dem Judentum übernommen hat.
Linda Wolfsgruber, die vielfach preisgekrönte Illustratorin, die immer wieder nicht nur andere Texte bebildert, sondern eigene Bücher erfindet, hat zu dieser Schöpfungsgeschichte das Buch „sieben – die schöpfung“ geschaffen. Sieben mal sieben Doppelseiten. Vom eher dunkel gehaltenen Chaos bis zur hellen Vielfalt von Pflanzen, Tieren und Menschen.

Die Collagen sowie Monotypien und in Kratztechnik (wie sie viele aus der Schule mit Wachsmalstiften kennen) und die in späteren Phasen im Stil an Höhlenmalereien erinnern, illustrieren die Evolution. Daneben stehen am Rand Sätze für die sich die Autorin und Illustratorin in Personalunion aus Bibel-Übersetzungen (1980 und 2016) inspirieren hat lassen.
Als Menschen noch nicht wussten, wie sich das Universum, die Erde und das Leben auf ihr wirklich entwickelt haben, dachten sie sich Geschichten aus, wie das gewesen sein hätte könnte. In verschiedensten Gegenden und Kulturen die unterschiedlichsten Mythen, Legenden und Religionen. Wobei interessanterweise sieben in vielen eine große Rolle spielt. Oft wird sie auch als Glückszahl angegeben; andere wiederum (etwa in Ostasien) halten sie für eine Unglückszahl.
Ein Erklärungsversuch wird oft – auch auf der wikipedia-Seite zu dieser Zahl – mit der Zahl der mit freiem Auge sichtbaren großen Himmelskörper angegeben: Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn.

Ein andere könnten die sieben Öffnungen in unserem Gesicht sein, mit denen wir die Welt um uns wahrnehmen: Zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher und ein Mund.
Selbst wer nicht daran glaubt (wie der Schreiber dieser Zeilen), dass ein höheres Wesen – wobei Wolfsgruber auf eine Bibelübersetzung zurückgreift, die „Gott“ geschlechtsneutral schreibt – in sechs Arbeitstagen Erde und Weltall „geschöpft“ hat und den siebenten Tag zum Ruhen verwendete, kann sich an den detailverliebten großflächigen Bildern erfreuen – und sich den wichtigen Grundsatz zu Herzen nehmen, den Wolfsgruber an den Beginn stellt: „… weil sie uns anvertraut ist“. Und das steht in der sonnenhellen Doppelseite vor dem düster-dunklen Tag 1.
Bei sieben mal sieben drängt sich die seit Generationen bekannte Scherzfrage mit der entsprechenden Antwort auf, was das ergibt: „feinen Sand!“
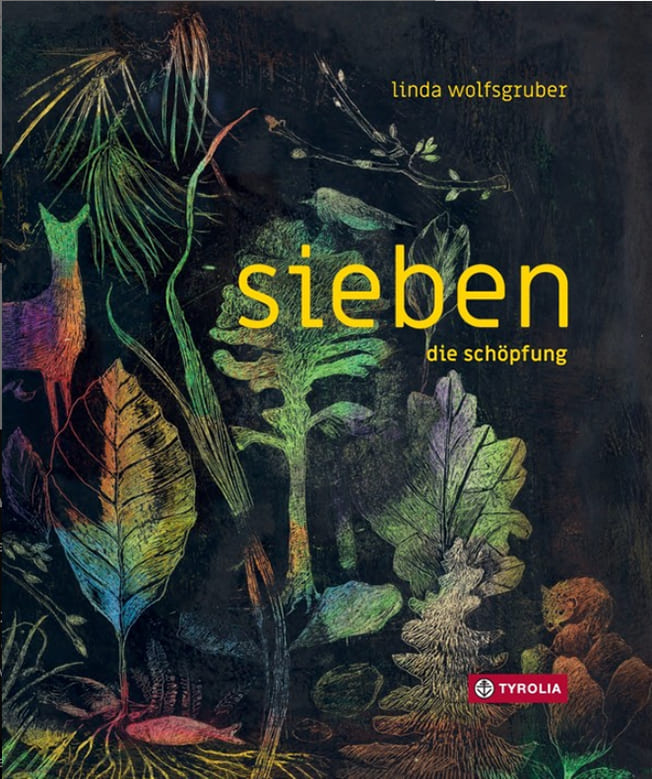
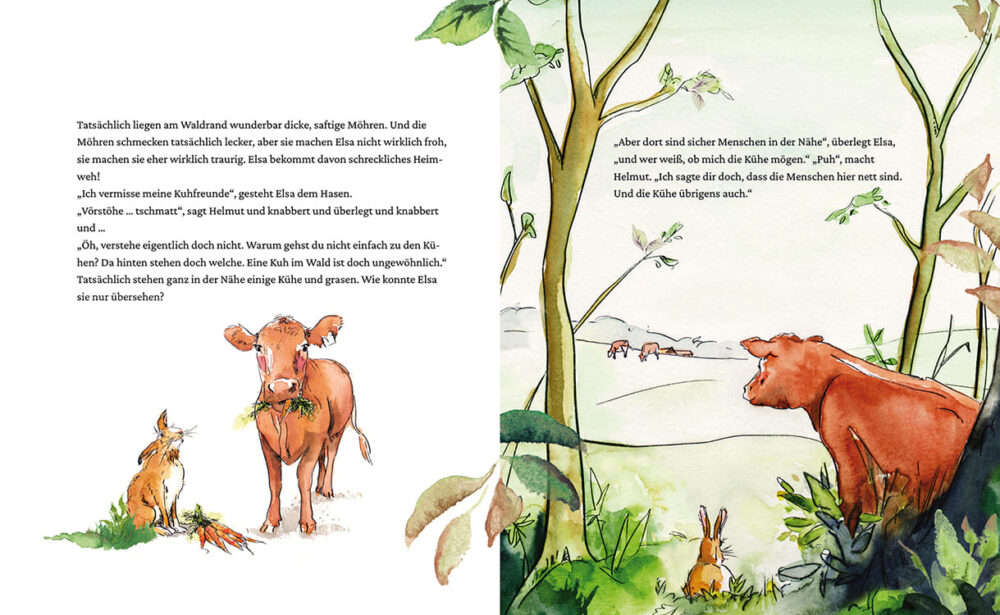
Schon zwei Jahre bevor 2018 (Februar) die Nachricht von einer rothaarigen Kuh (Rasse Limousin), die in Polen nahe der tschechischen Grenze beim Transport zum Schlachthof abhaute und es damit in viele (inter-)nationale Medien schaffte, gelang einer anderen Kuh ähnliches in Deutschland (2016). Die Geschichte der polnischen Kuh hatte Paloma Schreiber zum teils fiktiven Bilderbuch „Mulya die Kuh“ veranlasst (erschienen im Achse Verlag; Link zur Buchbesprechung im Februar 2021 noch im Kinder-KURIER unten am Ende dieses Beitrages).
Die deutsche Kuh namens Elsa landete nach ihrer Flucht zunächst in einem Wald und später auf dem Gnadenschutzhof Sol Luna, da es dort aber keine Rinder gab, wurde sie von dort in den „Begegnungs- und Gnadenhof Dorf Sentana“ (Bielefeld) gebracht. Und wie viele andere Tieren, die hier ihr letzten Zuhause fanden und finden, wurde sie zum Star eines eigenen Bilderbuches. Mit Ausnahme des Giraffen-Buches – Besprechung unten am Ende verlinkt – leb(t)en die anderen alle wirklich auf dieser tierischen „Senior:innen“- oder Rettungs-Residenz.
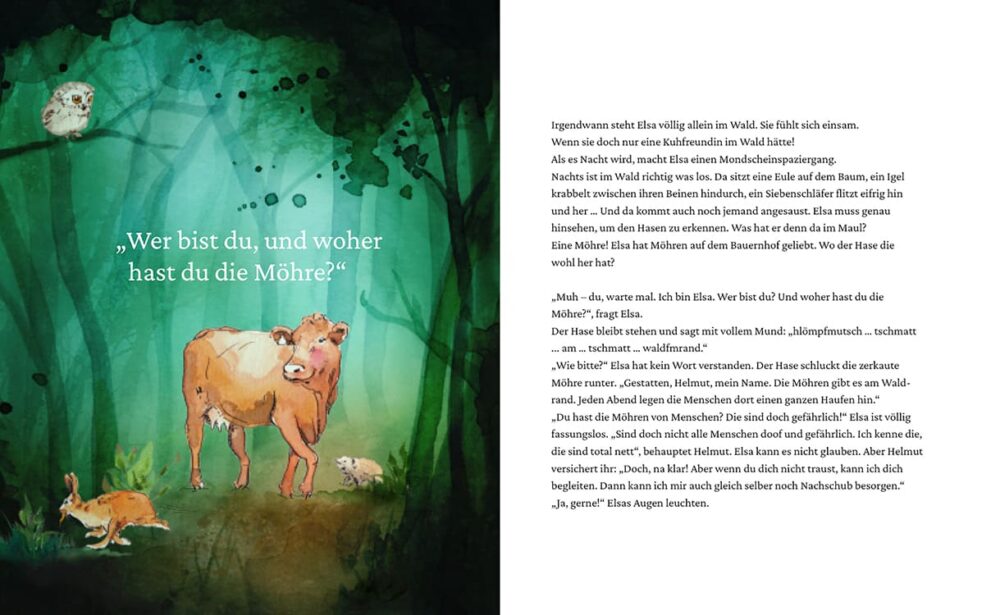
Natürlich fiel/fällt den jeweiligen Autor:innen und Illustrator:innen auch so manch Ausgedachtes zur Vorgeschichte ein. „Elsa büxt aus – Eine ziemlich wahre Geschichte“ hatte ja nur die verbürgten Fixpunkte: Ausgerissen vor dem Schlachthof, irgendwo im nahegelegenen Wald Unterschlupf gefunden und schließlich die beiden Gnadenhöfe.
Christiane Wittenburg (Text) und Linda Mieleck (Zeichnungen) ließen sich verschiedenen Begegnungen mit Waldbewohner:innen einfallen, die sie auch personalisierten – Eichhörnchen Mümmel, Fuchs Friederich, Wildschwein Buddel, Hirschkuh Bernadett, Dachsfamilie Berry, Bailey, Beny, Bobby und Betsy, Hase Helmut… Wie diese auf die Fremde, die „Waldkuh“ reagieren und ihr aber dennoch helfen, zu überleben, das schildern die beiden Künstlerinnen in wortreichen Geschichten und dazu passenden Zeichnungen. Und letztlich auch den Weg ins Dorf Sentana – auch Geburtsort des Verlages Calme Mara.
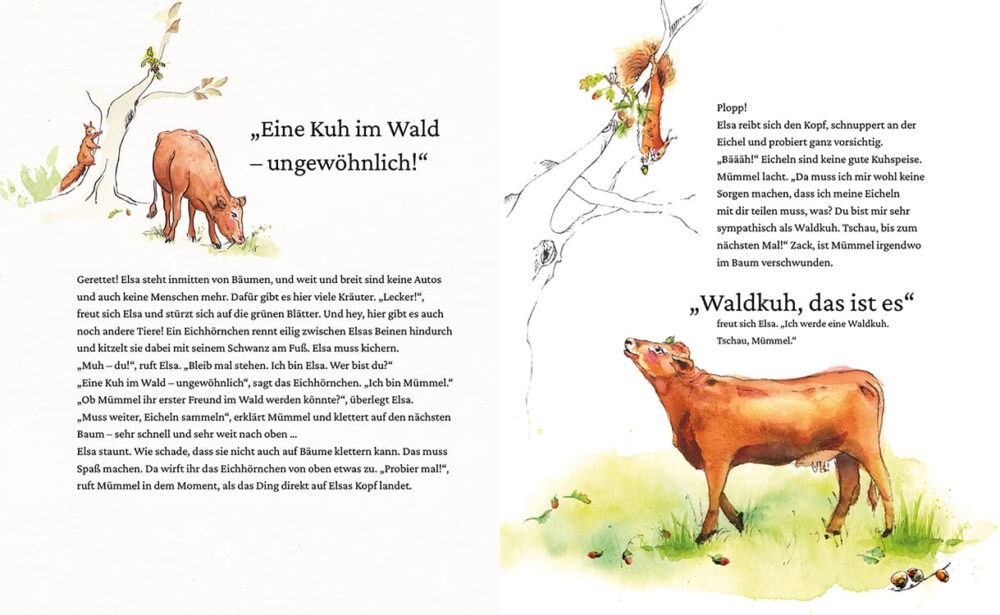
Auf die Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nach der Herkunft des Verlagsnamens, lüftete die Mediensprecherin das „Geheimnis“: „CalmeMara ist ein „geheimer“ Ort am Meer, den es tatsächlich gibt. Unser Verleger Ralph Anstoetz hat dort viele schöne (Vor)Lesestunden verbracht und ist dort auf die Idee gekommen, den Verlag zu gründen.“
Und wenn schon das Gnadendorf Tierleben schützt, so legt der Verlag – das steht in jedem der Bücher – Wert auf Tier- und Umweltschutz, stellt die Bücher möglichst regional (in Deutschland) her und vegan. „Vegan? Was ist an Büchern tierisch – außer mögliche Inhalte?“ – „Oft sind in Klebern tierische Produkte, wir achten darauf, dass weder im Leim, noch in den Druckfarben Tierisches drinnen ist“, lautete die Antwort auf die KiJuKU-Frage.
Buchbesprechung über Mulya die Kuh <- damals noch im Kinder-KURIER
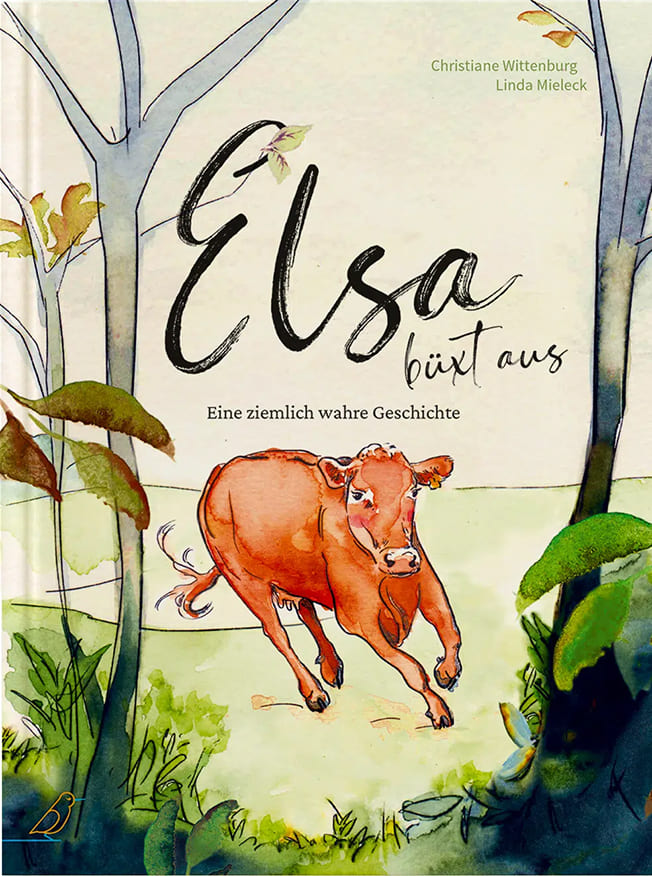
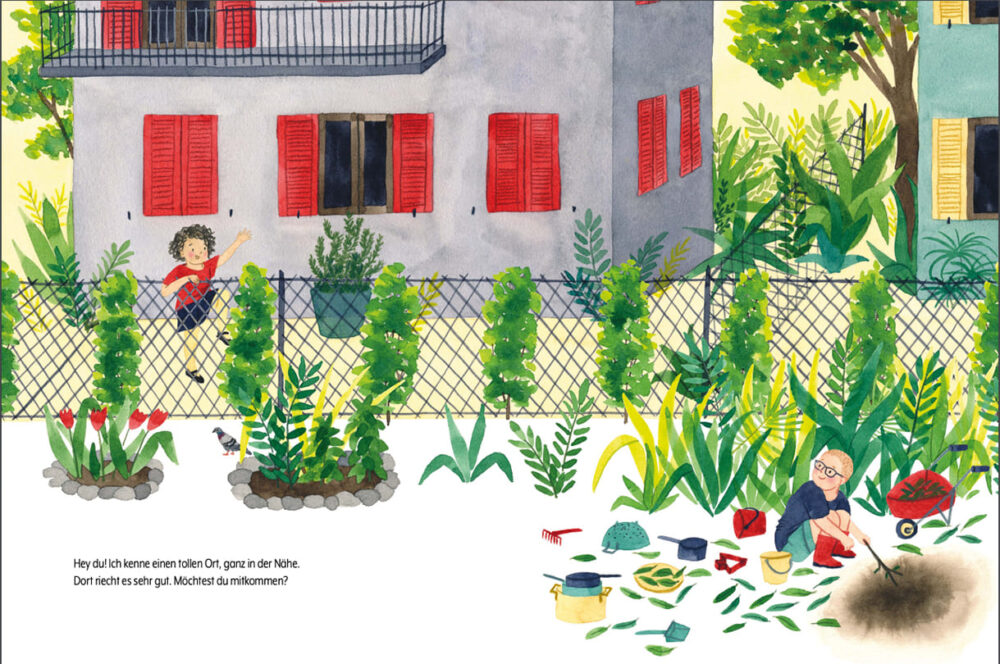
Ein Buch, das bei Büchern endet – zu dieser Reise lädt dich „Kommst du mit?“ ein. Ein Kind mit dunkelhaarigem Wuschelkopf stellt diese Frage auf der ersten Doppelseite an eines mit hellen kurzen Haaren, das gerade im Garten buddelt. Ersteres verspricht einen Ausflug zu einem „tollen Ort, ganz in der Nähe. Dort reicht es sehr gut“.
Doch es ist nicht die Bäckerei, auch nicht die Schule, der Park und so weiter – wo sie Doppelseite für Doppelseite hinkommen – mit immer mehr Kindern in der Wandergruppe. Von Station zu Station werden alle erst neugieriger, raten und schön langsam doch enttäuscht. Irgendwann sind einige sogar ziemlich verärgert, fühlen sich angelogen, auf den Arm genommen…
Natürlich kann das Bilderbuch – geschrieben von Cristina Petit (Übersetzung aus dem Italienischen: Anne Brauner) und gezeichnet von Chiara Ficarelli so nicht enden, sie gelangen an das versprochene Ziel – mit anfangs einigen enttäuschten Gesichtern. Was sich dann doch legt. Der Ort sei hier aber sicher nicht gespoilert.
Verraten sei hingegen: Das Buch ist im Achse-Verlag in der Reihe „Creating neighbourhood“ (Nachbarschaft schaffen) erschienen. Übersetzungen von Kinderbüchern aus Österreichs Nachbarländern Italien, Slowenien, Slowakei und Ungarn werden darin von der EU finanziell unterstützt.
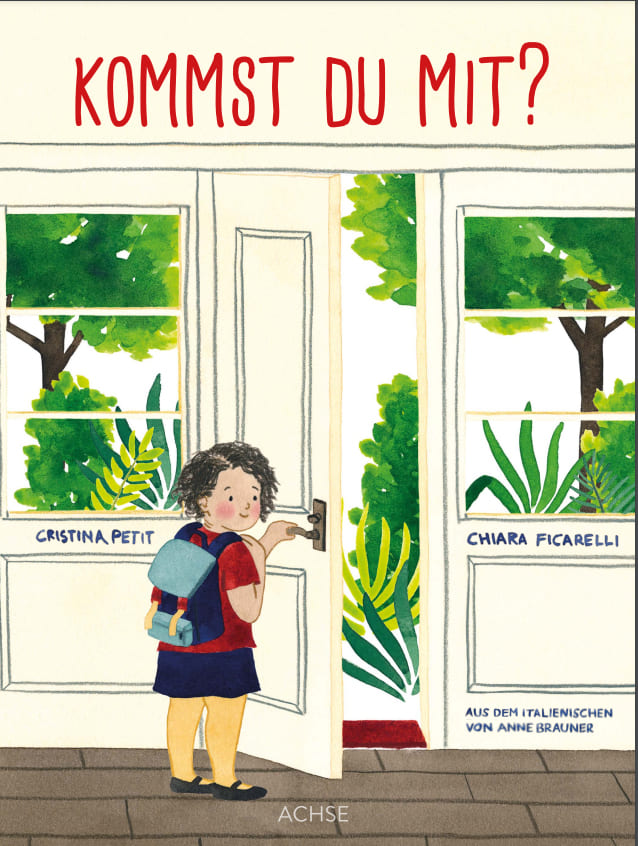
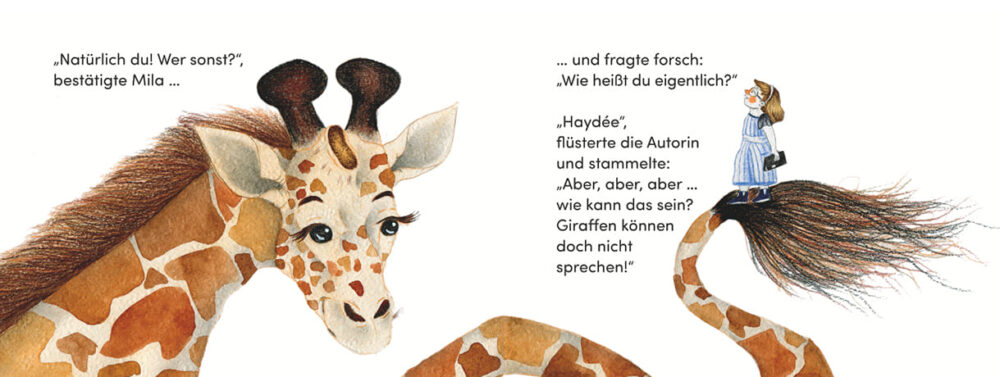
Schon das Format des Buches und sein Titel deuten die darin enthaltene Geschichte an: „Die Giraffe, die nicht in ihr Buch passte“ ist nicht in einem hoch-, sondern in einem querformatigen Bilderbuch erschienen. Nicht nur auf die Titelseite passen da zwei Beine – und der Kopf nur, weil die Giraffe ihren Hals offenbar nach unten gestreckt hat und zwischen den Haxen verkehrt herum rausschaut 😉
„Mila war eingequetscht. Sie passte nicht auf die Seiten ihres Buches“, lauten dann die ersten beiden Sätze. Doppelseite für Doppelseite hat Yohali Gutiérrez Estrada Teile des Körpers dieses großen Tieres namens Mila gemalt – mal ein Stückerl Hals, dann wieder Bauch, Schwanz usw. Mittendrin immer eine kleine menschliche Figur, die Autorin. Ihr will Mila eine Idee verklickern, wie sie doch ins Buch passen könnte.

Hähhh? Wie kann eine Giraffe sprechen? Lässt die Autorin Haydée Zayas Ramos (Übersetzung aus dem Spanischen: Jennifer Michalski) ihr kleines, gedrucktes Ebenbild fragen. Und gibt sich – in Person der Giraffe die logische Antwort: „Das hier ist ein Buch, und in einem Buch kann alles vorkommen. Nur ich nicht. Zumindest nicht ganz…“
Und dann erzählt die Giraffe die höchst logische Idee – die sei hier nicht verraten, du könntest ja vielleicht selber draufkommen 😉 Und wenn nicht, so soll dir das Buch doch noch Überraschendes bringen.
Möglicherweise ziehst du dann ja den Schluss, dass es auch bei Menschen so sein könnte, dass sie nicht in vorgegebene Formate passen, aber statt diese Menschen zurecht zu quetschen könnten eventuell ja Formate verändert bzw. angepasst werden 😉
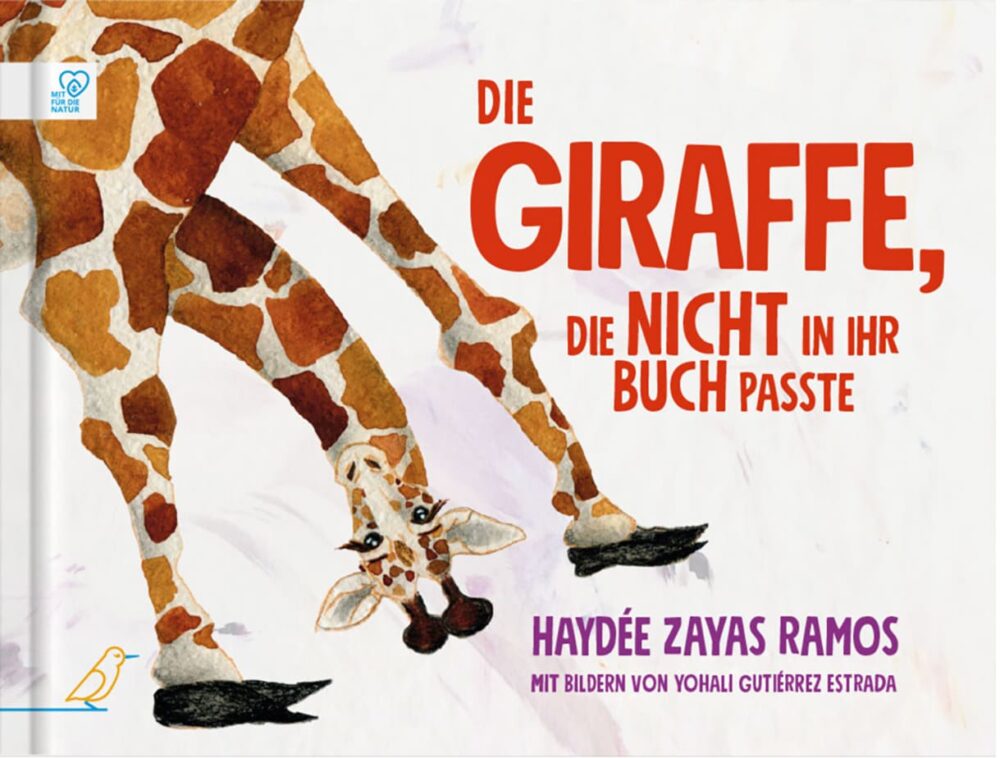
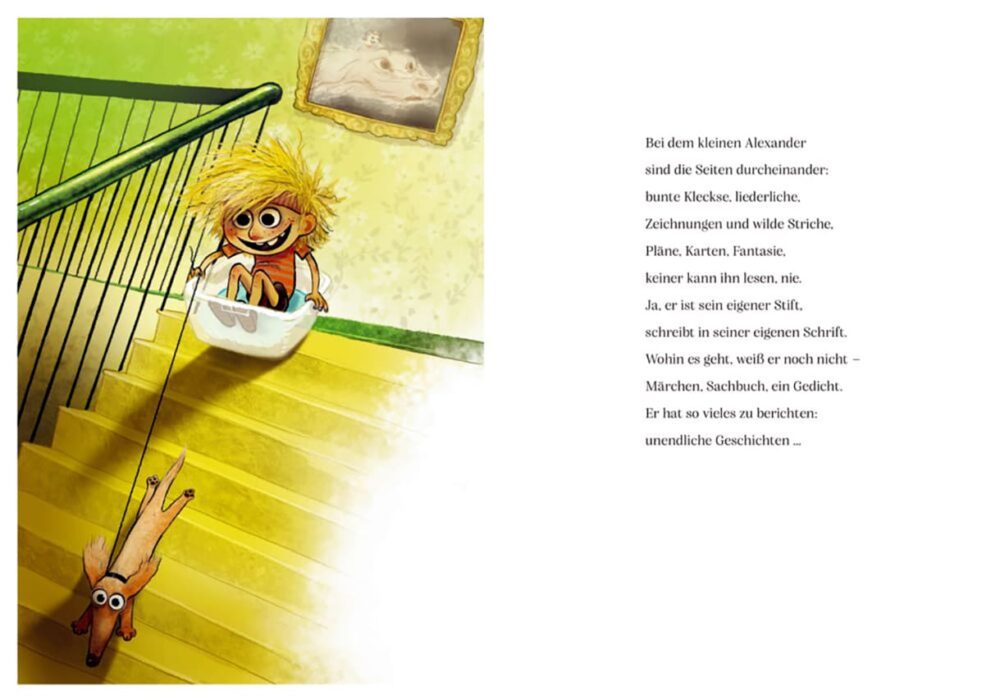
Ein Buch über ein Buch? Ja, gibt’s so manche. Die einen beschreiben, wie ein Buch entsteht, die anderen über die Bedeutung und Wichtigkeit von Büchern und manches mehr.
„Huch, ein Buch!“ beginnt hingegen damit, dass die Hauptfigur, ein Mann namens Hubert, eines Tages munter wurde und „war ein Buch“. Aber nicht so wie Gregor Samsa in Franz Kafkas „Die Verwandlung“, der „eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte“ und „sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt“ gefunden hat. Denn während Kafka seine Figur in dieser Erzählung tatsächlich als Käfer und noch dazu auf dem Rücken liegend und mit den Beinen in der Luft zappelnd wiederfand, belassen Kai Lüftner im Text und Wiebke Rauers in den dazupassenden Zeichnungen Hubert B. in Menschengestalt.
Der Untertitel dieses bebilderten gereimten Buches deutet schon an, worum’s wirklich geht: „Oder die anderen Seiten des Hubert B.“. Darum, dass – mit Hubert B. – Leser:innen viele Seiten an sich und anderen suchen, finden, entdecken (können). Und an ziemlich viel Vergnügen auf die verschiedensten Anspielungen des Autors draufzukommen. Und mit Hubert B., nicht nur sich selbst mehr zu erkennen, sondern auch in anderen Menschen zu „lesen“: „Bei dem kleinen Alexander / sind die Seiten durcheinander… er hat so vieles zu berichten / unendliche Geschichten“.
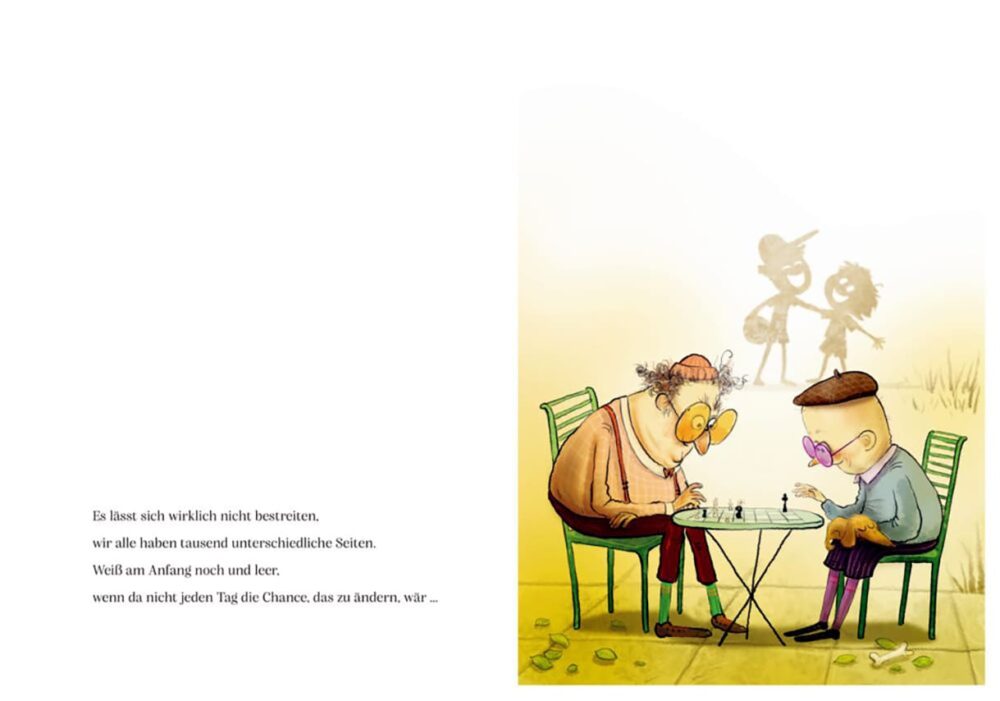
Die eine oder Anspielung auf Buch- oder Filmtitel richtet sich (eher) an Erwachsene wie „denn da sind zwischen Mann und Frau / 50 Schattierungen in Grau“ – mit aber durchaus eindeutig jugendfreien Zeichnungen!
So manche Lebensweisheit, die sich aus den Wort- und Gedankenspielen – im Wechselspiel mit den Illustrationen – ergibt, kommt hier ganz ohne Lehr-/Leer-Formel aus. So sind – unter anderem – Menschen genauso wie Bücher nicht unbedingt am Einband zu erkennen. Oder der Schlussreim auf der vorletzten Doppelseite: „Es lässt sich wirklich nicht bestreiten, / wir alle haben tausend unterschiedliche Seiten. / Weiß am Anfang noch und leer, / wenn da nicht jeden Tag die Chance, das zu ändern, wär… – und folgerichtig auf der nächsten Doppelseite Platz, was eigenes hineinzuschreiben für dein eigenes Buch, das rechts unten am Ende ein kleines Hündchen im Maul davonträgt 😉
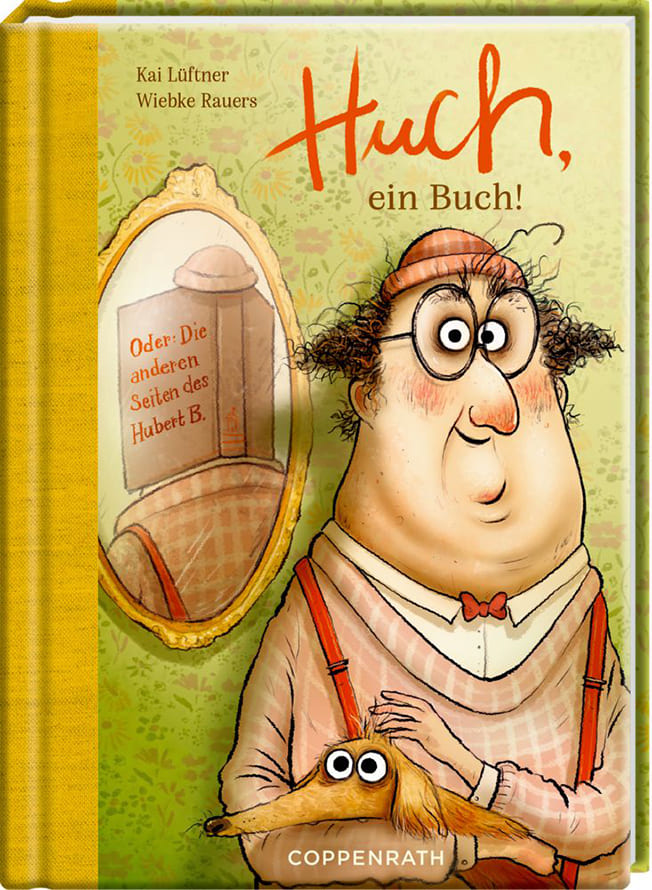
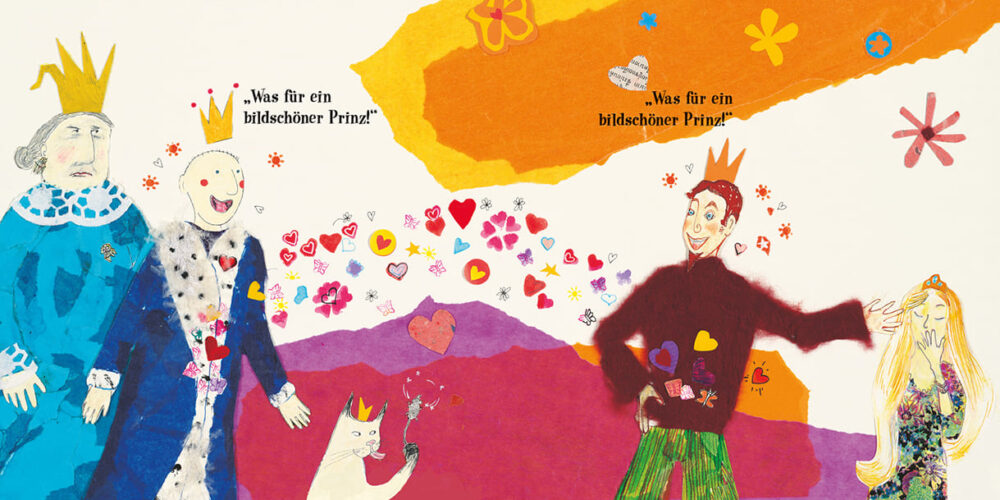
„Ich hab’s satt!“, poltert die alte kunstvoll gemalte aber nicht besonders sympathisch dreinschauende Königin. Sie will in Pension gehen, nicht mehr regieren, ihr Sohn soll übernehmen. Dafür aber, so die Noch-Königin, müsse der Prinz heiraten. „jeder Prinz in der ganzen Gegend ist verheiratet. Nur du nicht! Als ich so alt war wie du, war ich schon zweimal verheiratet!“, wirft sie dem Sohn an den Kopf.
Betretet lassen ihn die beiden niederländischen Künstlerinnen Linda de Haan und Stern Nijland an der langen Tafel dreinschauen, wenn die Mutter so dahinschimpft. Schließlich willigt er ein, klagt aber, gar keine Prinzessin zu kennen. Worauf die Mutter zum Telefon – einem alten Festnetzapparat – greift und „alle Prinzessinnen auf der ganzen Welt anrief“.
Gut, alle lassen die kunstvollen Illustratorinnen und Texterinnen nicht antanzen, aber einige – von Aria aus Österreich, die ein Lied vorsingt über Dolly aus dem US-Bundesstaat Texas, die jongliert, einer lustig-grünen aus Grönland – in die sich der Kammerdiener verliebt und so weiter. „Das Wahre war dies alles nicht“, lautet die Erkenntnis.
Doch, dann kam Prinzessin Liebegunde und ihr Bruder Prinz Herrlich. „und endlich begann das Herz des Prinzen wie wild zu pochen.“ Angesichts Letzterem.
Happy End. Hochzeit. Sogar die alte Königin war gerührt. Die nun angesichts von „König & König“ Zeit für sich selbst hatte 😉
Dieses Bilderbuch inspirierte so manche Theatergruppe zu einer Dramatisierung, als es vor mehr als 15 Jahren auf dem Spielplan im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier stand, gab es heftigste Attacken von rechter Seite und Boulevardmedien – noch bevor überhaupt jemand das Stück gesehen hatte. Linda de Haan und Stern Nijland schufen vor fast ¼ Jahrhundert „König & König“ im niederländischen Original gemeinsam – jede Seite gemeinsam gestaltet. Dieses Buch stand sicher auch so etwas wie Pate/Patin für so manche spätere Kinderbuchmacher:innen, nicht zuletzt jene von „Prinzessin Pompeline traut sich“, wo aber die Liebe zwischen Pompeline und Hedwig den Eltern zunächst einmal Probleme bereitet, während es im Vorbild schon viel offenere zugegangen ist. Link zur Besprechung dieses unten am Ende dieses Beitrages.
Mittlerweile musste das Buch – in der deutschsprachigen Version (Übersetzung ins Deutsche: Edmund Jacoby) – schon gut ein halbes Dutzend Mal nachgedruckt werden. Und da in dem Buch ja vielfältige Arten der Liebe vorkommen, ist es der KiJuKU-Buchtipp zum heutigen Valentinstag!
sohn-und-vater-rock-en-gegen-rollenklischees <- noch im Kinder-KURIER
Interview mit Nils Pickert <- noch im KiKu
Über Martin Auers Prinzessin mit Bart <- auch nch im KiKu
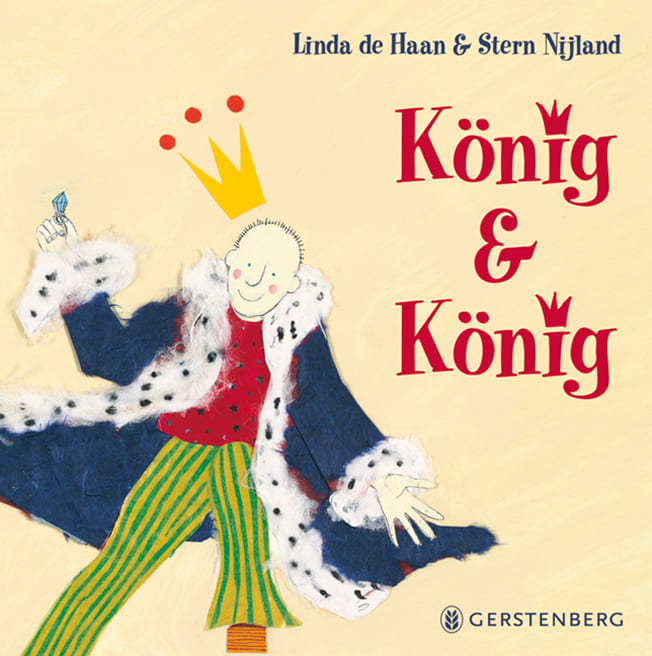
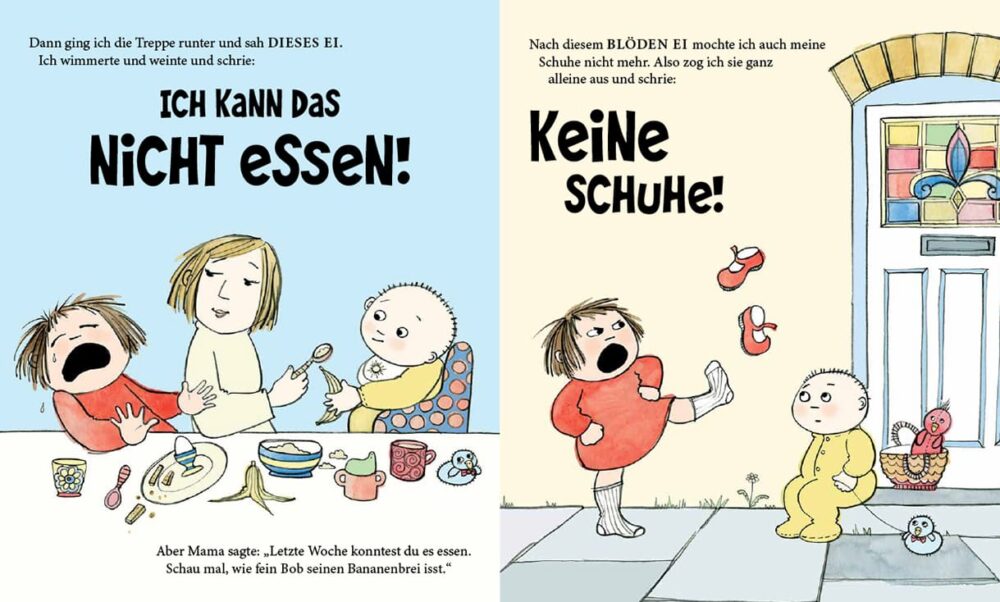
Das Bild auf dem Buchcover würde ohnehin schon fast alles sagen: Zum Schreien – und das dem Augenausdruck nach zu schließen – nicht gerade vor Freude steht das Kind mit rotem Pulli und nur einem gleichfarbigen Schuh da. Der Stoffhase auf dem Boden versucht sich seine langen Ohren einigermaßen zuzuhalten. Der Titel – in fast fröhlicher Schrift: „Mein fuchsteufelswilder Stinksauer-Tag“.
Bella, so heißt das gute Kind, erlebt einen Tag, an dem so gar nix passt. Alles geht ihr gegen den Strich. Das beginnt schon in aller Frühe, als ihr kleiner Bruder Bob in ihr Zimmer krabbelt, um ihren Schmuck abzuschlecken und dran zu lutschen. Frühstück, Schuhe, Einkaufen im Supermarkt, die Erbsen zu heiß, das Badewasser zu kalt – und noch viel mehr – jede einzelne der Situationen auf diesen Doppelseiten löst in Bella Wut, Zorn und Trotz aus. Den sie zum Glück nicht runterschluckt, sondern irgendwie auch lustvoll rauslässt.
Ist aber nicht immer gerade angenehm für alle Umstehenden oder -sitzenden. Eine Freundin, die zum Spielen gekommen ist, sucht – verständlicherweise – das Weite. Und natürlich endet das Buch nicht so. Aber wie und was Bella hilft, ihren Sch…-Tag anders ausklingen und ihr einen gänzlich andersgearteten nächsten Morgen beschert – das wird hier nicht verraten.
So viel aber schon: Die knappen Texte – im englischen Original von Rebecca Patterson – und die ebenfalls von ihr gezeichneten – durchaus lustigen Wut-Bilder, machen ganz schön viel Freude beim Anschauen und Lesen.

André Zeugner Leitere des Kraus-Verlags, in dem die deutsche Übersetzung erschienen ist, verriet Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, dass er zufällig auf das Buch gestoßen sei – über eine TV-Sendung in der britischen BBC, wo es die Grüffelo-Autorin Julia Donaldson gelobt hatte. Er bestellte es, las es – eigenhirnig simultan übersetzt – seiner kleinen Tochter vor, die es nach zwei Wochen auswendig zu den Bildern aufsagte. Woraufhin er die Rechte für die deutschsprachige Ausgabe kaufte und – tatatata – nun gibt’s das Buch auch auf Deutsch.
Nur der Titel ist doch einigermaßen anders, gesteht der Zeugner: „Sehr lange haben wir darüber nachgedacht, wie „My Big Shouting Day“ am besten zu übersetzen sei, denn „Mein großer Schrei-Tag“ oder „Mein großer Brüll-Tag“ oder „Mein großer Kratzbürsten-Tag“ ist natürlich nüschte, das klingt fad, unrund und gestelzt. „Fuchsteufelswild“ hingegen schien uns ein feines und ansonsten leicht vernachlässigtes Attribut zu sein, das sich einmal recht hübsch in einen Titel einfügen lassen möchte.“
Kinder haben lieb und brav zu sein, besonders wenn sie Mädchen sind. Leider noch immer lastet dieser Druck auf vielen Kindern. Auch wenn das Zulassen und Benennen-Lernen unterschiedlichster Gefühle längst eine wichtige und anerkannte Erkenntnis ist, schlägt sie sich im Alltag genauso wenig nieder wie in Darstellungen von Kinder(leben).
Gut, neugierig, aufgeweckt, hilfsbereit, abenteuerlustig – das hat längst auch in Medien für und über Kinder seinen Niederschlag gefunden. In dem einen oder anderen Bilderbuch, Theaterstück, Film usw. kommen hin und wieder schon auch wütende Kinder vor – ohne sie dort zu verdammen. Aber doch eher selten. Und noch seltener so doch recht lustig aufbereitet, ohne sich auch nur im Geringsten über die trotzige Bella lustig zu machen.
https://kijuku.at/tag/buch-wien/
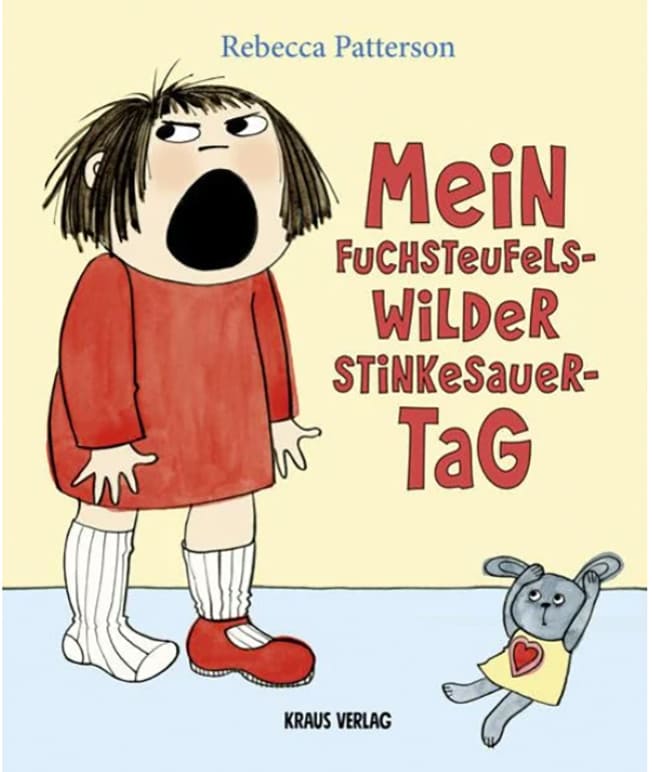

Gleich auf der ersten Doppelseite kannst du in diesem Buch mitmachen und Nayans Mutter Mira helfen. Ihr Sohn liebt es, sich zu verstecken. Auf der rechten dieser beiden Seiten sind nur kleine Stückerln von Nayan zu sehen. Da hat sich die Illustratorin Emőke Gabriella Németh einiges einfallen lassen, um beispielsweise Locken oder Ohr in Einrichtungsgegenständen zu verstecken.
Sicher entdeckst du ihn – so du sehen kannst. Das kann Nayan selbst nicht. Aber der von Geburt an blinde Bub könnte dich – wenn du im selben Raum wie er wärst – sicher in deinem besten Versteck finden. Das kleinste Geräusch – und schon hätte er dich! Hören, riechen, spüren – und das auch wenn du vor lauter Dunkelheit nicht einmal die Hand vor deinen Augen siehst – darin ist Nayan wie die meisten blinden Menschen Meister.
Die Film- und Theater-Schauspielerin Lena Kalisch, die sich die Geschichte „Nayan macht die Augen auf“ ausgedacht hat, beschreibt in der Folge, dass ihre Hauptfigur vieles gerne und anderes nicht mag – wie vielleicht du auch. Was das sein könnte, das setzt die Illustratorin in mehreren kleine Bilder um. Der Kern von Kalischs Geschichte ist hingegen ein anderer: Nayan wird operiert und kann auf einmal sehen. Danach ergibt sich noch ein dramaturgischer Bogen, bei dem ihm eine Kamera hilft – aber alles sei doch nicht verraten.

Operation, sehen können? Gibt es solches nicht nur beim Grauen Star, der üblicherweise bei sehenden Menschen eher im Alter auftritt – Trübung der Linse, die dann in einem kleinen Eingriff durch eine künstliche ersetzt wird?
Also Nachfrage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… bei der Autorin via Instagram: Wenige Minuten später die Antwort von Lena Kalisch: „Tatsächlich könnte nach jetzigem Stand der Medizin und Wissenschaft „nur“ der Graue Star bei sehr jungen Kindern und Säuglingen geheilt werden. Ein solches „Wunder“, wie es in der Geschichte beschrieben ist, ist heute so noch nicht umsetzbar. Darum bleibt die Geschichte auch ein Märchen. Ich habe jedoch in enger Rücksprache mit einem von Geburt an blinden Menschen zusammengearbeitet, der dafür plädiert hat, die Aussage rauszunehmen, dass so etwas „unmöglich“ sei. Nichts ist unmöglich und mit der schnellen Entwicklung der Technologien immer weniger.“
Auf die weitere Skepsis und die eigene Beobachtung nach einer der Grauen-Star-Operationen einer vormals Sehender bei einer Recherche-Reise mit Licht für die Welt, dass die frisch Operierten länger auch irritiert auf das plötzlich viele Licht reagieren, kam wieder eine prompte Antwort: „Ja, so ist das mit Märchen!“
Im Buch verrät die Autorin, dass sie „nach vielen Jahren der Meditationspraxis eine außergewöhnliche Erfahrung in einem Dunkelretreat, in dem sie tagelang nichts sah, machte. Von der Dunkelheit und dem darauffolgenden Sehen inspiriert, ist Nayan entstanden“. Und dass sie unter anderem mit Erich Schmid, Lehrer am Bundes-Blindeninstitut Wien sowie Vizepräsident des österreichischen Behindertenrates hilfreiche Gespräche im Prozess der Buch-Entstehung geführt habe. Der wird im Verlagsprogamm so zitiert: „In diesem Buch kommen das Erleben und die Fantasie einander ganz nahe, und das ist schön!“
Nun blieb noch meine grundsätzlich skeptische Haltung: Was macht so eine Botschaft bei von Geburt an blinden (Kindern)? Setzen sie auf Operationen, um danach etwas zu können, was sie gar nicht kennen? Oder bei Kindern mit anderen Behinderungen bzw. bei deren Freund:innen, Klassenkolleg:innen?
Um auch nicht nur Einzelmeinungen Betroffener einzufangen, wandte sich KiJuKU an die „Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs“. Martina Gollner, eine langjährige Beraterin, die selbst hochgradig sehbehindert ist und tagtäglich mit blinden oder sehschwachen Menschen zu tun hat, meinte: „Kinderbücher sollten darstellen, dass ein Kind mit einer Behinderung gut im Leben klarkommt und ein schönes Leben haben kann MIT der Behinderung, wie andere Kinder auch. Eine OP und die Behinderung ist weg, sehe ich kritisch (medizinisches Modell von Behinderung; alles ist behandelbar und damit wird „Normalität“ wiederhergestellt). Und sie entbehrt jeglicher Realität. Wäre das besagte Kind von Geburt an blind, könnte es mit den optischen Sinnes-Eindrücken gar nichts anfangen, weil das Gehirn nicht zu sehen „gelernt“ hätte. Es hätte auch keine Vorstellung von Farben, würde also auch keine Farben in der Welt vermissen. Je länger ich darüber nachdenke, desto unrealistischer wird dieses Szenario“, so die Fachberaterin zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…
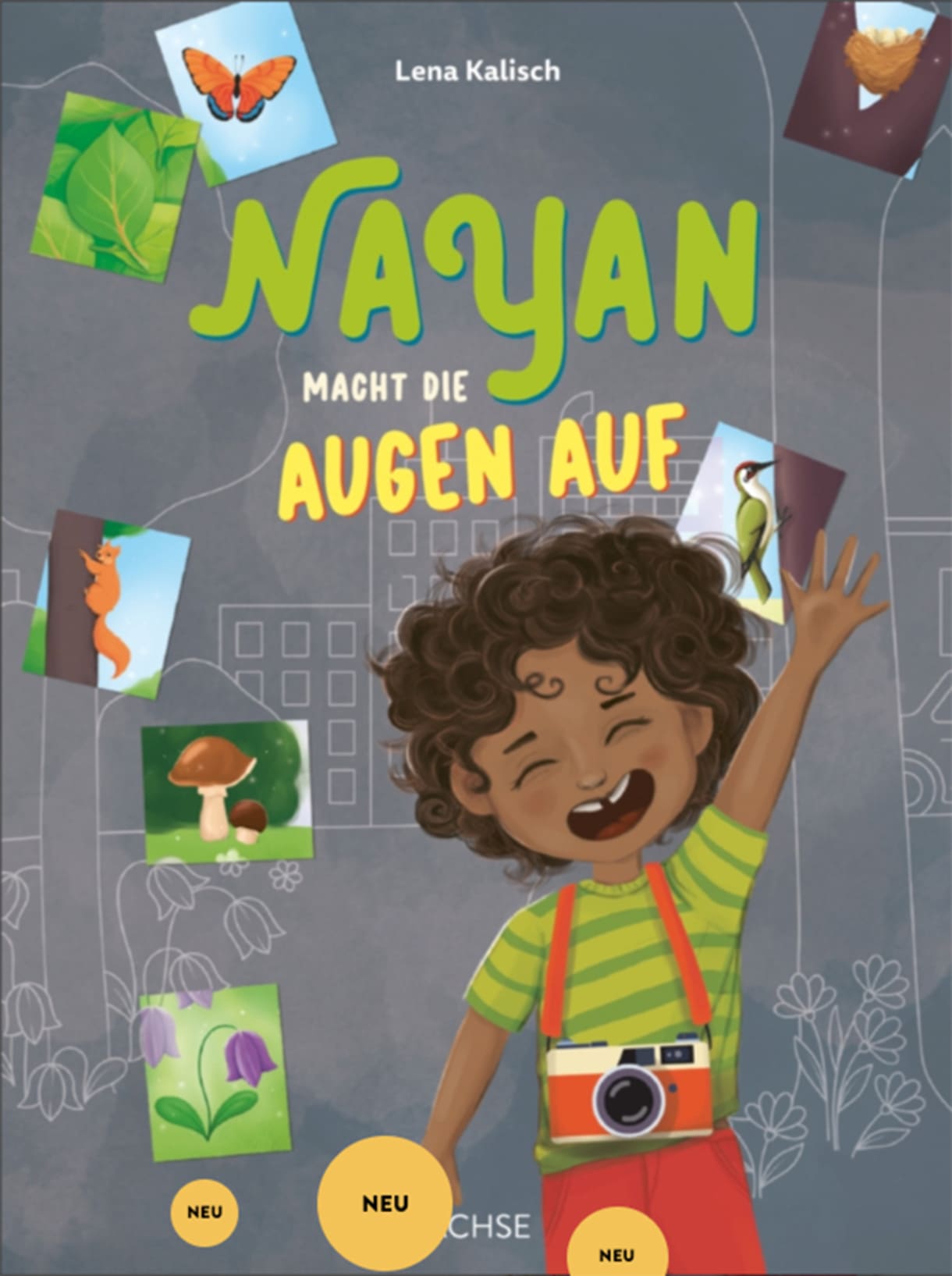
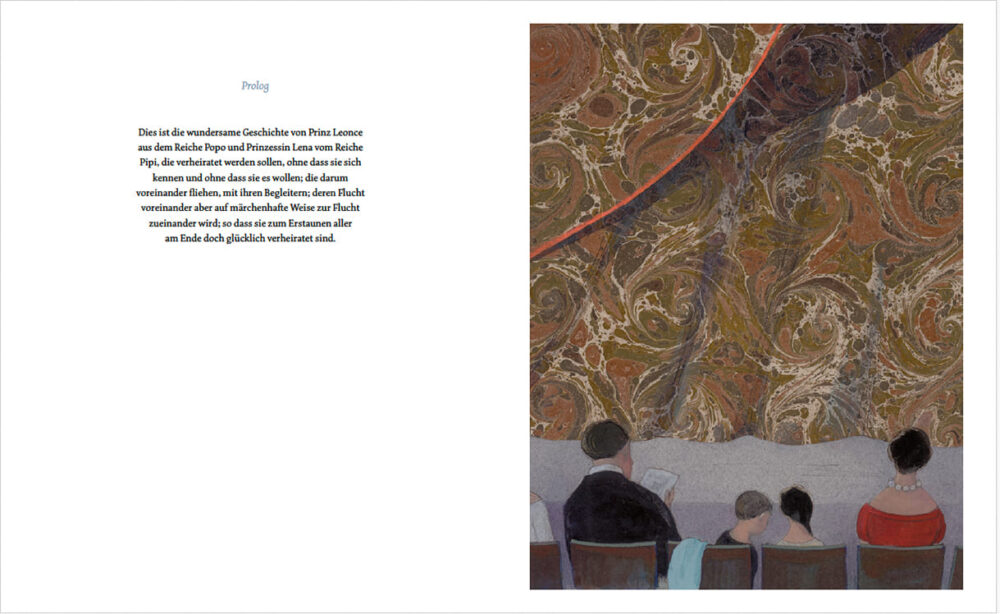
Leonce aus dem Königreich Popo und Lena aus Pipi, ebenfalls eine Monarchie, sollen miteinander zwangsverheiratet werden. Was in adeligen Familien gar nicht so selten war. Georg Büchner, ein junger revolutionärer Dichter – und Mediziner – machte sich schon mit diesen Königreichs-Namen über diese diktatorischen Herrschaften lustig.
Und dann ließ er noch die beiden jungen Leute von ihren Höfen abhauen. Die beiden treffen – ohne voneinander zu wissen, wer die/der andere ist, aufeinander, verlieben sich und …
Neben der vordergründigen Verwechslungskomödie nimmt der Autor diese Form der Herrschaft aufs Korn, aber auch die buckelnden, sich der Macht andienenden Höflinge. Der Nord Süd Verlag hat „Leonce und Lena“ schon für Kinder ab 7 Jahren herausgebracht – in einer eigenen Textfassung des Dramaturgen, Autors und Büchner-Kenners Jürg Amann, der sich sehr nahe ans Original hielt.
Lisbeth Zwerger zauberte alle paar Seiten ganzseitige bunte Bilder, die ein bisschen an Karikaturen erinnern – und zwischendurch für fast reine Textseiten kleine blumige Illustrationen. Im Anhang des Buches wird sie so zitiert: „Die spielerische, teils blumige Sprache des Stücks versuchte ich mit spielerischen Mitteln – der Collage – in Bilder zu übersetzen.“
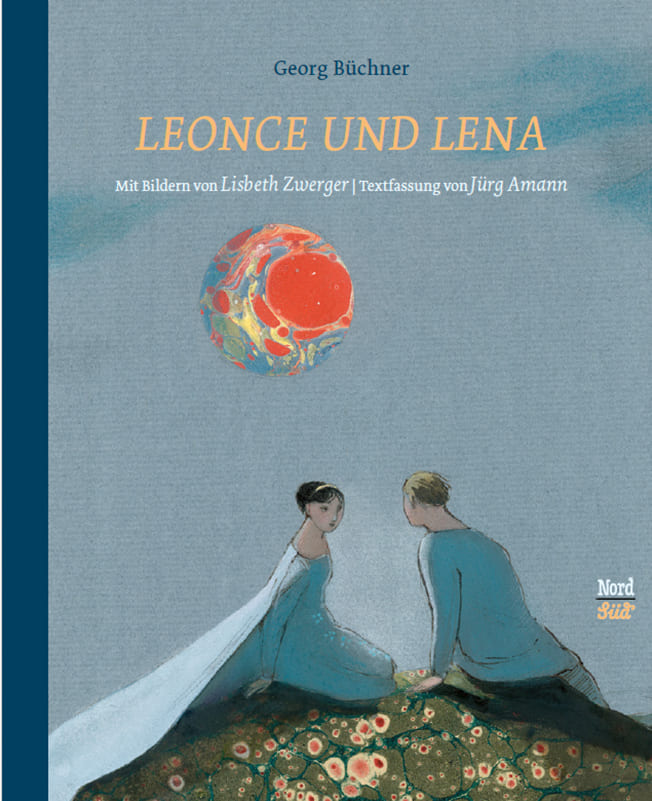

Die Halle E im Wiener MuseumsQuartier – bespielt vom MusikTheater an der Wien – ist vollbesetzt mit Kindern und Jugendlichen. Viele der jüngeren Kinder haben unterschiedliche bunte Monstermasken vor den Gesichtern, vielmehr solchen von „wilden Kerlen“. Nicht denen aus der Fußball-Buch und Kinofilm-Serie. Die sind ja „nur“ wilde Kicker:innen und alles andere als Monster. Vor allem in der oberen Tribüne sind die Kinder „masked“ (am Vormittag als Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die Vorstellung besucht).
Dafür hat irgendwo in den vorderen Reihen der unteren Galerie ein Kind offenbar von zu Hause oder aus der Schule eine selbst gebastelte riesige Maske mitgebracht.
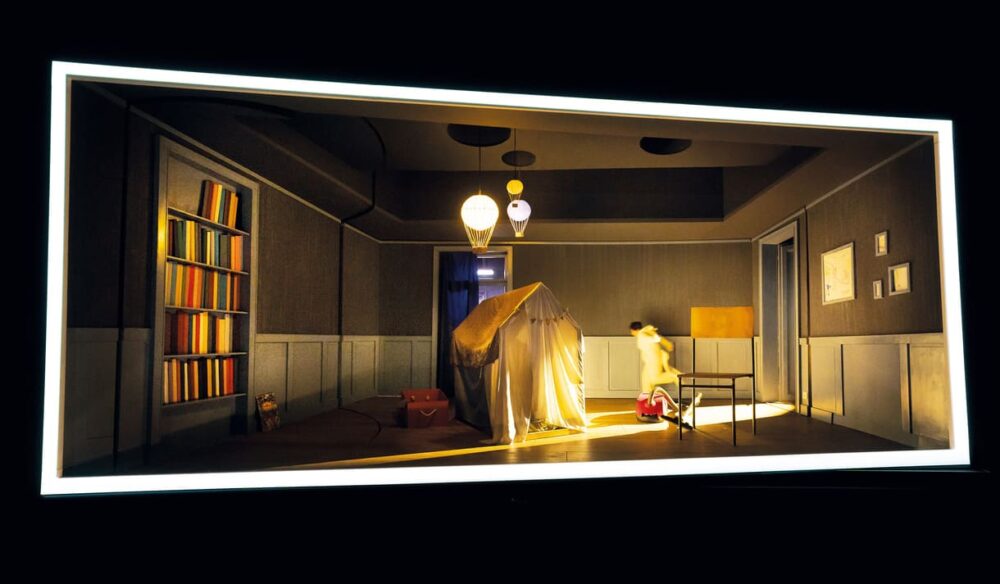
Zum 60. Geburtstag eines der beliebtesten Bilderbücher in vielen Ländern wird erstmals die auch schon mehr als 40 Jahre alte/junge Oper in Österreich erstmals aufgeführt: „Wo die wilden Kerle wohnen“ von Maurice Sendak Anfang der 60er Jahre ausgedacht, gezeichnet und in wenigen, knappen Worten geschrieben (1963 erstmals veröffentlicht) – im amerikanisch-englischen Original in 338 Wörtern, in der vier Jahre späteren deutschen Übersetzung sogar um fünf Wörter weniger schildert die Wut des Kindes Max nachdem ihn seine Mutter – ohne Abendessen in sein Zimmer schickt.

In den ersten zwei Jahren fanden US-amerikanische Eltern das Buch für ihre Kinder unzumutbar, zu grausam, manche Bibliotheken haben es sogar verboten. Kinder hingegen, die an das Buch herankamen, liebten es, waren fasziniert, dass in einem Buch, ein Kind so richtig wütend sein, herumtoben, alles kurz und klein schlagen darf – und dann in eine Fantasiewelt abtaucht. Dort wo die wilden Kerle wohnen. Die noch dazu Max zu ihrem König machen.

1980 erarbeitete der Autor und Illustrator gemeinsam mit dem britischen Komponisten Oliver Knussen eine Opernversion, die in Brüssel ihre Uraufführung hatte. Und nun – erstmals – in Österreich zu sehen, hören und erleben ist. Musikalisch geleitet von Stephan Zilias und inszeniert vom genialen Puppenbauer, -spieler und Regisseur Nikolaus Habjan. Ja genau, denn den Max – gesungen und gespielt von Jasmin Delfs gibt’s ab dem zeitpunkt, wo er aus seinem Zimmer in den Wald der „wilden Kerle“ aufbricht ein zweites Mal – als Puppe. Die wird geführt und bespielt von Angelo Konzett, der auch den Mund des Klappmaul-Ebenbilds von Max im Wolfskostüm zu den gesungenen Worten von Delfs bewegt.

Die fantasievolle Bühne – sowohl das Kinderzimmer mit einem Zelthaus als auch den durch eine Drehung des Bücherregals entstehenden Wald der wilden Kerle – hat sich Jakob Brossmann ausgedacht. Die – doch stark an die Figuren im Bilderbuch erinnernden riesigen Kostüme der „Kerle“, die sogar jeweils von zwei Spieler:innen bedeint werden, stammen von Denise Heschl. Anders als im Buch tritt hier Max‘ Mutter wirklich in Erscheinung (Katrin Wundsam).

Der Komponist Oliver Knussen hat übrigens, auch wenn die Oper nur eine ¾ Stunde dauert, „keine Kurzoper geschrieben, sondern eine große Oper im Miniaturformat“ wird er im Programmheft zitiert. Apropos Zitate, die von ihm geschaffene Musik (das Libretto, sprich den Text hat Sendak selbst geschrieben) enthält musikalischer Anklänge an berühmte andere Komponisten wie Gustav Mahler, Maurice Ravel, Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch und andere. „Wenn Max zum König der wilden Kerle gekrönt wird, erklingt Musik aus Modest Mussorgskys Oper Boris Godunow, und der Rumpus-Tanz der wilden Kerle zitiert die Turnhallen-Tänze aus Leonard Bernsteins West Side Story. Die Ruderfahrt über das Meer schließlich ist eine Hommage an die Sea Interludes aus Benjamin Brittens Peter Grimes.“ (Aus 10 Fakten über die Oper im Programmheft.) Max wurde von Oliver Knussen mit einem Koloratursopran besetzt, die wilden Kerle hingegen treten immer als fünfstimmiges Ensemble auf.

Fanden etliche Jugendliche die ¾-stündige Oper nach dem Bilderbuch zu „kindisch“ – gut, es ist ab 6 Jahren angegeben was auch Lehrer:innen, die mit ihren Klassen kamen, lesen hätten können – so rasteten die jüngeren Besucher:innen Applaus-mäßig am Ende richtiggehend aus 😉

In der ersten Reihe der unteren Galerie saßen Kinder, die sich vor Beginn der Vorstellung untereinander und mit den Lehrerinnen in Gebärdensprache unterhielten. Sie hatten den direkten Blick auf das große Orchester. Eine der Lehrerin blies Luftballons auf – auf diese Weise können Gehörlose oder schwer Hörende die Schwingungen der Musik mit ihren Händen intensiv spüren.
Apropos Luftballon. Einen solchen blies auch ein Musiker auf – um ihn gezielt an einer Stelle platzen zu lassen; sozusagen ein neues Instrument für Orchester 😉
Den Text konnten die im vorvorigen Absatz angesprochenen Schüler:innen in den Übertiteln – auf Deutsch und Englisch – mitlesen. Was übrigens auch allen Hörenden hilft, Opern-mäßig gesungener Text ist akustisch nicht immer leicht zu verstehen!
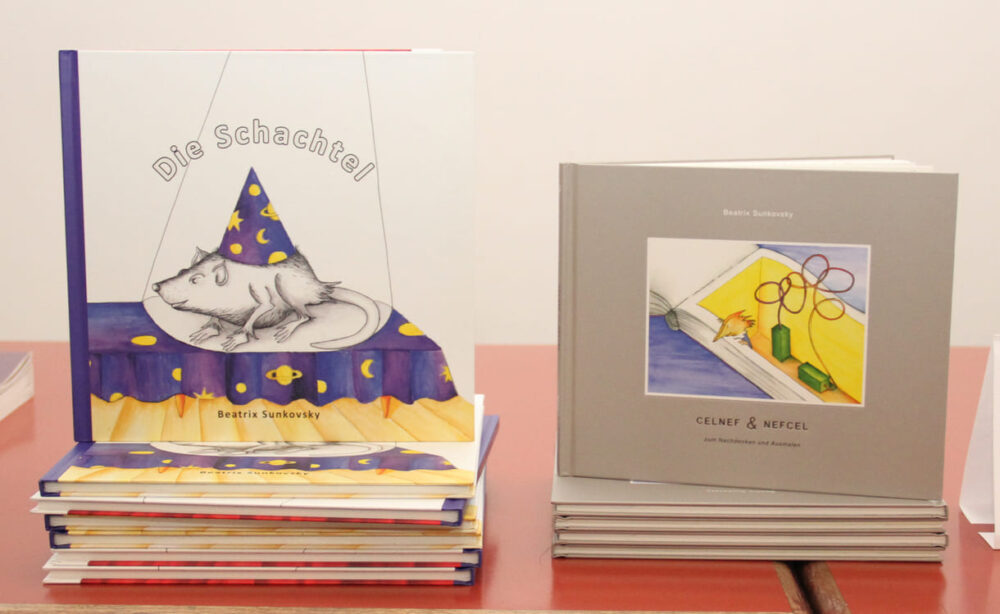
„Was ist da auf dem Tisch? … blubbert der Fisch“ – die Schrift in Wellenbewegung. Der Blick des großen schwarz-weiß gezeichneten Wasserbewohners auf einen Tisch außerhalb des Aquariums gerichtet. Dunkelblaues Tischtuch mit Sternen, Planeten, Himmelskörpern in eher leuchtendem Gelb.
Das aber wollte der Fisch gar nicht wissen. Sehsüchtig schaut er auf das Ding, das da auf dem Tuch steht. Und auch das Tier auf der nächsten Seite weiß es: „Das ist eine Schachtel!“ … sagt die Wachtel“
Für dich und unsereinen war das von Anfang an klar, aber was wir auch nicht wissen: „Was ist da drinnen? … fauchen die Spinnen“ nachdem du umgeblättert hast.
Und nun geht die Raterei los: Immer ein Tier einer anderen Art rätselt – und „natürlich“, das ergeben schon die ersten drei Zitate, hat’s was mit Reimen zu tun. Vase – Hase, Strudel – Pudel und noch viel mehr Verse – und die dazugehörigen Bilder lassen dich vielleicht sogar dazwischen einmal abschweifen und du willst deiner eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Oder dir fällt ein anderer Reim ein – statt Schrauben etwa Trauben, wenn die Tauben sich überlegen, was da wohl versteckt sein könnte. Sozusagen „out oft he Box“ – raus aus dem Denken in einer Schachtel 😉
Die bildende Künstlerin Beatrix Sunkovsky hat kürzlich ihr jüngstes Bilderbuch „Die Schachtel“ in der Wiener Secession vorgestellt. Wobei Bilderbücher nicht ihr vorrangiges Betätigungsfeld ist; Bilder sind es schon – für Ausstellungen oder auch seit ein paar Jahren auch bewegte Bilder in Form von Musikvideos.
Über ihr erstes Bilderbuch – vor mehr als 25 Jahren – in Zusammenarbeit mit ihrer Tochter Clarissa hat der Kinder-KURIER, die Vorform von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… damals berichtet. Und mit dem jüngsten Buch, so verrät die Künstlerin am Rande der Buchpräsentation – mit Musikbegleitung – dem Journalisten, schließe sich auch ein Kreis. „Die Schachtel“ ist – wie im Buch zu lesen – „für Paul“. Und das ist ihr Enkel, Sohn von Clarissa, mit der sie das erste Buch (Titel: „Clarissa“) geschaffen hat.
Dazwischen hat Sunkovsky – 2010 – das Bilderbuch „Celnef & Nefcel“ gezeichnet und – mit relativ viel Text – geschrieben: „Philosophisch-träumerische Dialoge zweier fantastischer Wesen – gedankenvollen Kindern, Geschwistern oder einem älteren, miteinander vertrauten Paar sehr ähnlich“, sagte der Verlagsleiter Johannes Schlebrügge anlässlich der Präsentation des neuen über das ältere Buch.
Und: Die Autorin und Illustratorin verrät dem Journalisten, dass der Inhalt der Schachtel in „Die Schachtel“ – der sei hier natürlich nicht, im Gegensatz zur Buchpräsentation, verraten – „schon im vorigen Buch vorgekommen ist. Und irgendwie hängt’s auch mit dem ersten Buch zusammen“, schließt die Künstlerin den Bogen.
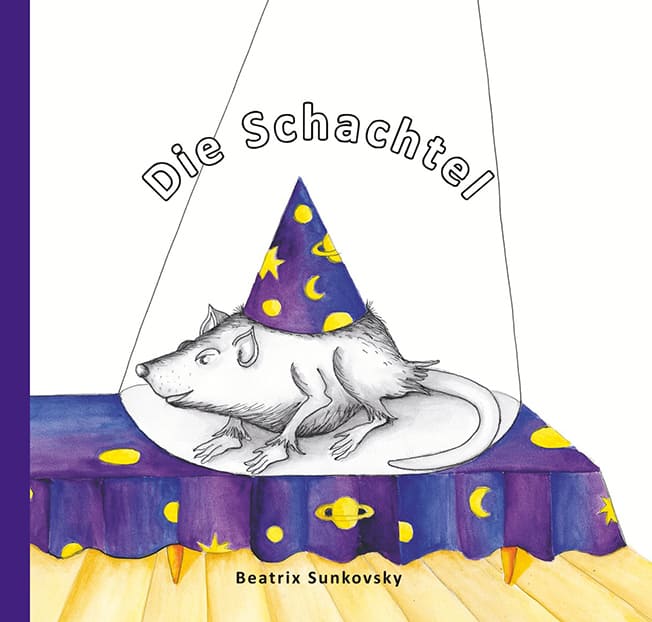

Ein wunderbar poetisch verträumtes, fast philosophisches Bilderbuch ist „In den Taschen des schönen Herrn Tag“, ausgedacht, in knappsten Worten geschrieben und kunstvoll illustriert von Franz Suess.
Bevor dir „der schöne Herr Tag“ – außer schon auf der Titelseite – begegnet, erlebst du die „Gute Frau Nacht“ auf mehreren der großformatigen Doppelseiten (größer als ein A3-Heft). Wie sie erwacht, sich den Schlaf aus dem Gesicht reibt und ihre Arbeit aufnimmt, die Welt stückerlweise in Dunkel zu hüllen.

Und dieser Herr Tag sammelt Doppelseite für Doppelseite noch schnell ein paar übrig gebliebene Dinge auf seinem Weg ein, um sie in eine seiner Taschen zu stopfen. Darunter sind so wundervolle Gedanken- und (Wort-)Bilder wie der „letzte Sonnenstrahl, der nicht mehr wärmte“ oder ein „Apfel, der zu weit von seinem Stamm gefallen war“ und nicht zuletzt „ein paar Worte, die nicht mehr gehört wurden“.
Der schöne Herr Tag greift aber auch in eine andere seiner Taschen und verstreut etwas – zauberhaft Strahlendes, das hier jetzt sicher nicht verraten wird.
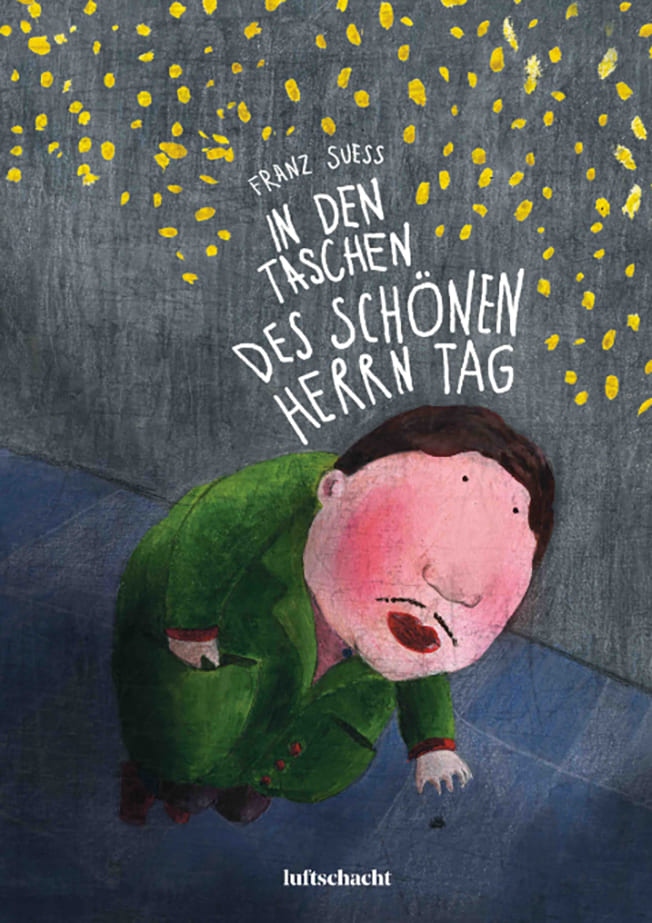
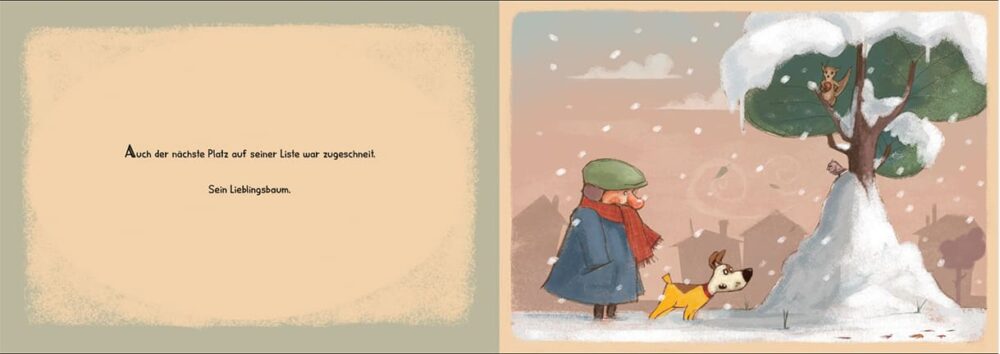
Ein älterer Mann sitzt in seinem fast zu großen gemütlichen Sessel auf dem er mit seinen Füßen gar nicht bis auf den Boden komm, und liest Zeitung. Vor ihm sitzt ein Hund und schaut recht sehnsüchtig. Jacobson, so nennt ihn Autor Christian Stejnar, braucht oder will von Herrn Vavra offenbar etwas. Einen der drei täglichen Gassi-Gänge.
Und gleich in der letzten Zeile der ersten Doppelseite wird angekündigt, dass dies an diesem Tag „Probleme mit sich bringen“ kann. In der Nacht hatte es geschneit – was wir übrigens schon von Anfang an wissen dürften, heißt dieses Bilderbuch doch „Lulu im Schnee“.
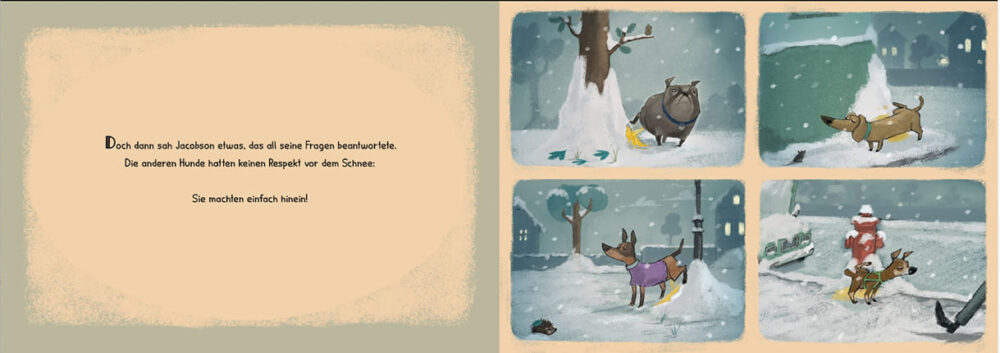
Und Jacobson ist offenbar zu sehr ein Haustier, als dass der Hund seinem natürlichen Drang nachgeben würde. Seine Pinkelplätze sind eingeschneit ;( Selbst als er – ein paar Doppelseiten weiter – Artgenossen erlebt und sieht, wie sie den frischgefallenen und damit noch weißen Schnee stellenweise gelb färben, traut er sich nicht!
Erst als Herr Vavra auch muss und sich einfach in den Schnee erleichtert, da kann auch Jacobson den Buchtitel erfüllen. Wie gut, dass sich der Autor ein Herrl einfallen hat lassen, ein Frauerl hätte sich vielleicht gar zurückgehalten, bis sie wieder in der Wohnung ist. Bzw. wär‘s zeichnerisch für den Illustrator David Hüttner ein wenig komplizierter geworden, würde Jacobson bei Frau Vavra leben.
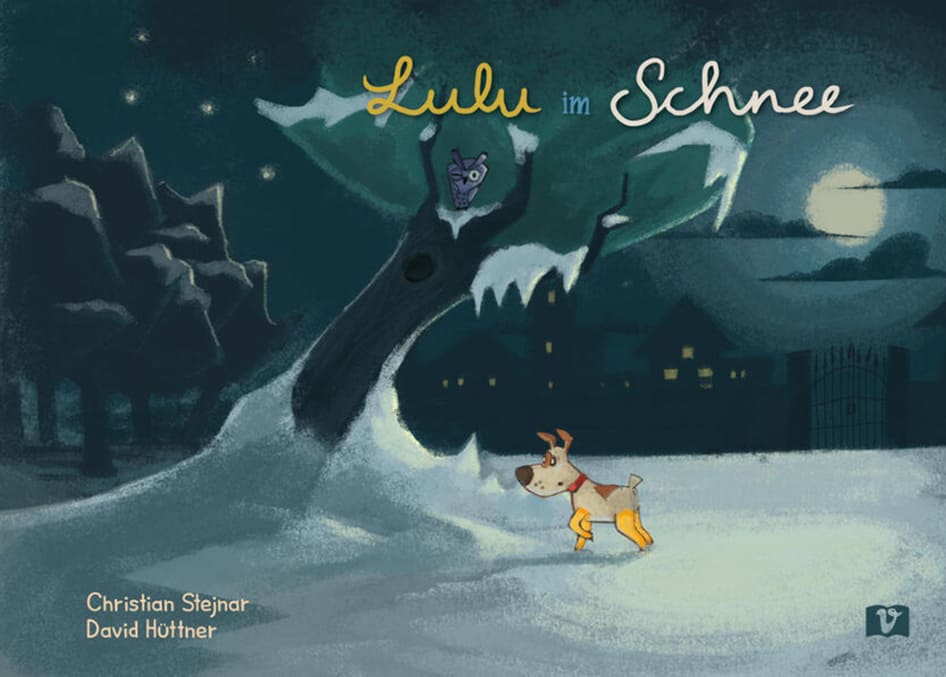
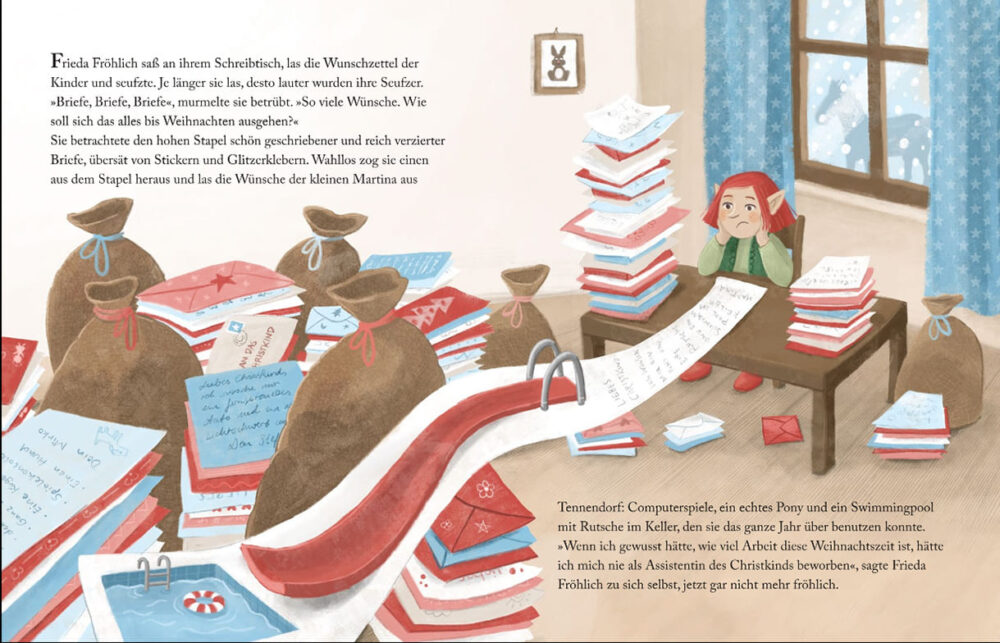
Vielleicht haben sich manche, die ans Christkind oder auch den Weihnachtsmann glauben (wollen), einmal gefragt: Was ist, wenn diese Figur krank ist? Kommen die Geschenke – und auf die scheint Weihnachten ja längst reduziert zu sein – später? Oder gar nicht?
Nun, Claudia Skopal hat sich dazu eine Geschichte ausgedacht. Frieda hat sich als Assistentin fürs Christkind gemeldet, wurde genommen – und erfährt: Christkind ist krank. Jetzt muss sie die ganze Arbeit – nein, nicht machen, aber organisieren. So hatte sich Frieda das nicht vorgestellt. Die Illustratorin Dorothea Blankenhagen lässt sich gleich auf der ersten Doppelseite des Bilderbuchs „Friedas Weihnachten“ verzweifelt dreinschauen angesichts der vielen Briefe und der noch fast unersättlicheren Wünsche.
Auch ein Engerl kann nicht helfen, weiß allerdings, da gibt’s noch Sebastian Sternschweif, der hat früher geholfen. Und tatsächlich hat der gute alte Mann ein dickes Buch „Das perfekte Weihnachten“ mit seinen Erfahrungen aus 530 Jahren gefüllt…
Wie sie Bäume schmücken und holen, Aufträge an die Werkstatt weitergeben und – eh kloar – rechtzeitig die Schlitten beladen, das zeigt das Duo in Wort und Bild – samt einem Rezept für Schokotaler auf der allerletzten Doppelseite.
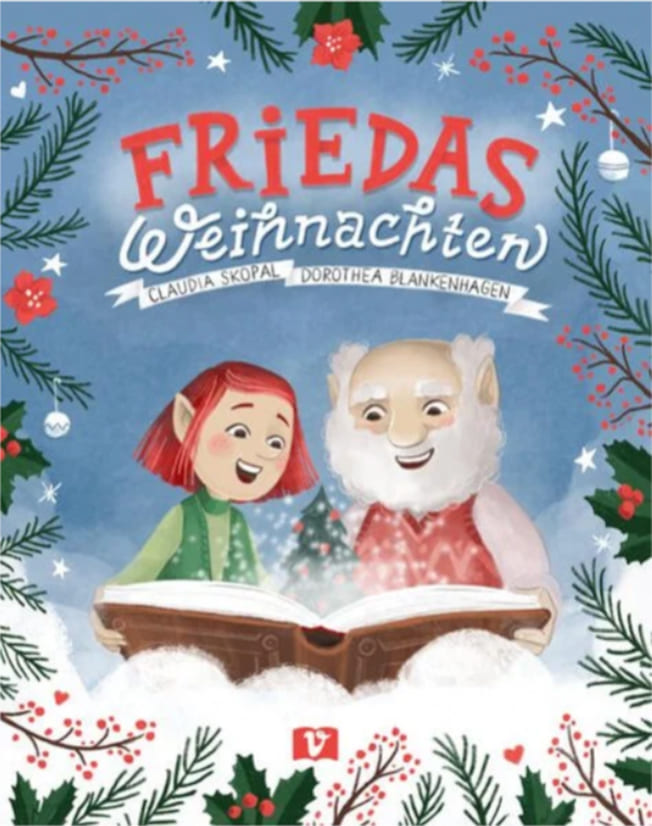
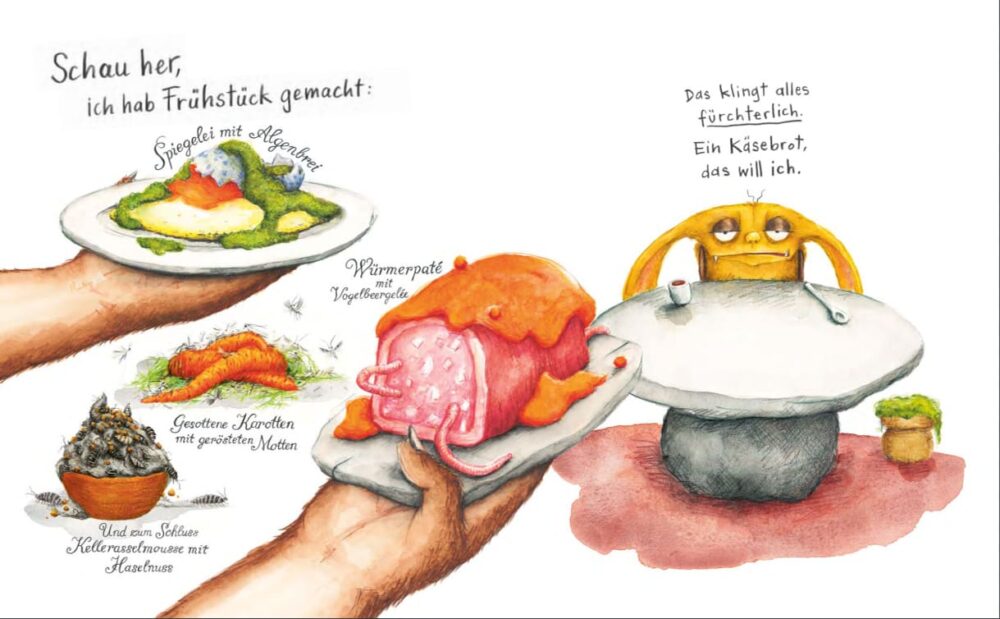
Irgendwie schauen die beiden Hauptfiguren Grigor und Tolja aufs erste nicht gerade besonders hübsch aus – nach recht weit verbreiteten Normen. Und dennoch strahlen sie gleichzeitig eine Mischung aus sympathisch und lustig aus. Mit einem Schuss Schusseligkeit.
Pascale Osterwalder, die sich für die (Wiener) Wochenzeitung „Falter“ schon den eher depressiven Alltag von Seifenspendern „Daily Soap (!) einfallen hat lassen, hat nun ein ziemlich schräges, witziges, üppiges Bilderbuch veröffentlicht. In „Das Käsebrot“ bereitet Tolja täglich das Frühstück zu. Doch Spieglei mit Algenbrei, Würmerpastete, geröstete Motten zu Karotten und mehr taugen Letzterem nicht. „Das klingt alles fürchterlich. Ein Käsebrot, das will ich.“
Problem, in der Vorratskammer gibt’s Vieles, aber – erraten, keinen Käse.
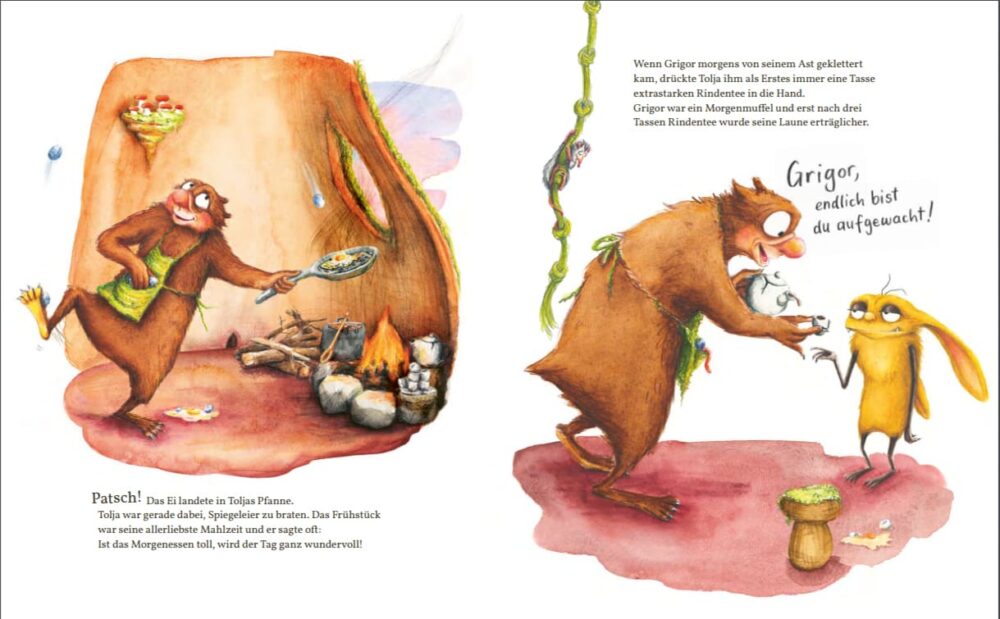
Welchen Trick sich Tolja einfallen lässt – und wie grauslich das in der vom Text und den Bildern ausgelösten Vorstellung wirken mag … – ach nein, das sei hier nicht verraten. Immerhin scheint’s Grigor zu schmecken. Bis in der nächsten Nacht – beide schlafen auf Ästen einer knorrigen, fast wie ein Raubtier aussehenden, Eiche – der „Duft“ des Käses von ganz woanders her weht.
Da sinnt Grigor auf Rache, steht erstmals früher auf, bereitet Frühstück zu – ein „köstliches“ …-Schmalzbrot 😉
Wie und was dann passiert – nix wird hier gespoilert. Auch wenn selbst beim Wissen darüber die Geschichte und gleichermaßen die Bilder beeindrucken und mindestens zum Schmunzeln – gepaart mit wäääh oder igittt – veranlassen, die Spannung soll nicht zerstört werden.
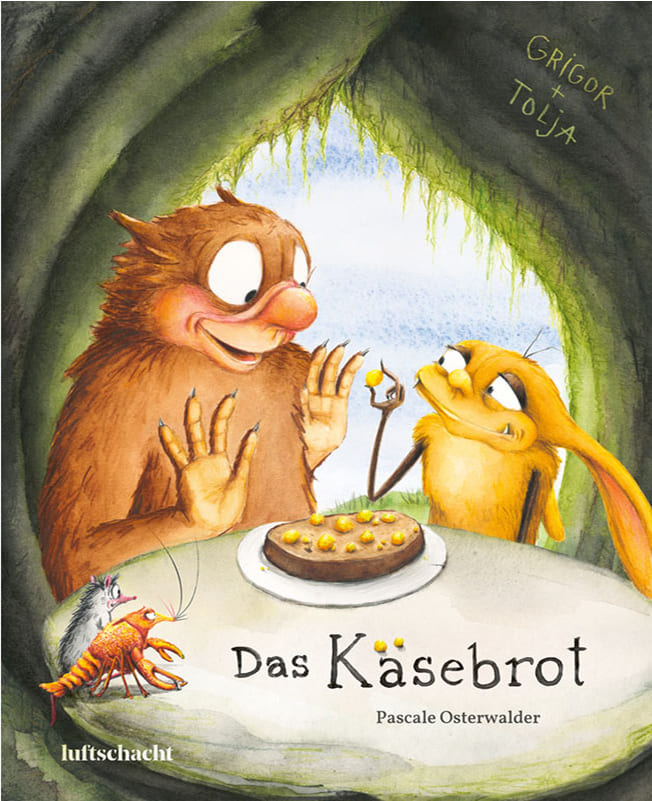

Känguru ist recht stark, will Boxweltmeister werden. Wombat tanzt super. Die Hüpfmaus baut kunstvolle Sandburgen. Schnabeltier schwimmt ur-schnell, ist sogar Australien-Meisterin bei der Bewegung durchs Wasser. Die vier sind Freunde von Koala. Doch der lehnt traurig an einem Baumstamm. Mögen sie ihn vielleicht gar nicht, lassen ihn nicht mitspielen?
Nein, gar nicht. Koala hat das Gefühl, rein gar nichts zu können. Natürlich muss und wird sich das ändern. Ein (Bilder-)Buch kann doch dabei nicht stehen bleiben 😉
Die fünf finden am Sandstrand immer wieder allerlei, das Menschen „vergessen“ haben. Eines Tages ist es ein Ding – du kennst es auf den ersten Blick, die Tiere (noch) nicht. Wombat verwendet es als Hut, die Maus als Zelt, Schnabeltier meint, es könnten Flügel sein und Känguru macht draus eine Art Boxsack.
Genau, jetzt schlägt DIE Stunde von Koala. „Wisst ihr nicht, was ein Buch ist? … Da sind Geschichten drin“, erklärt er. Die Freunde fragen gleich, ob es solche sind, die sie sich erträumen, kriegen die aber nicht und nicht raus – weder beim Schütteln, noch beim Draufklopfen und auch nicht, wenn sie ein Ohr an das Ding halten.
Und dann beginnt Koala „Es waren einmal fünf Freunde…“
Wowh, der kann lesen!
Oder, wie sich dann herausstellt – und der Titel des Bilderbuchs schon verrät –, vielleicht doch nicht?
Jedenfalls hat Nastja Holtfreter, die sich die Geschichte für „Koala denkt sich heut‘ was aus“ ausgedacht und die Illustrationen gezeichnet hat, noch einmal einen Twist ausgedacht. So leicht geht’s nicht, da braucht’s noch einen Rückschlag, aber dann… – Und nicht nur Koala kommt drauf, jede und jeder kann was!
Follow@kiJuKUheinz
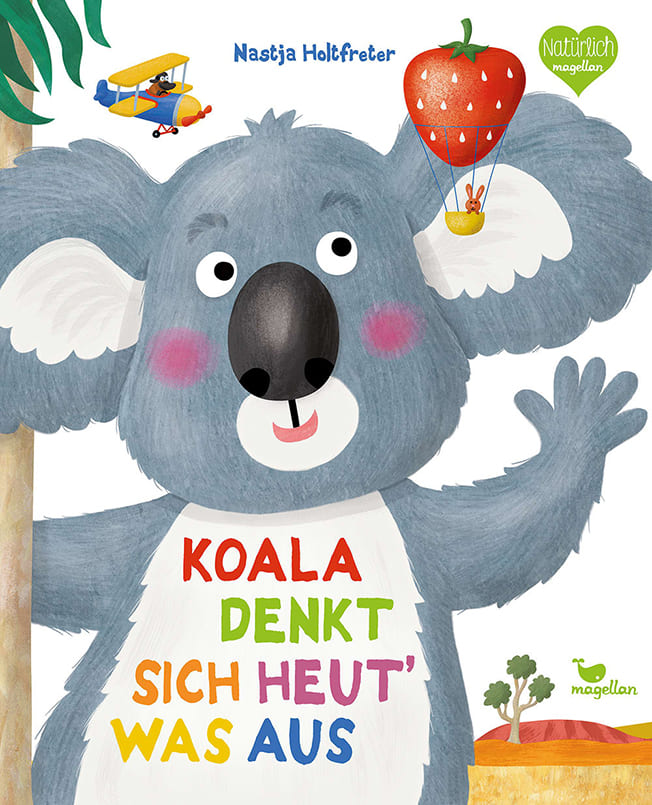
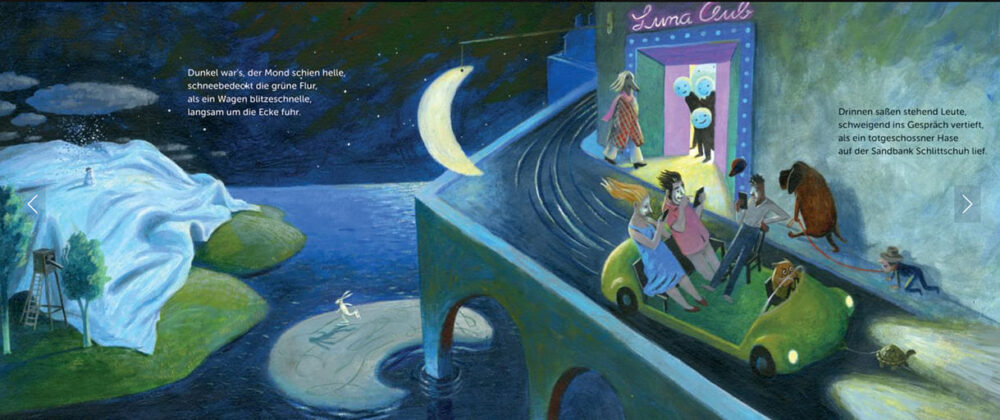
Finster, oder in anderen Versionen „Dunkel war’s, der Mond schien helle“ ist ein über viiiiele Generationen, meist mündlich weitergegebenes sogenanntes Nonsens-Gedicht. Ein Widerspruch nach dem anderen reimt sich in Gedichtform aneinander. Blitzschnell und langsam ergeben im Normallfall gleichzeitig genau gar keinen Sinn. In der Fantasie, in der Literatur, speziell der Lyrik (Gedichtform) ist aber so ziemlich alles möglich. Gedanken- und Wortspiele sind nicht nur erlaubt, sondern in manchen gerade die Voraussetzung.
Uwe Gutzschhahn dichtet gern und viel. Weil er aus Erfahrungen in Schul-Workshops befürchet, dass dieses oben angesprochene wohl bekannteste Nonsens-Gedicht im deutschsprachigen Raum in Vergessenheit zu geraten droht, ergriff er eine Initiative. In der Coronazeit bat er digital einige Kolleginnen und Kollegen, sich neue Reime für das anonyme Gedicht einfallen zu lassen. Rund ein Dutzend Autor:innen, darunter so bekannte wie Paul Maar, Heinz Janisch und Elisabeth Steinkellner sowie Jens Rassmus sandten fantasievolle Widersprüche in jeweils vierzeiliger Reimform. Der zuletzt Genannte schuf auch die dazu passenden wunderbaren, ebenfalls fantasievollen Bilderwelten für jede der Doppelseiten, schon beginnend mit dem an einer Schnur baumelnden Mond als O in „seinem“ Wort über düsterem Durcheinander unter der Schrift.

Wenn Uwe Gutzschhahn über Kinderlyrik spricht, gerät er ins Schwärmen – darüber welche Welten sich in knappen, verdichteten Zeilen öffnen (können). Und wie scheinbar widersprüchliches doch voll und ganz passt. Anlässlich der Präsentation seines Buches „Der kleine Eiskönig“ – wunderbar illustriert von Linda Wolfsgruber (Links dazu unten am Ende des Beitrages) schildert Gutzschhahn dies am Beispiel eines Reimes von einem Schüler in einem seiner Workshops – Video-Link dazu ebenfalls unten am Ende dieses Beitrages.

Als Herausgeber der nunmehrigen fortgesetzten – wobei sich, insbesondere zu Beginn, auch Reime aus dem Original finden – trug er natürlich auch selbst ein Gedicht bei, aber er holte auch vier Zeilen einer zwölfjährigen Schülerin aus einem seiner Workshops ins Buch, Laura Depperschmidt. Welches der gereimten widersprüchlichen Bilder von ihr stammt, wissen mehr oder minder nur die beiden. Als Herausgeber nennt er zwar alle Autor:innen, aber in keinem Fall eine Zuordnung. Beim Urgedicht weiß es ja auch niemand, von wem die Zeilen sind, so sein Argument im Nachwort.
Kleiner Wermutstropfen: Obwohl ein Drittel der Autor:innen weiblich ist, hat’s keine von ihnen auf das Buchcover geschafft, wo nur auszugsweise Männer genannt werden.
Am Ende des Nachwortes hofft der Herausgeber, dass Leserinnen und Leser sich von den Gedichtzeilen anregen lassen, selber weitere schräge (Wort-)Bilder zu finden…
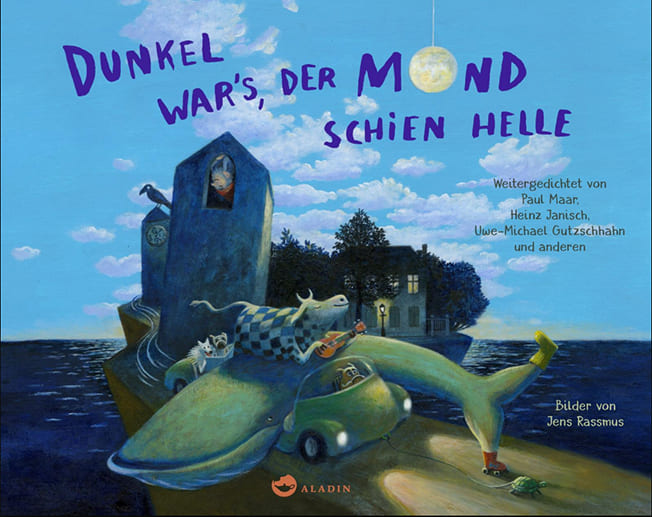
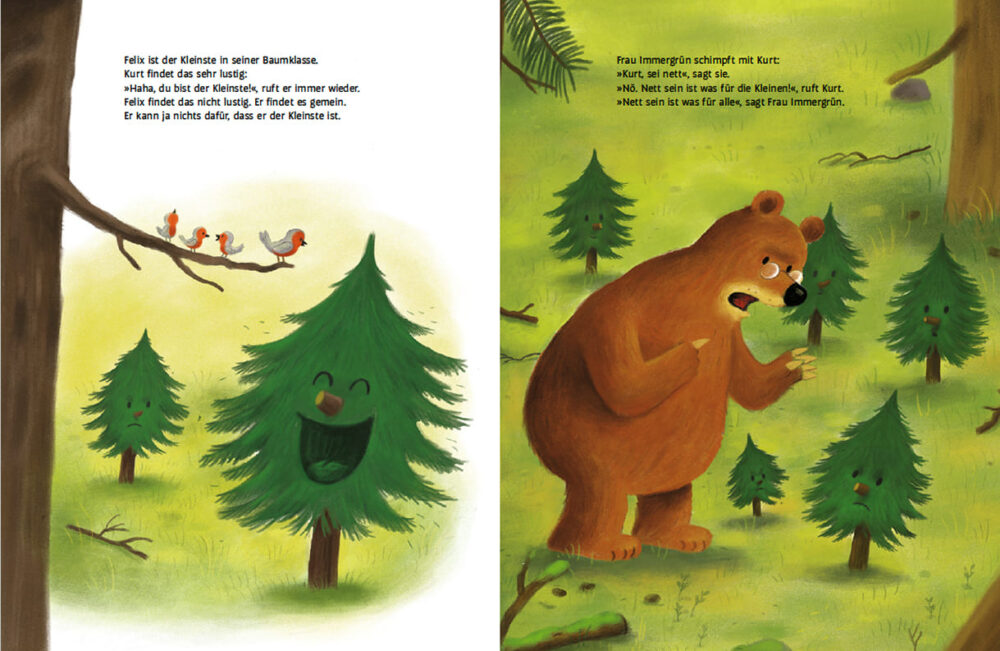
Kurt ist eine große, mächtige Tanne. Und stolz darauf. Aber auch mehr als überheblich. Grausam macht er sich lustig über seinen Artgenossen Felix, nur weil der viel kleiner ist und deshalb – nicht nur von Kurt Tännchen genannt wird. Was Felix verständlicherweise sehr kränkt.
Kurt hört rein gar nicht auf die Ermahnung der Lehrerin Immergrün, einer Bärin, in der Baumschule: „Nett sein ist was für alle“ – so die Aufforderung der Lehrerin. Aber schon auf der nächsten Doppelseite, in der es um die Vorbereitung der Tannen auf Weihnachten geht. Wobei all diese Nadelbäume des Waldes das Glück haben, nicht abgeholzt und nur für wenige Tage oder zwei, Wochen in einem Wohnzimmer stehen zu müssen. Sie dürfen im Wald bleiben, werden dennoch geschmückt – damit Tiere hier dieses Fest feiern können.

Weshalb die Lehrerin dann allerdings den Bäumen die Aufgaben gibt: „gerade stehen“, „möglichst wenig Nadeln verlieren“ entzieht sich doch der Logik. Dass sie nicht mitsingen sollen – gut, das passt dazu, dass die Tannen auch für die Tiere hier geschmückt werden wie in Wohnungen.
Und es kommt wie fast vorauszusehen – zur Freude Kurts – Ob Familie Fuchs, Dachs, Maulwurf, Reh, Specht und so weiter – alle „übersehen“ Felix.
Natürlich nur fast alle, Happy End muss her und – nein, welches Tier sich gerade darüber freut, dass Felix nicht größer ist, das wird nicht gespoilert. Nur so viel: Dieses Tier kann auch die eigene Familie davon überzeugen, rund um diese kleine Tanne zu feiern.
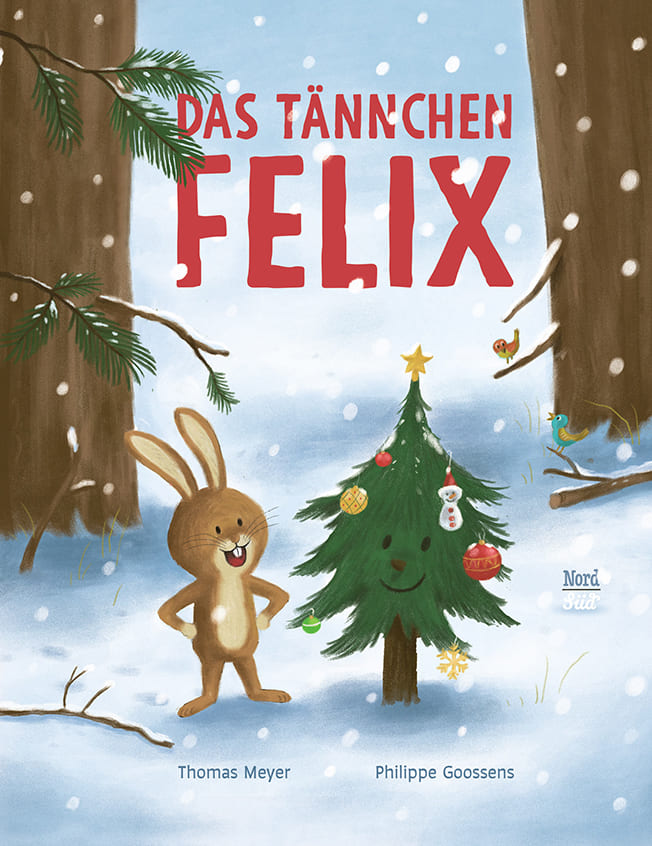
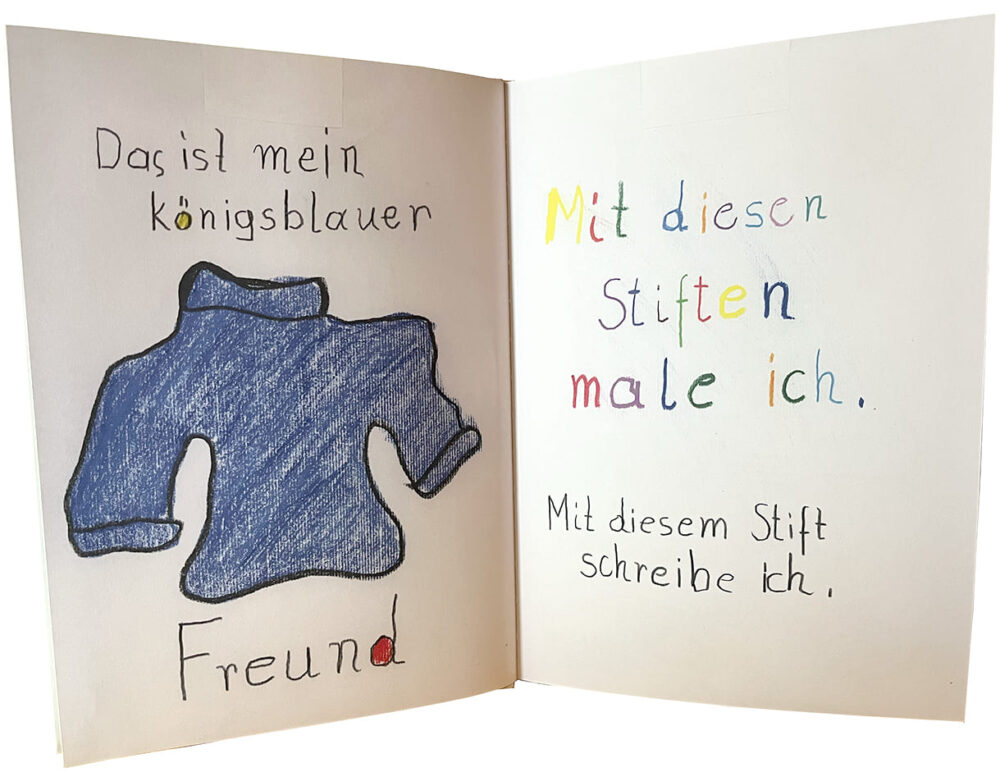
Der weltberühmte Maler Pablo Picasso wird häufig damit zitiert, dass er zwar schon sehr früh sehr perfekt malen konnte, es aber sehr viele Jahre gebraucht hätte, „bis ich zeichnen konnte wie diese Kinder“. Dabei bezog er sich auf eine Ausstellung von Kinderzeichnungen, die das Britisch Council in Paris organisiert hatte.
Dieses Zitat kommt fast unweigerlich in den Sinn, wenn du „Mein königsblauer Freund“ von Monika Helfer und Michael Köhlmeier auch nur durchblätterst. Der letztgenannte, mehr durch seine vielen preisgekrönten schriftstellerischen Werke bekannte Autor hat hier die Geschichte illustriert – im Stile von Kinderzeichnungen. Nach wenigen Seiten gesteht der Illustrator „Hände zeichnen kann ich leider nicht gut. Entschuldigung“. Was er auch gleich beweist mit einigermaßen missglückten Hände-Darstellungen, von denen er eine gleich noch mit zwei großen roten Linien durchstreicht.
Und der Text der – ebenfalls vielfach preisgekrönten Autorin – ist in großen dicken Bleistiftstrichen handgeschrieben, auch das eher in Kinderschrift, manchmal auch mit durchgestrichenen Buchstaben und eingefügten Wörtern – ausgedacht von Monika Helfer, handgeschrieben von Michael Köhlmeier. Beide sind mehr als 70 Jahre jung – jeweils.
Es handelt sich um eine – in Text und Bildern wunderbare Geschichte. Moritz, den alle nur Monki nennen, hat einen heißgeliebten blauen Pulli. Der erinnert ihn an die Farbe seiner Mama. „Auf einmal war sie nicht mehr da. Darum wohne ich bei Opa und Oma.“
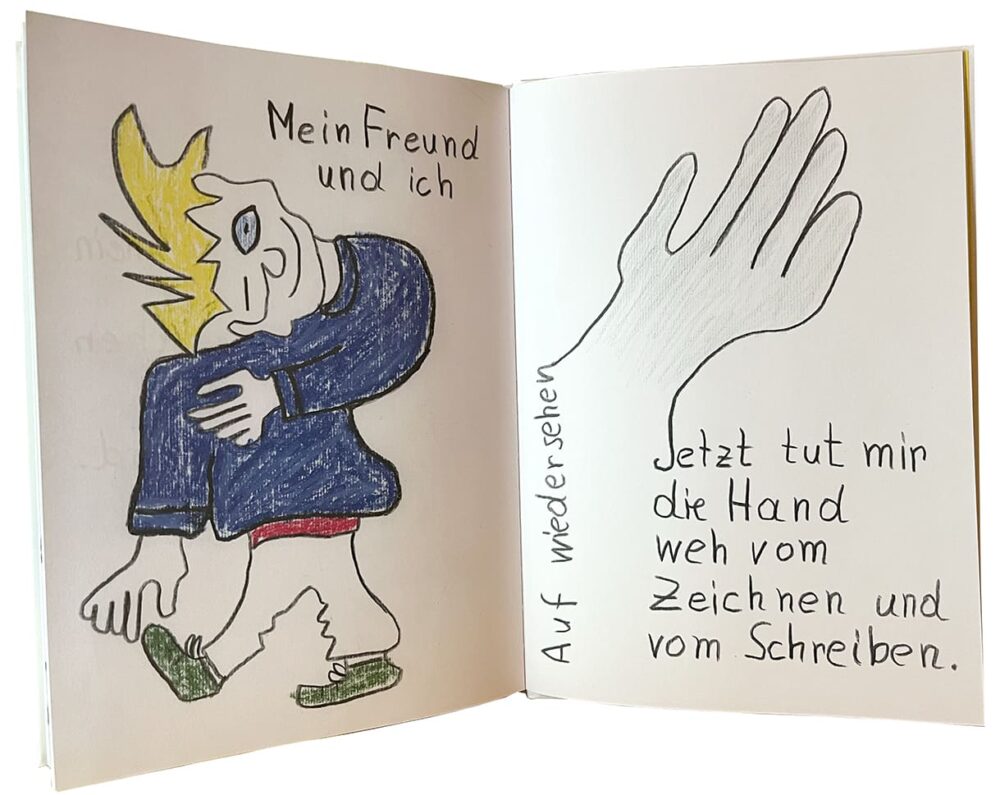
Monki hat schon Freund:innen – Fatma etwa oder einen Baum. Aber keiner ist so eng an ihm dran wie der Pullover. Und so ist der Bub auch lange auf keiner Zeichnung ohne dieses Kleidungsstück zu sehen. Natürlich muss was passieren. Beim Fußballspielen zieht er ihn aus, geht danach nach Haus und vergisst. Und klar, am nächsten Tag liegt er nicht mehr beim Fußballtor, aber…
Na, sicher wird hier nicht verraten, wie’s weiter- und gar ausgeht.
Nur so viel noch: Auf der Buch Wien wurde Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vom Verlag verraten, dass es noch weitere solche Bücher des bekannten Duos geben werde 😉

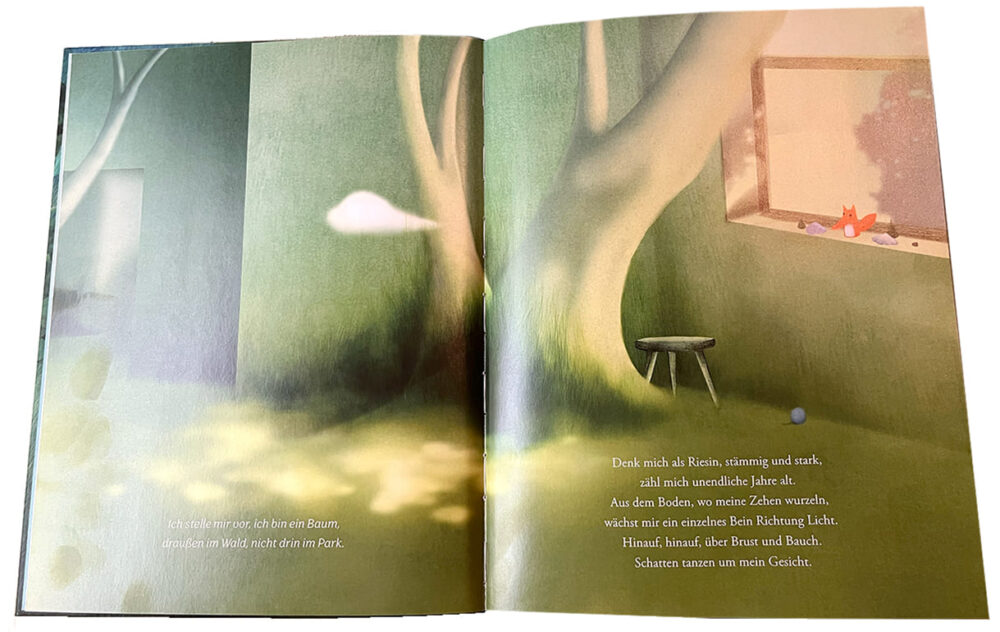
Ach wie könnte die Welt doch schön sein ohne Autos, Beton und all dem Zeugs, das die Menschen erfunden und damit die Natur zerstört haben und es ständig weiter tun. Dieser Grundgedanke schwebt über dem dennoch sehr stimmungsvollen Bilderbuch „Wie ich die Welt mir träume“.
In – meist nicht gereimten – Gedichtzeilen fühlt sich die Autorin in ein Kind hinein, das sich solche Gedanken macht, wenn die Erde ganz menschenleer und die Natur unzerstört sein würde. Und sie verbindet diese weitschweifenden Überlegungen mit der Frage:
„Was wäre dann mit mir?
Würde es mich trotzdem geben,
würde ich leben, anderswie?
Auf dieser Welt als Anderswas?
Ein Anderswer im Anderswo?“
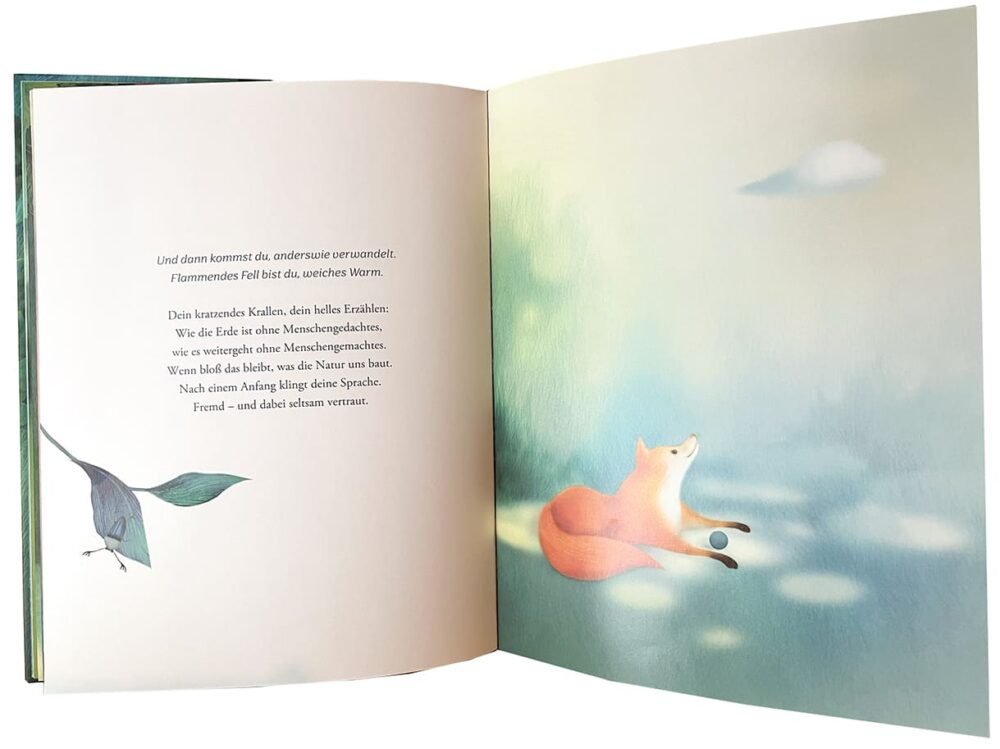
Die hoch (kinder-)philosophischen Fragen spinnt sie sprachlich Fort als möglicherweise Baum, Pilz usw. Stella Dreis erweitert die knappen, Gedankenanstoßenden Zeilen zu einem weichen, sanften, endlos scheinenden Bilderkosmos. In den baut sie immer wieder das Bild eines kleinen, rötlichen Fuchses ein – und löst damit unwillkürlich die gedankliche Verbindung zu Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ aus. Dieser vermittelt der Hauptfigur ja, dass er Sehnsucht hat nach Freundschaft, danach einander vertraut zu machen.
Denn – so die Überlegung des Kindes, das sich immer wieder in andere Naturobjekte/subjekte hineindenkt: …“ das Staunen, frage ich. Ist es noch da, mitten im Wundern und Bewundern?… Ohne ein wenig vom Menschenwesen/würden wir wohl genau das verlieren.“
Als Ausweg finden Autorin in Worten und Illustratorin in Bildern ein sich Bescheiden, ein Leben im Einklang mit der Natur. Das liest sich dann etwa so:
„Paradies wie noch nie, mit einfachen Regeln:
Wer etwas nimmt, wird auch etwas geben…
Dadurch fehlt nichts und nichts geht verloren.
Reich ist die Werde, wunderbar…“
Die letzte Zeile erinnert wiederum an Jura Soyfers humorvolles und doch bitterböses Theaterstück „Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein‘ Fall mehr lang“, in dem er unter anderem gedichtet hat:
Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde,
Voll Leben und voll Tod ist diese Erde,
In Armut und in Reichtum grenzenlos.
Gesegnet und verdammt ist diese Erde,
Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde,
Und ihre Zukunft ist herrlich und groß!
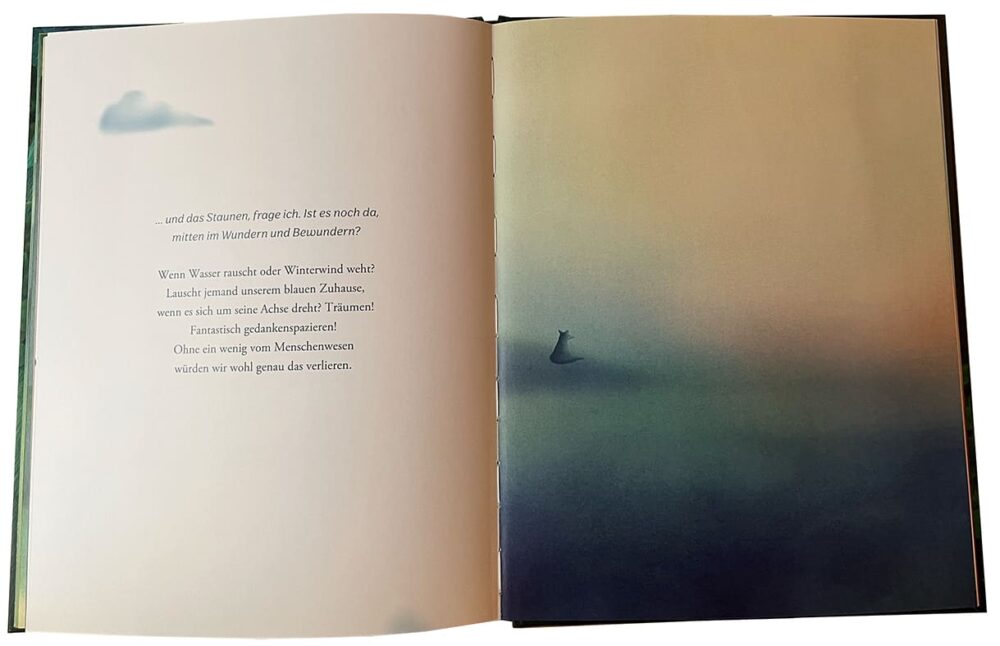
Bleibt noch eine Anmerkung zum echt wunderbaren, tiefschürfenden und weitblickenden Bilderbuch, auch wenn natürlich nie alles umfassend angesprochen werden kann, aber vielleicht doch Platz in der einen oder anderen Nebenbemerkung finden hätte können: Die Menschheit wird auf das weit verbreitete sogenannte „zivilisierte“ Leben verallgemeinert. Sogenannte „Wilde“, so manch indigene Völler, leben sehr wohl im Wissen, „nur“ Teil des Universums zu sein, empfinden beispielsweise Schmerz, wenn ein Baum gefällt wird. Und einige sagen – und handeln: Wenn wir eine wichtige Entscheidung treffen müssen, beraten wir, was wären/sind die Folgen und Auswirkungen in sieben Generationen! Letzteres berichtet Felix Finkbeiner, 2007 im Alter von zehn Jahren Gründer von „Plant fort he Planet“, von einem Treffen mit Chief Shaw, einem Häuptling eines First-Nation-Stammes in Nordamerika einige Jahre später.
Wobei vielleicht die Illustration des Kindes zu Beginn und am Endes des Buches auf eine solche Herkunft hindeuten könnte – mit den Zeilen
Denk mich als Mensch einer anderen Art.
Als Geschöpf unter vielen – achtsam und zart.


Ein wenig erinnert dieses Bilderbuch an Geschichten wie das Erfolgstheaterstück „Unsichtbare Freunde“ von Alan Ayckbourn. Und doch hat „Das Gespenst will bleiben“ von Jesse Rose (Text und Illustration, Übersetzung aus dem Englischen: Susanne Weber) noch etwas anderes. Denn das Gespenst in dem Haus, in dem der kleine Levi mit seiner Familie einzieht, erschreckt die Oma – und wird offenbar eben nicht nur von Levi gesehen.
Doch während das Kind sich mit dem ungewöhnlichen Mitbewohner, der keine Türen benützen muss, sondern durch Wände schweben kann, anfreundet, wollen die anderen, dass es verschwindet. Für immer. Und weil meist die Erwachsenen ihren Willen durchsetzen …
Levi allerdings vermisst nicht nur das Gespenst, er fühlt sich auch in die Lage des vor die Tür Gesetzten ein. …
„Natürlich“ – ist es doch ein Bilderbuch zum Vorlesen ab 4 Jahren – schafft es Levi nach dem Rauswurf des Gespenstes seine Familie zum Umdenken zu bewegen. Doch so einfach ist das nicht. Wo könnte das vertriebene Wesen Zuflucht gefunden haben? Auf einigen weiteren Doppelseiten gibt es viel zu Schauen und Suchen, ob das Gespenst zu finden ist…
Und vielleicht bleibt ja hängen, wenn schon ein Gespenst nicht vertrieben werden sollte, könnte das nicht auch für Menschen gelten, immerhin zeichnet sich Levis Familie schon durch sichtbare Diversität aus.
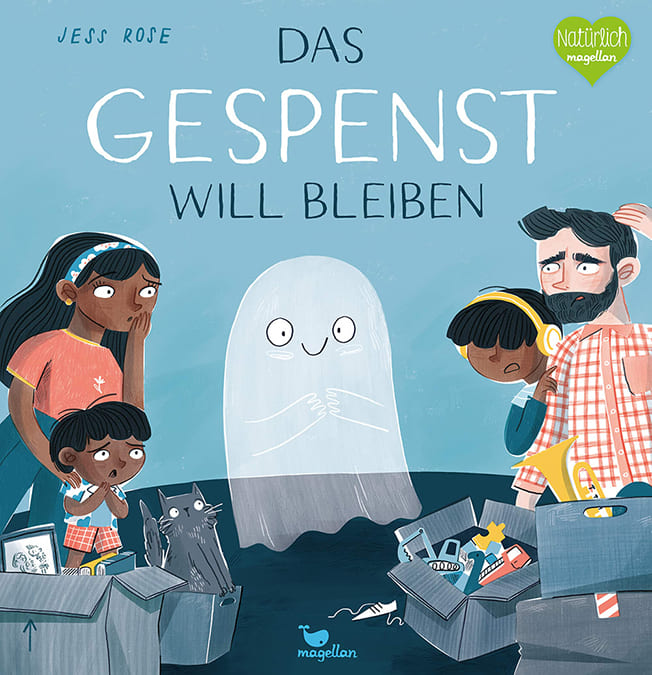
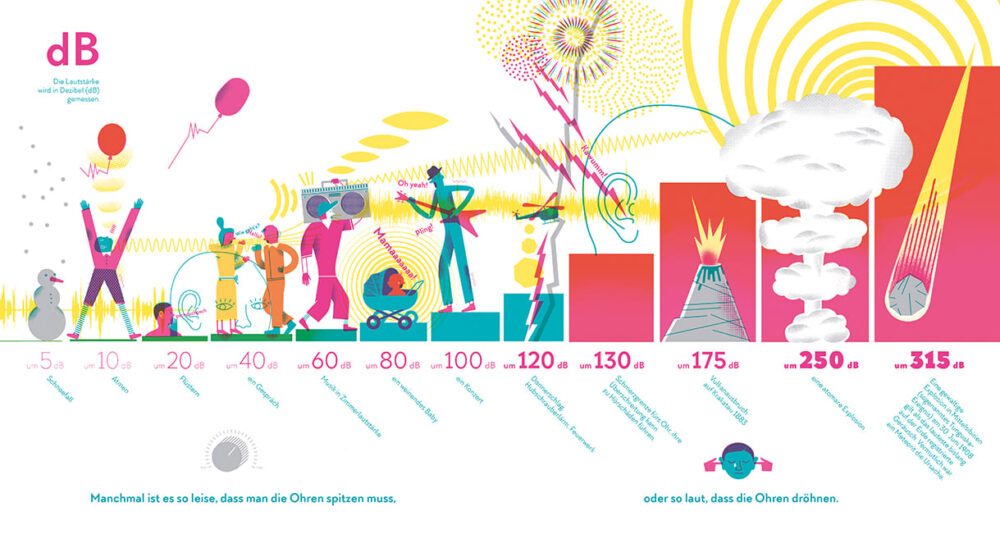
„Hören“ sichtbar machen – das gelingt diesem Bilderbuch des grandiosen Duos Romana Romanyschyn und Andrij Lessiw im gleichnamigen Bilderbuch umfassend und vielseitig. Schon von der Titelseite lächelt dir ein Strichgesicht mit zusätzlichen langen Hasenohren entgegen, in die verschiedenste Schallwellen und Töne schweben.
Doppelseite für Doppelseite verbinden die beiden Künstler:innen mit Sachtehmen, die sie kunst- und oft fantasievoll zeichnerisch zu Papier gebracht haben: Vom Urknall über eine detaillierte Zeichnung, wie unser Hörorgan funktioniert; wenn es nicht beeinträchtigt ist. Für Letzteres findet sich gegen Ende auch eine Doppelseite zu Gebärdensprache und dem – deutschsprachigen – Fingeralphabet.
Wie unterschiedlich Töne, Geräusche, Klänge sein können und erzeugt werden schildern die beiden Künstler:innen aus dem ukrainischen Lwiw (Übersetzung Claudia Dathe) in vielen bunten gezeichneten Bildern – mit jeweils knappen und doch hinreichenden Texten. Auch welche Geräusche unsere Körper erzeugen (können) findest du anschaulich dargestellt. Oder wie unterschiedlich verschiedene Lebewesen hören, dass etwa Grasshüpfer ihren Ohren auf den Knien haben… Was das Lauteste und was das Leisteste Geräusch war/ist, wie sich der Urknall angehört haben könnte – dazu gibt’s einen Link im Buch.
Dass zu laut als heftiger Lärm uns ziemlich zusetzen kann, wird bildlich meisterhaft umgesetzt. Selbst wenn es „nur“ allzu viele Wörter und Sätze sind, die auf uns einprasseln, und du vielleicht den einen oder anderen Moment der Ruhe, Stille brauchen würdest – welch geniales Bild mit Regenschirm in der Buchstabenflut…
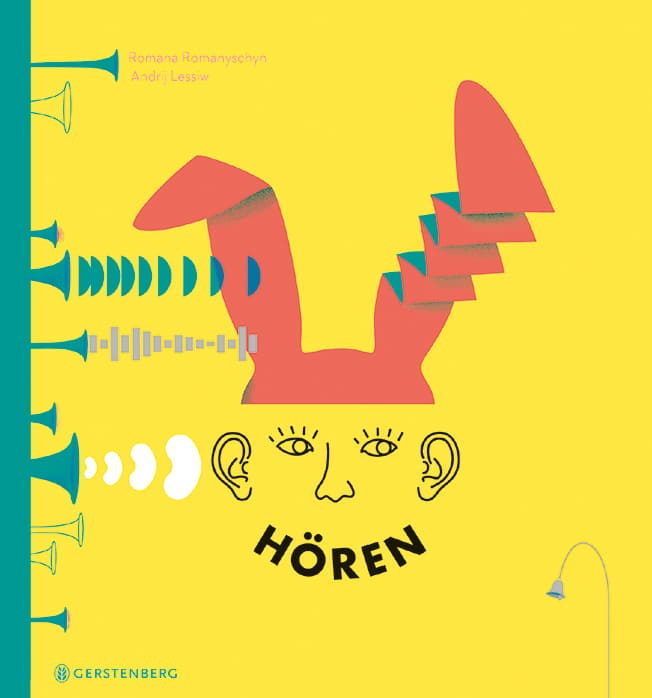
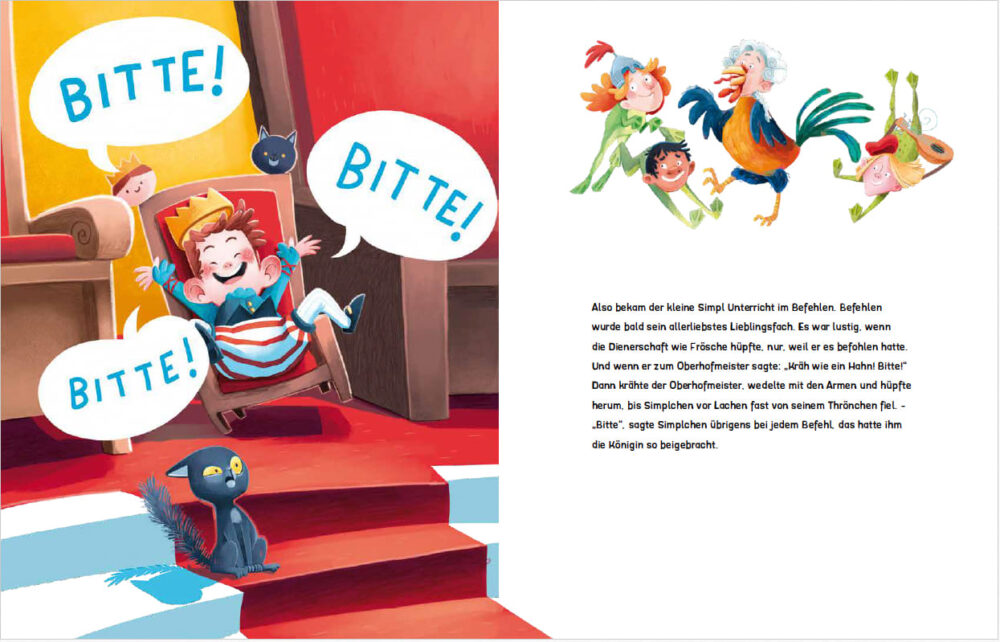
Sein Name und die Zeichnung auf der Titelseite deuten schon darauf hin: Die hellste Kerze auf der Torte ist dieser König nicht. Simplicius Maximus und weil es davor noch keinen solchen Namens gegeben hat, der Erste, nannten die Eltern – König und Königin – ihren Neugeborenen. Natürlich riefen sie ihn nie in voller Länge, sondern meist Simpl oder Simpelchen.
So beginnt Brigitte Endres „Die fast ganz wahre Geschichte von König Simpl“ zu der Corinna Jegelka die bunten lustigen Zeichnungen beisteuerte, die jedenfalls Tollpatschigkeit des heranwachsenden Prinzen und späteren Königs nahelegen.
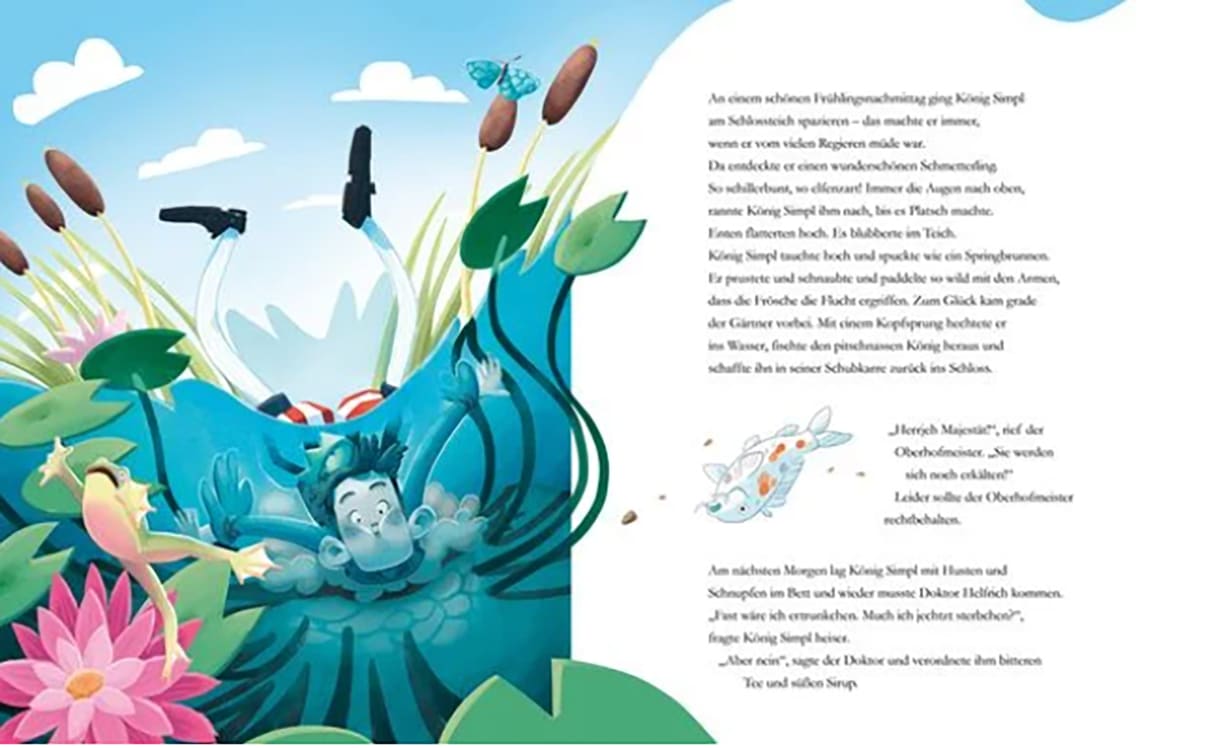
Die Autorin beschreibt ihre Hauptfigur als freundlich und ängstlich. Ob die zuletzt genannte Eigenschaft dafür verantwortlich ist, dass er nicht wirklich was lernen konnte/wollte? Jedenfalls meinte der Hauslehrer zum König: Der kleine Simpl ist sehr begabt, vor allem darin, rein gar nichts zu begreifen.“ Was den Vater offenbar wenig störte. Er meinte lediglich: „Ein König muss vor allem eines können: Befehlen.“
Und so unterrichtete der Lehrer seinen Schüler nur in diesem Fach, was seine Umgebung, die vor allem aus Dienerschaft bestand, fast zur Verzweiflung brachte. Der sehr junge Prinz fand es ur-lustig, anzuschaffen, dass die einen wie Frösche hüpfen, die anderen wie Hähne krähen sollten und so weiter.
Schlauer wurde Simpl mit zunehmenden Jahren nicht und so kam’s, dass er als König einmal in den Schlossteich plumpste und weil er nicht schwimmen konnte, befahl, dass alle Menschen dauernd mit einem Schwimmreifen rumrennen mussten.
Schon davor, als allererstes, hatte Simpl alle Messer verbieten lassen. Er hatte sich beim Schneiden einer Wassermelone – seiner Lieblings-Nachspeise – verletzt. Und weil er allen anderen keinen vorsichtigeren Umgang mit Schneidewerkzeugen zutraute, also das Verbot; er wolle nur seine Untertan:innen schützen…
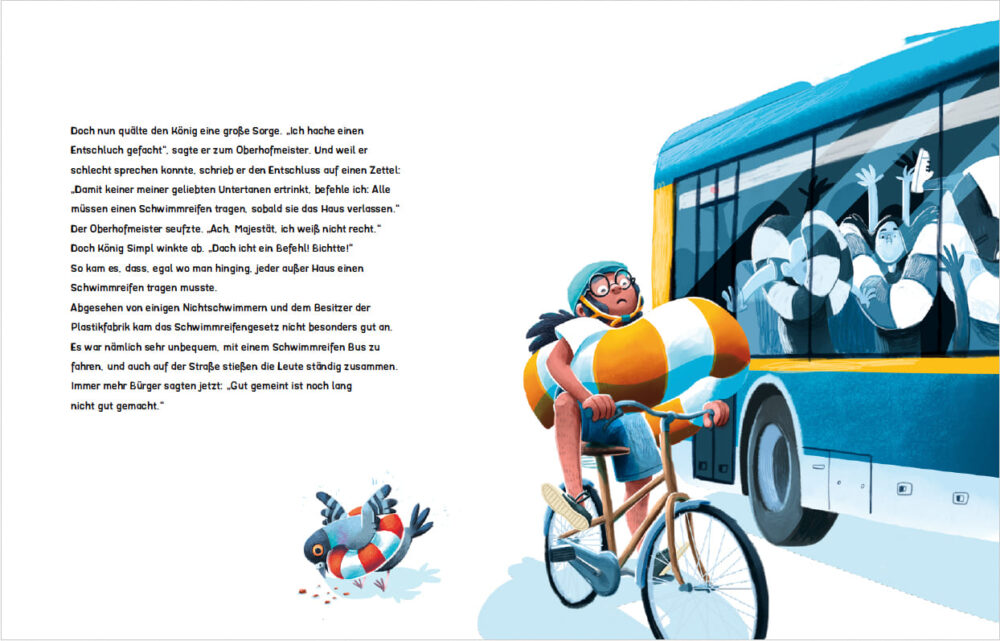
War das hier zuerst Genannte äußerst unpraktisch, so hatte das Messerverbot unter anderem zur Folge, dass es beispielsweise nur mehr Suppen, Brei und ähnliches zu essen gab. Wie das Kartoffelpüree, das die Autorin mit aufzählt, zustande kam, ohne die Erdäpfel vorher zu schälen und danach im Idealfall auch klein zu schneiden???
Wie auch immer, alles wurde immer schlimmer.
Natürlich dachte sich die Autorin eine Wende aus. Die hängt mit einer klugen Prinzessin namens Sapperlotta zusammen. Warum ausgerechnet die sich auf den Simpl einlässt – das ist nicht wirklich schlüssig, aber…
… immerhin wird am Ende sie regieren und er sich um die Kinder kümmern. Denen kann er – ein bisschen gelernt dürfte Simpl haben – vermitteln: „Merkt euch Kinder: Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht…. Vor allem aber: Angst ist ein schlechter Berater.“

Wer Kind war oder mit solchen zusammenlebt, kennt diese Tierchen mit unangenehmen Begleit-Erscheinungen: Jucken am Kopf – sofern sich dort Haare und nicht eine Glatze befinden. Scharfes Mittel zum Erst-Einreiben, spezielles Shampoo danach und Metallkamm mit eng stehenden Zähnen, um die Kopfläuse wieder los zu werden. Und in der Zeit des Befalls, ja nicht die Köpfe mit anderen zusammenstecken…
Das Bilderbuch „Luki Laus“ setzt die Reihe, die mit „Gerda Gelse“ begonnen hat und der „Willi Virus“, Susi Schimmel und „Klarissa von und zu Karies“ gefolgt sind, fort. Jeweils andere Autor:innen und Illustrator:innen (außer Leonora Leitl, die zwei Mal zuschlug) beschäftigten sich mit diesen (wunzig-)kleinen äußerst unangenehmen Mit-Bewohner:innen. Stets eingebettet in eine Geschichte aus der Sicht – nein, nicht der Menschen, sondern hineinversetzt in die Lage der Genannten – aber auch ergänzt und erweitert um Sachinformationen.
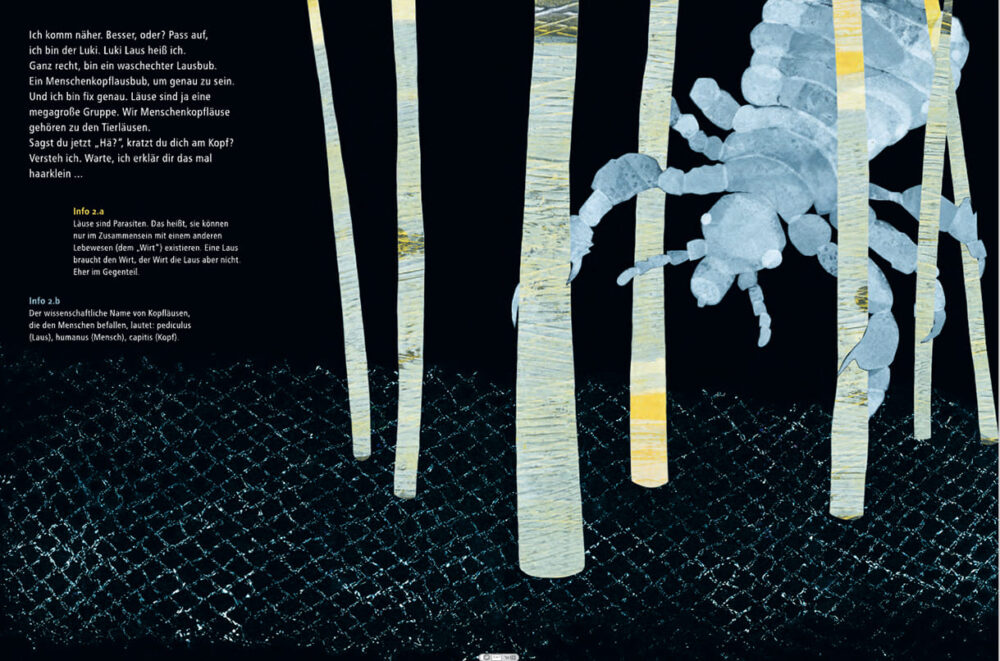
Dieses Mal war Lena Raubaum am Zug, die sich auch gleich Haare raufend als hätte sie Läuse gehabt fotografieren ließ. Sie legt Luki, einer Kopflaus, Sätze und Gedanken in den Mund. Und aus diesen ebenso wie den Sachtexten erfahren wir, was uns das Jucken verursacht, dass ihre Verwandten in Pflanzen und jene in Tieren schon zu Dinosaurier-Zeiten die Erde bevölkerten…
Und wir sehen dank der Illustrationen von Laura Momo Aufderhaar, die echt so heißt und sich keinen Künstlerinnen-Namen für dieses Buch ausgedacht hat, wie unsere Kopf- aber auch andere Läuse ausschauen. Auch in ihren verschiedenen „Nymphen“-Stadien in denen sie sich nach dem Schlüpfen aus den Eiern (Nissen) zu ausgewachsenen Läusen entwickeln. Viele ihrer Bilder schuf die Illustratorin mit Pflanzendruck.
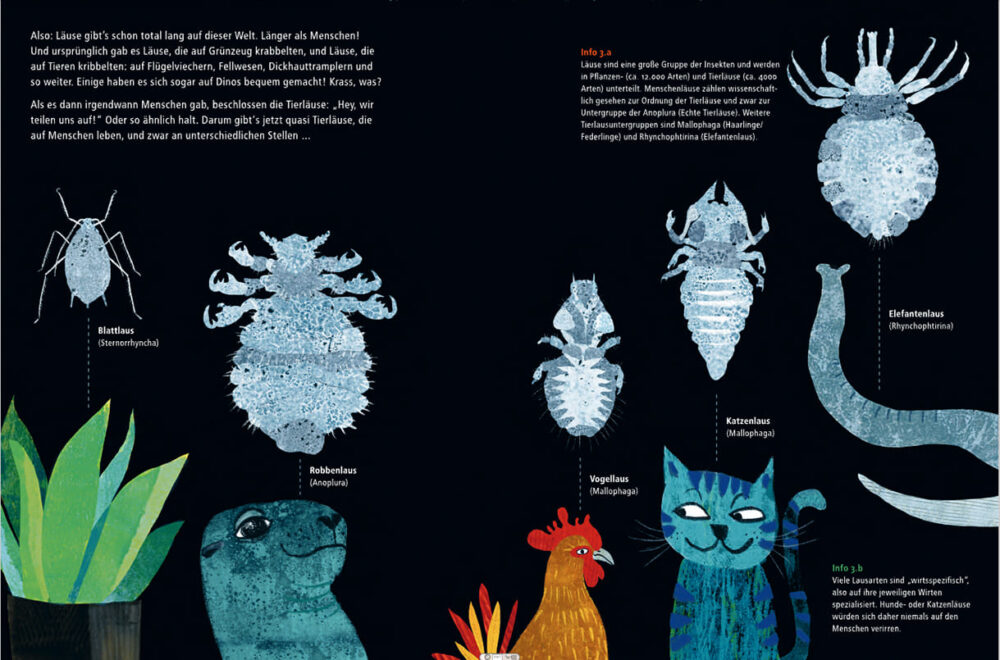
Und obwohl vielleicht dank des liebevollen Textes und der spannenden Bilder Luki und seine Kumpan:innen vielleicht ein bisschen sympathisch rüberkommen, können wir nur froh sein, wenn sie unser Haupthaar oder ihre Verwandten, die Filzläuse, andere Körperbehaarungen nicht befallen. Auch wenn wir jetzt vielleicht noch besser wissen, wie wir sie wieder loswerden!
Achja, als Beilage gibt’s ein Blatt mit „Lausmalbild“ und auf der Rückseite – oder umgekehrt – „Lausige Redewendungen und Witze“; Beispiel gefällig: „Was hat Batman, wenn er sich andauernd am Kopf kratzt?“
„Flederläuse“.
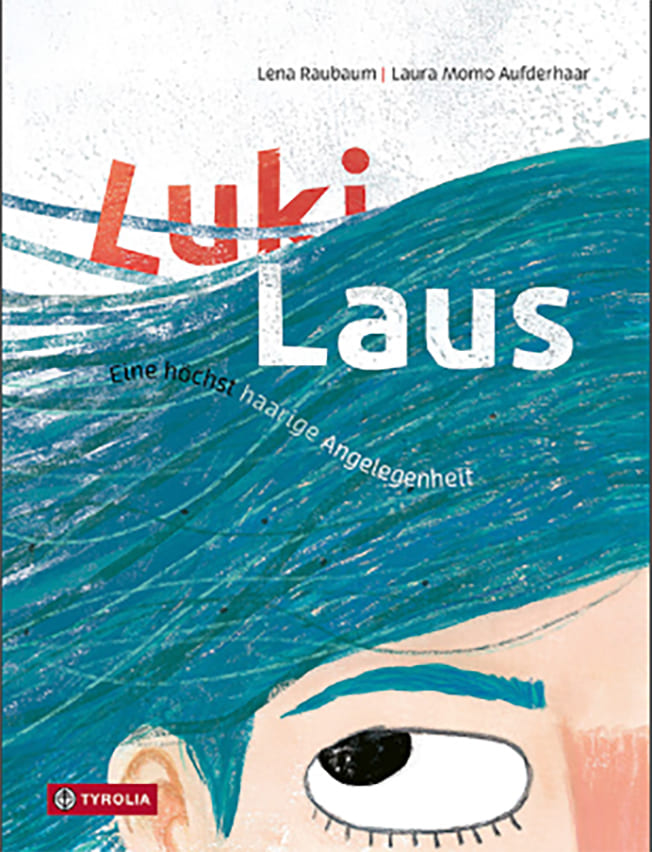
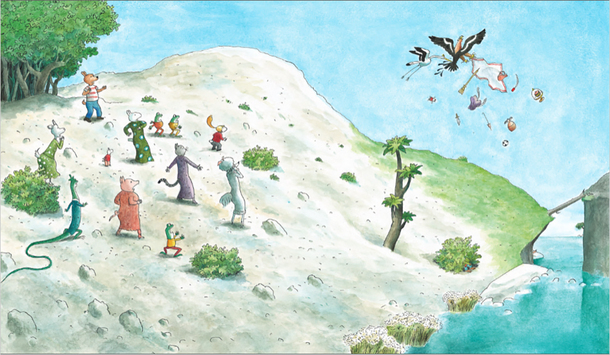
Ein neues Buch ohne Worte – aber mit Torte! Vor 17 Jahren schuf Thé Tjong-Khing, damals schon an die 80 Jahre das erste der nunmehr auf fünf Bände angewachsenen „Torte“-Serie. Merkmal dieser seiner – neben vielen anderen – Bilderbücher: Der Illustrator wird zum Autor ohne Worte, er erzählt die Geschichten rund um die Torte(n) ausschließlich in Bildern.
Die Tiere versammeln sich zu einem Picknick auf einer Wiese. Da kommt ein Adler geflogen, fährt seine Krallen aus, schnappt sich die Picknick-Decker zu einem Bündel und ab die Post. So schnell können die anderen Tiere gar nicht schauen.

Nach wenigen Metern füllt das Bündel auseinander, Lebensmittel und Spielsachen fliegen durch die Luft in Richtung Boden. Weit verstreut. Die Party-Runde hetzt zu den Fundorten, wo die Dinge auf der Erde landen. Dabei müssen sie unter anderem über einen Baumstamm balancieren, um über den Fluss zu kommen…
Plötzlich taucht aus einem Busch ein Affe auf, der manchen der Tiere die gefundenen Gegenstände ab„luchsen“ will. In der Zwischenzeit hat sich eines der Tiere nicht aus der Ruhe bringen lassen und aus Zutaten auf dem Tisch vor sich Teig und daraus „Torte(n) für alle“ gemacht.
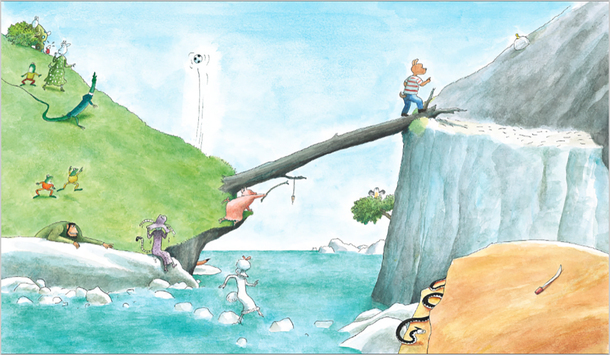
Alle?
Nicht ganz, Adler und Affe sind offenbar nicht eingeladen. Schaaade eigentlich.
Der in Indonesien geborene Sohn einer chinesisch-stämmigen Familie wanderte als junger Erwachsener in die Niederlande aus, wurde Lehrer und Comic-Zeichner, später freischaffender Illustrator von Kinderbüchern und noch später Schöpfer eigener Bilderbücher – für die der heute 90-Jährige schon etliche Preise bekommen hat.
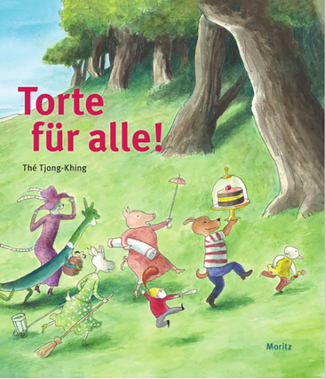
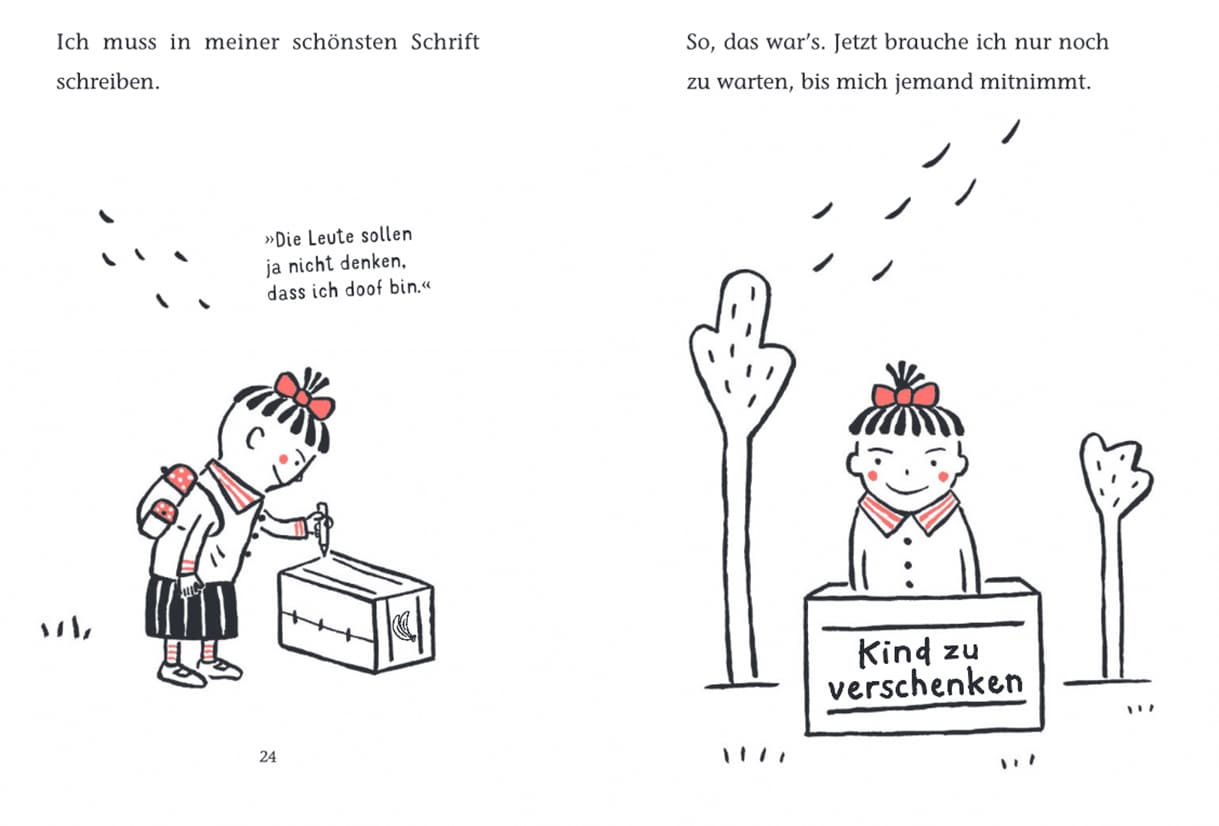
Der heftige Titel dieses bebilderten knapp mehr als 100-seitigen Buches wird zunächst auf dem Cover durch das strahlend lächelnde Kind in einem Karton erträglicher, weil es schon auf Ironie hindeutet. „Kind zu verkaufen“ von Hiroshi Ito (gezeichnet und geschrieben, ins Deutsch übersetzt von Ursula Gräfe) dreht sich also nicht um Kinderhandel, den es leider noch immer auf der Welt gibt.
Die Geschichte handelt von einem – das ganze Buch über namenlos bleibenden Mädchen – das plötzlich für die Eltern Luft zu sein schein. Grund ein kleines Geschwisterchen. Das hat übrigens sehr wohl einen Namen. „Was ist denn so toll an Daichi! Der ist ein nerviges Äffchen“, klagt die Hauptfigur des Bilderbuch-Romans. Was die Mutter der beiden mit „Aber ein süßes Äffchen“, kommentiert. Übrigens die einzige echte Antwort auf den ersten Seiten.
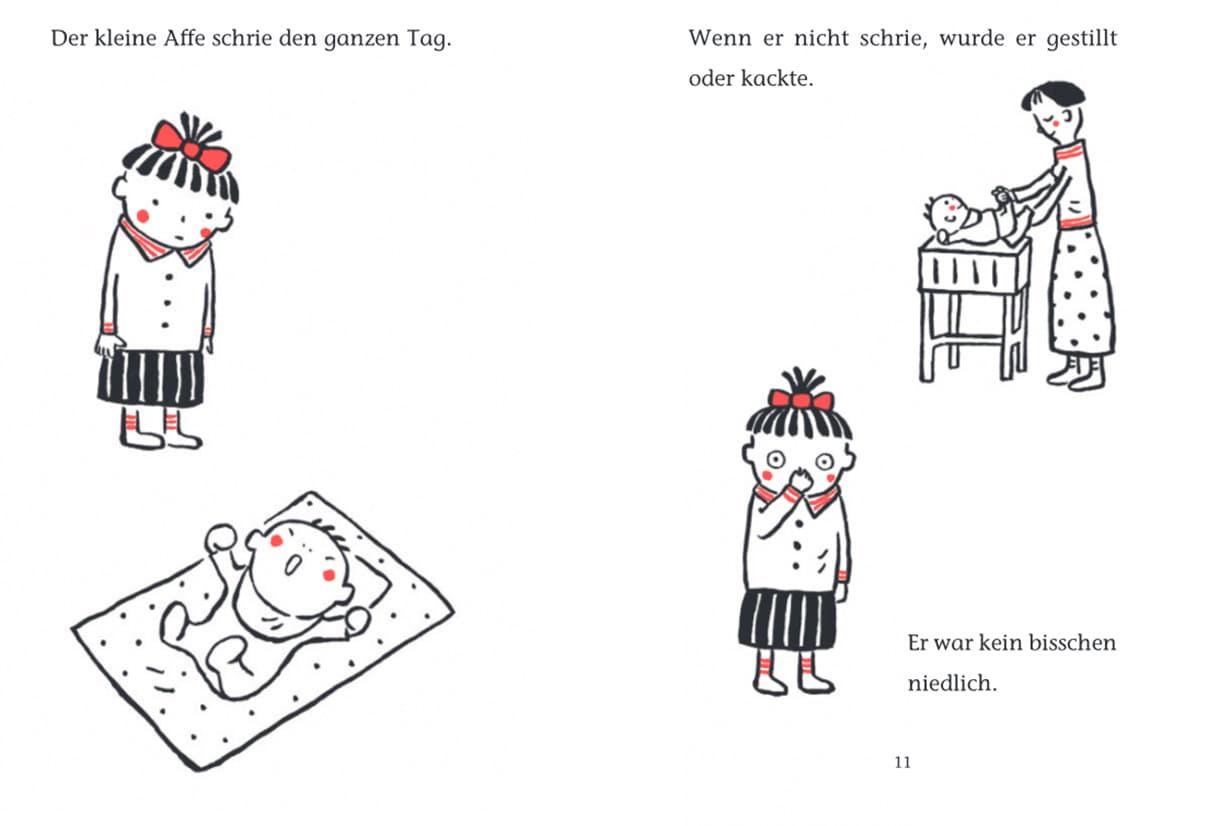
Zuvor lässt sie jeweils nur ein „Ja, ja“ aus. Egal ob das Mädchen bittet, ja bettelnd fragt: „Du brauchst mich wohl nicht mehr, Mama, oder?“ Auch auf der nächsten Seite kriegt die Tochter auf den Satz: „Ich haue ab. Ich such mir ein neues Zuhause!“ keine andere Antwort.
Auch wenn’s offenkundig eher als provokative Drohung gemeint war, um doch endlich Aufmerksamkeit zu kriegen – Versuch gescheitert. Und so packt sich das Kind zusammen. Mit einem kleinen Rucksack macht es sich auf den Weg, findet einen Karton beim Mist, leert ihn aus, nimmt ihn mit und schreibt in schönster Schrift: „Kind zu verschenken“ drauf. Dann malt es sich aus, welche netten Menschen es mitnehmen in ein neues Zuhause, wo es geschätzt wird.
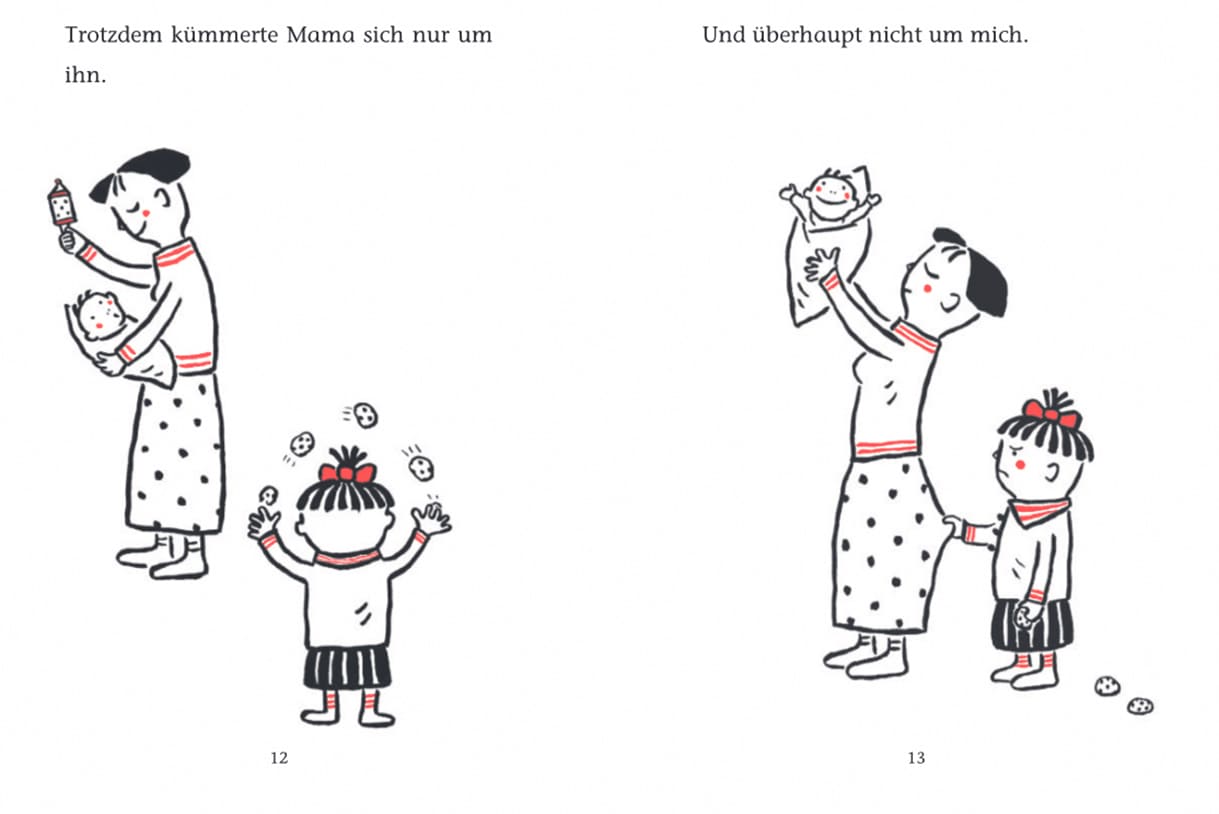
Allerdings… – wie wahrscheinlich zu erwarten, da wird nix draus. Dafür gesellt sich ein verlaufener Hund, ein Kätzchen und eine Schildkröte zu dem Mädchen in der Papp-Schachtel.
Wie’s ausgeht wird hier sicher nicht gespoilert. Das Wichtigste an der Geschichte ist ja wohl das durchaus bitterböse humorvolle Schildern, wie es allzu vielen Kindern geht, wenn ein Baby als Geschwisterchen in die Familie kommt und wie sich das verletzend anfühlen kann…
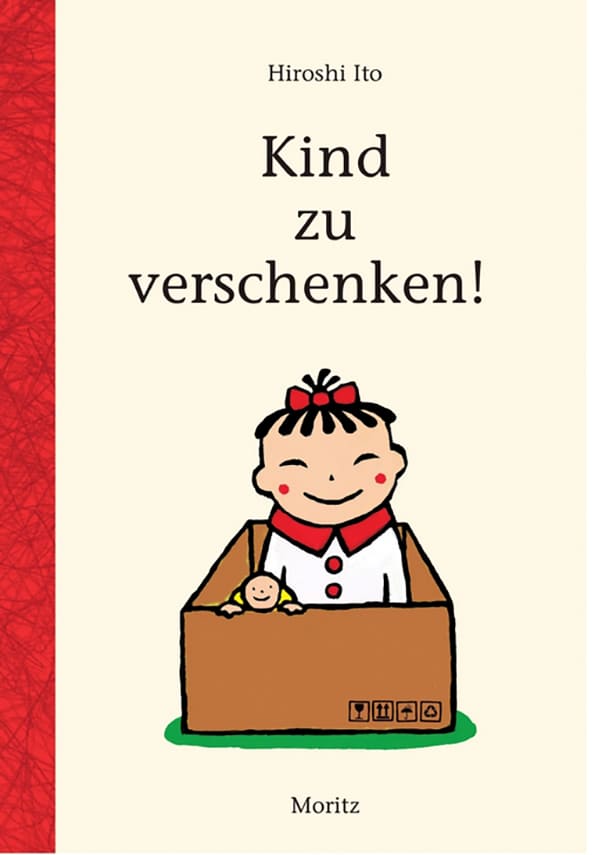
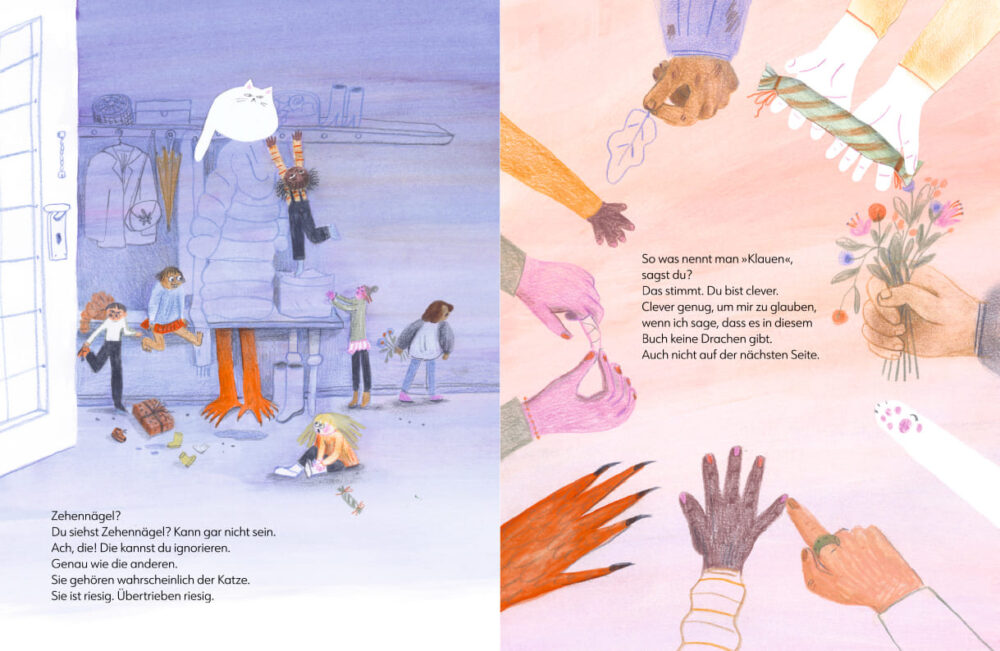
Natürlich suchst du – so wie es sicher alle tun werden -, ob der Titel dieses Bilderbuches wirklich stimmt: „Es gibt keine Drachen in diesem Buch“, das Mitte August 2023 erscheint. Wahrscheinlich gibt es Millionen von Büchern, auf die das zutrifft, aber würde irgendwer so etwas auf die Titelseite schreiben?
Klar macht das erst recht neugierig. Genau geschaut. Könnten das nicht Beine von einem… – bevor du diesen Gedanken vielleicht fasst, nachdem du etwas entdeckt hast, das, ja genau nach Drachenfüßen ausschaut, schreibt die Autorin: „Ach, die! Die kannst du ignorieren… Sie gehören wahrscheinlich der Katze. Sie ist riesig. Übertrieben riesig.“
Ähnlich spinnen Donna Lambo-Weidner und Carla Haslbauer die Geschichte Doppelseite für Doppelseite weiter. Du meinst das eine oder andere Körperteil eines Wesens zu sehen, das dich doch sehr stark an einen Drachen erinnert. Auch wenn es solche in echt nicht gibt – in Büchern, Filmen, Comics, als Spielfiguren usw. existieren sie in hunderterlei Bildern. Aber schon, hat die Autorin sich irgendeine Erklärung einfallen lassen, was das sonst sein könnte. Funken zum Beispiel aus dem Kamin oder was auch immer. Klar, irgendwann heißt’s über das Durcheinander in der Wohnung: „Das waren bestimmt die Kinder!“
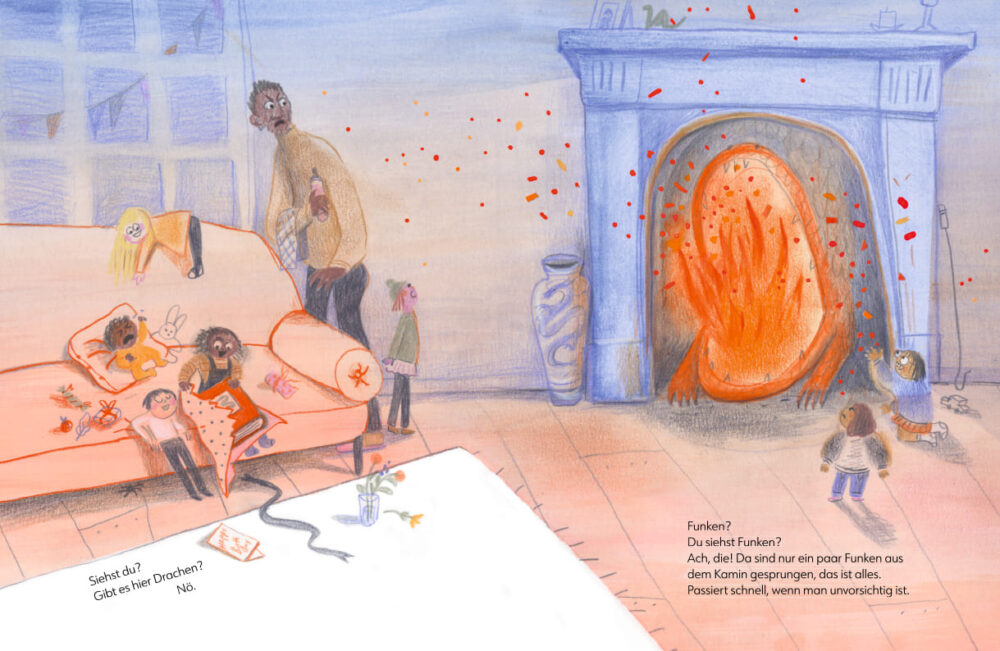
Du siehst gemalte Kinder, die offenbar sehr wohl Drachen-Körperteile sehen – der Text wirkt, als wären es die zurechtweisenden Sätze erschreckter, fantasie-befreiter Erwachsener 😉
Und so schwingt zwischen den wenigen prägnanten Zeilen und vor allem in den Bildern mit, irgendwie halten sie dich am Schmäh – nein, keine Fake News, sondern Aufbau eines Spannungsbogens sozusagen. Auch wenn hier sicher nicht alles verraten wird, ein „Trick“ sei gespoilert: Ungefähr nach zwei Drittel des Buches schaut dich – ein wenig ängstlich – ein Drache an: Eben nur einer …
Ob dann doch noch weitere auftauchen? Nun, das bleibt dir überlassen zu ergründen, entdecken, erforschen, schauen, lesen und so weiter – einige Seiten vom Anfang – findest du übrigens in der Lese- und Schauprobe, die in der Info-Box am Ende des Beitrages verlinkt ist.
Ach ja, und selbst wenn du das Ende dann kennen wirst, laden vor allem die Bilder, in denen sich noch so manches Detail versteckt, zum immer-wieder-Anschauen ein, dann fällt dir vielleicht noch nicht Gesehenes auf.
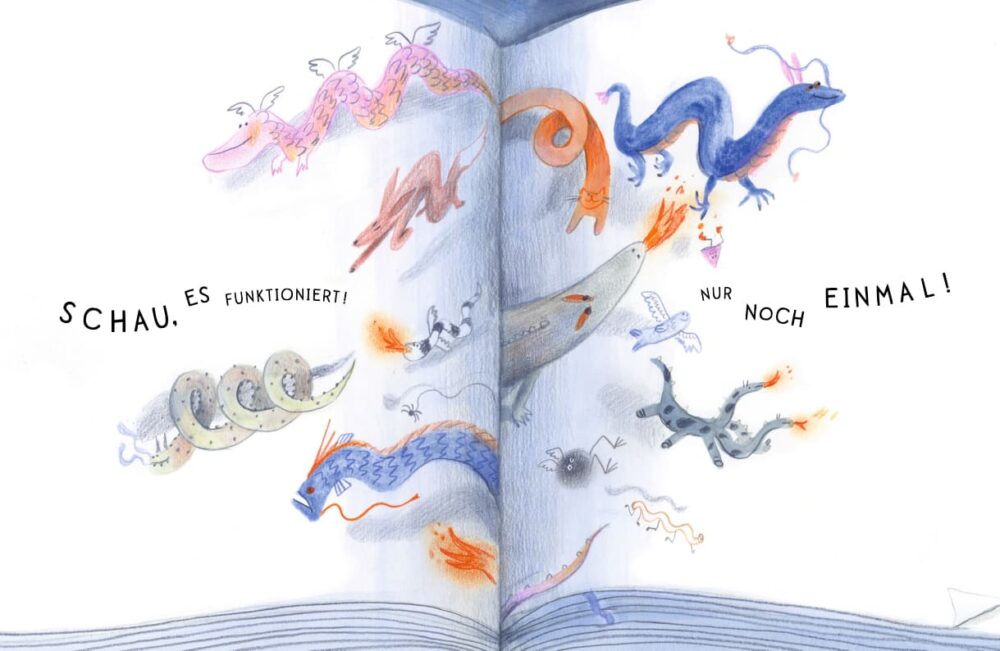
Die Illustratorin ist mit diesem Buch übrigens für den Serafina Nachwuchspreis nominiert, der von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Kooperation mit dem Börsenblatt und der Frankfurter Buchmesse vergeben wird. Die Jury begründet die Nominierung übrigens so: „Carla Haslbauers Illustrationen zeigen den ganz normalen Familienwahnsinn in großer Dynamik und Vielschichtigkeit. Diversität ist integraler Bestandteil der Geschichte, wie zufällig hingezeichnete Gegenstände auf Boden, Sofas und Tischen bieten immer wieder neue Entdeckungen und beschreiben sehr realistisch das kreative Chaos eines Kinderzimmers. Erwachsene spielen eine Nebenrolle, Hinweise auf eventuelle Drachen im Buch gibt es in vielfältiger Weise und am Schluss gibt‘s neue Nachbarn.“
Übrigens mit einem vergleichbaren Dreh arbeitete Klaus Baumgart in seinem allerersten Bilderbuch (1989, vor drei Jahren neu erschienen). Der Autor, vor allem für seine Serien „Lauras Stern“ und „Tobi“ berühmt, ließ in „Ungeheuerlich“ einen kleinen Drachen Annas Kakao verschütten. Der kleine grüne Drache sorgte für so manches Chaos am Frühstückstisch.
Na geh, das warst sicher du, Drache ist nur Ausrede meinte die Mutter. Bis es an der Tür klopft und ein großer Drache nach seinem Kind fragt.
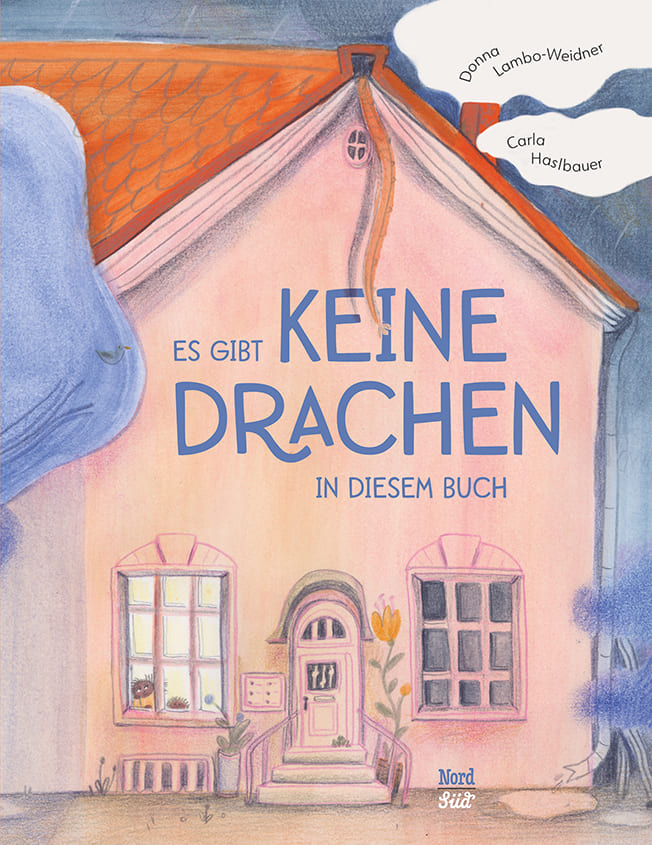
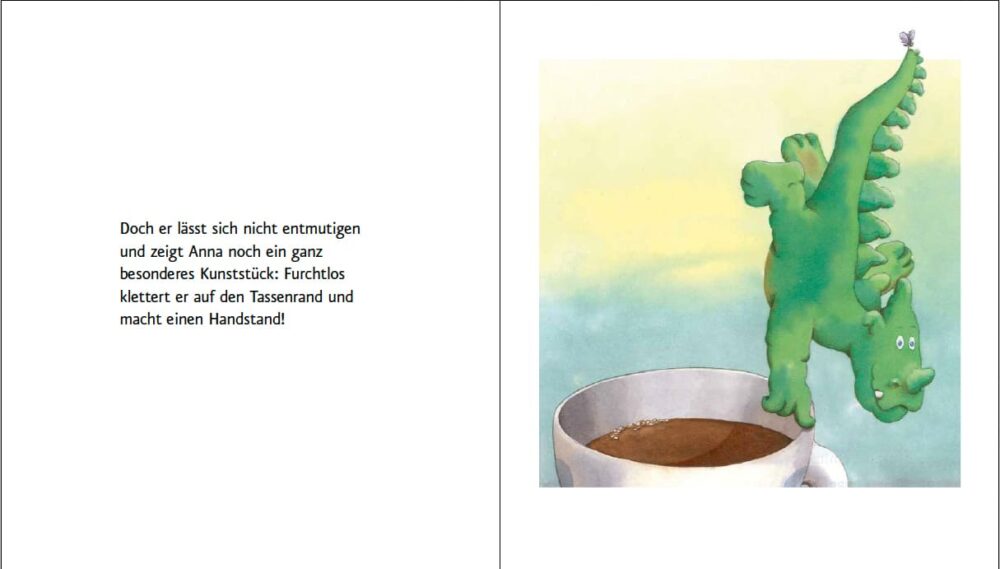
Etliche Jahre bevor Klaus Baumgarts „Stern“ vor allem mit den „Lauras Stern“-Büchern so richtig aufging, startete er mit „Ungeheuerlich“, Geschichten über einen kleinen Drachen. Sein allererstes Bilderbuch, damals nur mit diesem Titel, ist vor 34 Jahren erschienen. 1989 veröffentlichte er nach diversen Jobs, einem Jahr in Nepal und Indien zum Abschluss seines Studiums der visuellen Kommunikation in Berlin (Hochschule der Künste) die Geschichte über Anna am Frühstückstisch. Die Cornflakes-Packung fängt an zu ruckeln und zuckeln, ein kleiner grüner Drache krabbelt raus, führt sich am Tisch auf, platscht in den Kakao. Und als die Mutter das Chaos sieht und mit der Tochter schimpft, glaubt sie dieser – natürlich – nicht, dass ein Drache das angerichtet hat.
Doch dann klopft’s an der Tür: Draußen ein großer Drache: „Guten Morgen“, sagte er höflich. „Haben Sie vielleicht meinen Sohn Tobi gesehen?“
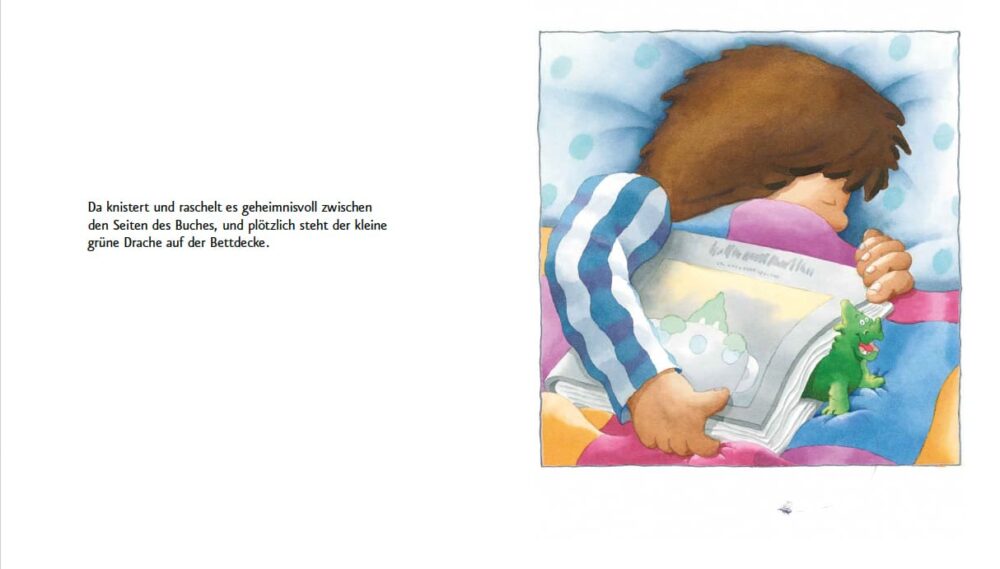
Viele Kinder kennen aus eigener (leidvoller) Erfahrung, dass ihnen Erwachsene oft nicht glauben. Diese „Bekehrung“ in diesem damals handlichen kleinen Bilderbüchlein, in der Neuauflage im Großformat (ca. A4), war so erfolgreich, dass der damalige Verlag (Breitschopf) den Autor und Illustrator glich danach bat, einen Folgeband zu schreiben und zu zeichnen. Ein bisschen unlogisch als Fortsetzung lebt Tobi, der in dem zweiten Band nur im Klappentext namentlich genannt wird, in „Ungeheuerlich – Ein kleiner Drache bleibt wach“ nur in Annas Bilderbuch. Lediglich wenn Anna schläft, kommt er heraus, spielt und schaut sich im Kinderzimmer um – und nimmt einige der Dinge mit ins Buch. Worüber Anna am nächsten Morgen klarerweise mehr als staunt.
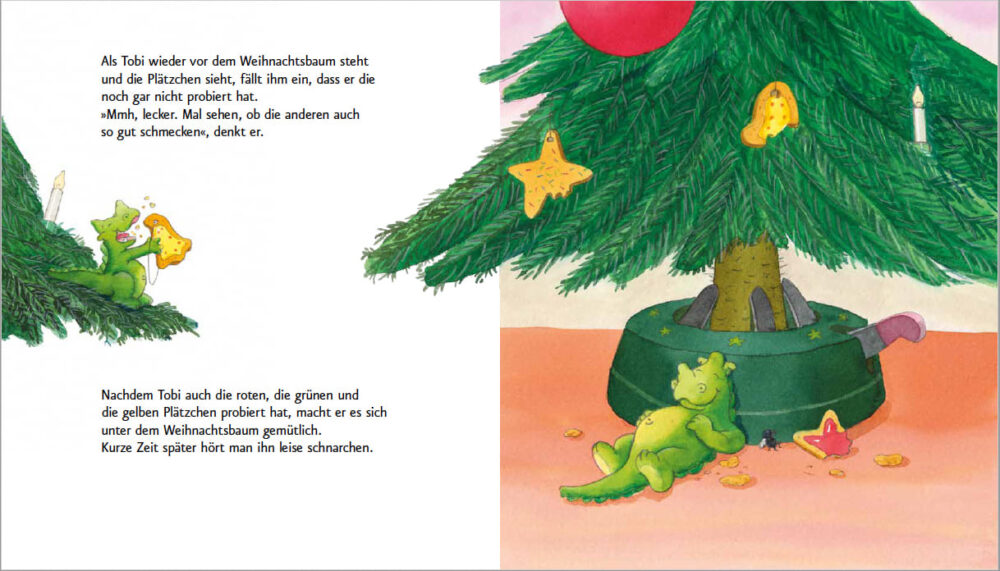
Vor drei Jahren hat der Annette Betz Verlag die Bücher neu – und wie schon erwähnt in größerem Format – aufgelegt und offenbar nach Verkaufserfolgen den Auftrag für einen dritten Band gegeben, der im Vorjahr erschienen ist. In diesem warten Anna und Tobi auf Weihnachten – und was da allerhand passiert, das ist in „Ungeheuerlich – Ein kleiner Drache wartet auf Weihnachten“ zu sehen und zu lesen.
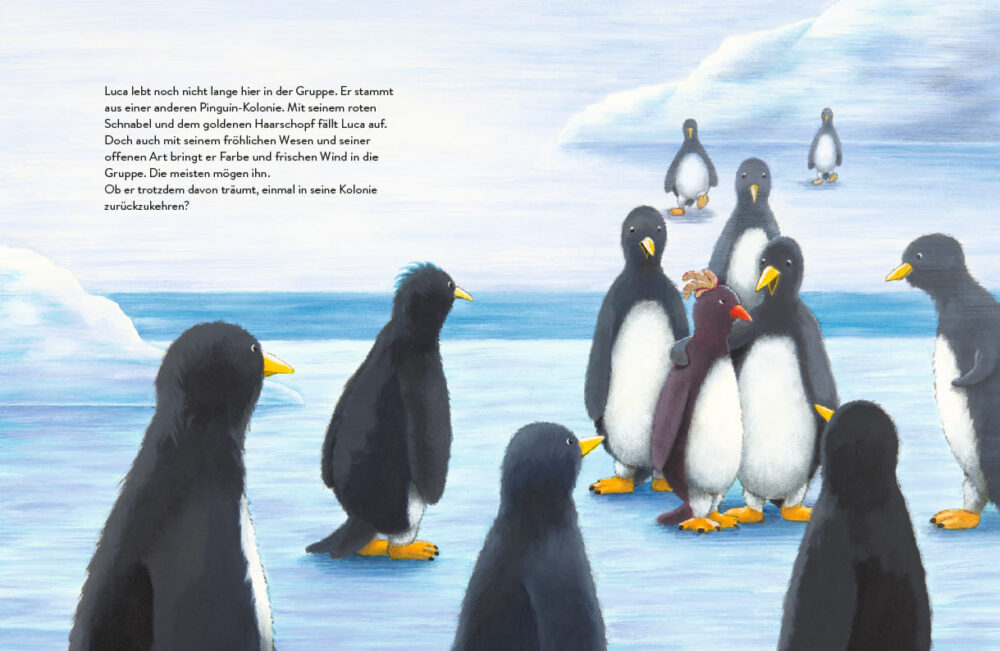
Das jüngste Bilderbuch von Marcus Pfister, der vor allem für seine Regenbogenfisch-Serie berühmt ist, dreht sich um Pinguine. Das hatte er ja schon im Vorjahr im Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… bei der Buch Wien verraten. Sogar einzelne der Bilder – vom Anfang und vom Schluss sowie einige der Charaktere hatte er dabei schon genannt – zu diesem Interview geht es hier unten.
Nun ist also „So und so – Einfach Pinguin sein“ erschienen. Und beinhaltet dennoch so manche Überraschung. Die Vielfalt dieser – auf den ersten Blick vielleicht so einheitlich erscheinenden Vögel im (hoffentlich noch lange) ewigen Eis der Antarktis. Schon auf dem Cover ist die erste Zeile des Buchtitels bunt – praktisch jeder Buchstabe in einer anderen Farbe. Blätterst du um, findest du auf der ersten Innen-Doppelseite, noch bevor das Buch so richtig beginnt, nicht ganz zwei Dutzend (22) Pinguine in Grau-Weiß-Tönen mit gelben Füßen und Schnäbel – und doch alle schon verschieden. Obendrein stechen ein rötlicher sowie ein bläulicher Schopf auf den Köpfen zweier dieser Charaktere hervor.

Und dann, nochmals weitergeblättert die innere Titelseite – hier ist die Schrift „nur“ schwarz-weiß, aber jeder der Buchstaben von „So oder so“ in einem anderen Grau-Ton. Und dabei ist das nur der Einstieg, denn von nun an nimmt dich der Autor und Illustrator in Personalunion mit in eine ganze Pinguinkolonie, die zunächst als schwarz-graue Masse erscheint, um gleich danach einzelne Individuen vorzustellen. Da ist zunächst der Neue – Luca ist aus einer anderen Kolonie hier gelandet und fällt mit rotem Schnabel, goldenem Haarschopf und lila schillerndem Federkleid auf.
Du triffst aber auch die drei Freundinnen Mila, Hanna und Emilie, die genauso BFF sein können wie heftig zerstritten. Oder Ida, die so gerne fliegen könnte, den Spaßmacher Timo, der aber innen drinnen ziemlich traurig ist. Alle Charaktere, die sich Marcus Pfister ausgedacht, beschrieben und gezeichnet hat, seien hier sicher nicht verraten, du mögest dich ja noch durch das Bilderbuch selber überraschen lassen.
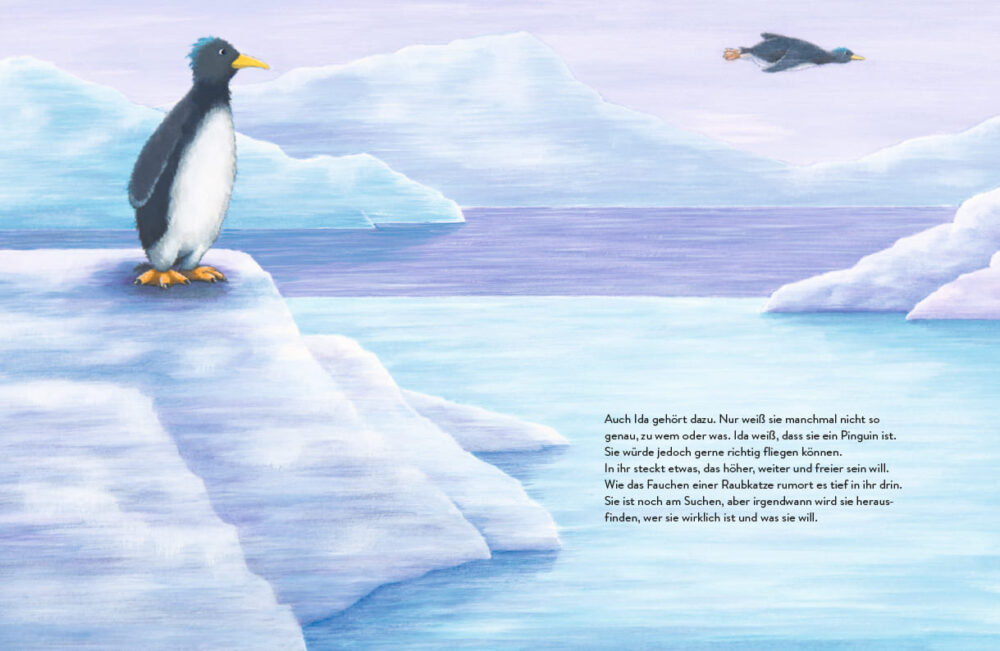
Nur eine sei noch genannt, die der Autor und Illustrator ja schon im Interview im November 2022 Preis gegeben hat – damals noch namenlos. „Lena ist verwirrt. Die anderen Pinguin-Mädchen schwärmen alle für irgendwelche Pinguin-Jungs. … sie ist verliebt in Ida… Wie kann das sein? Was stimmt nicht mit ihr? Bald wird sie merken, dass mit ihr alles stimmt, hundertpro.“
Denn die Natur ist ganz wirklich vielfältig. Es ist Tatsache, dass es neben der großen Mehrheit von Hetero-Sexualität auch im Tierreich die Liebe zu Geschlechtsgenoss:innen gibt – und sogar die Verwandlung von einem Geschlecht in ein anderes – das und mehr von tierischer Vielfalt beschreibt das wunderbare Bilderbuch „Wer ist die Schnecke Sam?“ – Link zur Rezension am Ende dieses Beitrages. Insofern ist das Wettern so mancher gegen Kinderbuchlesungen queerer Menschen oder das Pochen auf „Normalität“ sachlich völlig falsch: Denn normal ist die Vielfalt. Dafür ist „So oder so – Einfach Pinguin sein“ insofern ein optimales Plädoyer, weil es völlig unverkrampft und gar nicht „lehr-reich“ mit erhobenem Zeigefinger daherkommt.
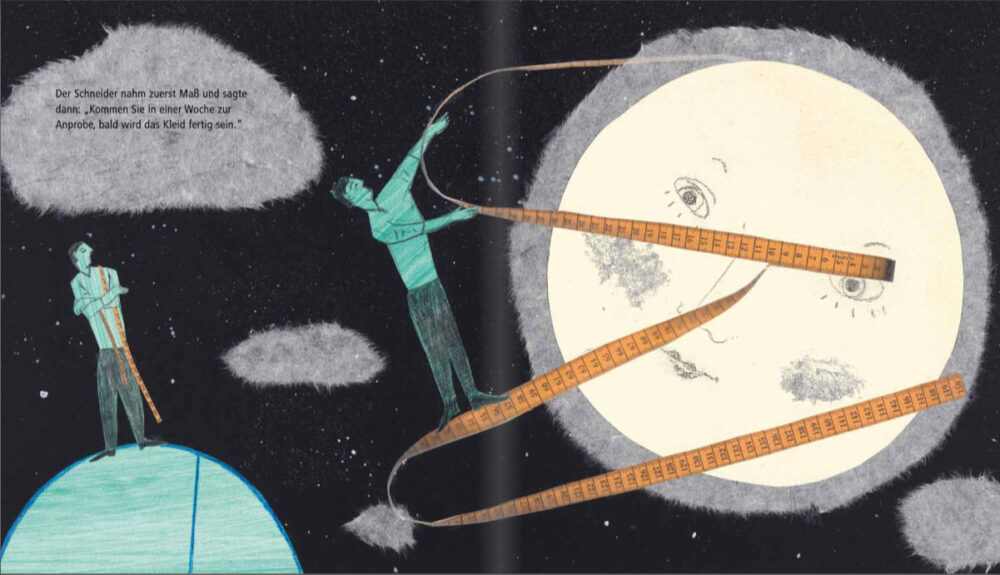
Umkränzt von einem flauschigen Kreis lächelt der volle Mond auf die Erde und bewundert die Spaziergänger:innen – vor allem deren bunte Gewänder. „Gibt es hier einen Schneider oder eine Modedesignerin?“ lässt die Autorin und Illustratorin in Personalunion, Linda Wolfsgruber, ihre Hauptfigur auf der zweiten Doppelseite rufen, auf der sie schon ein klassisches Schneider:innen-Maßband sehr zentral im Zick-Zack platziert hat.
Inspiriert von dem rund 150 Jahre alten Märchen „Der Schneider im Mond“ in der wenig bekannten Sammlung von Ludwig Aurbacher, schneiderte die bekannte, vielfach preisgekrönte Illustratorin und immer wieder auch Autorin das nun erscheinende Bilderbuch „Ein Kleid für den Mond“.
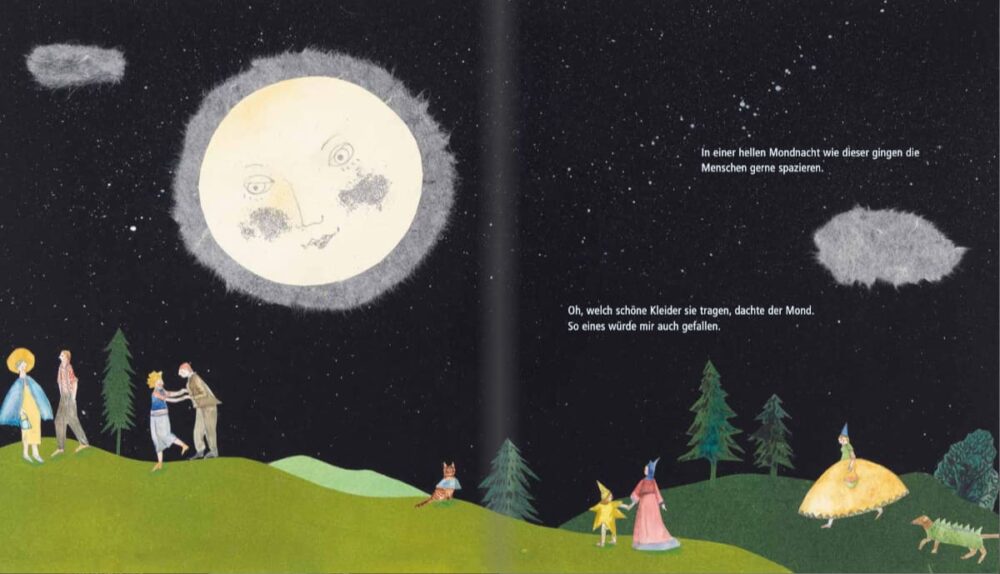
Während natürlich allen Leser:innen und Betrachter:innen von Anfang an klar ist, das werde ein unmögliches Unterfangen, geht der Schneider pflichtbewusst aber naiv an die Bitte/den Auftrag heran. Er vermisst den Kunden, schneidert aus bunten Stoffen – und: Natürlich passt’s dann nicht. Verändert der Mond doch seine Gestalt – auch wenn’s „nur“ für unsere Augen ist und er in Wahrheit immer gleich rund bleibt 😉
Der Bilderbuch-Schneider hat gerade die abnehmende Phase erwischt, also enger machen, und das von Mal zu Mal. Und dann – das kannst du dir schon denken… Linda Wolfsgruber fand in ihrem Bilderbuch – im Gegensatz zum Märchen, von dem sie sich inspirieren hatte lassen und das sie öfter als Figurentheater in Südtiroler Kindergärten bei Workshops aufgeführt hatte, ein wahrhaftes Happy End, denn schließlich… – aber nein, das soll eine Überraschung bleiben.
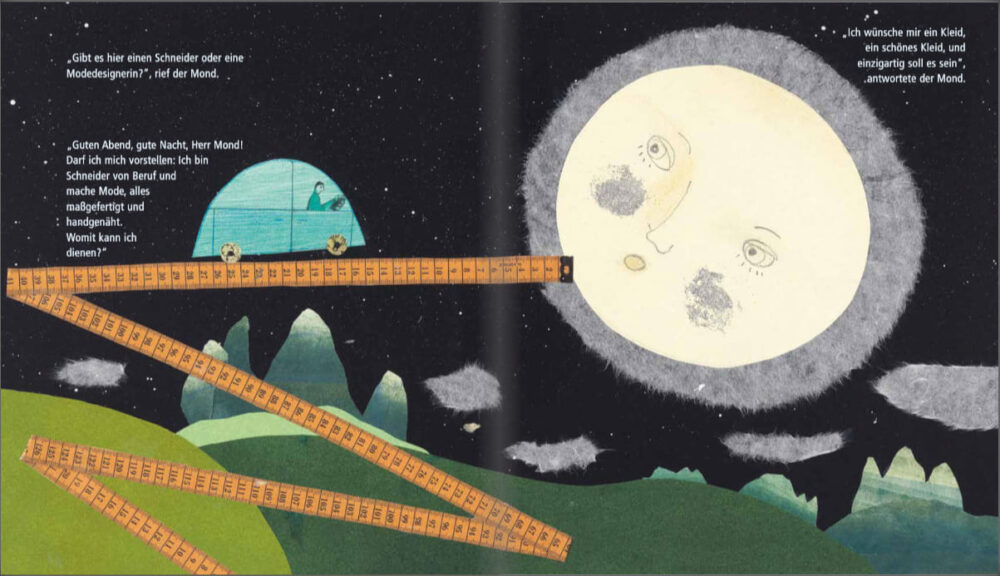
Verraten aber sei die Mach-Art der vielen bunten Stoffe auf den Bilderbuch-Seiten mit denen der Schneider arbeitet und die wie echte aussehen, insbesondere auch der flauschige Ring um den Mond oder die ebensolchen Wolken. Dachte ich, das seien wirklich echte Stoffe, eventuell langfaserige Filz und dann zusammengeschnipselt, fotografiert oder gescannt, antwortete Wolfsgruber auf die entsprechende mailige Anfrage: „Also es ist alles viel einfacher, keine echten Stoffe, kein langhaariger Filz und auch keine eingefärbte Watte, sondern… Origami-Papiere für das Kleid und der Mondschein ist aus Japanpapier (Reispapier) gerissen. Wenn man mit Wasser und Pinsel die Konturen auf das Japanpapier zeichnet, kann man es in jede Form reißen. Und wenn man das Papier nach außen wegzieht, so entstehen diese schönen Ränder.“
Und: Ist der Mond nicht wunderschön so wie er ist? Auch wenn er immer gleich bleibt und nur durch die astronomischen Lichtspiele für uns sein Aussehen ständig verändert?!
kreis-dreieck-und-quadrat -> Bilderbücherbesprechung damals noch im Kinder-KURIER
Ich möchte wieder spitz sein… „Na ja!“ Buchbesprechung zu Jutta Treiber – damals noch im KiKu

Wölfe sind derzeit in unseren Breitengraden wieder die Ur-Bösen. Während es als völlig normal verteidigt wird, dass Menschen Tiere töten, um sie zu essen, sollen die Hunde-Vorfahren, die ihren Hunger stillen, gleich zum Abschuss freigegeben werden. Dabei sind Wölfe intelligente und soziale, in Rudeln lebende Tiere, die in West-, Mittel-Europa und Japan im vorvorigen Jahrhundert fast ausgerottet worden waren. In den vergangenen Jahrzehnten wurden sie unter Schutz gestellt und wieder angesiedelt.
Und schon wurden sie wieder zu den Bösen schlechthin, in den meisten Märchen sind sie’s, in manchen greifen sie sogar zu verschiedensten Listen – so verkleidet sich in Rotkäppchen der Wolf, der die Oma verschlungen hat, als solche, um auch noch die Enkelin zu verspeisen. Bei den sieben Geißlein, taucht er das Fell in weißes Mehl und frisst Kreide, um die Stimme zu erhöhen und so die Ziegenkinder zu verspeisen. Für die Verkleidungen, Verstellungen hat sich der Begriff vom „Wolf im Schafspelz“ eingebürgert. Er geht auf sowohl auf Fabeln des altgriechischen Dichters Äsop als auch eine Jesus-Predigt im Neuen Testament zurück.

Nun ist ein üppiges Bilderbuch, eigentlich schon eine Graphic Novel erschienen, die die Kern-Idee umdreht: „Der Wolfspelz“, geschrieben und gemalt von Sid Sharp, vom Englischen ins Deutsche übersetzt von Alexandra Rak.
Bellwidder Rückwelzer heißt das Schaf, das ziemlich einzelgängerisch und eher menschlich lebt, in einem Haus, in dem es sich zu Beginn aus dem Bett räkelt und sich selbst genügt. Nur die Brombeeren, die neigten sich zu Ende. Und so wollte die Hauptfigur dieser nicht ganz 130 Seiten in den Wald, um welche zu holen. Wenige Sätze pro Seite auf – meist – in düsteren, und doch nicht wirklich Angst erzeugenden Farben (viel davon ist schwarze Tinte) bilden die Hintergründe für die stark an Comichafte Zeichnungen erinnernden Figuren. Von letzteren gibt es außer dem Schaf nicht allzu viele.
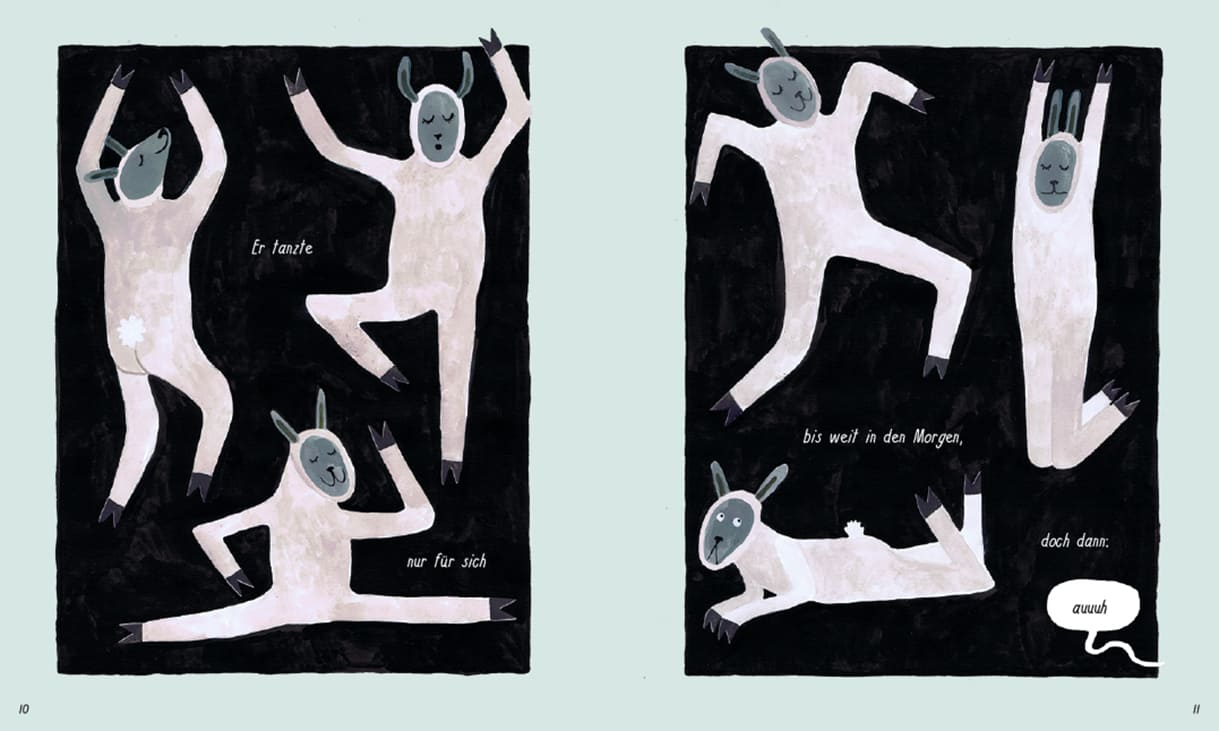
Den Wald mochte unser Schaf auch sehr gern, an den Blumen reichen, die Vögel zwitschern hören. Nur, es hatte fürchterliche Angst vor dem bösen Wolf. Da Bellwidder Rückwelzer aber sehr geschickt war und äußerst gut nähen konnte, da – dachte es sich aus: Ein Wolfskostüm zu schneidern und in dieses zu schlüpfen!
Nun fühlte sich das Schaf im Wald sicher, allerdings konnte es wegen der unter der Wolfsschnauze versteckten eigene Nase die Blumen nicht mehr riechen und die Ohren waren auch nimmer frei, weswegen der Protagonist der Geschichte auf die geleibten Gesänge der gefiederten, fliegenden Waldbewohner:innen verzichten musste. Und überhaupt war’s nicht so angenehm in dem Vollkörperkostüm, das auch noch da und dort zu reißen begann…

Aber sicher war’s trotzdem. Und Bellwidder Rückwelzer stieß auf andere Wölf:innen, von denen manche von der Form her schon ein bisschen, naja… – alles sei sicher nicht verraten, höchstens so viel, wie auch in der Verlags-Ankündigung schon steht: „Keiner der anderen Wölfe ist, was er zu sein vorgibt.“
Also eine Art Plädoyer, zu sich und seinen Eigenheiten zu stehen und sich nicht zu verstellen, um sich an- und vorgeblich sicherer zu fühlen.
Angeblich ist Sid Sharp übrigens die erste Idee, die später erst zu diesem Kinderbuch geführt hat, im Traum erschienen, wie they im Interview mit dem Verlag erzählt: „Absolut! In meinem Traum war ich ein Schaf, das versuchte, den Tag zu überstehen, ohne gefressen zu werden. Es war schrecklich! Danach habe ich viele Zeichnungen und Comics dazu gemacht.“
Und als Schlussfolgerung heißt es später in dem Interview – Link zum gesamten am Ende des Beitrages: „Bellwidder leidet ziemlich unter seinem Wolfsanzug, auch wenn er ihm vermeintlich Sicherheit gibt. Der Anzug passt einfach nicht, obwohl er sehr gut gemacht ist. Sich zu verstellen funktioniert also nie. Und trotzdem tun wir es so oft. »Sich anpassen« und »sich nicht anpassen« ist also nicht so einfach, wie es manchmal scheint. Das ist ein zentraler Punkt, den wir in meiner Geschichte untersuchen.“
Zum Interview auf der Verlagsseite
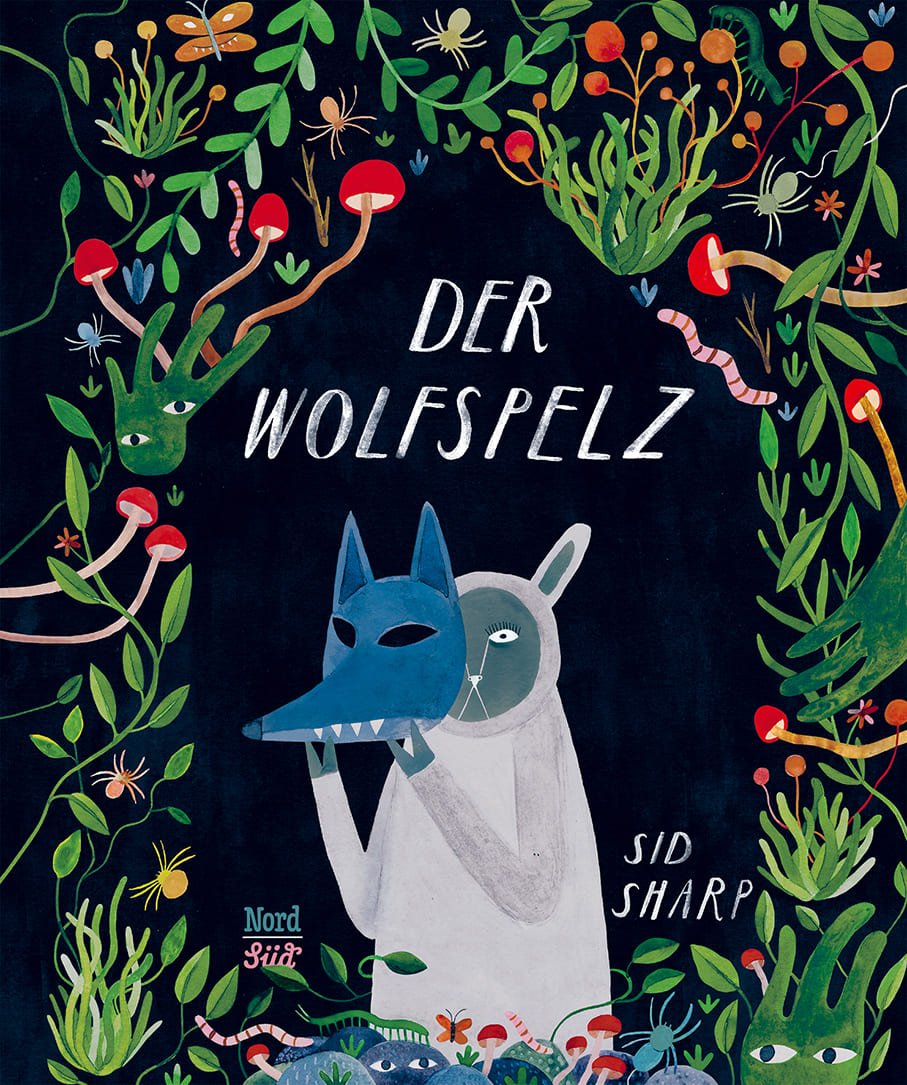
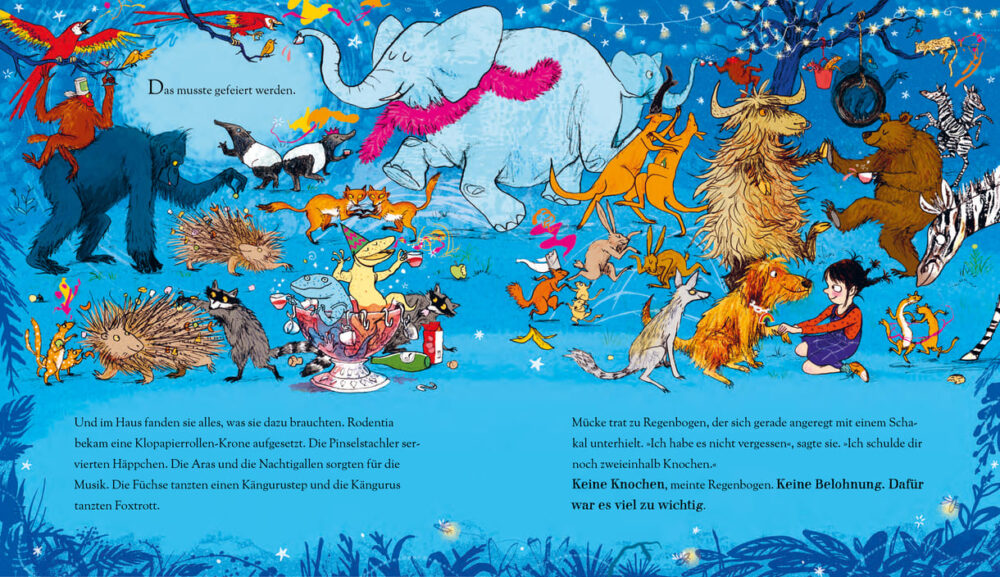
Mücke liebt es, wild zu schaukeln. Nicht nur das. Und Mücke heißt irgendwie anders, wie das verrät das ausgedehnte Bilderbuch (60 Seiten) gar nicht, weil das Mädchen den eigenen Namen gar nicht mag. Aber Mücken findet sie faszinierend – so klein diese Tierchen auch sind, so können sie sich gegen viel, viel Größere zur Wehr setzen. Naja, (Tot-)Schlägen mit Hand, Zeitung, Fliegenpracker oder Insektensprays fallen sie schon oft zum Opfer – das verheimlicht Autorin Katherine Rundell (Übersetzung aus dem Englischen: Nadine Mannchen).
Aber darum geht’s auch gar nicht wirklich. Hier ist sie eben Mücke. Und die fällt beim wilden Schaukeln eines Abends kopfüber in ein Gebüsch, nachdem sie zuvor von einer langen Zunge abgeschleckt wurde. Und so landet Mücke bei einem Zebra-Kind, das sich später als Gabriel vorstellt.
Auf Anhieb kann Mücke verstehen, was Gabriel sagt, naja, sie kann’s fühlen und vor sich in bunten Farben sehen. Mücke kann auch andere Tiere verstehen – und umgekehrt mit ihnen reden.
Gabriel ist traurig, er vermisst seine Eltern. Und die sehen wir schon in einer Art Parallel-Handlung davor. Ein Mann hat zwei ausgewachsene Zebras gefangen und eingesperrt. Und genau die sind Gabriels Eltern – lässt sich vermuten. Hier darf’s deswegen auch schon verraten werden.
Mücke aktiviert nun tierische Freunde, die wiederum die Information weiterreichen und letztlich … genau: Happy End.
Die Illustrationen von Sara Ogilvie, einerseits in naturalistischen Bildern und andererseits in fantasievollen, farbenfrohen Elementen für die Kommunikation zwischen Mücke und den Tieren, ergänzen die in knappen Sätzen erzählte Geschichte eines Kindes, das sich für Tiere einsetzt und durch nichts vom durchaus schwierigen Unterfangen abhalten lässt.
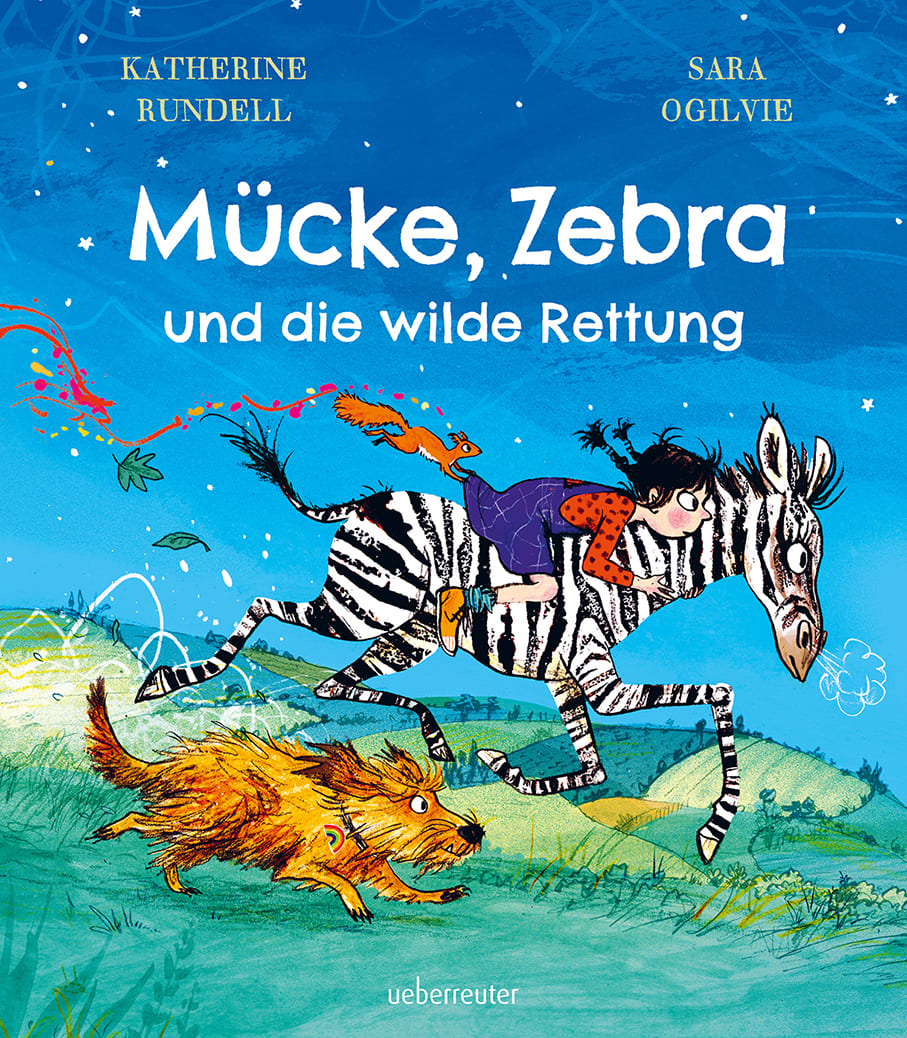
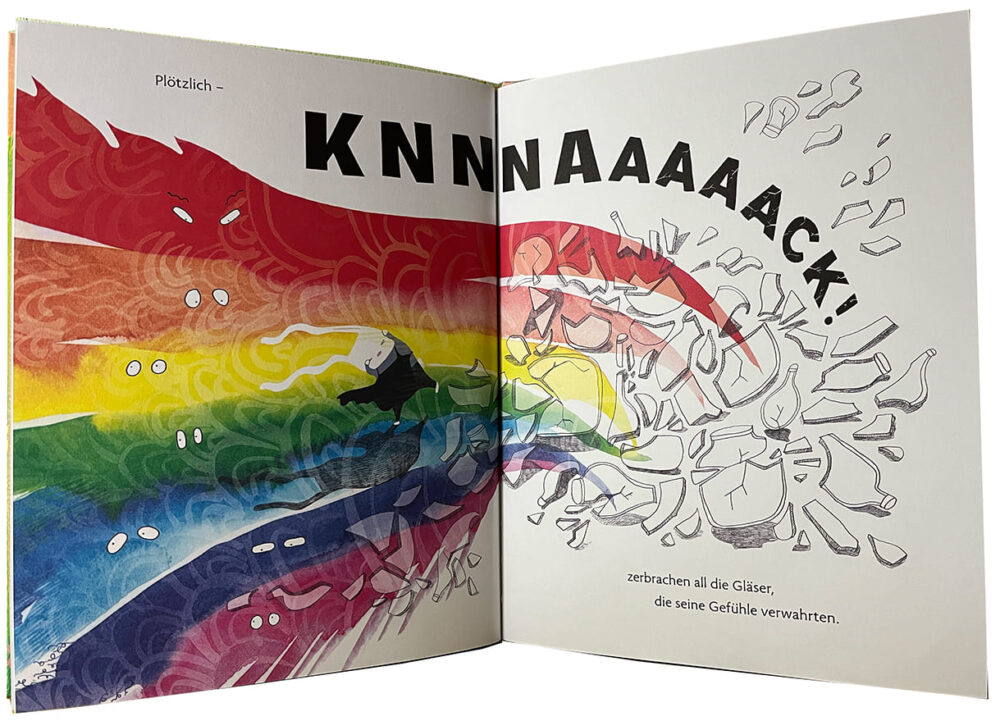
„Warum können Skelette so schlecht lügen?“
„Weil sie so leicht zu durchschauen sind!“
Dieser „gruselige Witz“ ist das zweite Bild samt Sprechblasen im jüngsten – übersetzten – Buch von Deborah Marcero. Wieder lässt sie die Leser:innen und natürlich nicht zuletzt Schauer:innen – es ist ja ein sehr üppig illustriertes Bilderbuch mit wenigen Textzeilen – eintauchen in das (Gefühls-)Leben von Leander, einem hasenartigen Wesen.
Wie schon in ihrem vorigen Werk „Freunde“ – Link zu dieser Buchbesprechung unten am Ende des Beitrages – spielen auch Gläser mit Schraubverschluss eine große Rolle. Sammelte er im ersten alle möglichen Gegenstände, die so auf dem Weg lagen und ihm zumindest ein Schmunzeln ins Gesicht zauberten, so sind hier die Inhalte nicht so greifbar.
Zurück zum Beginn dieses neuen Buches – das übrigens im Original „Out of a jar“ (Raus aus einem Glas) heißt: Leander liebt – das hat sich die Autorin und Illustratorin eben so ausgedacht – Gruseliges: Bücher, Witze, Filme. „Aber“ – so findet es sich gleich auf der zweiten Seite neben seinen geschilderten Vorlieben – „Leander mochte es überhaupt nicht, selbst Angst zu haben.“
Er versuchte dieses Gefühl unter seinem Bett zu verstecken, unter den Teppich zu kehren und so weiter. Nach zwei Seiten, in denen er die Angst wegzupacken trachtete kam er – natürlich, eh klar – auf die Idee, sie in ein Glas zu verfrachten.
Ab dem Moment war er angst-los. Dann aber tauchten andere Gefühle auf, die ihm Sorgen bereiteten: Traurigkeit, Aufregung, Wut, Einsamkeit und noch viele mehr. Aber Leander wusste sich ja zu helfen: Ab damit in das eine, ein anderes und noch ein weiteres Glas… Bis er „fast nichts mehr fühlte“.
Klar, dass die Autorin, die ihre Bilderbücher mit Bleistift, Wasserfarben, Tinte und digitalen Werkzeugen zeichnet und malt, es dabei nicht bewenden lässt. Und so zerbrechen eines Tages alle Gläser – und all die weggesperrten Gefühle überrollten Leander. Natürlich war das in diesen Augenblicken alles andere als leicht für ihn, aber er lernte rasch, den Mut zu haben, zu fühlen…
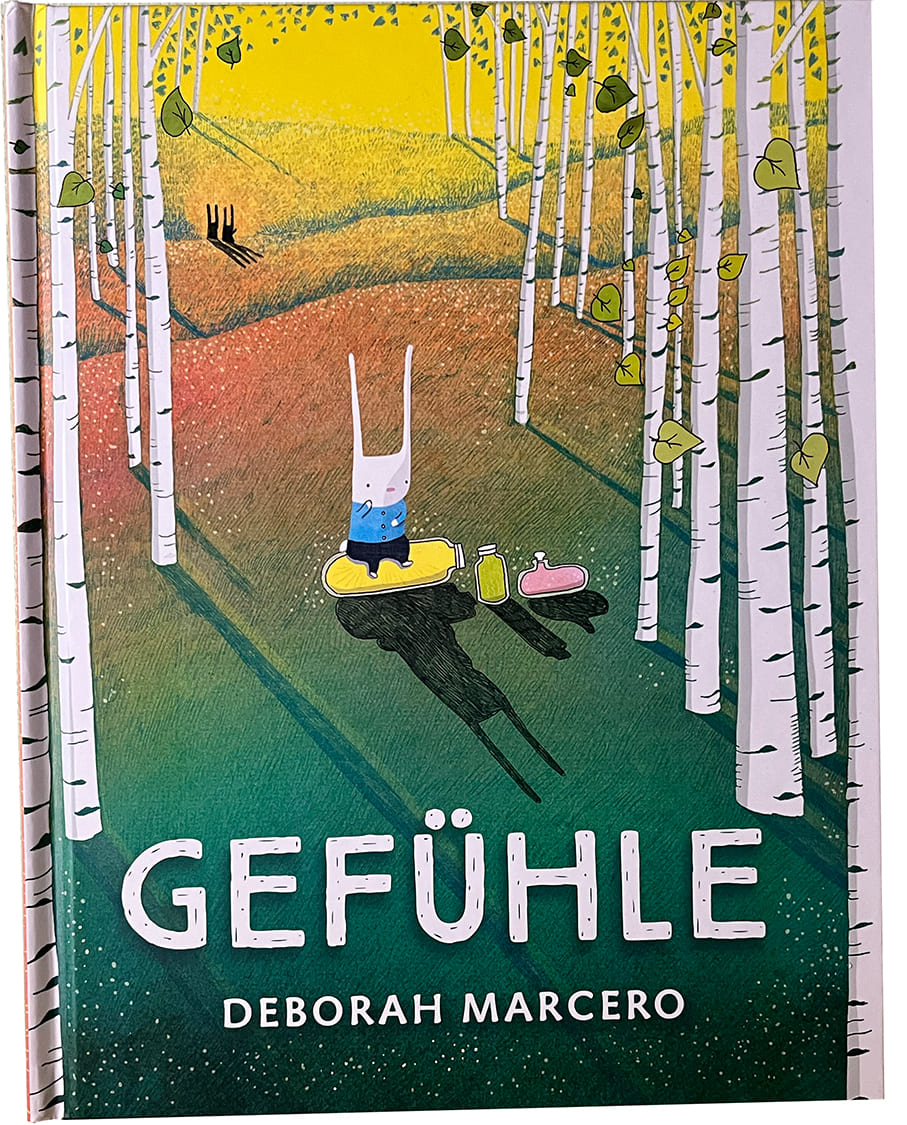
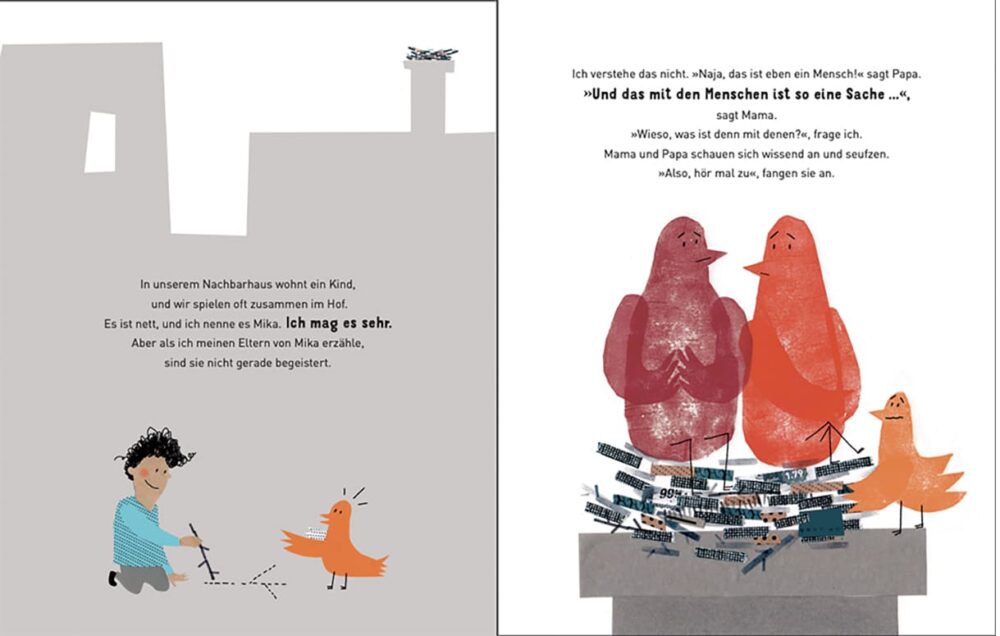
Die Eltern finden es gar nicht so toll, dass die Hauptfigur in diesem Bilderbuch sich mit dem Kind aus dem Nachbarhaus anfreunden. Mika heißt dieses Kind. Die Eltern des namenlos bleibenden Vögelchens aber können nur ihre Köpfe schütteln. „Naja, das ist eben ein Mensch!“
Und das mit den Menschen sei „so eine Sache“, sie seine jung auf der Erde, was Vögelchen kommentiert: „Naja, nur dass sie jung sind, spricht doch nicht gegen sie, oder?“
Aber was die alles aufführen, verbauen Wiesen, holzen Wälder ab. Fast jede Idee, die sie hatten und haben zerstört Natur, Lebensraum von Tieren… – in „Aaah, diese Menschen! – Und wie sie mit ihren Ideen fast alles versaut hätten…“ von Miro Poferl, die sich die Geschichte sowohl ausgedacht als auch getextet UND illustriert hat.
Vögelchen versteht, ist aber trotzdem traurig, Mika scheint doch so nett zu sein. UND das Kind hat auch viele Ideen – die in eine ganz andere Richtung gehen – Blumen und andere Pflanzen setzen. Andere folgen und pflanzen Bäume… worauf die Eltern zwitschern: „Du, da tut sich gerade was – die kriegen ja glatt noch die Kurve“ und den eigenen Nachwuchs bitten, doch das befreundete Menschenkind kennenlernen zu wollen.
Dieses Bilderbuch vermittelt – und das ganz und gar nicht belehrend – das wohl drängendste Problem, vor dem die Menschheit steht. Klimawandel, vielmehr -krise – das weltweit insgesamt drängendste Problem. Für die Erde? Ja und Nein, auch wenn die Menschheit den Planeten krass zerstört, wenn es kein Umdenken und vielmehr -handeln gibt, werden die Menschen viele Tier- und Pflanzenarten vernichten und sich selbst ausrotten. Die Natur wird sich danach erholen und sehr wohl überleben.
Wobei das mit der Hoffnung auf Änderung, weltverträglichem Verhalten der Menschheit so eine Sache ist. Schon vor fast 90 Jahren hat der jung im Konzentrationslager Buchenwald an Typhus verstorbene scharf analysierende und formulierende Schriftsteller Jura Soyfer in „Der Weltuntergang oder die Welt steht auf kein‘ Fall mehr lang“ bei einer Zusammenkunft unseres Planetensystems mit der Sonne geschrieben, das Problem der Erde sei, dass sie Menschen hat. (Übrigens ab 12. September 2023 im Theater Arche in Wien-Mariahilf.)
Und im „Lied des einfachen Menschen“ schrieb Soyfer: „Wir sind das schlecht entworf’ne Skizzenbild/ Des Menschen, den es erst zu zeichnen gilt…“
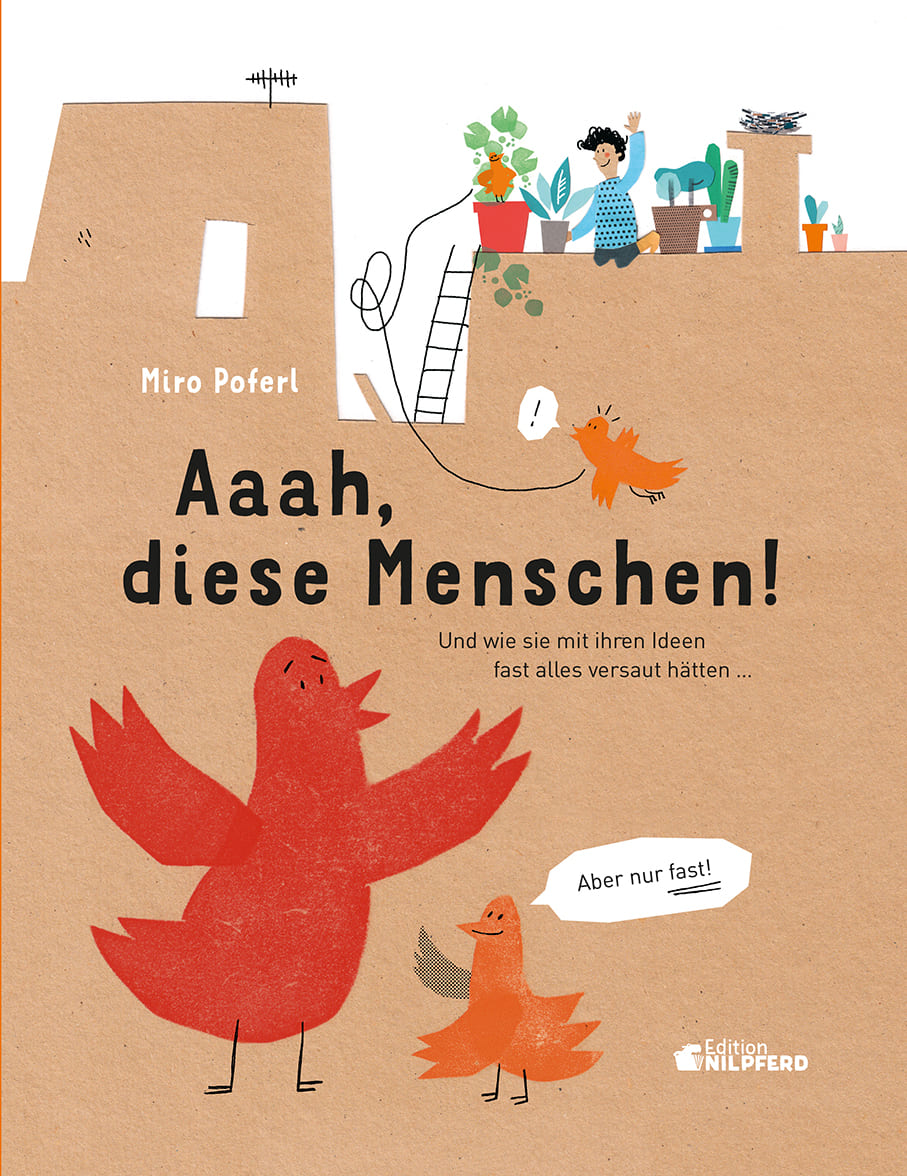

Zwischen der großen Außenrunde in der das Publikum auf Pölstern und manche dahinter auf Sesseln sitzen und einem acht-eckigen Kobel mit metallenen Querstreben bewegen sich zwei Tänzerinnen- Christine Maria Krenn und Jolanda Lülsdorf -, klauben mal da dann wieder dort schmale, biegsame Metallstreifen auf, ordnen sie neu an, beginnen damit zu spielen, basteln Gürtel, Schnäbel, Vogelflügeln, vieles mehr und einen Geigenbogen – just in dem Moment als die dritte im Bunde (Judith Koblmüller) tatsächlich einen Geigenbogen in dem Gefängnis oder Baumhaus (?) in der Mitte bedient und damit auf der Violine zu spielen anfängt.
Zu dieser sowie zu Musik aus einer Blockflöte verwandeln sich die Tänzerinnen in spielende Kinder, wobei Christine Maria Krenn, die auch für Regie und Choreografie verantwortlich ist, immer die Prinzessin spielen will – im Bilderbuch, auf dem dieses Stück basiert, heißt sie Lamia. Die andere darf höchstens Räuber sein, obwohl sie auch so gern einmal gekrönt wäre. Irgendwann biegen die beiden zwei Metallstreifen zu länglichen Ovalen und platzieren dazwischen eine lange runde Stange.
Da das Stück – so wie das Bilderbuch von Lisa Aigelsperger – „Panzerschloss“ heißt, liegt nahe, was das gebastelte Objekt darstellt. Nun schiebt die Musikerin aus ihrem „Bunker“ ein noch längeres Rohr über die Oberkante und zitiert aus dem Buch, das die Künstlerinnen sehr frei umsetzen konnten: „Ihr lieben Kinder, das hier macht BUMM BUMM, und dann fallen alle Um“ (Buchbesprechung am Ende des Beitrages verlinkt).
Krieg. Bedrohung in wenigen, einfachen Mitteln dargestellt schon für sehr junge Kinder. Bedrohung von außen? Helfen da Zäune und Mauern? Also werden die Umsitzenden eingeladen, aufzustehen, eine menschliche Mauer zu bauen, gemeinsam aus den herumliegenden Metallteilen – es sind die Elemente von Rollos wie sie auch den „Bunker“, das Baumhaus (?) verbarrikadieren – eine Art Zaun zu bilden.
Aber kam nicht die Bedrohung von innen? Dort rollten doch die Panzer, aus dem Zentrum kam das ganz große Kanonenrohr. Und sind nicht die stilisierten „Soldat:innen“ aus den Metallgestellen für große Mistkübel auch von innen gekommen?
Diese sich szenisch aufdrängenden gar nicht ausgesprochene Fragen sowie aus dem Off eingespielte Gedanken von Kindern, die im Probenprozess in Theater-, Musik- und Bau-Workshops von den Bühnenkünstlerinnen eingebunden worden sind, und natürlich die Grundgeschichte des Bilderbuchs lassen aus dem Bunker, dessen Teile nun zu Toren werden, und dem Panzer ein Schloss werden, in dem gemeinsam gefeiert und gespielt wird. Gemeinsam lassen sich sozusagen Mauern und Zäune niederreißen und ein fröhliches Miteinander entstehen…
Die Arbeit der Künstlerinnen mit den Kindern in den genannten Werkstätten führten nicht nur zu aufgenommenen und eingespielten Sagern über Regeln, Mitsprache und den Umgang der Menschen mit der Natur, sondern führte zu vielen Inspirationen für Szenen und nicht zuletzt auch Bühnenbild. Übrigens, die Metallstreifen – Lamellen der Rollos – stammen ebenso aus dem Gebäude der alten Linzer Kunstuni, sozusagen einem Abbruchhaus wie die feuerfest imprägnierten Vorhänge, die sowohl zu Umhängen für die Prinzessin als auch zu Soldatenröcken werden (Bühnenbau: Birgitta Kunsch). Die Rollos in den hölzernen Türrahmen des anfänglichen Bunkers ergeben somit variable Situationen: Blickdicht verschlossen, dann wieder wenigstens Blicke freigeben, die Kipp-Elemente in den Rahmen lassen die im ersten Teil verschanzte Musikerin später doch den Kontakt mit der Umgebung aufnehmen. Diese Lamellen sind aber auch die Elemente für die Prinzessinnen-Krone bzw. Blumen rund um das doch irgendwie auch heimelige Ambiente im Foyer des ersten Stocks im Linzer Musiktheater, wo „Panzerschloss“ beim Schäxpir-Theaterfestival für junges Publikum gespielt wurde/wird.
Wenngleich das Musiktheater bei Vermietung von Räumlichkeiten vielleicht darauf achten könnte, nicht zeitgleich im Stock darunter eine private Hochzeit einzubuchen, wo Jubel aufbrandet, während einen Stock drüber sich gerade eher ruhige Szenen abspielen.
Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die ersten vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.
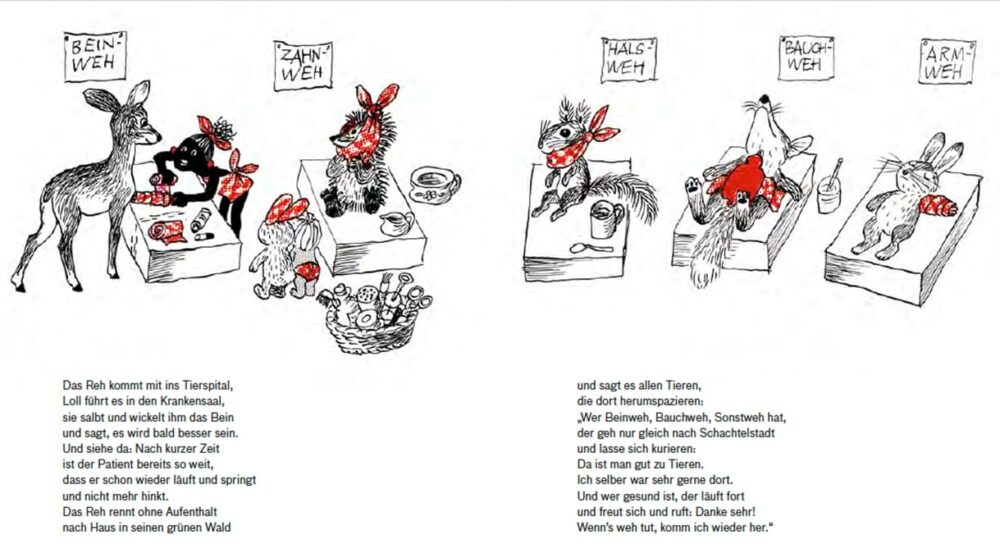
Nachhaltigkeit – davon reden viele. So manche tun auch was dafür – so präsentierten bei zwei großen Bewerben (Jugend Innovativ und Junior Companys) ältere Schüler:innen – Oberstufe – ganz handfeste, konkrete Projekte, mit denen sie Müll vermeiden bzw. Dinge recyclen: Zweites Leben für alte Akkus beispielsweise (ReCell), ein schulübergreifendes Netzwerk zum Kleidertausch und mehr, Verarbeitung von Brotrestln, die weggeworfen worden wären zu köstlichen Crackers (Scherzl mit Herzl)… – Links zu Ersteren unten am Ende des Beitrages, die Reportage über die Junior-Firmen von Schüler:innen folgt am 8. Juni 2023.
So wichtig der Gedanke der Nachhaltigkeit gerade heute ist, einige Menschen haben schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen, etwa die (leider längst verstorbenen) Kinderbuchmacherinnen Mira Lobe und Susi Weigel (bekannt nicht zuletzt für „Das kleine Ich bin ich“ oder „Die Geggis). In „Lollo“ – das noch, vertont und mit interaktiven Workshops für Kinder – am 7. Juni 2023 im Dschungel Wien läuft. Dort ist auch schon kurz das Bilderbuch erwähnt, auf dem die Geschichte aufbaut.
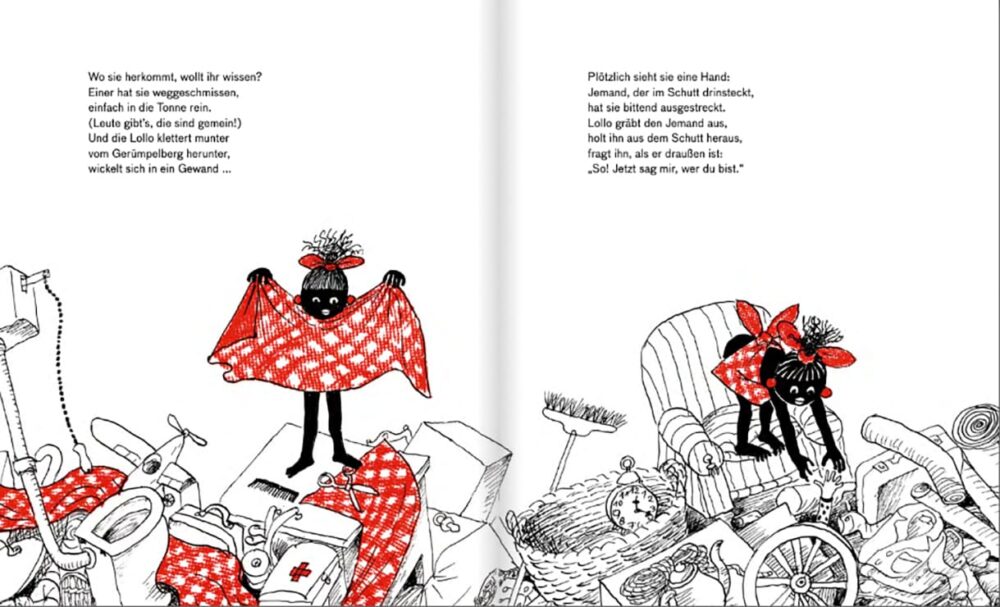
Es ist übrigens ein für Bilderbücher ganz schön dickes – 72 Seiten Inhalt mit – wie es für die Bilderbücher dieses Duos praktisch immer der Fall war Reimen. Lollo ist eine – auch das eher für die Entstehungszeit ungewöhnlich in Österreich (1987) schwarze Puppe mit der damals üblichen N-Wort-Bezeichnung, die in der Neuauflage 2013 erklärt wird, weshalb dieses Wort eigentlich vermieden werden sollte, weil es für die Betreffenden abwertend verwendet wird.
Also, diese Lollo kämpft sich aus der Müllhalde heraus, sucht sich dort Stoff, aus dem sie sich ein Kleid anfertigen kann. Stoff verwendet sie sozusagen als Puppendoktorin nun auch, um anderen Spielzeugfiguren und -tieren zu helfen, sie zu verarzten. Aus Weggeworfenem, weil da und dort was fehlt, wird wieder vollwertiges Spielzeug.
Neben diesem Re- oder Upcycling spielt Zusammenhalt und Freundschaft – wie in praktisch allen Mira-Lobe- und Susi-Weigel-Büchern eine große Rolle. Sogar die kleinen Mäuse, die zu Dieben werden und den wertvollen Stoff stehlen, der als Bandagen bei den Verletzungen dient, werden zwar gestellt, aber nicht ausgeschlossen, sondern einbezogen – sozusagen resozialisiert 😉
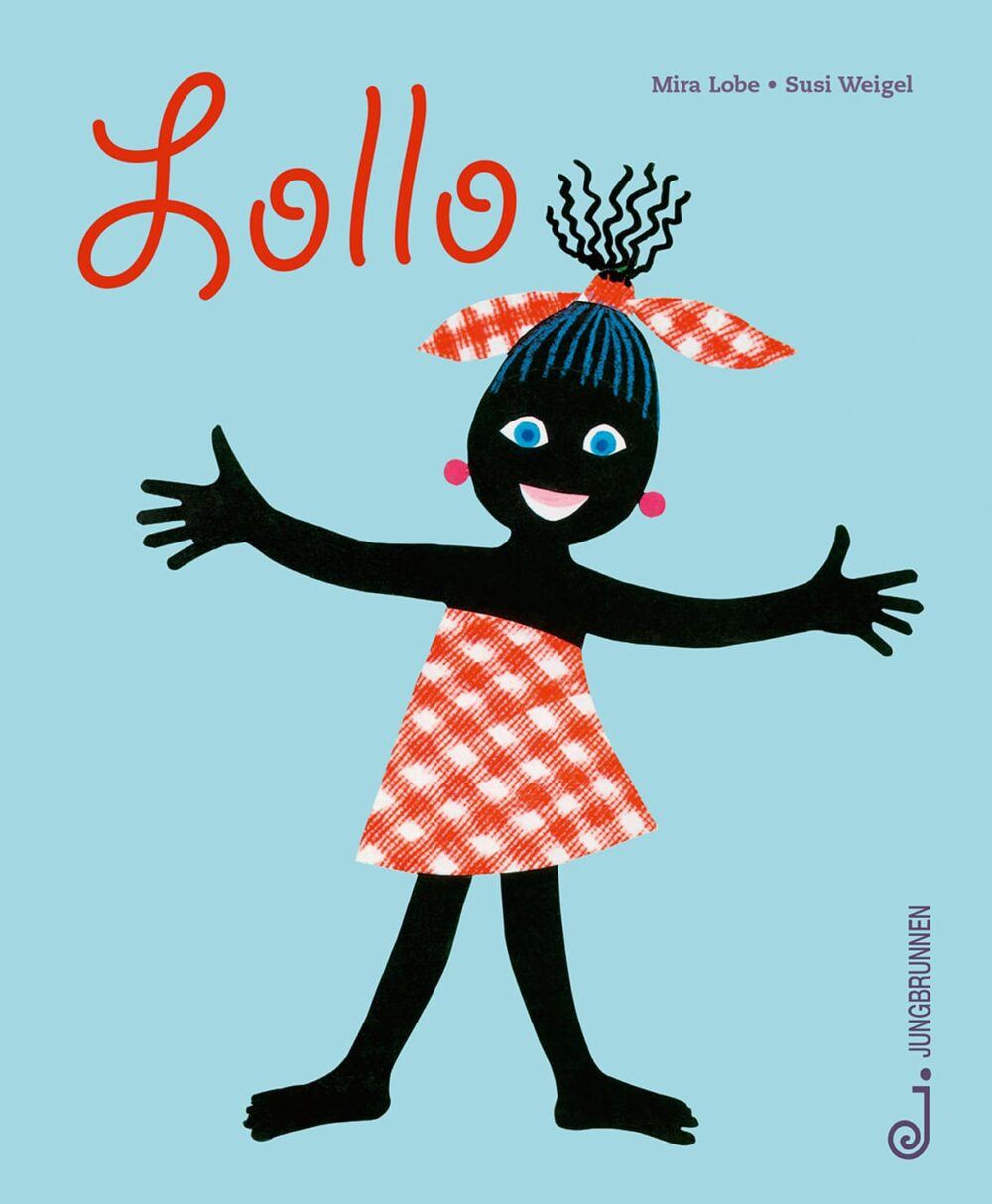

Es muss nicht alles weggeschmissen werden. Selbst wenn dem Kuschelhasen ein Ohr, dem Spielzeug-Elefanten der Rüssel oder einfach der Puppe ihr Kleid fehlt. So könnte sich kürzest zusammengefasst die Geschichte „Lollo“ beschreiben lassen. Vor mehr als 35 Jahren erschien sie als Bilderbuch vom berühmten Duo Mira Lobe und Susi Weigel, deren bekannteste Werke wohl „Das kleine Ich bin ich“ und „Die Geggis“ sind.
Die Puppe Lollo klettert aus einer riesigen Müllhalde am Rande der Stadt, davor aber – sie entdeckt, dass sie nackt ist, sucht sie sich hier ein passendes Stück Stoff, aus dem sie sich in Kleid macht. Und sie findet ein Maxerl, dem fehlt ein Haxerl, einen Spielzeug-Elefanten, der seinen Rüssel vermisst, einen Kuschelhasen mit nur einem Ohr… Lollo wird sozusagen zur Chirurgin, verarztet die Spieltiere und -Figuren – mit lauter Zeug aus dem Mist. …
Das und den späteren Bau einer Schachtelstadt gibt es nun in einer knapp mehr als 1 ½ -stündigen Bühnen-Mitmachversion für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren. Gespielt, gesungen und musiziert wird im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier – und zwar in einer Kooperation mit dem im selben MQW-Hof angesiedelten Kindermuseum Zoom. Dort gab’s schon vor einigen Jahren eine kleinere Version von „Lollo“ vom Verein Metterschling. Elisabeth Naske hat sich gemeinsam mit Ela Baumann (Regie) die Umsetzung mit Musik und Workshops ausgedacht und die Reime Mira Lobes vertont.
Eingebettet ins Stück bauen die Kinder Musikinstrumente – knapp nach Beginn in rund einer halben Stunde – und gegen Ende aus Kartons eine Schachtelstadt. Dabei werden sie von ZOOM-Vermittler:innen – Perihan Seifried, Werner Moebius, Johannes Franz Figeac, Sepehr Sarabchi – angeleitet und unterstützt, um aus Schachteln, Röhren, Flaschen, Gummiringern und anderen Utensilien Gitarren, Trommeln, Xylophone usw. zu basteln.
Die Opernsängerin Marie-Christiane Nishimwe singt die Geschichte – im Wesentlichen die Reime von Mira Lobe – und wird zur Dirigentin für das Kinder-Orchester mit seinen neuen Instrumenten aus altem Zeug. Florian Fennes auf verschiedenen Klarinetten unterstützt die Sängerin und die musizierenden Kinder. Für die Ausstattung und die visuelle Livegestaltung zuständig ist Raimund Pleschberger, der vor allem im Müllberg gräbt und der Reihe nach die verletzten Spielsachen herauskramt sowie den Haufen später zu einem Fantasiebaum für die Schachtelstadt umbaut. Uta Knittel gestaltete die Kostüme – unter anderem als Art Logo einen Teil des Buchcovers von Lollo auf den T-Shirts der Zoom-Vermittler:innen und das Kleid für die Sängerin – ebenfalls sehr angelehnt an die Titelzeichnung des Bilderbuchs.
Wissenschafter:innen waren seit Jahrzehnten, dass die Menschheit die Ressourcen des Planeten zu rasch verbraucht, das Klima kippen könnte…, Künstler:innen greifen immer wieder recht früh solche – und andere Themen auf. Nachhaltigkeit, Re- und Upcycling ist seit Jahren ein boomendes Thema. Wie Felix Mitterer in seiner „Superhenne Hanna“ schon 1977 Legehennen-Batterien in einer Kinderbuchgeschichte thematisiert, so griffen auch schon früh Mira Lobe und Susi Weigel in ihrem Bilderbuch „Lollo“ (1987, Verlag Jungbrunnen) Müllberge und Wegwerfen – in dem Fall vor allem von Spielzeug – auf.
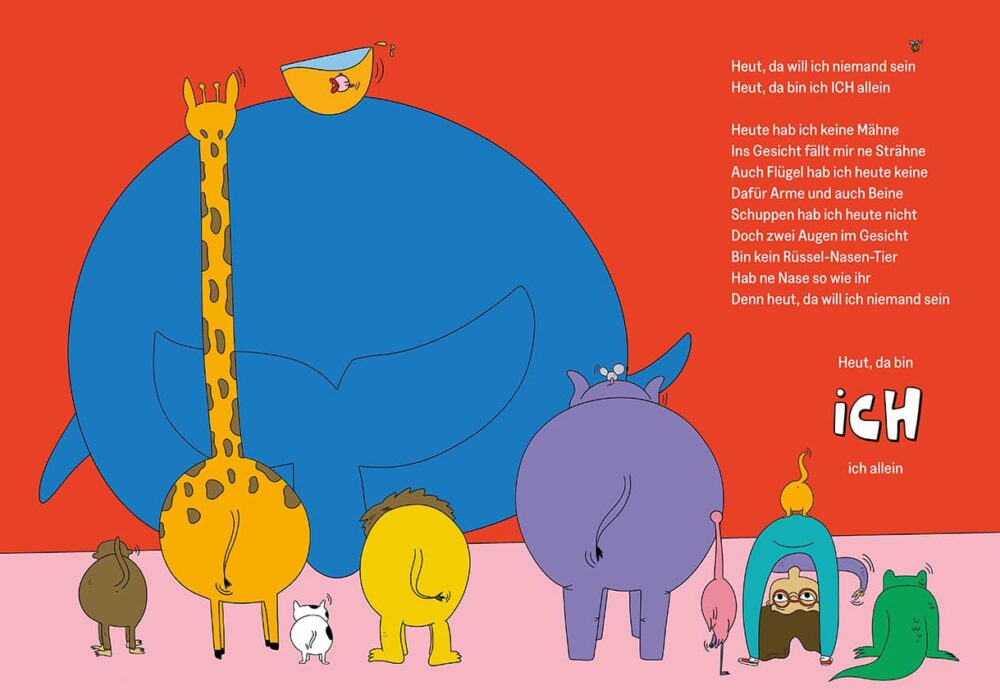
Seit mehr als 50 Jahren wandert ein kleines, buntes Wesen in Reimform durch eines der wohl bekanntesten Bilderbücher Österreichs und sucht – auch in vielen verschiedenen Sprache – wer es ist: „Das kleine Ich bin ich“ (Verlag Jungbrunnen). Vor einigen Monaten ist ein anderes Bilderbuch erschienen, das auch damit endet, dass du sozusagen du bist – sprich, die Hauptfigur ich!
Davor aber schlüpft sie in die verschiedensten (Tier-)Rollen und Stimmungen bzw. Gefühle, ist sozusagen jeden Tag anders. Klein und schnell auf der ersten Doppelseite, die dem Buch auch den Titel gab: „Heut, da bin ich eine Maus“ (Edition 5Haus), Giraffe, Affe, Flamingo – als das fühlt sich die Hauptfigur auf den folgenden jeweils Doppelseiten – immer mit sechs Gedichtzeilen und bunten computergenerierten Illustrationen. Später mal ein Wal ebenso wie danach ein kleines Fischlein und gegen Ende ein Elefant. Doch halt, nicht ganz.

Denn auf der letzten Doppelseite versammelt die Autorin und Illustratorin in Personalunion, Franziska Höllbacher noch einmal alle zuvor aufgetauchten Tiere, in die sich ihre Hauptfigur – ein Kind mit lila Leiberl und roter Brille -, verwandelt, um zu enden „Heut, da bin ich ich allein.“
Wobei die gereimten Zeilen hier leider damit beginnen „Heut, da will ich niemand sein…“ Und der Schluss, „ich bin niemand“ scheint ja doch nicht in der Absicht der Autorin und Illustratorin zu liegen – da wurde wohl dem Reimen zuliebe nach „niemand“ so etwas wie „anderer“ geopfert worden zu sein.
Höllbachers Bilderbuch regte die Kinderliedermacherin Kiri Rakete an, daraus einen eigenen Song zu machen. In den baut sie nicht nur die Gedichtzeilen und Geschichten aus dem Buch ein, sondern erweitert das Lied noch um andere Geschichterln. „Gleich beim ersten Lesen und Staunen hörte ich ein Lied – nein, eigentlich einen Beat! Ein Buch, das tanzt und singt: Probier dich aus!“, zitiert der Verlag sie.
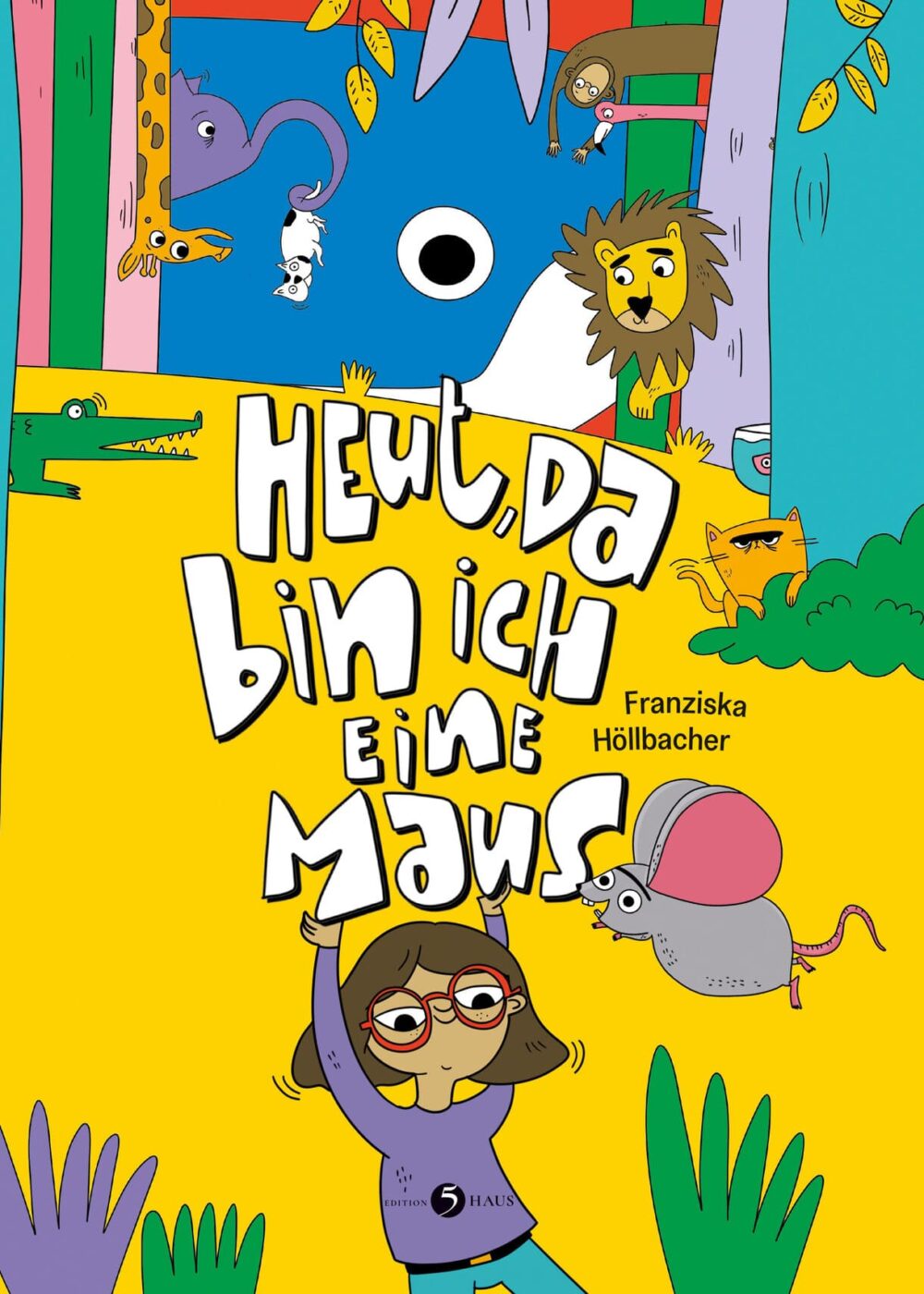

Von mirmirrok (grantig auf Kurdisch) über le latsche gondi hi (einfallsreich, Romani) lekful (tierisch, Schwedisch) bis niezapomniany (unvergesslich, Polnisch) kannst du dich in diesem fast 100-seiigen Bilderbuch lesen – und vor allem schauen. Linda Woldsgruber, vielfach ausgezeichnete Kinderbuchillustratorin und oft auch -autorin, hat ihr Buch „wir“ nach mehr als einem halben Jahrzehnt ergänzt, erweitert. Und wie!
2017 standen nur deutschsprachige Adjektive (Eigenschaftswörter) bei ihren gezeichneten Gesichtern. Womit schon die Sichtweise auf eine Zeichnung verändert werden konnte. In der neuen, brandaktuellen Version wurden den 44 gemalten Porträts verschiedene Sprachen zugeordnet. Wobei das zuletzt genannte Wort so nicht ganz stimmt. Um möglichen Klischee-Fallen zu entgehen – Österreicher:innen sind so, Nigerianer:innen so… -, wurden die Sprachen den Bildern und ihren deutschen Adjektiven zugelost. Diesen Vorgang filmte der Verlag und stellt ihn als Video ins Internet (Link dazu in der Info-Box am Ende des Beitrages).
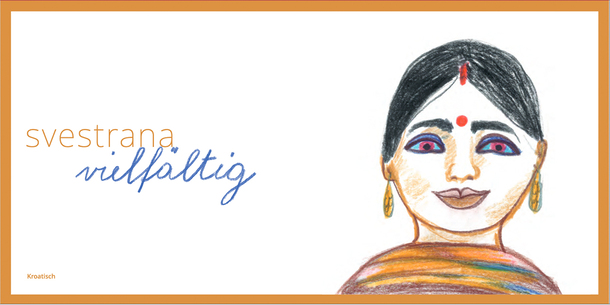
Es tauchten noch weitere Fragen auf, denen sich Autorin/ Illustratorin und Verlag stellten. Nicht jedes Eigenschaftswort lässt sich einfach 1:1 übersetzen, bzw. hat in manchen Sprachen eine andere, vielleicht negativere Bedeutung. Umgekehrt gibt es ja in den verschiedensten Sprachen auch (fast) unübersetzbare Begriffe, natürlich auch bei Eigenschaften. So würde das Finnische „humalassa syntymästä asti“ auf Deutsch „seit meiner Geburt betrunken“ heißen, was aber mit Saufen gar nichts zu tun hat, sondern ungefähr so viel wie kreatives Ver-rücktsein von Anfang an bedeutet.
Um „Fettnäppfchen“ zu vermeiden, kontaktieren die Verleger:innen einerseits Menschen, für die die entsprechende Sprache ihre Erstsprache ist und andererseits auch Wissenschafter:innen. Anhand einer speziellen Herausforderung schildert der Verlag (Tyrolia) die Vorgangsweise: „Da es für Gebärden kein standardisiertes, schriftliches Darstellungssystem gibt – vom Fingeralphabet allerdings schon“, entschlossen sie sich, zickig mit den sechs Buchstaben-Gebärden des Wortes darzustellen – und ein Video der dazugehörigen Gebärde aufnehmen zu lassen – der entsprechende QR-Code im Buch führt zu diesem. Wobei’s noch ein bissl komplizeirter war, aber das lässt sich im pädagogischen Begleitmaterial im Detail nachlesen – Link in der Infobox.

Dem Internet sei Dank, finden sich auf der Verlags-Homepage zum Buch darüber hinaus auch Kopiervorlagen, u.a. für Burgenlandkroatisch. Die lassen sich ergänzen – möglicherweise um weitere Sprachen oder solche, die sich aus Anregungen und vielleicht auch Kritik ergeben, so wurde „übersehen“, dass manche Sprachen in mehreren Schriften existieren, etwa Serbisch oder Kurdisch – bzw. bei letzterem es sogar mehrere kurdische Sprachen gibt. Und Alphabete, die nicht von links nach rechts, sondern umgekehrt geschrieben werden, hätten vielleicht auf den Seiten auch rechts statt links beginnen können.
Und cool wäre es auch noch: Begriffe in anderen Schriften vielleicht dort entweder in Lautschrift oder per QR-Code oder Audio-File zum Anhören zu platzieren. „Das Buch soll aber ja auch anregen, Leute zu suchen, die diese Sprachen können und es dann vorsagen“, heißt es auf die entsprechende kijuku.at-Anregung. Also auf zum Sprachen-Sammeln 😉
Wie auch immer – das Buch kann vor allem in Kindergärten und Volksschulen einen Gutteil der Sprachen, die Kinder aus ihren Familien mitbringen, zur Sprache bringen, zur Weiterarbeit anregen, zum Diskutieren und Spielen, wie mit Gesichtsausdrücken – oder auch Körperhaltungen – Gefühlen dargestellt werden können. Und „Wir“, das auf der Rückseite des Buches um „…sind da“ ergänzt ist, zeigt die Wertschätzung über vorhandene Vielfalt und den natürliche Umgang damit – und kann somit Einfalt verhindern.
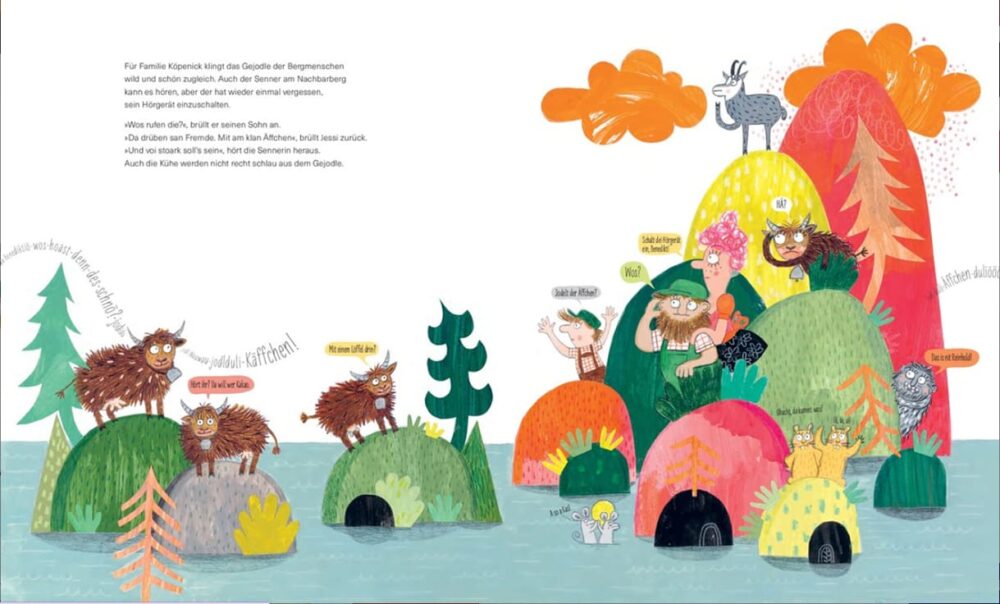
„Simma bald da?“, tönt’s in einer Sprechblase aus dem Kleinbus der Familie Köpenick. Und das ist nicht der einzige Satz, der die lange Urlaubsfahrt charakterisiert. „Ick muss Pipi!“, deutet darauf hin, dass die Familie aus einer Gegend Deutschlands anreist. Und sie landet irgendwo in den Bergen wo gejodelt wird – und dem Dialekt nach irgendwo in Österreich liegen könnte: „Da drüben san Fremde.“
Ein Missverständnis in der gemeinsamen deutschen Sprache wächst sich zur zentralen Geschichte des Bilderbuchs „Monsteraffen gibt es nicht!“ aus. Leonora Leitl lässt ihre Figuren – die Urlauber:innen und die Einheimischen – in Wort und Bildern in Angst und Schrecken versetzen. „Voi soark soll’s sein“, das kleine Äffchen, das die mitgebracht haben. Dabei hatte Vaddi doch nur gefragt: „Ham se mal ‚n Käffchen für uns?“
Einmal als Wort in die kleine Welt gesetzt, wird das Äffchen immer größer und wilder, Menschen und Tiere meinen sich, fürchten zu müssen. „Die wilde Nachricht rollt weiter über die Gipfel. In der Burgruine Schreckenstein mit ihren dicken Mauern findet sie besonders schaurigen Widerhall“, schreibt die Autorin und Illustratorin in Personalunion und lässt in Bildern die Gespenster der Ruine zittern.

Ein paar Seiten weiter ist das Äffchen schon „ein wüster Monsteraffe mit Krallen so spitz wie Stricknadeln. Ein Pratzenschlag und du blutest wie nix. Ur-arg!“ Alarmistische Radiomeldungen, Hubschraubereinsatz zur Suche nach dem Monster, „nur der Adler Horst, der versteht die Welt nicht mehr“, denn durch seine Höhenflüge hat er den Überblick und obwohl sonst zurückhaltend teilt er den Menschen mit: „Leute! Das ist gequirlter Blödsinn! Ein Monsteraffe auf unsern Bergen?? Der Heimat von Gämsen, Steinböcken und Murmeltieren? Denkt doch mal ein bisschen nach! Was für ein Schwachsinn!“
Damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, aber Spannung soll ja wohl ncoh bleiben in dieser leicht fasslichen und bunt fast im Stil von Kinderzeichnungen bebilderten Geschichte über eine Art wie Fake News sich verbreiten (können).
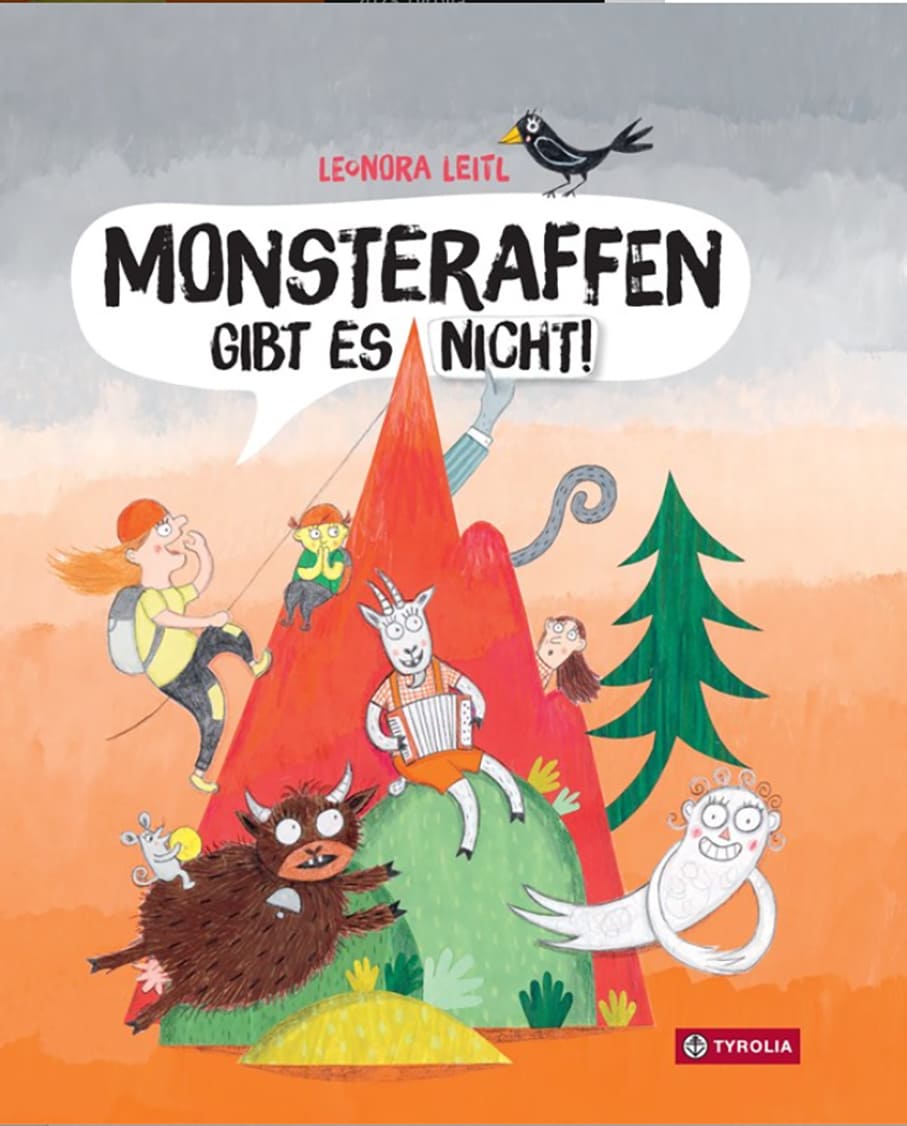
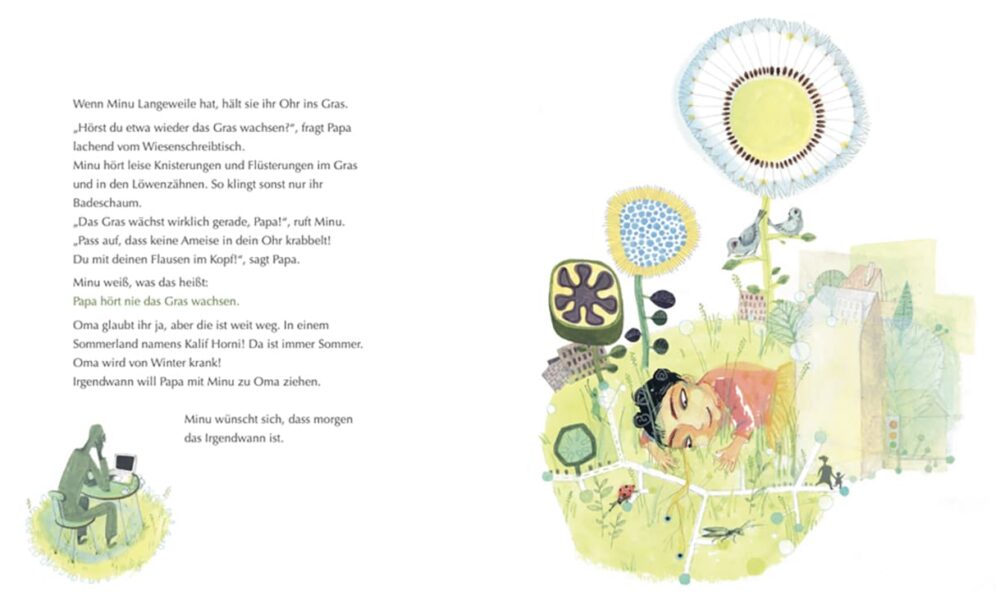
„Hörst du etwa wieder das Gras wachsen?“ Dies Frage stellt Papa seiner Tochter Minu. Und er meint es liebevoll. Meist wird der Spruch im Alltag verwendet, um anderen der Spinnerei zu bezichtigen, etwas zu sehen oder hören, das es gar nicht gibt.
Aber der Vater in dieser fantasievollen, einfühlsamen Bilderbuchgeschichte „Minu un der Geheimnismann“ – ausgedacht und verfasst von Andrea Karimé und illustriert von Renate Habinger – hat selbst seinen Arbeitstisch auf dem er am Computer schreibt, in die Wiese gestellt. Zwischen bunten, fantastischen Blumen, Käfern, Insekten und Vögeln fühlt sich Minu wohl. Hier kann sie auch mit der Oma, die weit weg lebt, gedanklich und gefühlsmäßig in Kontakt treten.
Jenseits der Mauer entdeckt Minu ein kleines Männlein, das ähnlich tickt wie sie, den Geheimnismann. Mit dem freundet sie sich an, der lädt sie und ihren Papa ein, nachdem sie ihm eine wunderbare, mysteriöse Handtasche, die er verloren hat, zurückbringt.
Was es mit dieser Tasche auf sich hat, sei hier nicht verraten, höchstens so viel, sie treibt Karimés Wortspiellust an, den sie veranlasst den Geheimnismann Minu von einer Wunschblume und Feen zu erzählen, die Wünsche in den „Schick-Saal“ tragen.
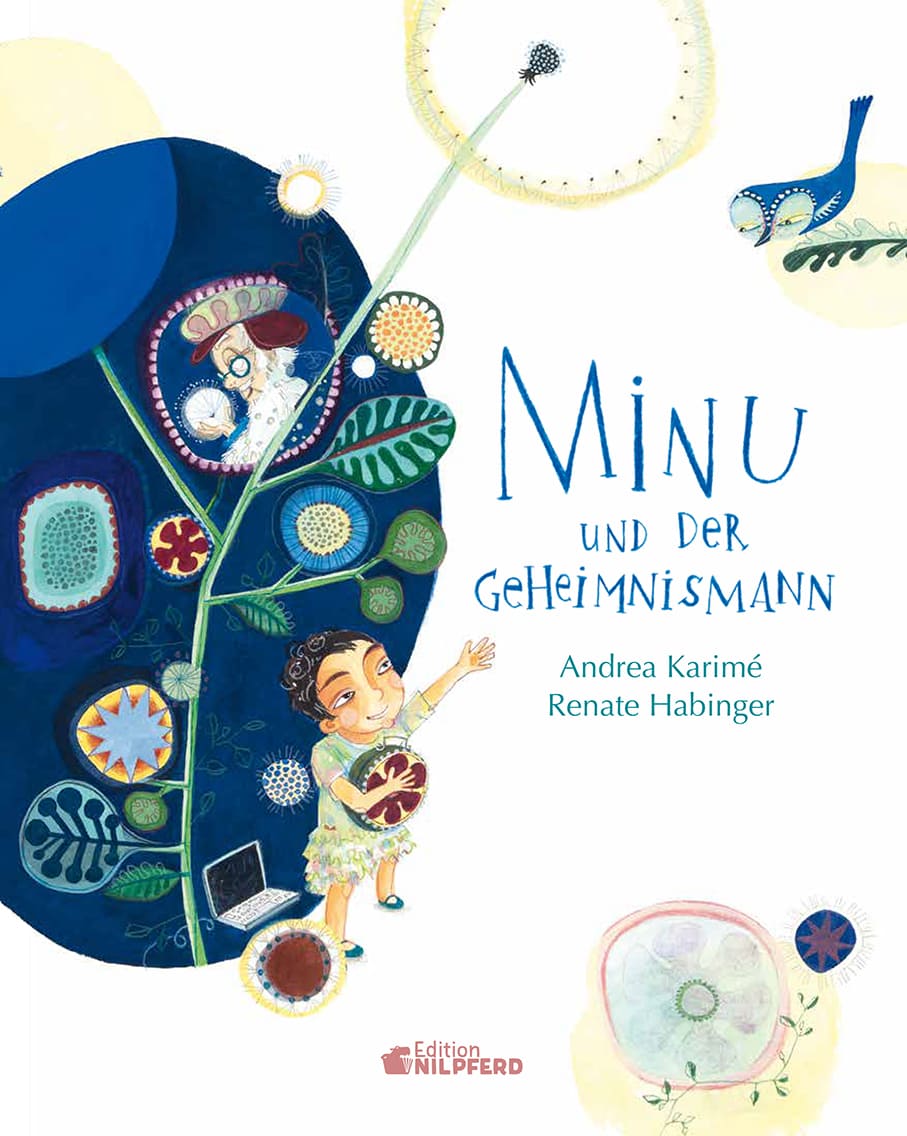
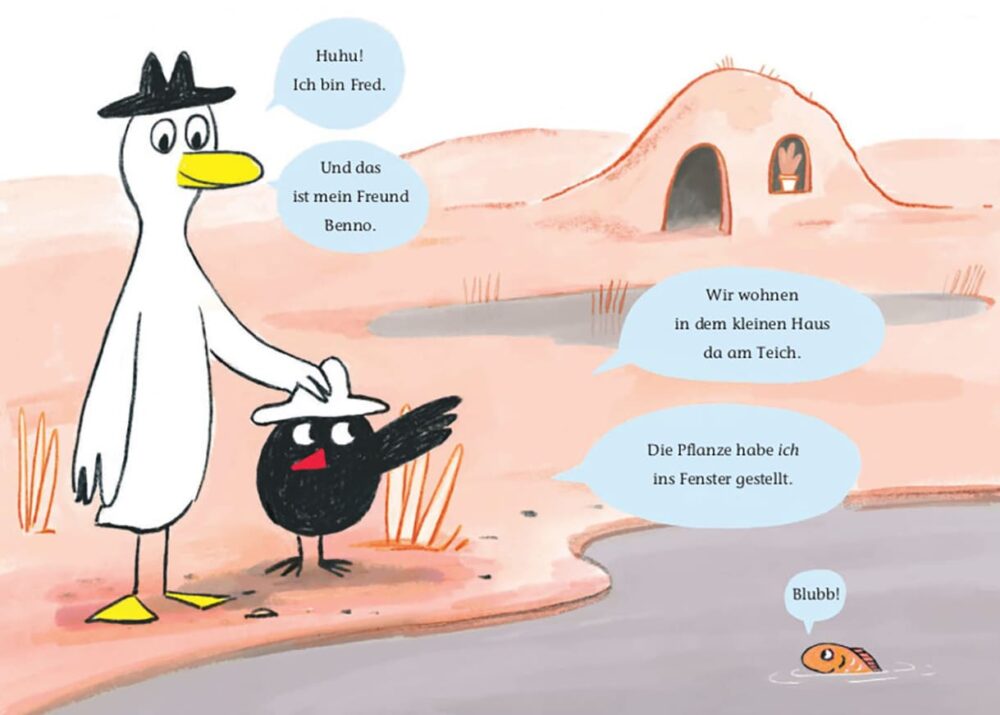
Fred und Benno – den beiden Vögeln widmet Cataharnia Valckx Valckx (Übersetzung aus dem Französischen: Julia Süßbrich) mehrere Bücher mit kurzen – gezeichneten – Erlebnissen, in die sie – sowohl von den Bildern als auch von den kurzen Texten witzige Pointen einbaut. Eine der jeweils sechs Episoden gibt dem jeweiligen Buch dann auch den Titel. In „Benno, Fred und das Geschenk“ besuchen die beiden, die gemeinsam in einem kleinen Erdhügelhaus an einem Teich wohnen, ihre Freundin Ursula, eine Eule.
Auf dem Weg, den sie hüpfend und watschelnd zurücklegen, kommen sie auf die Idee, vielleicht ein Geschenk mitzubringen. Doch natürlich – die meisten Geschichten und ihre Leser:innen lieben spannende Höhe- und Tiefpunkte – geht dabei was schief – mit dem ersten Geschenk – gepflückten Blumen und dem „Ersatz“, den ihnen ein Pferd mitgibt. Das Hufeisen, das als altes Symbol Glück bringen soll, gefällt Ursula schon, aber… – Nein, was da passiert sei sicher nicht gespoilert.
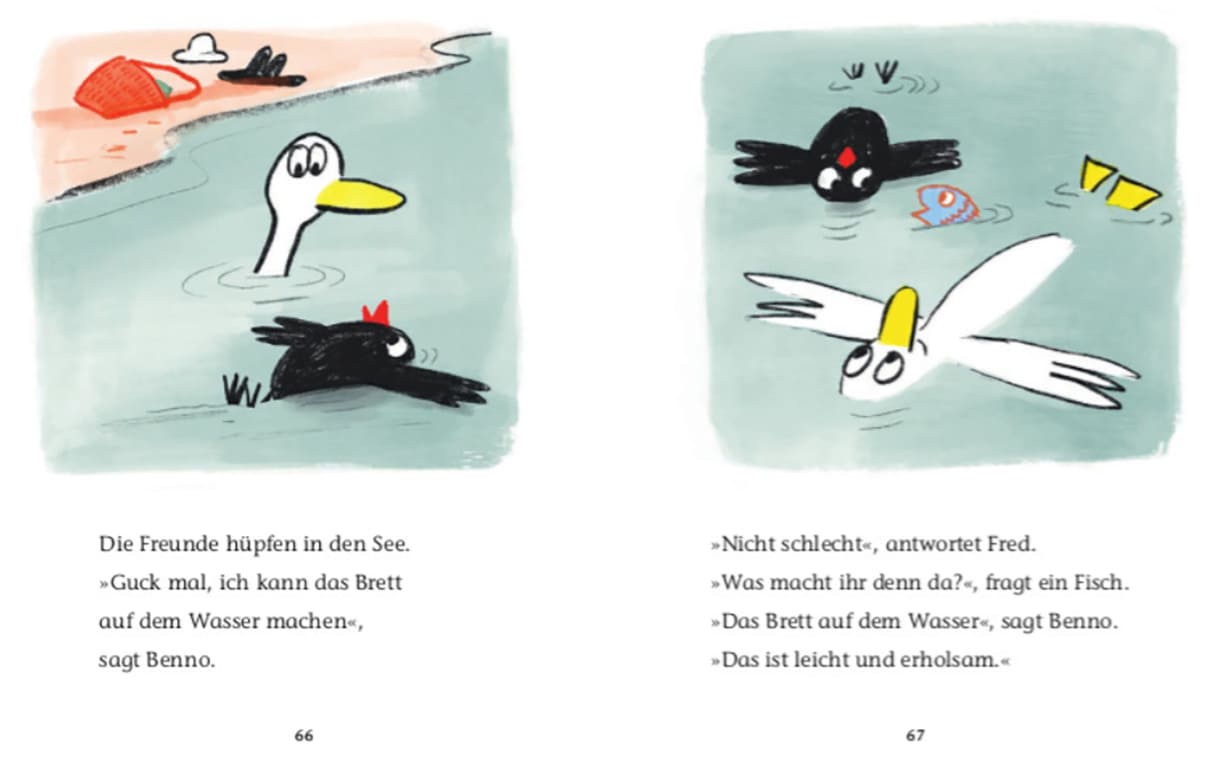
Schon ein wenig was verraten möchte ich vom Kapitel „Das Brett“, in dem Benno sich flach – Kopf auf einem Baumstumpf, Füße auf einer Kiste – hinlegt und auf Freds verwunderte Frage, was er da mache, antwortet, dass er eben ein Brett spiele. Andauernd trifft der kleine schwarze Vogel an diesem Tag auf Tiere, die in verschiedene Rollen schlüpfen. Am lustigsten wirken wohl zwei Regenwürmer, die eine Blume spielen. Und was wird Fred wohl machen? Lässt er sich von diesem Spiel anstecken?
Gerade dies ist dann sogar ein bisschen mehr als ein (Vor-)Lesebuch, es könnte auch dich animieren zu verschiedensten (Rollen-)Spielen.
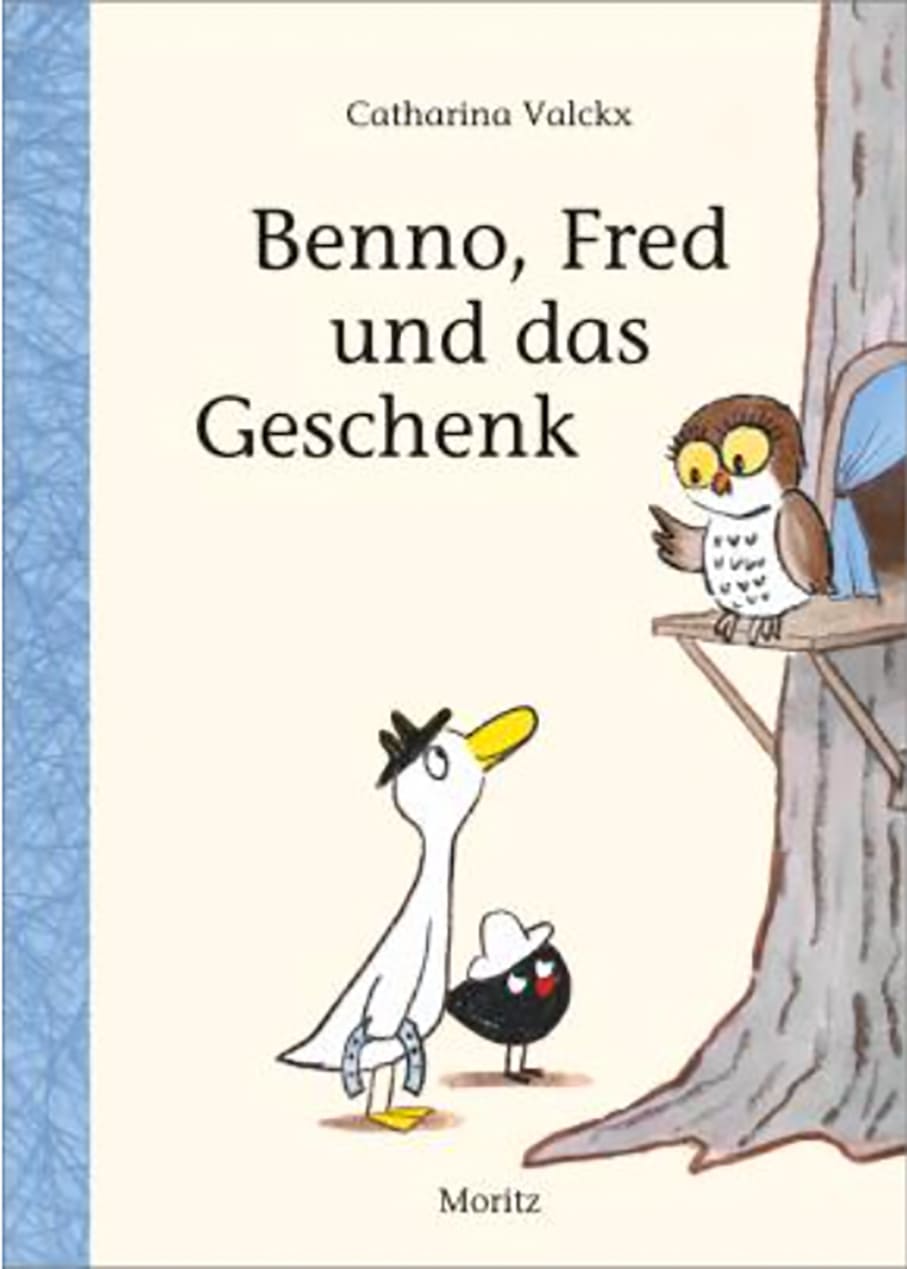
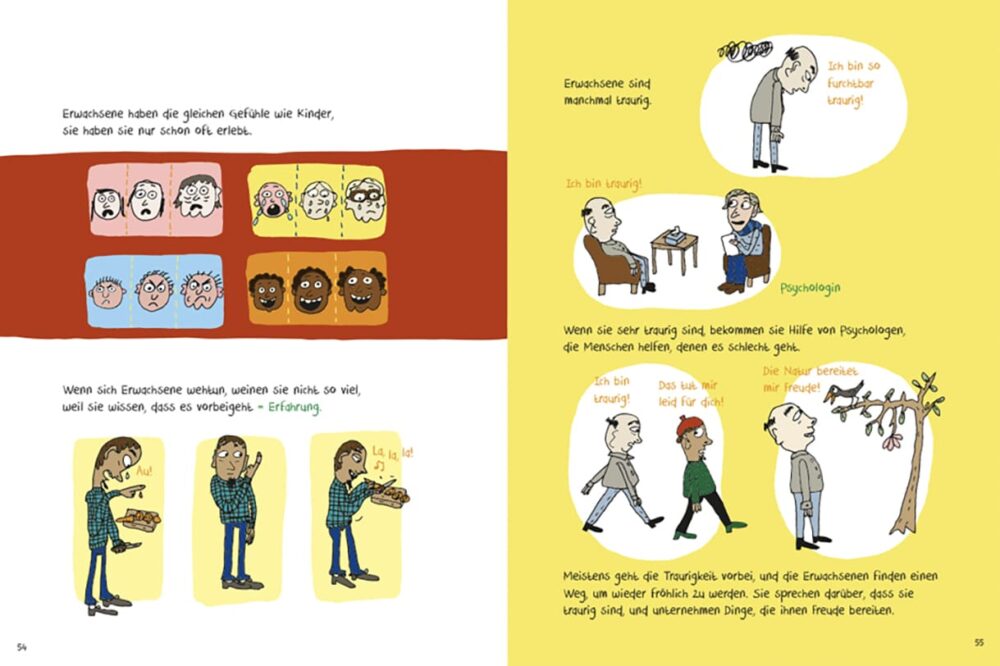
„Wenn ich groß bin, kann ich Eis essen, wann ich will, darf ich selber bestimmen und … vieles mehr!“ Ist das so, oder doch ganz anders? Oder irgendwo dazwischen?
Auf fast 80 Seiten – mit vielen Bildern und wenigen Worten – widmet sich Anna Fiske, eine norwegische Autorin und Illustratorin in einer Person der Frage: „Wie ist es eigentlich, erwachsen zu sein?“ Ausgehend von Dutzenden Kinderfragen dazu hat sie viele kleine Bilder und große Szenen gezeichnet und beschrieben. Gleich auf der ersten Doppelseite sind viele ganz unterschiedliche Gesichter zu sehen – rechts Kindergesichter und ihre Vorstellungen, wie sie wohl erwachsen aussehen würden/könnten; links Erwachsene, die sich noch erinnern können, wie sie als Kinder ausgesehen haben.
Aber können Erwachsene wirklich immer mehr als Kinder? Schon nach ein paar Doppelseiten thematisiert Fiske etwas auf der Hand Liegendes: Kinder wachsen, Erwachsene nicht mehr – höchstens in die Breite 😉
Aber, nennt die Autorin und Illustratorin ein weiteres mögliches, unsichtbares Wachstum: „innerlich“.
Dass Menschen ab bestimmten Altersgrenzen mehr dürfen wird in diesem umfangreichen großformatigen Bilderbuch auch thematisiert – leider ist Österreich insofern nicht berücksichtigt, als hier schon ab 16 – nicht erst ab 18 Jahren – gewählt werden darf.
Dass es bei Menschen-(Gruppen) nicht immer um Unterschiede geht oder die ins Zentrum gerückt werden sollen, kommt immer wieder so „nebenbei“ bei Fiske heraus. Erstens finden sich in den meisten Szenen ganz unterschiedliche sowohl Kinder als auch Erwachsene und zweitens auch zwischen den verschiedenen Alterskategorien setzt das Buch immer wieder auf Gemeinsamkeiten – siehe Beispiele auf der oben abgebildeten Doppelseite. „Erwachsene habend die gleichen Gefühle wie Kinder, sie haben sie nur schon oft erlebt.“ Womit sie sich (vielleicht) leichter tun, damit umzugehen 😉
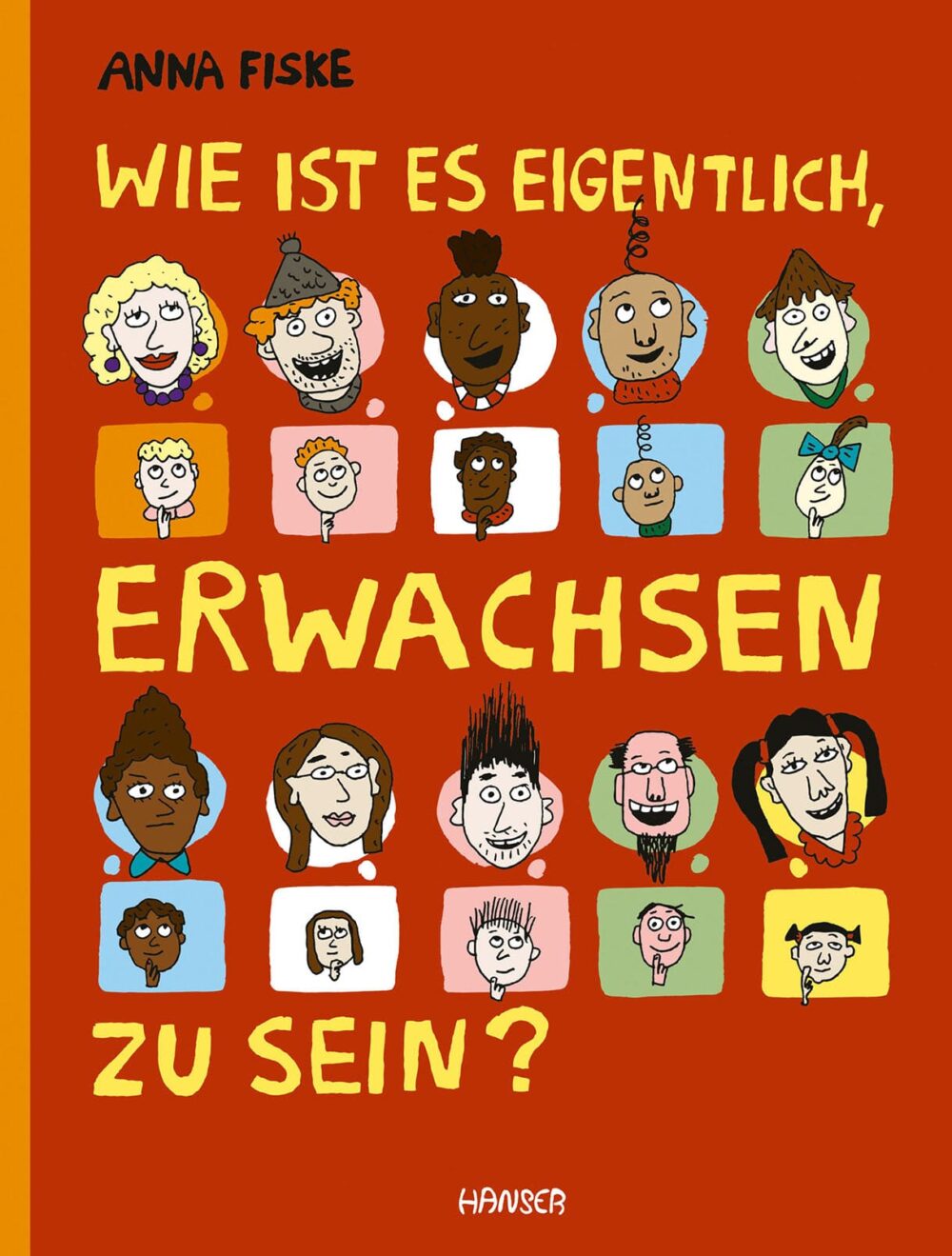
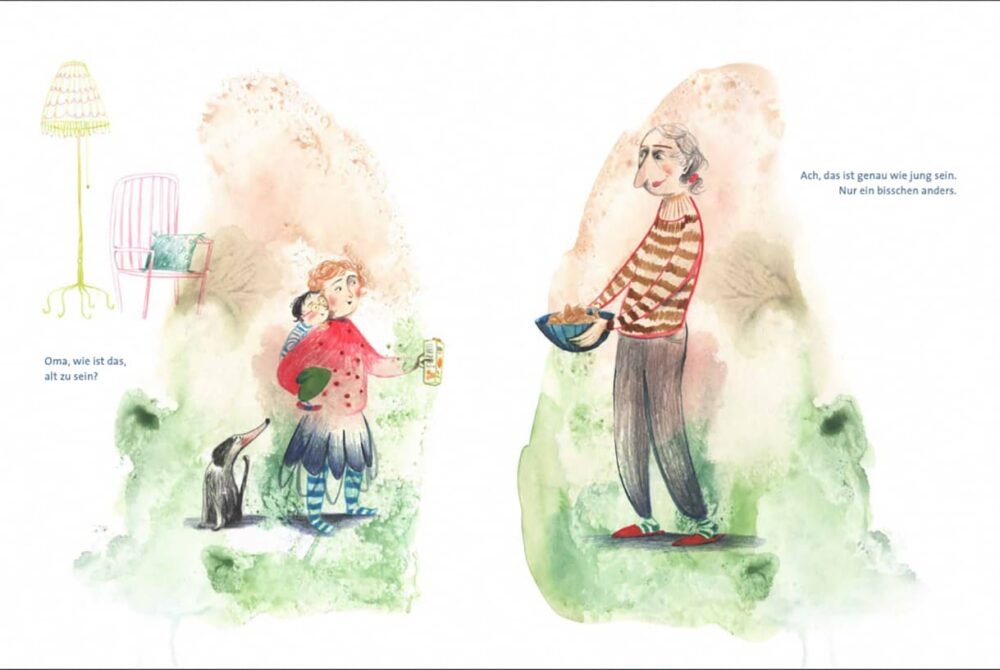
„Oma, wie ist das, alt zu sein?“, fragt das sehr junge Kind, das irgendwie eingeklemmt zwischen Ellenbogen und Schulter getragen wird. Nicht von der Oma, sondern – wahrscheinlich/möglicherweise der Mutter. Die fröhlich dreinschauende, bunte Großmutter auf der gegenüberliegenden Seite dieses Bilderbuchs sagt: „Ach, das ist genauso wie jung sein. Nur ein bisschen anders.“
Die Idee und Texte für „Wie anders ist alt“ stammen von Bettina Obrecht, die bunten – oft mit verschwimmenden Hintergründen – immer wieder auch dazwischen mit skizzenhaften Zeichnungen (als Wünsche einer- und Erinnerungen andererseits?) gemalten Bilder von Julie Völk. Die eingangs beschriebene, erste, Doppelseite hätte vielleicht besser an den Schluss gepasst – als Schlussfolgerung. Nun, so steht die Erkenntnis also am Anfang und es folgen immer wieder parallele Szenen von Gleichheit und dabei doch Anderssein.
Vielleicht noch ein eindrückliches Beispiel: „Wenn du klein bist, ärgerst du dich über alles, was du noch nicht kannst. Wenn du alt bist, ärgerst du dich über alles, was du nicht mehr kannst.“
Ein Bilderbuch zum im Idealfall gemeinsamen Anschauen und Weiter-Erzählen und Philosophieren von Enkelkindern mit Großeltern oder einfach auch Kindern und Älteren und zum Weiterspinnen – an Beispielen, aber auch an anderen Menschengruppen, wo allzu oft die Unterschiede hervorgehoben werden und es natürlich genauso Gemeinsamkeiten gibt.
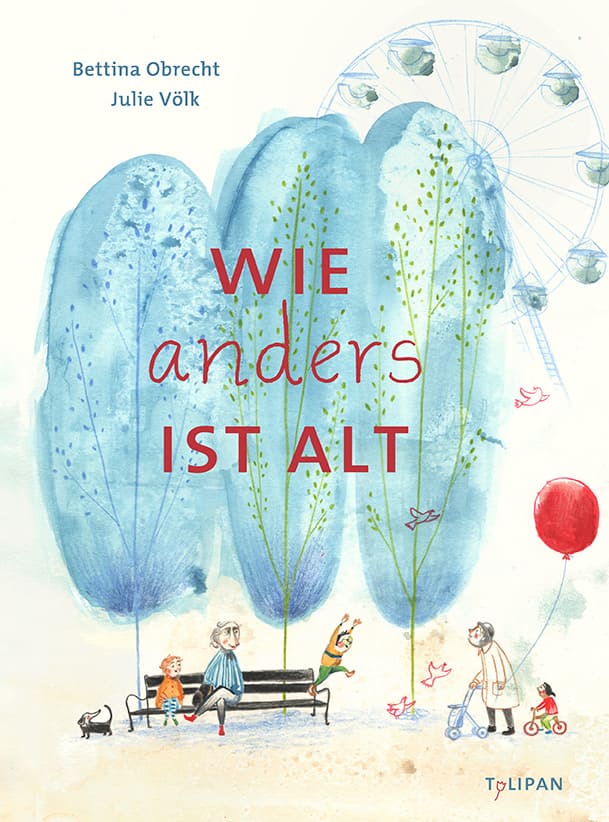
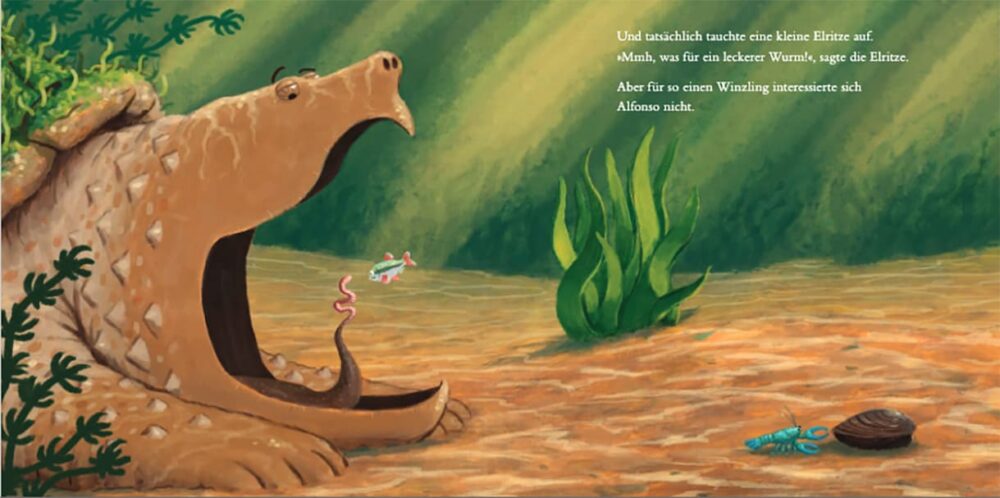
Nach eine Reihe von wortlosen Bilderbüchern – u.a. „Die Vulkaninsel“ – veröffentlichte der US-amerikanische Kinderbuchautor/-illustrator John Hare wieder eines mit einer geschriebenen Geschichte: „Alfonso geht angeln“.
Die Hauptfigur ist aber kein Fischer, sondern eine Geierschildkröte, die zur Gattung der Alligatorschildkröten zählt. Und ein wenig Krokodilartig sieht er aus der Alfonso (die Art kann übrigens fast einen Meter lang und 100 Kilo schwer werden). Das Besondere an seiner vorwiegenden Ernährung: Er und seinesgleichen legen sich ins Wasser, öffnen den Mund und bewegen ihre Zunge. Die hat Ähnlichkeiten mit einem Wurm – und locken so Fische an. Die schwimmen ins geöffnete Maul. Und schwupp…
Natürlich muss sich in so einer Bilderbuch-Geschichte etwas Ungewöhnliches abspielen. Und dazu hat sich John Hare einfallen lassen, dass ihn der erste Fisch, eine kleine Elritze nicht interessierte – zu mickrig. Aber dann hört er, dass das Fischlein über den großen Wurm staunt und laut denkt, auch Freunde zu holen, um sich da Leckerbissen zu holen. Und die wieder wollten noch weitere holen und…
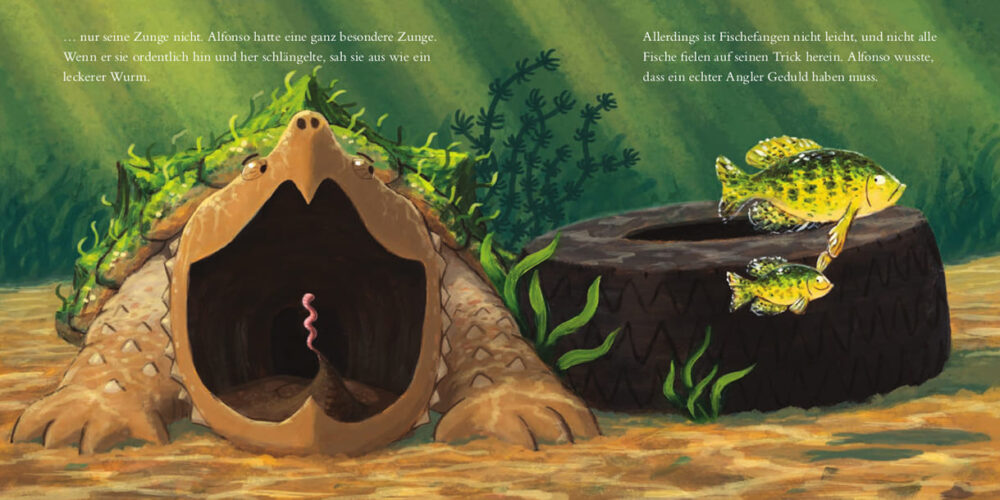
Knapp bevor Alfonso – übrigens ist sein Name auf dem Buchcover aus Buchstaben gemalt, die alle wie Würmer aussehen – zuschnappen und sich damit den Bauch vollschlagen könnte, vernimmt er wie eines der kleinen Fischlein sagt: „Hört her! Vielleicht sollten wir den ersten Bissen Oma Bertha überlassen. Sie ist dick und langsam, aber vergluckst noch mal, sie hat heute Geburtstag!“
Also wieder einmal: Noch nicht zubeißen, warten auf die fette Beute. Und als die Oma und alle Fischlein sein ganzes Maul füllen, sich Bertha so freut, alle um sich zu haben, und sich den fetten Wurm teilen zu können…
… ist die Schildkröte ganz gerührt… Also frisst er den Schwarm nicht, lässt die Fischlein aber auch nicht von seiner Zunge abbeißen. Die finden einen anderen Wurm, aber…
… Nein, alles sei hier sicher nicht verraten, wenngleich es sich sehr auszahlt, dieses Bilderbuch – selbst wenn du die ganze Geschichte dann schon kennst – sogar mehrmals zu lesen/ vorlesen zu lassen und die Bilder aber schon ganz genau anzuschauen und selbst kleine Details zu entdecken.
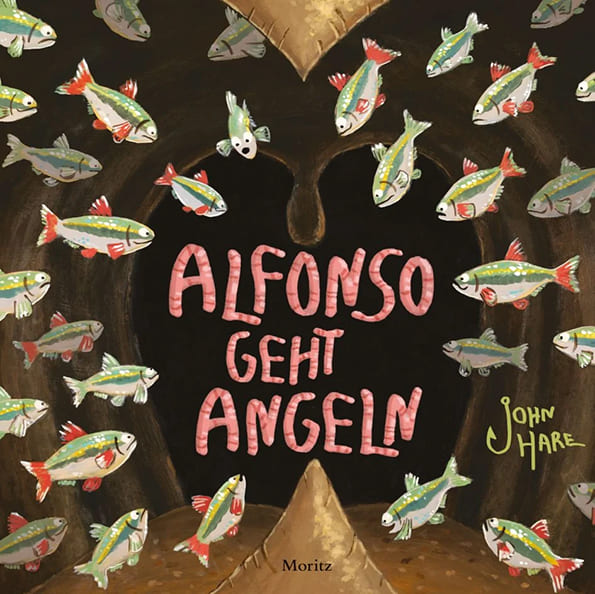
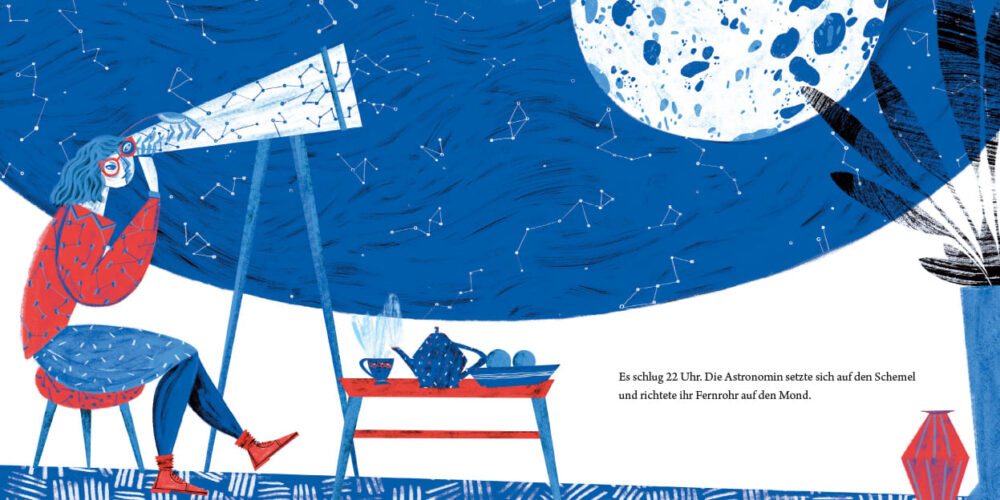
Diese Astronomin mit der coolen roten Brille war Fachfrau für den Mond. Aus ihren Beobachtungen auf ihrer Sternwarte kannte sie alle Berge und Krater. Natürlich nur die auf jener Seite, die uns dieser Erd-Begleiter zuwendet – später im Verlauf dieses Bilderbuchs wird sie auch die Rückseite – the dark side – erkunden, weil sie selber auf dem Mond landet.
Aber die Hauptgeschichte des polnischen Künstler:innen-Duos ist die aus dem Titel: „Der Elefant im Mond“. Und das kam so: Eines Abends, als sie wieder einmal ihr Lieblings-Forschungsobjekt ins Visier ihres Fernrohrs nahm, „entdeckte die Astronomin Außergewöhnliches. >Das ist ja nicht zu fassen! Ein Elefant auf dem Mond!<“
Diese Sensation musst verbreitet werden, wobei ihr kaum wer glauben wollte. So lud sie ihrer Kolleg:innen ein, aber ausgerechnet als die durchs Teleskop schauten – nichts. Endlich tauchten die großen Ohren auf… in der Hektik ging der vielen Astronom:innen ging allerdings das Fernrohr zu Bruch. Außerdem glaubten sie ihr dennoch nicht, lachten sie aus und verspotteten sie.
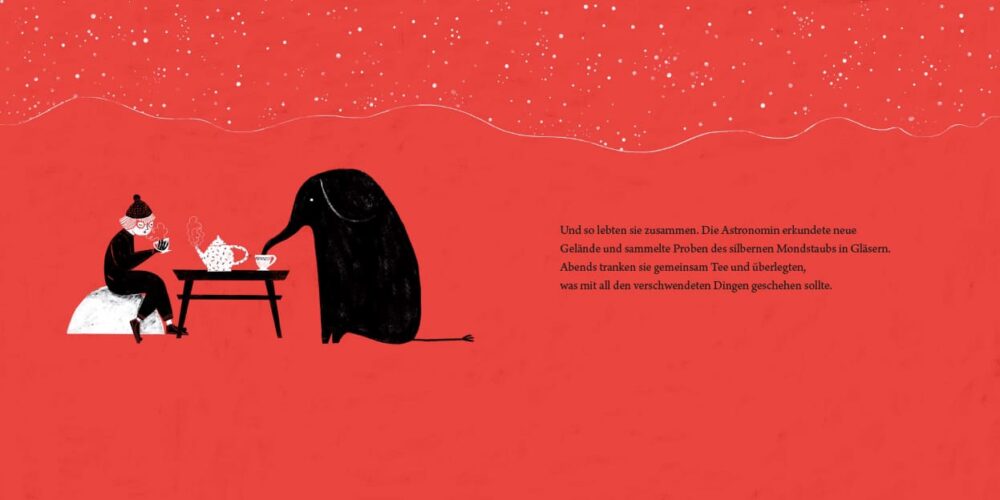
Doch die Wissenschafterin ließ sich nicht beirren, von ihrer ersten Erkenntnis abbringen. Dafür kaufte sie nicht ein neues Fernrohr, sondern baute eine Rakete, sie wollte vor Ort selber nachschauen…
Natürlich – es handelt sich ja um eine ausgedachte Geschichte mit wunderbaren sehr graphisch gezeichneten Bildern – landet sie auch auf ihrem Zielobjekt und trifft den Elefanten. Einen ungewöhnlichen noch dazu, denn er entpuppt sich als Sammler – aller möglichen Dinge, die Menschen auf der Erde verschwenden – Wasser in einem See, Lebensmittel in einer riesigen Vorratskammer und Regale mit Schachteln voller nicht gehaltener Versprechen und Gläsern vergeudeter Zeit sowie – vielleicht am traurigsten – „verkümmerter Talente“.
Die Forscherin blieb sehr lange und – siehe die Andeutung im ersten Absatz…

Auch wenn es in echt auf dem Mond kein Leben gibt, so macht das fantasievolle Bilderbuch doch Mut, Entdeckungen und Ideen zu Erfindungen nicht (gleich) aufzugeben, wenn alle anderen dir nicht glauben, dich sogar dafür verspotten. So ging’s in Wahrheit so manchen Erfinder:innen und Wissenschafter:innen auch im wirklichen Leben, deren Leistung nicht selten erst nach ihrem Tod gewürdigt worden. Ein solchen verkanntes Genie war beispielsweise Nicolai Tesla, der den Wechselstrom erforschte.
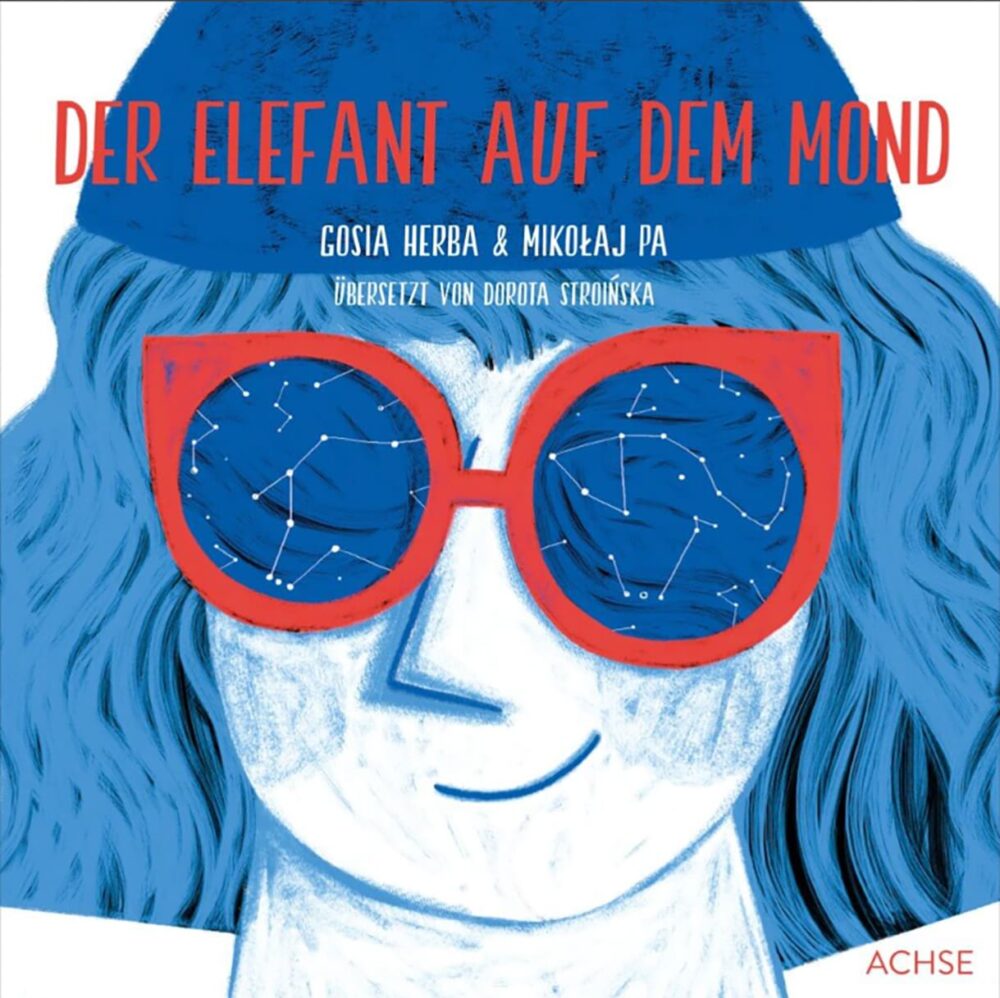

„Kracks“ machte es als sich der kleine Fuchs langsam anschleichen wollte. Er war auf ein trockenes Asterl gereten, nein eher getapst. Denn dieser kleine Fuchs, den sich die Autorin Anu Stohner ausgedacht und Henrike Wilson in Bildern lebendig werden ließ, ist ziemlich Tollpatschig.
Mal stolpert er über Maulwurfshügel, dann bleibt er in Dornenhecken hängen und ein anderes Mal – genau, da knickt er lautstark Holzstückchen. Und erschreckt damit allerlei andere Tiere im Wald, die meinen, es drohe Gefahr. Von ihm dich nicht, dem kleinen Fuchs. Der entschuldigt sich auch noch für seine Missgeschicke. „Das war doch nicht mit Absicht“, heißt das Bilderbuch der beiden schon genannten Künstlerinnen.
Und wie natürlich auch so ein Bilderbuch einen dramatischen Höhepunkt braucht, so beginnt der damit, dass der Fuchs einmal als er stolpert gegen etwas Großes, Weiches tuscht. Und das ist ein Bär. Ein sogar eher unangenehmer Zeitgenosse.
Könnte also ganz schön gefährlich werden. Schaut anfangs auch so aus. Aber natürlich endet auch diese Bilderbuchgeschichte glücklich. Dabei hilft dem Fuchs sogar seine Tollpatschigkeit – wie genau? Nein, nix wird da gespoilert.

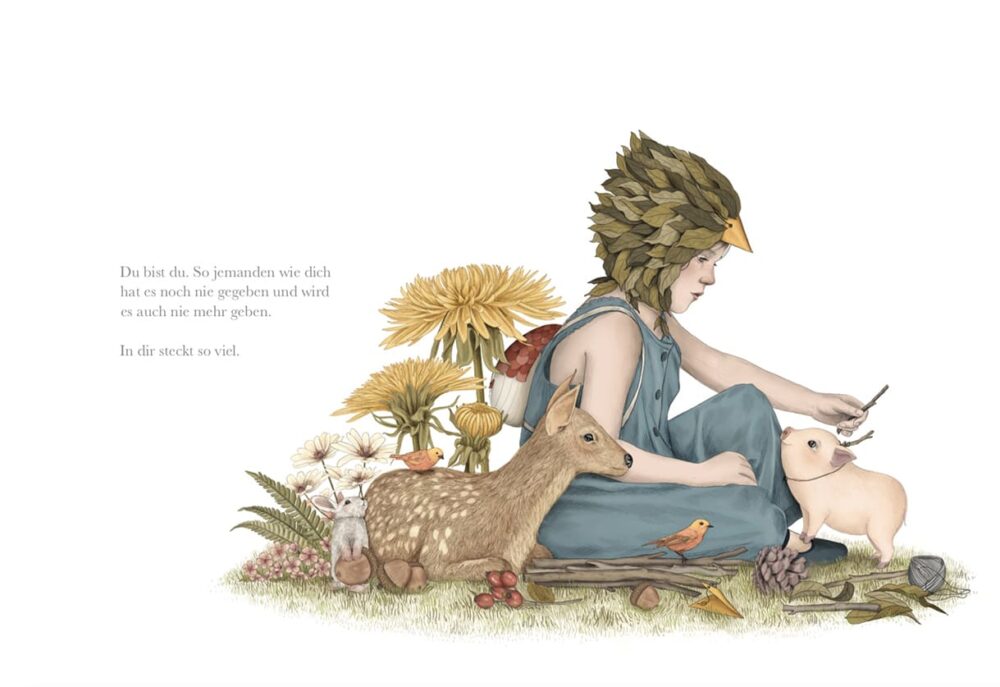
Ein Blick, der verliebt sein könnte eines kleinen Schweinchens in Richtung eines über ihm flatternden Schmetterlings ziert die Innenseite mit der Titelschrift „vielleicht“. Die beiden kommen in diesem Bilderbuch mit dem Untertitel „Eine Geschichte über die unendliche vielen Begabungen in jedem von uns“ auf vielen weiteren Doppelseiten vor. Im Zentrum aber steht, sitzt, klettert und vieles mehr eine kindliche Figur mit einer Art Haube aus Laubblättern. Die wirken als könnten sie Federn sein. Ein – auf dem Buchcover sogar golden glänzender Vogelschnabel über der Stirn des menschlichen Gesichts lädt schon symbolisch zu Gedanken- und Höhenflügen ein.
Knappe, punktgenaue Sätze und Fragen von Kobi Yamada (übersetzt von Gerda M. Pum) begleiten die Bilder von Gabriella Barouch. Den Auftakt macht: „Hast du dich jemals gefragt, warum du hier bist?“
Solltest du Zweifel hegen, dann beruhigen dich Autor und Illustratorin: „Du bist du. So jemanden wie dich hat es noch nie gegeben und wird es ach auch nie mehr geben. In dir steckt so viel.“
Die 21 Doppelseiten bestärken nicht nur dich, sondern besonders alle Erwachsenen in deinem Umfeld, dich so zu akzeptieren, wie du bist: Und dir selber alles aber auch wirklich alles zuzutrauen.
Dieses Bilderbuch ist ein wunderbares Gegenbeispiel zu einschränkenden oder gar demütigenden (Groß-)Eltern oder Pädagog:innen-Sager, dass du nicht diesen oder jenen Anforderungen entsprechen könntest oder dir deine Ziele, Wünsche. Träume „aus dem Kopf schlagen“ mögest.
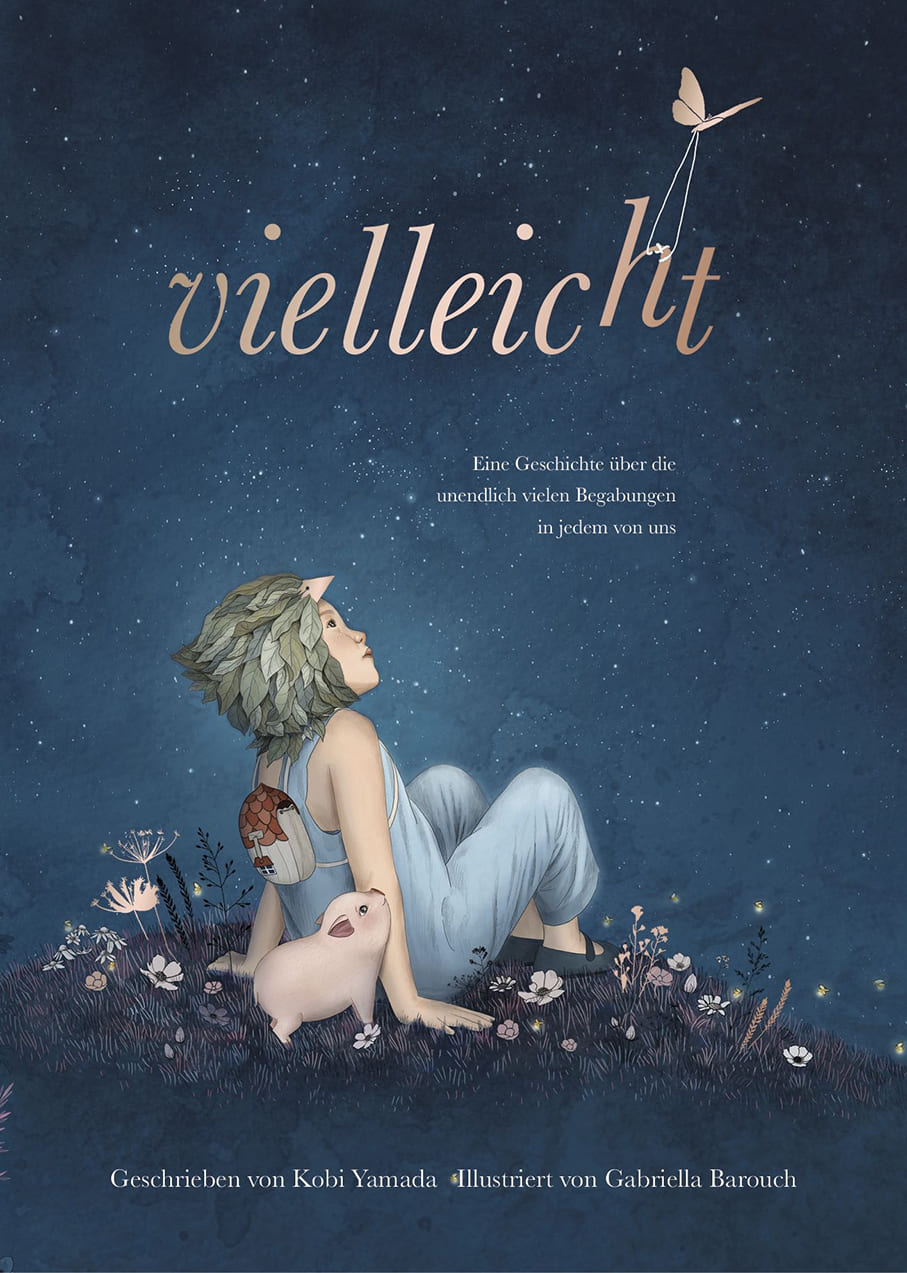
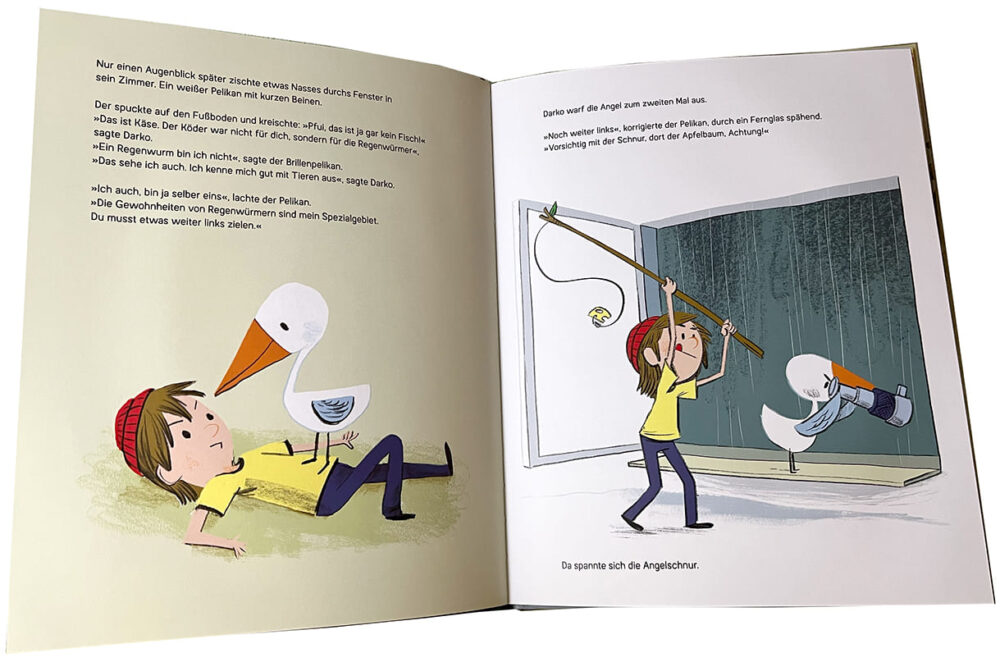
Bevor die Geschichte noch beginnt, findest du auf den sogenannten Vorsatzseiten (erste innere Doppelseite) handgezeichnete Skizzen von einem Elefanten, einem Affen, einem Krokodil und weiteren Tieren – und vergrößerte Details, etwa vom Rüssel-Anfang (oder Ende), das weit aufgerissene Maul des brüllenden Affen…
Die alle – und noch einige – kommen vor. Und das in Darkos Zimmer. Dabei liegt dieses im achten Stück eines der Häuser, die in den Himmel wachsen.
Und das kam so: Darko wollte eigentlich runter und rausgehen, um einen Regenwurm – oder mehrere – zu fangen. Nix da, sagt die Mutter zum jungen Tierforscher, weil es draußen fürchterlich schüttet.
Das ärgert Darko sehr, vor lauter Wut schmeißt er sein bebildertes Tierlexikon aus dem Fenster, bastelt sich mit einem Ast und einer langen Schnur eine Angel. So will er trotz alledem einen Regenwurm eben fangen.
Natürlich klappt das nicht auf Anhieb. Dafür fliegt ein kleiner Pelikan in Darkos Zimmer, gibt ihm Tipps, besser zu zielen. Doch … stattdessen klettert ein Brüllaffe ins Zimmer. Auch er will beim Angeln helfen. Und … – Autor Jonny Bauer und Illustrator Stephan Lomp setzen in „Fang – Eine Tiergeschichte aus dem achten Stock“ der Fantasie keine Grenzen. Doppelseite für Doppelseite taucht ein weiteres Tier auf. Genau, auch der schon oben erwähnte Elefant. Der ist übrigens blau.
Und? Fängt Darko irgendwann einen Regenwurm?
Das wird hier sicher nicht verraten 😉
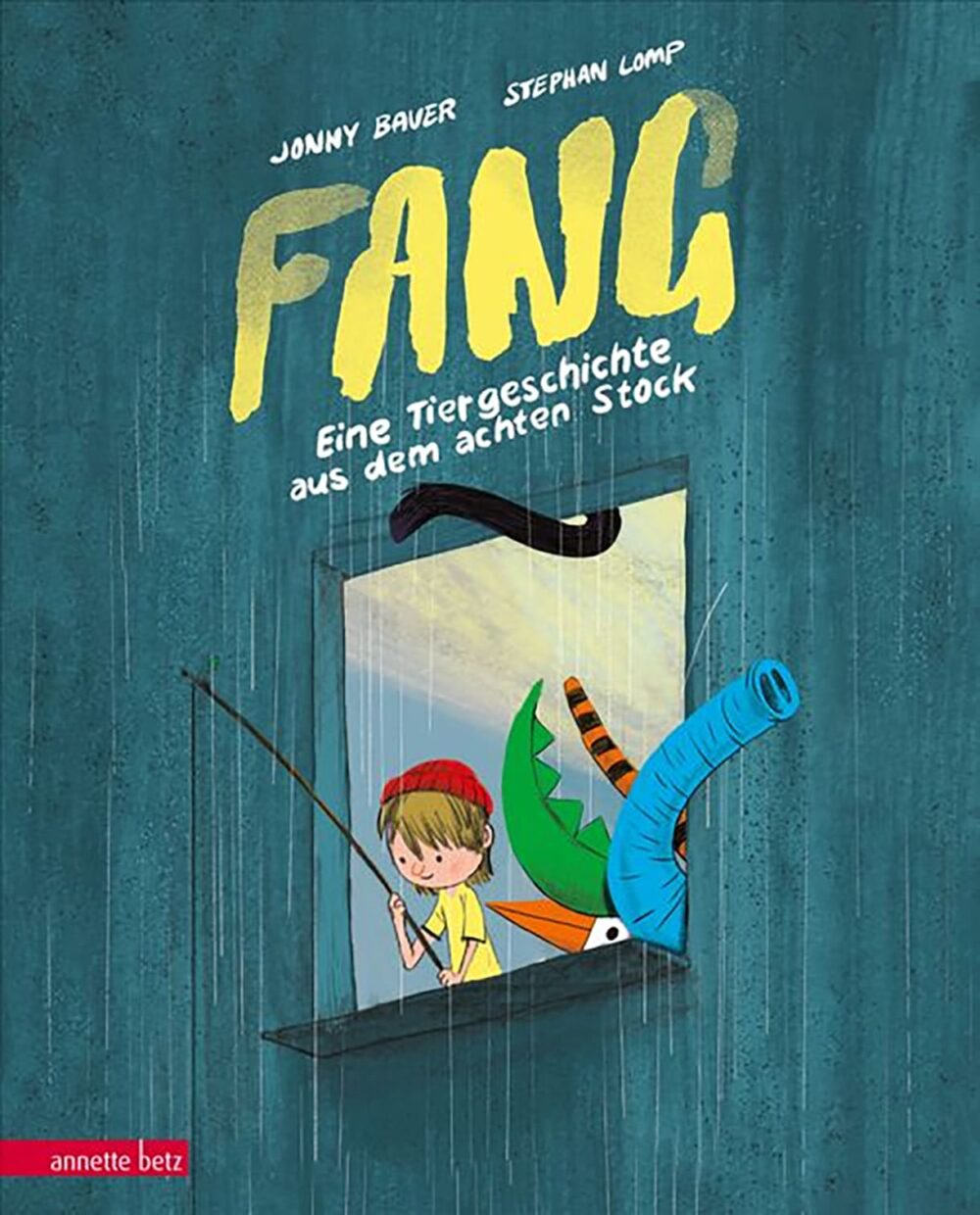
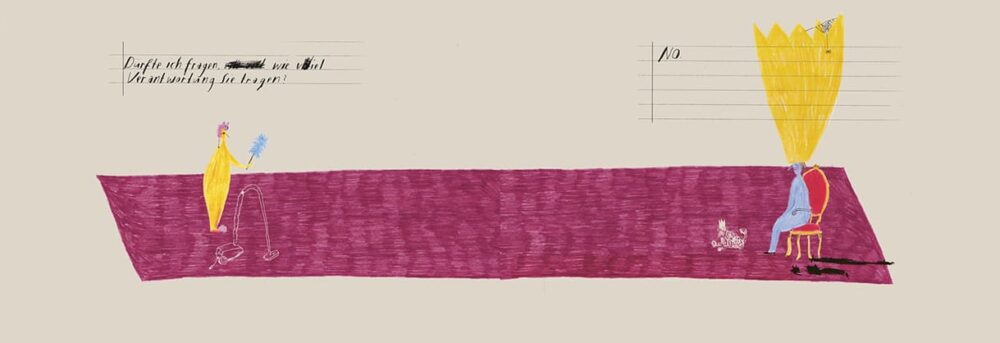
Welcher Hut steht dir gut? Wobei in Hut mehr steckt als „nur“ eine Kopfbedeckung, gibt es doch „behütet“ im Sinn von beschützt. Neuerdings wird sich die Bedeutung erweitern, denn kürzlich ist ein Bilderbuch (nicht nur) für Kinder erschienen, das Hüten weiter auflädt. Tessa Sima hat mit ihrem ersten, im März 2023 veröffentlicht: „Wär‘ Verantwortung ein Hut“ spielt mit dem Gedanken, ob und welche Verantwortung zu wem passt, zu Gesicht steht und vieles mehr.
So findest du auf einer Seite zwei gemalte Figuren – alle mit speziellen Buntstiften, die fast wie Ölkreiden wirken –, die ihre Hüte, sprich ihre Verantwortungen tauschen, weil sie aus ihren zuvor getragenen schnell rausgewachsen sind. Die Seite daneben könnte eine Art Vorgeschichte darstellen. Die eine Figur (blau) wird niedergedrückt, geht auf allen Vieren, während die zweite (gelb) federnden Schrittes fast dahinschwebt. Bild-Unterschrift: „Dieselbe Verantwortung ist für mich unerträglich, aber für dich federleicht.“
Übrigens: Vor dem „aber“ ist ein Wort kräftig vielfach durchgestrichen – so wie an vielen Stellen des handschriftlichen Textes quer über das ganze Buch. „Wenn Fehler passieren, dann will ich die auch herzeigen“, sagt die Illustratorin und Autorin im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr in ihrer Atelier-Wohnung – mehr dazu und über ihre Arbeit und sie selbst in einem eigenen Interview – am Ende dieses Beitrages verlinkt. Nur eins noch zu den durchgestrichenen Wörtern bzw. Buchstaben gleich hier: „Außerdem schaut‘s auch lustig aus.“
Nicht immer muss große Verantwortung mit einem ebensolchen Hut einhergehen, manchmal drückt sich diese auch in einer kleinen Kopfbedeckung aus, andere können oder wollen viele Verantwortungen übernehmen – Tessa Sima lässt die entsprechende Person mit vielen Hüten jonglieren. Nicht alle Figuren tragen sie/ihn (die Verantwortung/den Hut) nur für sich, manche der Figuren kümmern sich sozusagen um Natur, andere verteilen die Last(en) und tragen gemeinsame einen Hut.
Neben den großen, Seiten-füllenden Bildern lässt Sima noch von der ersten, der Vorsatz-Seite weg eine kleine fast zu übersehende Taube mitspielen. Die findet eine Scheibe Toastbrot, die sie sich – einmal umgeblättert – auf den Kopf setzt 😉 Um auf der vorletzten Doppelseite, der knallbuntesten, wieder – unbe-hütet – aufzutauchen.
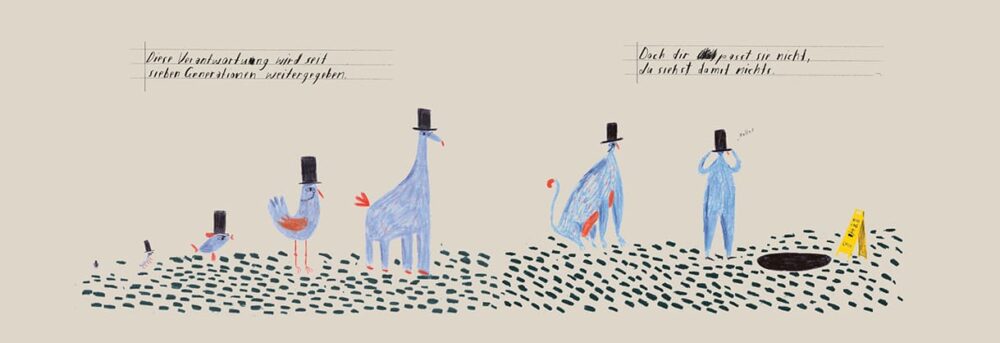
In einem weiteren Bild – einem, das sich über eine Doppelseite des querformatigen Buches erstreckt, wird Verantwortung über Generationen weitergegeben – übrigens sieben. Auf diese Zahl sei gekommen, berichtet die Autorin und Illustratorin, weil ihre Mama, eine klinische Psychologin, erzählt habe, dass (seelische) Traumata mitunter bis zu sieben Generationen „vererbt“ werden, also weiterwirken. Bei der Recherche im Internet wird diese 7-Generationen-Folge übrigens mehrfach im Zusammenhang mit indigener Medizin bzw. Schamanismus genannt.
Vielleicht kommt daher auch, dass indigene Völker, die enger mit der Natur verbunden sind und Menschen als viel integraleren Teil der Welt, des Universums sehen, mehr darauf geachtet wird, was ihre heute gesetzten Maßnahmen in der Zukunft bedeuten (könnten).
So berichtete Felix Finkbeiner, der im Alter von zehn Jahren (2007) die längst weltweit aktive Initiative „Plant fort he Planet“ (Pflanzen für den Planeten) gegründet hat, weil Bäume DIE Maschinen gegen den Klimawandel sind, vor rund zehn Jahren von einem Treffen mit Chief Shaw, einem Häuptling eines First-Nation-Stammes in Nordamerika: Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, muss der Ältestenrat immer prüfen, ob das was sie beschließen auch noch für die Menschen in der siebenten Generation (!) gut sein würde!
Wie Tessa Sima Verantwortung mit Hüten verband – ursprünglich hatte sie im Sinne von Last an Steine gedacht – und über verschiedene Auslandsaufenthalte erzählt sie in dem oben schon erwähnten ausführlichen Interview – zu dem geht es in einem Link am Ende dieses Beitrages.
Kinder-Kurier -> Dixi-Kinderliteraturpreise u.a. für Tessa Sima
Kinder-KURIER -> kinder-pflanzten-baeume-fuer-klimaschutz
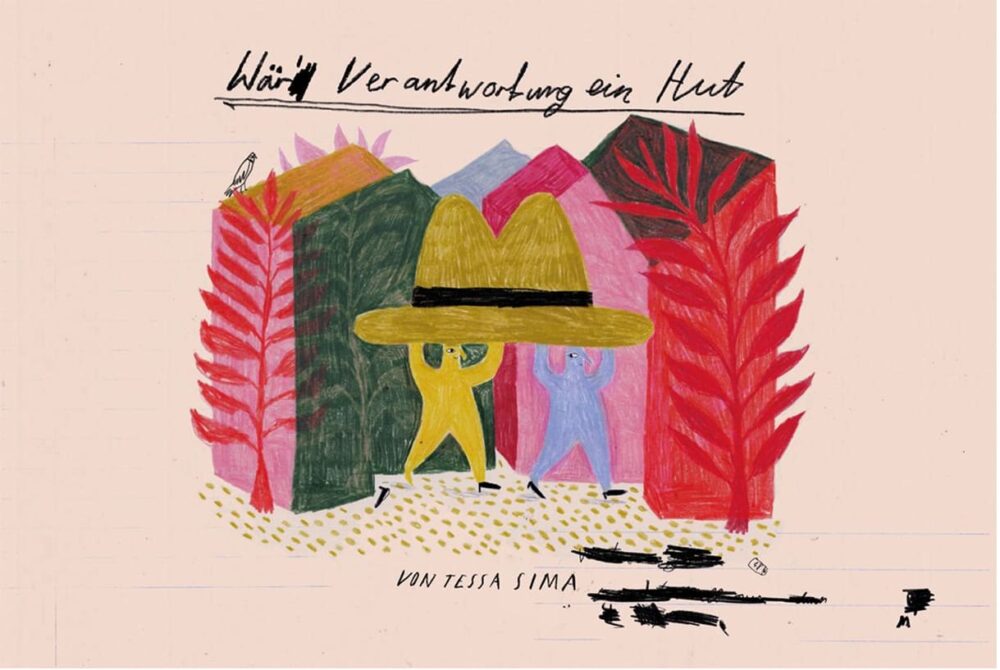
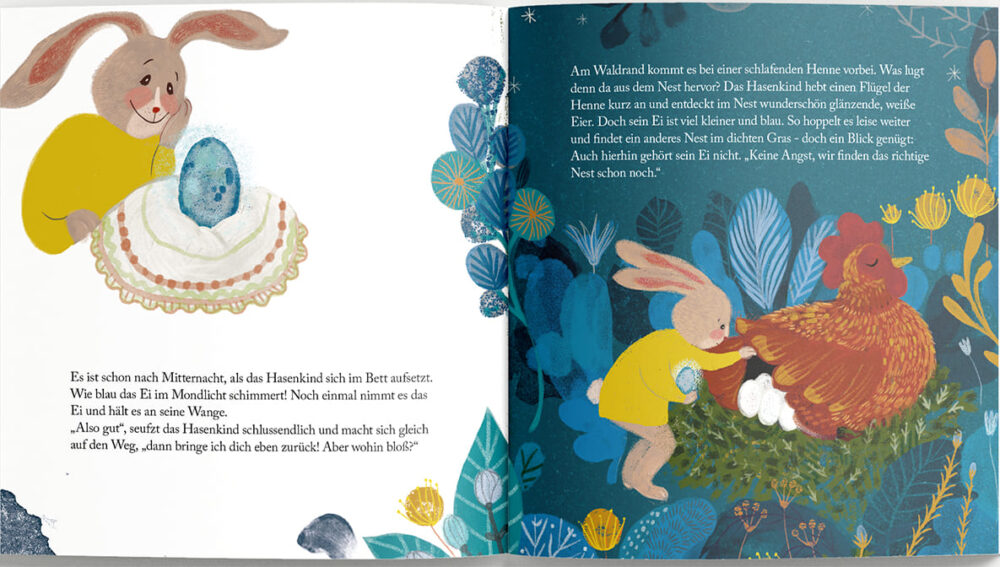
Ostern steht sozusagen vor der Tür. Doch die Geschichte beginnt schon wenigstens ein bisschen früher. Klein Häschen hat noch viel zu tun, bereitet Farbtöpfe und Pinseln vor und … Bevor es Eier zu bemalen beginnt, läuft Osterhäschen erst einmal in den Wald, um den Tieren „vom Läuten der Osterglocken zu erzählen“. Und sieht ein kleines blaues Ei.
Soweit der Inhalt der ersten paar Seiten des Bilderbuchs „Das blaue Ei“. Mit diesem schon gefärbten Ei macht sich der Hase zurück nach zu Hause, um sein Werk zu beginnen. Gleichzeitig herrscht im Wald große Aufregung, denn die Singdrossel vermisst eines ihrer Eier – deren Schale tatsächlich bläulich gefärbt sind.
Die Aufregung spricht sich bis zum kleinen Osterhasen durch, der das aber sicher nicht hergeben möchte… Aber natürlich kommt es zu einem Gesinnungswandel, Häschen kann gar nicht richtig einschlafen und entschließt sich zur Rückgabe des Fundes – was auch mit Schwierigkeiten verbunden ist – muss er doch die richtigen Vögel finden und dann noch auf einen Baum klettern, mit einem Ei in den Pfoten noch dazu…

Aber wie kommt Osterhäschen nun zu Eiern – solche will er ja zum Fest verstecken. Es nimmt sich ein Beispiel am Vögelchen, setzt sich hin und presst. „Einmal presst es noch und dreht sich dann erwartungsvoll um. Es reibt seine Augen und mustert sein Werk: Die kleinen, braunen Böhnchen riechen zwar nicht besonders gut, aber eine schöne Form haben sie schon mal. Vielleicht sind sie etwas klein… „Ich hab‘s!“, ruft das Hasenkind und …“
Nein, natürlich verschenkt Osterhäschen keine „Bemmerl“, wie im ostösterreichischen Dialekt seine Verdauungsprodukte heißen. Aber das bringt das junge Osterhaserl auf die Idee was nur in der Form Ähnliches zu fabrizieren: Schokolade schmelzen lassen, in Nussschalen gießen lassen und die dann hart gewordenen Hälften mit Zuckerguss zusammenkleben: Schoko-Eier!
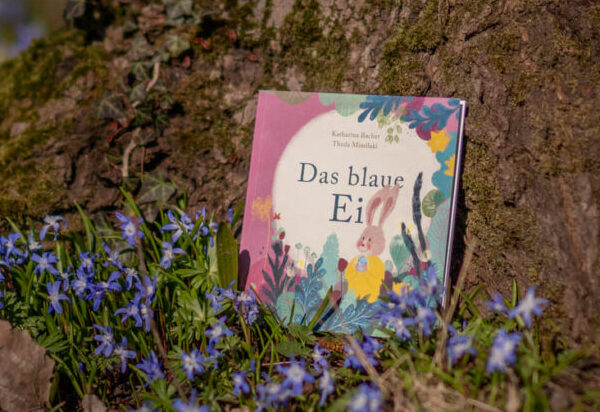
Dieses Bilderbuch hat aber noch einen ganz anderen Anfang, den die Autorin Katharina Bacher in ihrer Medieninformation so beschreibt: „Als vegan lebende Autorin war es für mich besonders schön, eine vegane Osterhasengeschichte gemeinsam mit der Verlegerin Moïra Himmelsbach auszuarbeiten und diese mit der griechischen Künstlerin Theda Mimilaki zu verwirklichen.“
Vor Weihnachten des Vorvorjahres (2021) hatte die Chefin des „veganen Kinderbuchverlags Next Level“ die Idee zu einem Osterbuch. „Von der ersten Idee zum fertigen Buch gab es allerdings unzählige verschiedene Versionen, bis uns klar war, was wir mit dieser Geschichte aussagen wollten: Ein schönes Fest kann gefeiert werden, ohne einem (anderen) Tier seine Eier wegzunehmen. All das wollten wir in eine freudvolle Geschichte verpacken“, so schreibt Bacher.
Und auf KiJuKU-Nachfrage, was einen veganen Verlag auszeichnet, schreibt die Autorin zurück: „Beim herkömmlichen Drucken werden tierische Inhaltsstoffe hergenommen, die bei unseren Büchern eben nicht verwendet werden. Kleber, Leim, Papier, Farben, ja sogar Klammern (die durch tierisches Öl gezogen werden) sind bei uns also vegan – und die Bücher dadurch auch mit dem V-Label-zertifiziert.“
Bleibt nur noch: Es muss sich um vegane – also jedenfalls keine Milch-Schokolade handeln. Und die Frage, ob nicht Hasen, die so viele Schoko-Eier zubereiten müssen, zu viel Stress zugemutet wird 😉
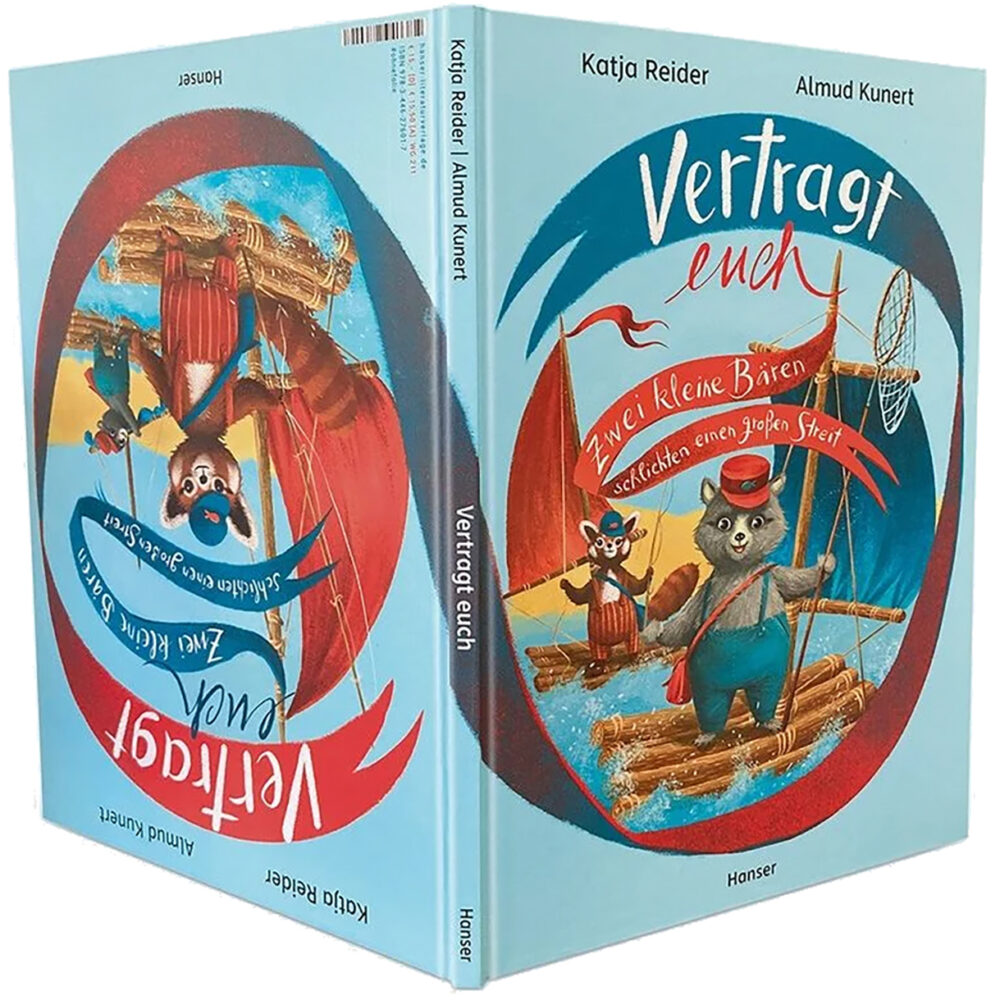
Ein Buch – von zwei Seiten zu lesen und anzuschauen. „Vertragt euch“ hat zwei Titelseiten – einmal sind die beiden Wörter rot, im anderen Fall blau unterlegt. Beim folgenden Untertitel „Zwei kleine Bären schlichten einen großen Streit“ ist das genau andersrum.
Bei den einen ist Jaro, bei den anderen Juli die Hauptfigur. Beides sind Bärenkinder, die mit ihren Familien und Freund:innen an den gegenüberliegenden Ufern eines Flusses leben. Glücklich und zufrieden. Bis sich die Anzahl der Fische, die sie im Fluss fangen, verringert.
Ab dann wird gehetzt. Schuld sind die da „drüben“. Bei Jaros Bären behaupten sie, die anderen hätten Stinkwarzen am Po. Am gegenüberliegenden Fluss lernt Juli, die anderen hätten sitze Hörner. Hass wird gesät, die Idee, Zäune zu bauen entsteht…
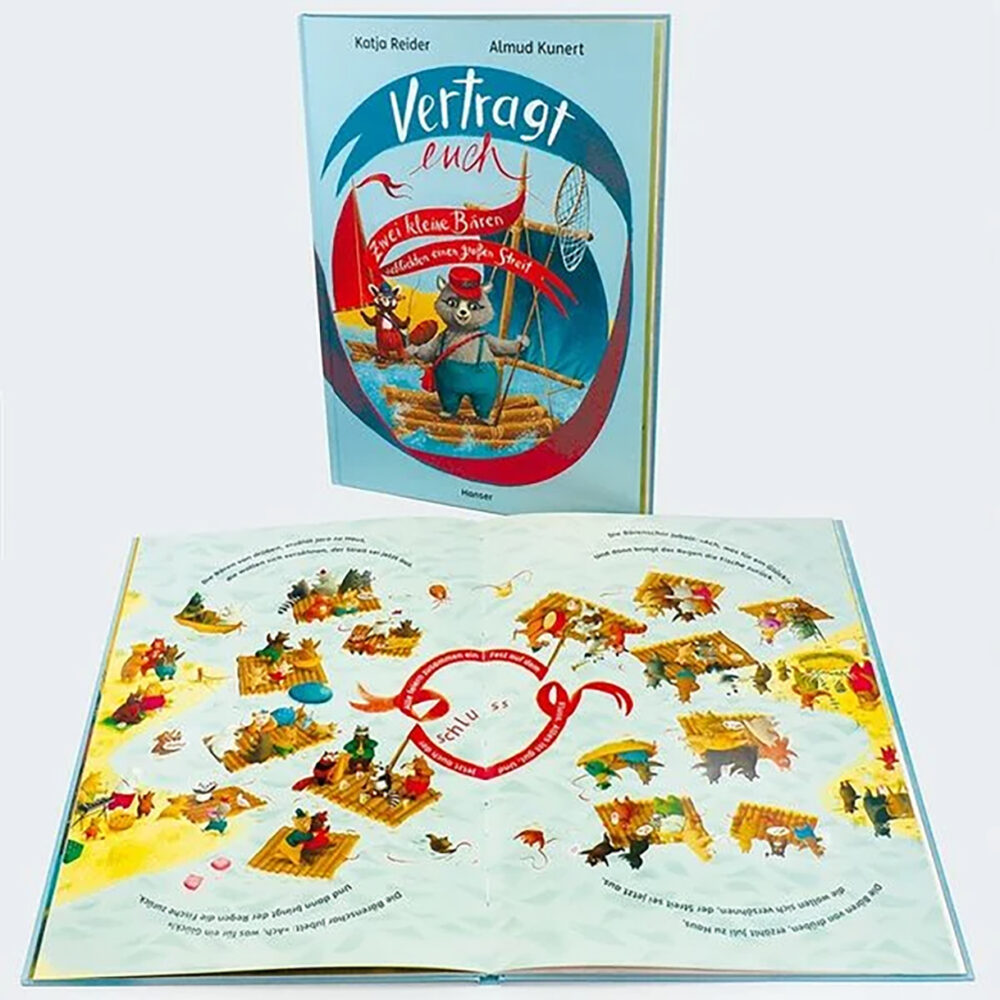
Katja Reider und Almud Kunert erzählen – die eine in Texten, die andere in Bildern – zunächst auf je sieben Doppelseiten einmal von vorne, dann das Buch gewendet von hinten, was sich wie bei Jaro bzw. Juli und ihren Mit-Bär:innen abspielt. Wobei du auch genau umgekehrt anfangen kannst; mit Ausnahme vom Strichcode und den Preisinformationen sind auch die Titelseiten gleich – nur mit der anderen Farb-Unterlegung wie eingangs beschrieben.
Beide Kinder kommen mit ihrem jeweiligen Floß in einen Sturm, landen auf der gegenüberliegenden Seite – und kommen drauf – ja worauf wohl? Genau, und aus dieser Erkenntnis, die andern sind gar nicht so, wie ihnen die Alten einreden wollen, kommen sie zum Schluss, sie wollen die Verfeindeten wieder versöhnen. Happy End in der Mitte des Bilderbuchs.
Erinnert stark am Mira Lobes und Susi Weigels Klassiker „Die Geggis“, nur dass diese dort erst im Gerangel draufkommen, dass die einen nicht stinken und die anderen gar nicht blöd sind.

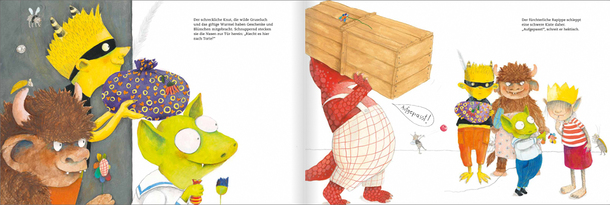
Aribute hat Geburtstag. Das Fest wird alles andere als was so umgangssprachlich als „Kindergeburtstag“ bezeichnet wird, das dann immer für eine recht leichte Aufgabe steht. Zwar kommen all die anderen Monster – Aribute ist auch ein solches, gekennzeichnet durch eine goldenen Papierkrone – mit kleinen und größeren Geschenken, alles ist für die Party bereit, sogar die Eltern haben sich zurückgezogen.
„Der schreckliche Knut, die wilde Gruseluch und das giftige Wurmel“ sind schon mit ihren Packerln angekommen, fragen nach der duftenden Torte. Da kommt „der fürchterliche Rapippe“ und schleppt eine große Holzkiste an. Die trägt er auf dem Kopf, sie verstellt ihm die Sicht, ungeschickt – und unabsichtlich – tritt er auf den langen, dünnen Schwanz von Wurmel und – holter di polter ein Schmerzensschrei, hinfallen, übereinander purzeln, das reinste Chaos.
Natürlich findet die Autorin und Illustratorin in Personalunion, Helga Bansch, wie in vielen ihrer Bücher eine friedliche Lösung, die sich so gar nicht aufs Erste aufdrängt. Schließlich will sie ja eine Geschichte in Worten und Bildern erzählen.
Wie aber aus dem missglückten Beginn des Geburtstagsfests der Monsterkinder eine mehr als gelungene Party wird – nun, das sei hier jetzt wirklich nicht verraten; genauso wenig wie die Geschenke, die die anderen Monsterkinder mitgebracht haben – nur so viel: Die reimen sich auf ihre jeweiligen Vornamen
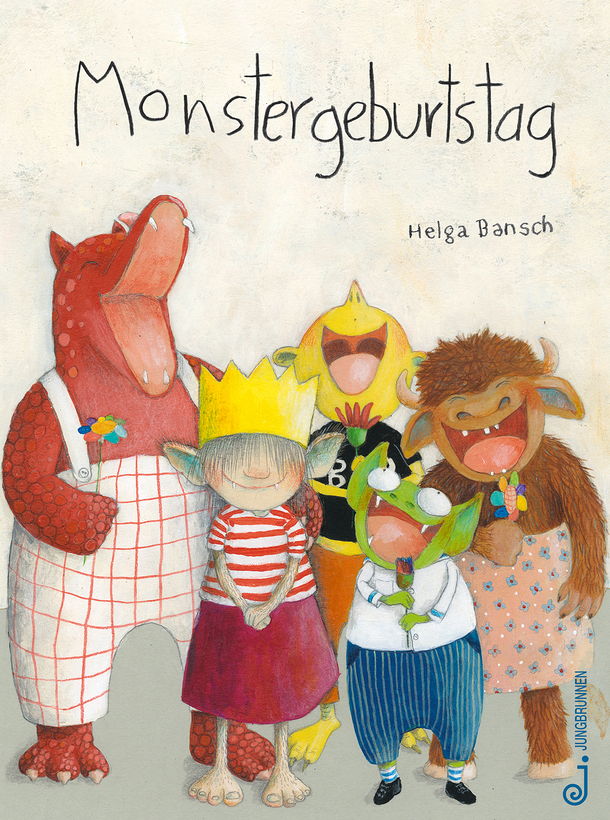
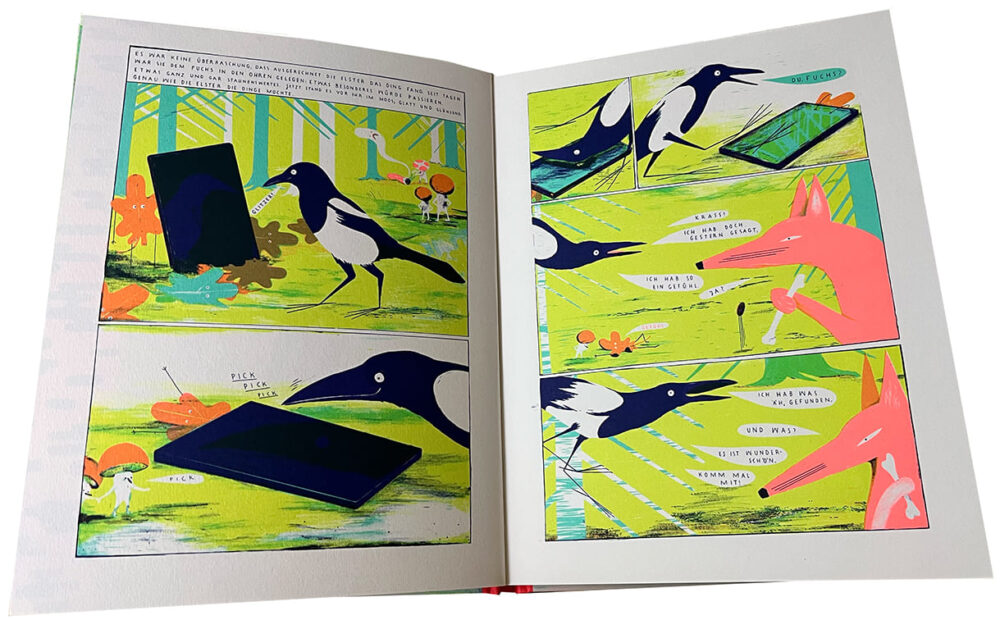
Im Sachbilderbuch „Schau wie schlau“ ging die Autorin menschlichen Erfindungen nach (Illustrationen Kukas Vogl, Tyrolia Verlag), die diese sich von Tieren abgeschaut haben (Bionik). Im Jahr darauf dachte sich Melanie Laibl fast ein umgekehrtes Szenario aus. Ein Glitzerding landet mitten im Wald. Eine – eh kloar – Elster ist völlig spitz darauf.
Du weiß natürlich spätestens auf der zweiten Doppelseite von „Superglitzer“, dass es sich um das handelt, was wir Handy nennen. Zu dem angeblich auf glänzende und glitzernde Dinge abfahrenden Vogel gesellt sich hier ein neugieriger Fuchs – knallig, fast neonrosa gezeichnet von Nele Brönner.
Die Geschichte beginnt nicht nur schräg, sie wird immer ver-rückter als noch weitere Tiere auftauchen, rätseln, worum es sich bei dem Ding handeln könnte. Es plötzlich „Kuck Kuck Kuck“ zu „rufen“ und später zu „schauen“ beginnt. Die zu Hilfe gerufenen Ameisen – damit sie es transportieren sollen – wissen angeblich alles. Und stoßen auch die Frage an, darf die Elster, nur weil sie „Superglitzer“ gefunden hat, dieses auch behalten.
Vielleicht werden aber auch Diskussionen oder Weiterspinnen angeregt, ob – siehe Beginn des Beitrages – umgekehrt auch Tiere etwas von menschlichen Erfindungen lernen können oder die für die Natur weniger brauchbar sind, sogar eher das Gegenteil?
Übrigens: So wie „Schau wie Schlau“ ausgezeichnet worden ist, so bekam „Superglitzer“ kürzlich einen der vier Österreichischen Kinder- und Jugendbuch-Hauptpreise.
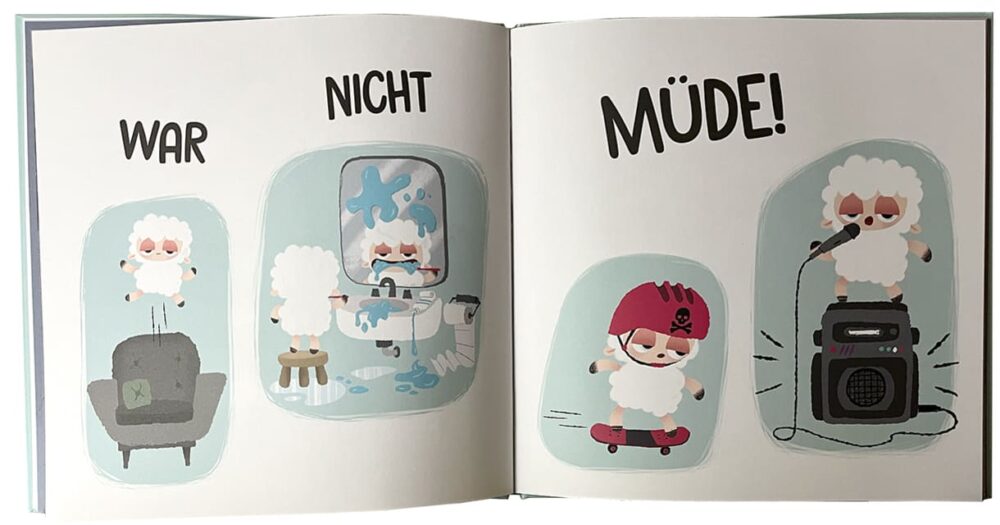
„Ich bin aber noch nicht müde!“, „Ich kann gar nicht einschlafen!“ – Auf den so oder ähnlich gesagten Satz eines Kindes kommt nicht selten die elterliche Anregung, sich Schäfchen vorzustellen und sie zu zählen, beispielsweise wenn sie über einen Zaun springen.
Wie aber ist dies nur für Schafe, bzw. Lämmer wie die Kinder der wolligen Verbeiner genannt werden?
Lucy Ruth Cummins hat sich dazu eine Geschichte ausgedacht, die Pete Oswald gezeichnet hat – „Schlaf Schaf“ heißt das Bilderbuch das daraus entstanden ist; das heißt vielmehr heißt es im US-amerikanischen Original „Sleepy Sheepy“ (Übersetzung Gerda M. Pum). Quietschmunter turnt und spielt Klein-Schäfchen und in großen Buchstaben sehen wir: „war nicht müde!“ – und das über viele Doppelseiten hinweg mehrmals. „Null Bock“ sich nach der elterlichen Vorgabe und einer Uhrzeit zu halten, die Schlafenszeit anzeigte.
Was natürlich nicht so bleibt, denn irgendwann wird auch einmal ein kleines energiegeladenes Schaf müü…, wenigstens ein bisschen 😉
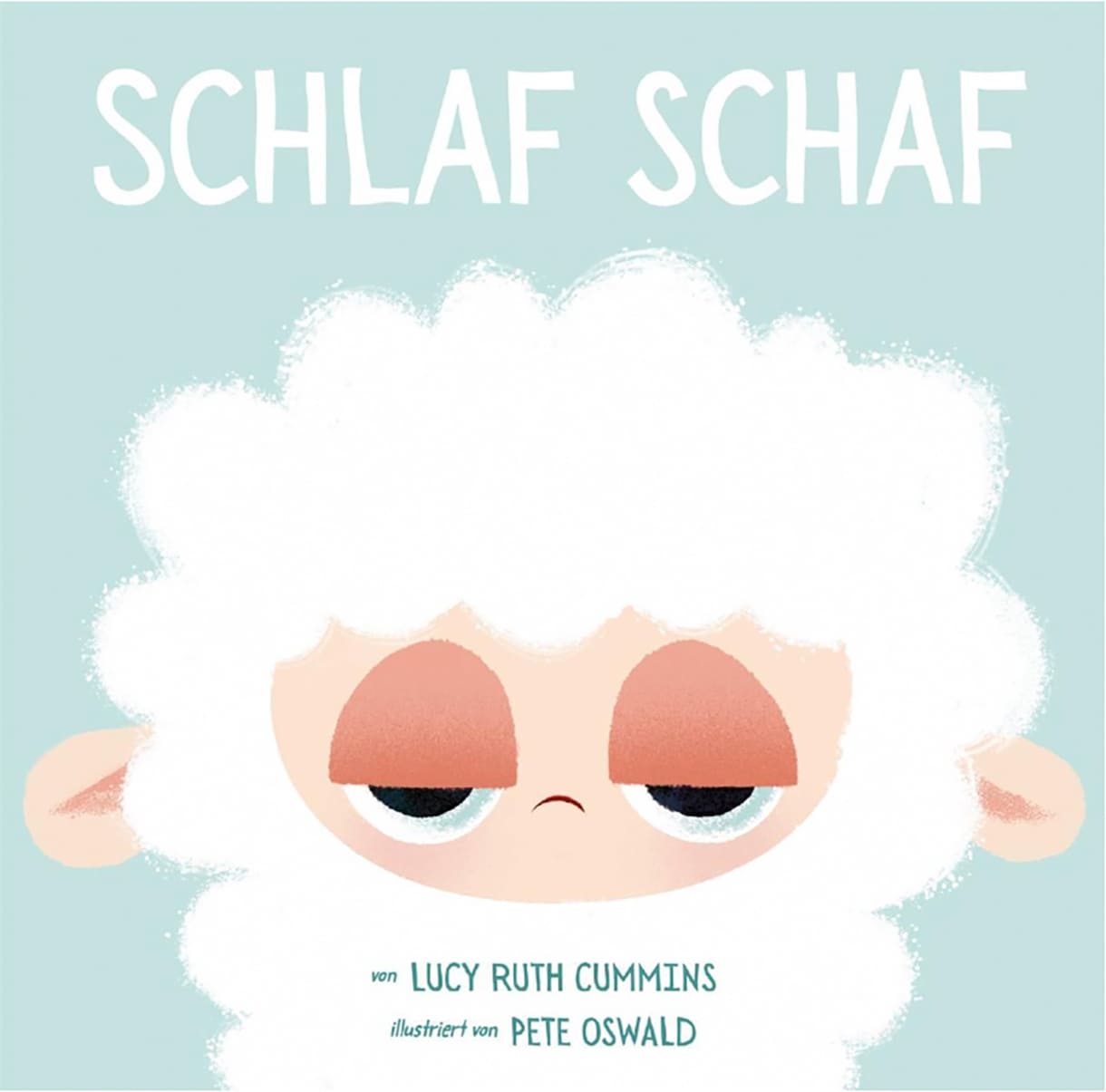
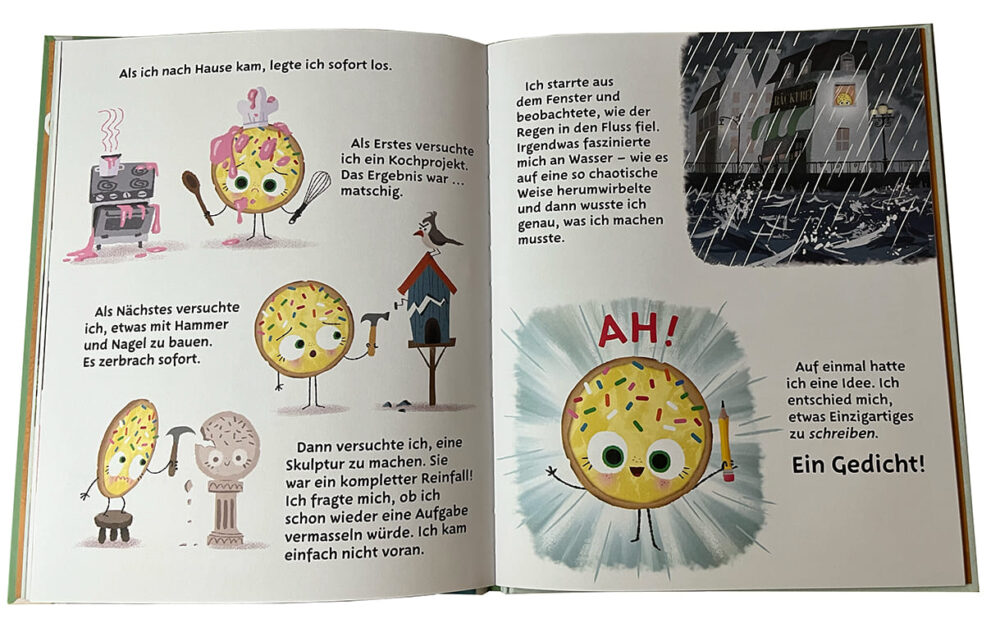
Spaziert ein Kreis mit Gesicht und bunten kurzen Haaren durch die „Süße Straße“… Nein, so beginnt kein Witz, sondern dieses Bilderbuch. Der Kreis ist nicht nur ein solcher, sondern wie schon der Titel und die Illustration auf dem Buchcover nahelegt, auf dem der Kreis einen Bleistift in einer Hand hält, ein Keks.
Dieser Keks – dem Bilderbuchtitel zufolge noch dazu ein kluger – war nicht immer schlau. Oder eigentlich schon. Nur hat er’s nicht geglaubt.
Wie es dazu kam, dass er weniger verunsichert, mutiger geworden ist und Selbstvertrauen gewonnen hat, – das erzählen Autor Jory John (Übersetzung: Luise Richter) und Illustrator Pete Oswald auf den drei Dutzend bunt bebilderten Seiten. Die Welt ist sozusagen eine Bäckerei. Unser Keks hält alle für viel schlauer, weil sie in der Schule in einem Lebkuchenhaus viel schneller die Fragen von Lehrerin Biscotti beantworten konnten. Manchmal wusste Keks es, war aber mit seinen Gedanken ganz woanders – verträumt fantasierte sich die Hauptfigur in ganz andere Szenarien.
Und genau das kam Keks zugute als die Lehrerin die neueste Aufgabe verteilte: „Ich möchte, dass ihr heute Abend etwas erschafft, das total einzigartig ist… Bitte bringt es morgen mit in den Unterricht.“
Und damit die Geschichte nicht so schnell zu Ende geht, lässt das Duo von „Der kluge Keks“ den Protagonisten mit einigem, das er erschaffen möchte, vorerst noch scheitern. Doch dann… – ja dann fiel Keks ein, ein Gedicht zu verfassen: „Meine krümeligen Tage“.
Noch hatte Keks richtig Angst, als Frau Biscotti ihn bat, sein Gedicht vorzutragen. „Schluck!“ Ich seufzte. Ich dachte, ich würde wahrscheinlich unter dem ganzen Druck zerkrümeln.“
War natürlich nicht so, schließlich neigt das Bilderbuch sich schon seinem Ende zu. Applaus. Erfolg. Selbstvertrauen. „Schule war danach ein bisschen anders.“ Davor gab’s sozusagen eher immer wieder „Brösel“ – wie ein Wiener Dialektausdruck für Wickel, Zoff, Streit heißt. Solchen hatte Keks mit sich selbst. Und drohte daran soagr zu zerbröseln.
Ein wahrhaftes „Lehr“-Buch – vor allem für Lehrer:innen. Aber auch du kannst daraus Mut schöpfen, solltest du dich fühlen wie Keks zu Beginn. Denn sicher findest auch du etwas, worin du gut bist! Oder wie es in diesem Bilderbuch auf der vorvorletzten Seite heißt: „Du musst nicht die Antwort auf jede Frage haben oder plötzlich perfekt in allem sein. Du brauchst nur eine Chance, alle möglichen Dinge auszuprobieren, um herauszufinden, wer du bist und was du gerne machst.“
Auch wenn diese Gebrauchsanleitung fast ein bisschen zu zeigefingermäßig daherkommmt – denn darauf wärest du bei dieser Bilderbuchgeschichte sicher selber draufgekommen 😉
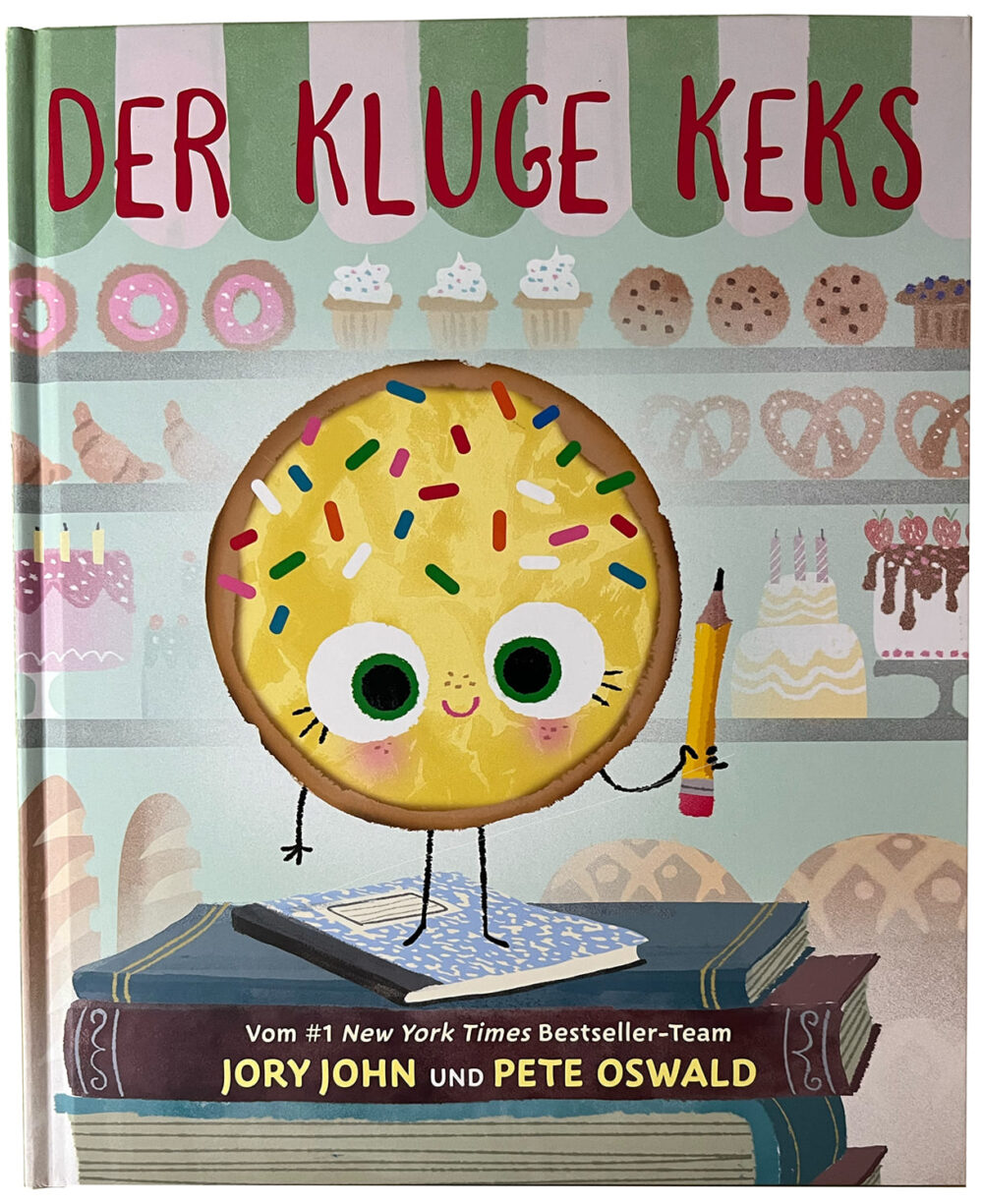
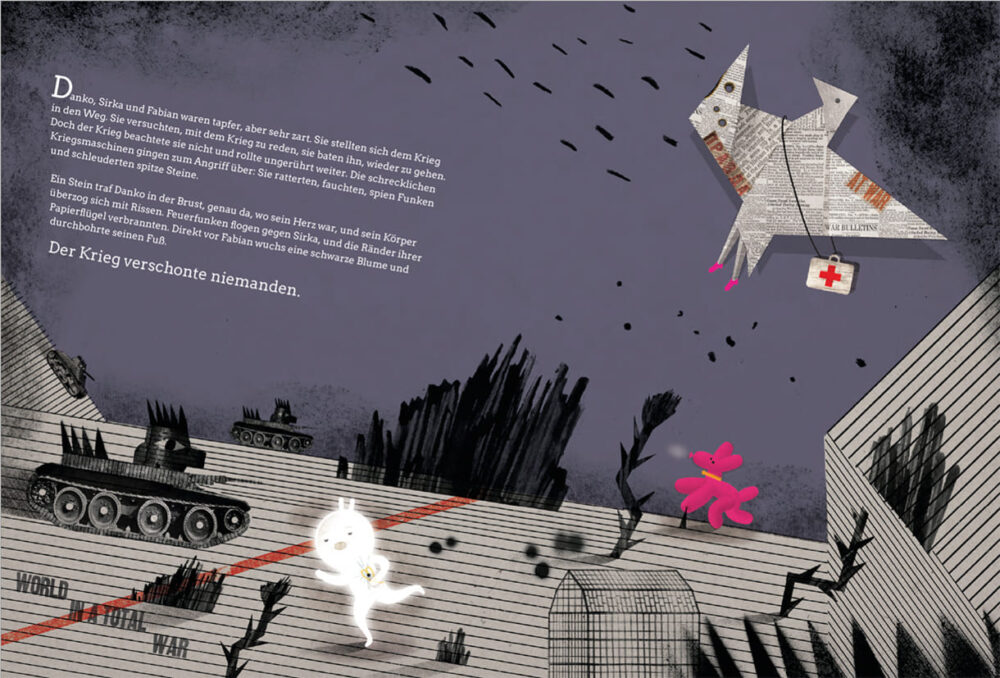
Ein kleines, von innen heraus leuchtendes weißes Figürchen namens Danko, das vielleicht aus Glas sein könnte, ein pinkfarbener Hund, der wirkt als wäre er aus einer langen Luftballonschlange geformt worden (Fabian) und das aus bemaltem Papier gefaltete Vögelchen Sirka sind die Hauptfiguren in dem Bilderbuch „Als der Krieg nach Rondo kam“.
Ihre Heimat ist – wie der Name nahelegt – kreis- oder auch kugelrund und bunt. Viele Pflanzen, sogar solche, die in einem Gewächshaus fröhlich singen, kennzeichnen die Landschaft dieser Stadt. Sirka, das Vögelchen, zieht es in die weite Welt hinaus und bringt für seine Freund:innen viele Geschichten mit.

Die jüngsten Erzählungen Sirkas sind – niederschmetternd. Die nächste Doppelseite grau bis schwarz, düster, Panzer rollen und eine furchterregende Schrift: „Der Krieg kommt in die Stadt“. Obwohl klein, zart und zerbrechlich versuchte das Trio sich dem Ungeheuer entgegenzustellen, mit ihm zu reden, doch „ein Stein traf Danko in der Brust, genau da, wo sein Herz war, und sein Körper überzog sich mit Rissen. Feuerfunken flogen gegen Sirka, und die Ränder ihrer Papierflügel verbrannten. Direkt vor Fabian wuchs eine schwarze Blume und durchbohrte seinen Fuß. Der Krieg verschonte niemanden“.
Nun versuchten die drei Freund:innen mit gleicher Münze heimzuzahlen, mit Steinen und Nägeln auf den Krieg zu schießen… Das beeindruckte diesen genau gar nicht. Da hatte Danko eine Idee: Er ging zum Gewächshaus, strahlte die letzten noch nicht verwelkten Blumen mit der Lampe seines Fahrrades an. Die Pflanzen reckten und streckten sich, wuchsen schnell und als Danko kräftig in die Pedale trat, um das Licht ja nicht ausgehen zu lassen immer höher und stärker. Und als ein Lichtstrahl auf den Krieg fiel, erstarrte der kurz.
„Plötzlich ging Danko ein Licht auf: Der Krieg bekam Angst, weil er und die Blumen trotz allem gesungen hatten, weil selbst der kleinste Lichtstrahl die Dunkelheit vertreiben konnte…“

„Als der Krieg nach Rondo kam von Romana Romanyschyn und Andrij Lessiw ist bereits 2015 in der Ukraine erschienen. Obwohl als Reaktion auf den ein Jahr zuvor begonnen Krieg Russlands – Krim und Ostukraine – „handelt es nicht vom Krieg in der Ukraine“, sagen die beiden Künstler:innen in einem Interview, das auszugsweise übersetzt vom Gerstenberg Verlag veröffentlicht wurde. „Es geht um Krieg als Volkskrankheit der Welt. Es sagt Kindern, wie wichtig es ist, keine Angst zu haben, stark zu bleiben, mit Freunden und deinem eigenen Volk zusammenzubleiben und die Hoffnung zu bewahren.“
Bewussten haben sie die drei Hauptfiguren – so weiter in dem Interview – „aus empfindlichen Materialien gefertigt. Es ist leicht, sie zu verletzten – ihre Welt zu zerstören“.
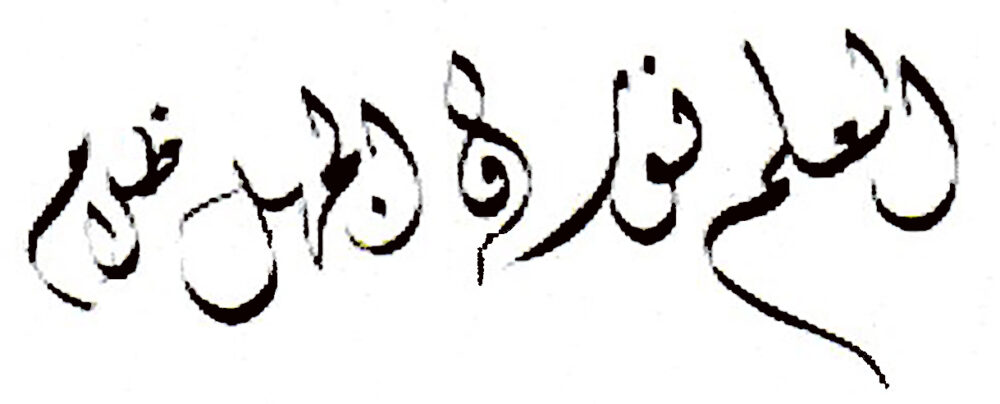
Darin erläutern sie auch ihr Farbkonzept: „Es beginnt mit hellen Farben, mit viel Licht, zeigt das friedliche Leben der Stadt… Dann ändert es sich unerwartet; die Farben werden dunkler; das Licht ist ausgeschaltet. Wir haben sogar weißen Text diagonal auf dunklen Hintergründen platziert, um das Lesen unbequem zu machen, so wie der Krieg unser Leben unbequem macht.
Und am Ende des Buches, wenn der Krieg vorbei ist, kehrt das Licht zurück. Hell und dunkel sind hier die Hauptsymbole; die Dunkelheit des Krieges wird durch das Licht besiegt, das von der Bevölkerung von Rondo erzeugt wird. Das Licht ist ein Symbol für Bildung, Kultur und gute Ideen.“
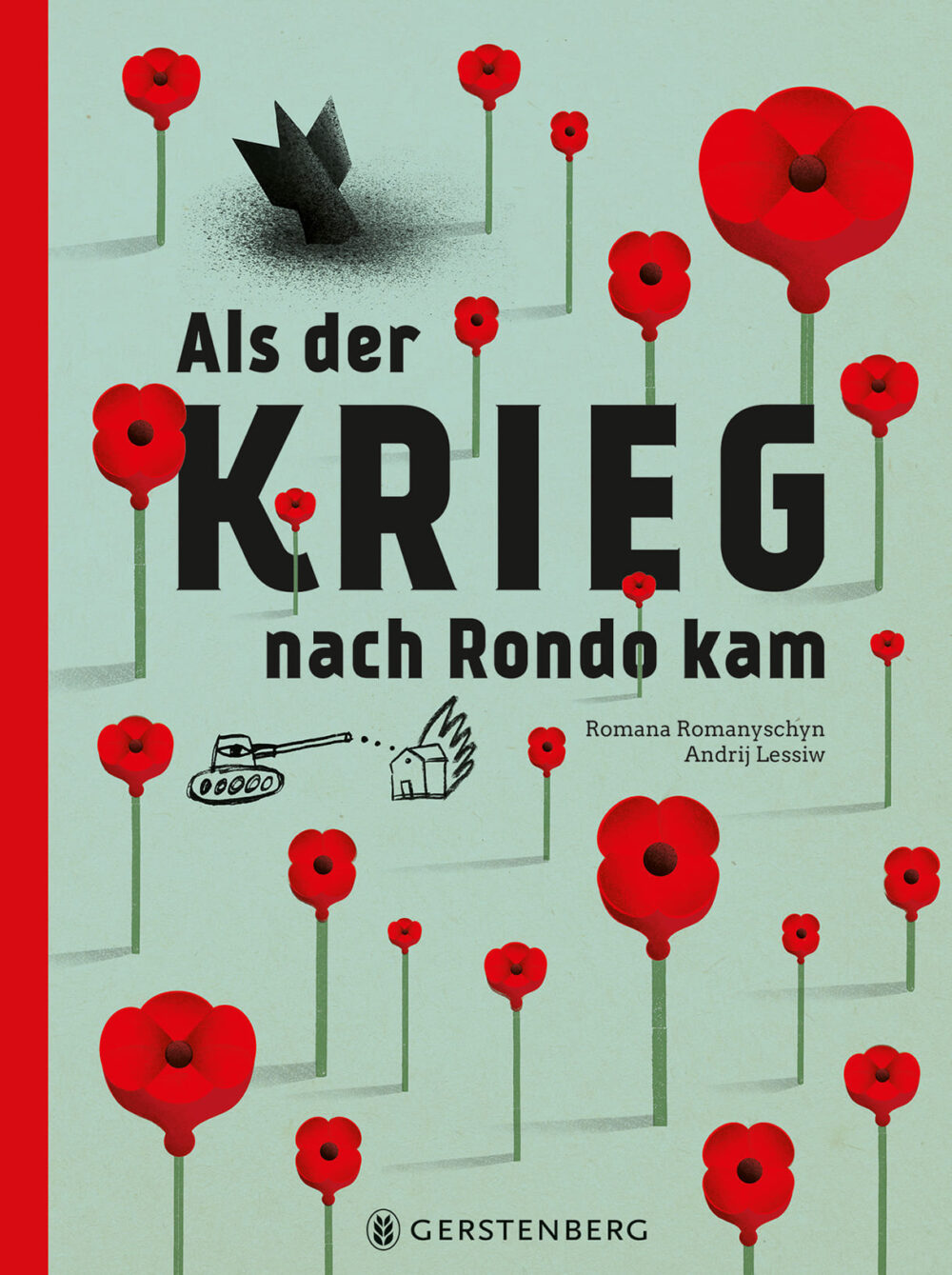
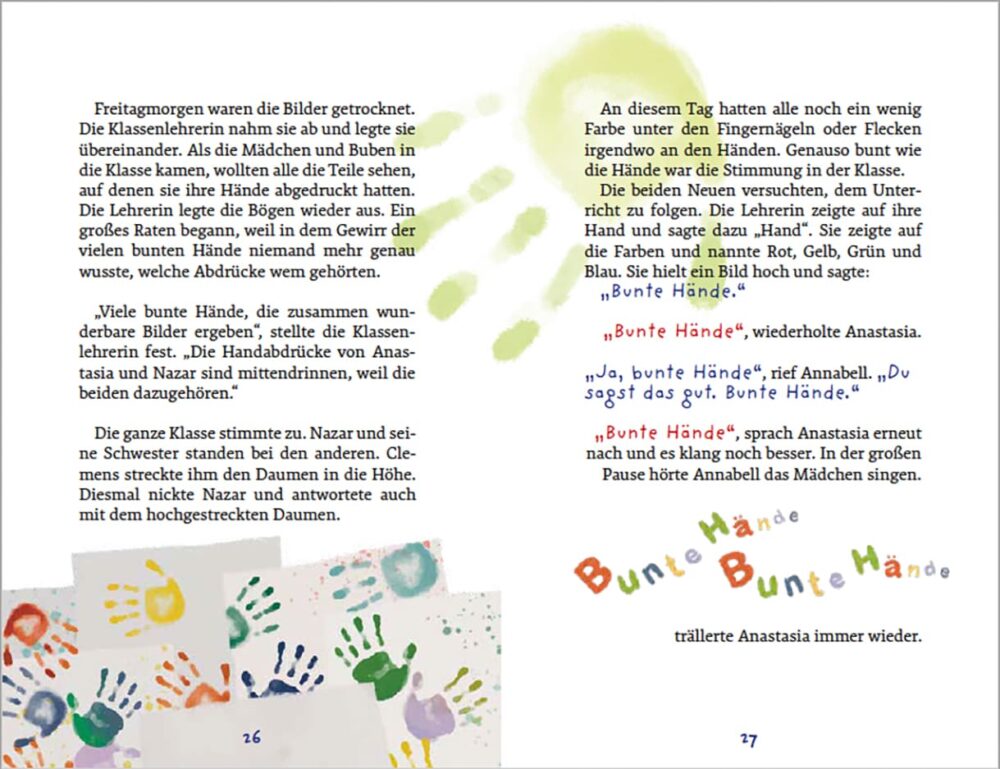
Neue Kinder in der Klasse. Solche für die Deutsch völlig neu und fremd, mitunter sogar die dritte oder vierte Sprache ist. Die noch dazu mit schweren unsichtbaren Rucksäcken gekommen sind, weil sie vielleicht Krieg erlebt, Verwandte und Freund:innen verloren oder zumindestens verlassen musste und nur ganz wenig mitnehmen konnten. Zwar in Sicherheit, aber nicht immer auch nur nett und freundlich aufgenommen – Sorgen, Nöte, Ängste…
Vielleicht kommt’s sogar zu Missverständnissen beim Versuch von Kindern sich an die neuen Mitschüler:innen in der Klasse anzunähern.
Das sind die Hintergründe für einige der Geschichten in „Bunte Hände – Geschichten über das Zusammenfinden“ des bekannten Viel- und Schnellschreibers Thomas Brezina. In der ersten Geschichte, die letztlich auch zum Titel des ganzen rund 170-seitigen Buches wurde, ist der Ausgangspunkt ein Klassenchor. Das Lied, das sich die Lehrerin ausgedacht hat, finden viele Kinder fad. Langweilig finden viele auch ihre neuen Mitschüler:innen Anastasia und Nazar. Natürlich gibt’s einen Wendepunkt – beim gemeinsamen Malen – und wie? Na, das legt schon der Titel nahe.
Der Autor stellte sein jüngstes Buch – von rund 600 Werken – küzrlich in einer Wiener Volksschule vor, wo er die Schüler:innen der 4. Klasse zum Mitdenken und -machen bei einer der Geschichten einlud. Zum Bericht über diese Aktion in der VS Kleistgasse (Wien-Landstraße) geht es hier im Link unten.
Streits und sogar Raufereien sind der Ausgangspunkt für Direktor Grübchen in der zweiten Geschichte. „Das Kochfest“ lässt auch schon erahnen, was sich der Schulleiter für einen wichtigen Schritt zum Miteinander überlegt hat.
In der dritten Geschichte haben Samira einer- und Tim andererseits jeweils ein Geheimnis vor allen (anderen) Kindern in der Klasse. Nur du als Leserin/Leser kennst Basima und Rexi, die Puppe und den plüschigen Saurier von Anfang an. Auch da ist die Annäherung keine glatte, einfache Sache. Wie in Wirklichkeit – und für eine Geschichte braucht’s erst recht einen Spannungsbogen.
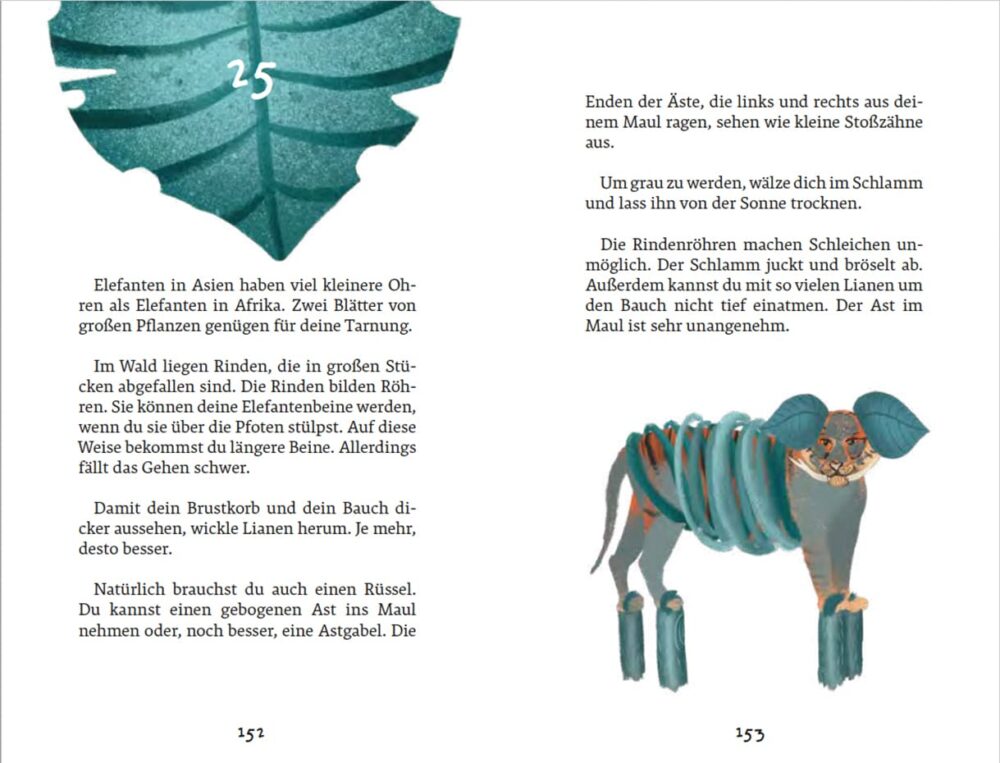
Die vierte Geschichte geht das Über-Thema wenige offensichtlich an und erinnert stärker noch fast an Brezinas mitunter sehr fantasievolle Krimis. In „Im Turnsaal steht ein Rätseltor“ wirst du selbst in die Story reingezogen, triffst auf einen Adler, ein Pony, einen Tiger und einen Pinguin. Immer wieder bittet der Autor die Leser:innen, sich mal in die Rolle des einen, dann eines der anderen Tiere hineinzudenken und fühlen. Und es geht letztlich darum, vier verschiedene – auf der Welt verstreute – Schlüssel zu finden, um das zugefallene Tor wieder von innen öffnen zu können.
Bunt illustriert sind die vier unterschiedlichen Geschichten alle von Anna-Mariya Rakhmankina, die als Illustratorin und Grafikdesignerin in Wien arbeitet, wohin sie vor drei Jahren aus der Ukraine gekommen ist. Schräges Highlight der Zeichnungen ist vielleicht die zu Brezinas Idee, dass sich der Tiger als Elefant verkleidet, um in den Tempel der grauen Riesen zu gelangen, wo er einen der Schlüssel vermutet. Und „versteckt“ in dieser Verkleidung die Botschaft: Wenn du vorgibst, wer anderer zu sein, kommst du erst recht nicht ans Ziel – der Tiger kann seine Stärken – beispielsweise sich leise anzuschleichen – gar nicht mehr ausspielen. Erst als er die ablegt und auch – wieder – hoch hinaufspringen kann, klappt’s…
Letztlich passt natürlich auch diese Geschichte zum Motto miteinander, denn nur wenn alle vier Schlüssel – von den vier Tieren – gefunden sind…
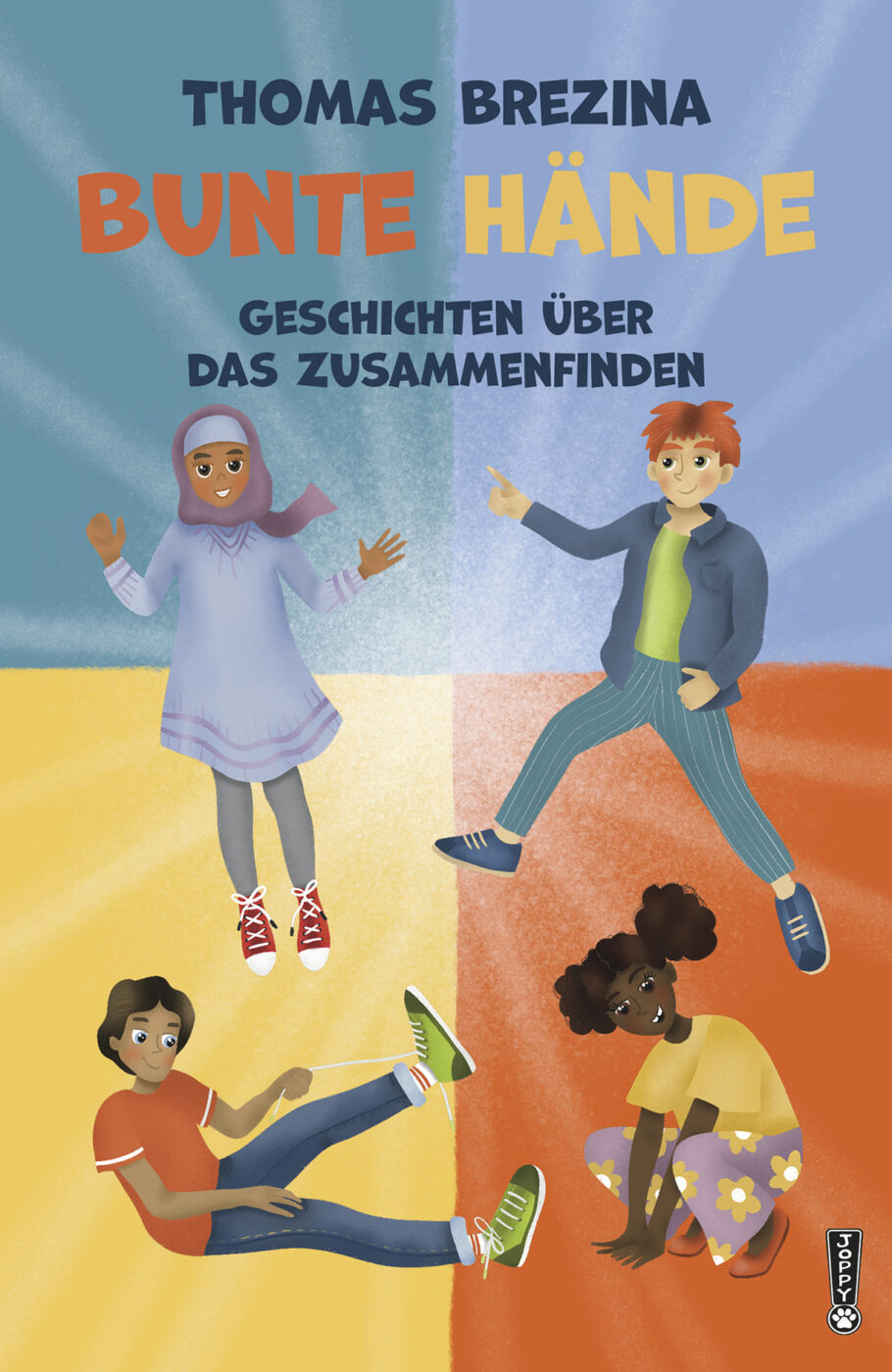
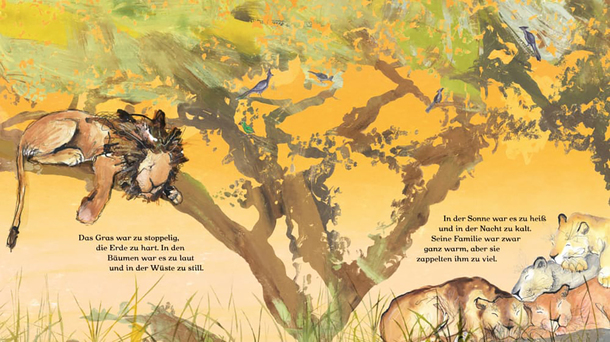
Seinesgleichen schlafen im Schnitt gut den halben Tag, nicht selten sogar bis zu 18 Stunden. Nur Arlo schaffte es gar nicht und nicht auch nur einzuschlafen. „Das Gras war zu stoppelig, die Erde zu hart. In den Bäumen war es zu laut und in der Wüste zu still…“ Und das sind nur die Sätze auf der dritten Seite, wo Catherine Rayner, die Autorin und Illustratorin, einige der Gründe anführt, die den Löwen am Einschlafen hindern. Es folgen noch fünf weitere Zeilen, die Arlo verunmöglichen, sich auszuruhen.
Sein Jammern und Seufzen hört eine Eule – die beginnt für ihn zu singen – mit Textzeilen, die Arlo in einen Zustand der Entspannung versetzen. Und siehe da, es klappt.
Damit ist die Geschichte (aus dem englischen Original übersetzt von Tatjana Kröll) mit sehr künstlerischen Zeichnungen noch lange nicht zu Ende. Denn in seinem Jubel über den erholsamen Schlaf weckt er die tagsüber schlafende Eule auf. Doch Arlo weiß ja nun, was zu tun ist…
Und vielleicht damit auch Kinder – und Eltern 😉
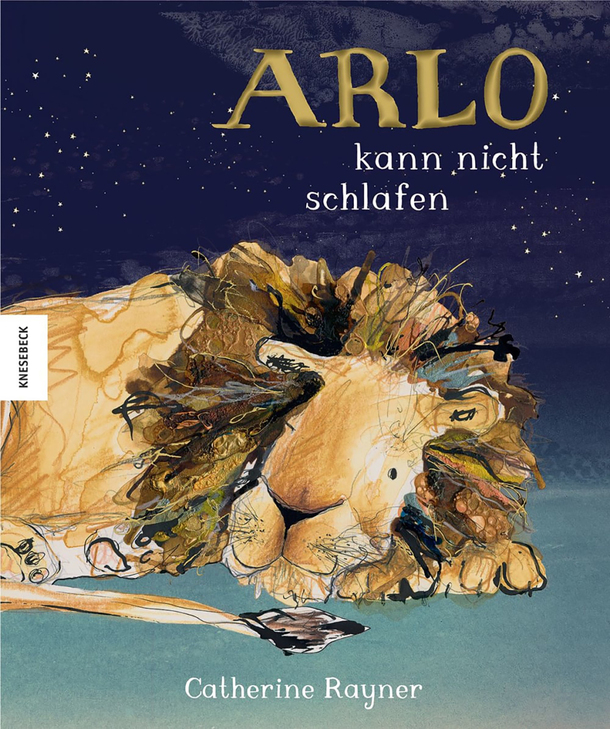
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen